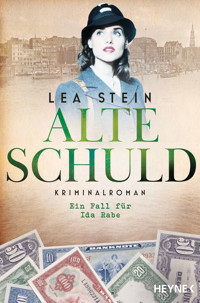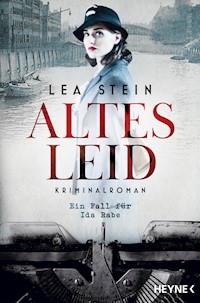9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Ida-Rabe-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein toter Junge, ein Wunderheiler und eine abgelegene Elbinsel
Juli 1949. Zwei Monate nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland geht in Hamburg alles seinen gewohnten Gang, zumindest bei Ida Rabe. Die Schutzpolizistin teilt sich das Büro an der Reeperbahn mit Heide Brasch und ihr Leben mal mehr, mal weniger mit dem Gerichtsmediziner Ares Konstantinos. Als am Strand von Övelgönne die Leiche eines Jungen angeschwemmt wird, ist Ida erschüttert: Handelt es sich bei ihm um dasselbe Kind, das Heide und sie ein paar Monate zuvor halb erfroren und stark abgemagert in einem Hauseingang gefunden haben? Ida schwört, es herauszufinden. Die Spur führt sie auf die Elbinsel Waltershof, zu einer kleinen verschworenen Gemeinschaft. In deren Mitte: selbsternannter Wunderheiler Wilhelm Maurer. Ida bleibt nichts anderes übrig, als sich unter seine Anhänger zu mischen. Doch jemand wird auf sie aufmerksam und es wird gefährlich für Ida.
Ida Rabes dritter Fall
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Juli 1949. Zwei Monate nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland geht in Hamburg alles seinen gewohnten Gang, zumindest bei Ida Rabe. Die Schutzpolizistin teilt sich das Kellerbüro an der Reeperbahn mit Heide Brasch und ihr Leben mal mehr, mal weniger mit dem Gerichtsmediziner Ares Konstantinos. Doch die Toten gehen bei Ida vor, so auch im Fall des am Strand von Övelgönne angetriebenen Jungen, eine Leiche, die wohl schon eine ganze Weile im Wasser lag. Ida ist erschüttert – zumal sie sich glaubt, ihn zuvor gesehen zu haben, gemeinsam mit Heide. An einem Wintertag stießen sie auf das halb verhungerte Kind, das kein Wort sagte und nur gierig aß, was sie ihm gaben. Ida will um jeden Preis herausfinden, ob es sich bei dem Toten wirklich um den Jungen handelt – den sie eigentlich im Heim abgegeben hatten. Die ersten Spuren weisen über die Elbe, auf die Insel Waltershof, wo sich ein Wunderheiler niedergelassen hat. Frauen, Kinder und Kranke sollen ihm in Scharen zuströmen, sagt man. Idas Misstrauen ist geweckt – zu Recht, wie sich bald herausstellen wird …
Die Autorin
Lea Stein ist das Pseudonym der Autorin und Journalistin Kerstin Sgonina, die bereits mehrere Romane veröffentlichte. Als sie mit 18 nach Hamburg zog, verliebte sie sich sofort in die Stadt. Nach dem Abitur schlug sie sich auf der Reeperbahn als Türsteherin und Barfrau durch. Heute lebt sie mit ihrem Mann, den beiden Kindern und ihrem Hund in Brandenburg. Die Romane um Polizistin Ida Rabe sind ihre erste Krimi-Reihe.
Lieferbare Titel
Altes Leid
Alte Schuld
LEA STEIN
ALTER ZORN
Ein Fall für Ida Rabe
Kriminalroman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 01/2025
Copyright © 2025 by Lea Stein
Copyright © 2025 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Katja Bendels
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, unter Verwendung eines Motivs von © Richard Jenkins Photography, Vintage Germany (Hamburg, Hafen, HADAG-Fähre vor den Landungsbrücken, im Hintergrund der Michel, um 1937), FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31619-8V002
www.heyne.de
Hamburg-Övelgönne
Freitag, 8. Juli 1949, kurz vor Sonnenaufgang
Im Nebel des Morgens wirkt die Stadt wie aus einem Traum. Kein Auto ist zu hören. Kein Fischerboot schaukelt am Strand. Es gibt nur den Geruch des Salzes, so dick, als liege es ihm auf der Zunge.
Seine groben Hände, die neben seinem Körper schlackern. Seine Hüfte, die bei jedem Schritt schmerzt. Er ist alt. Ein alter Mann, der jeden Morgen, bevor Hamburg erwacht, seine Kreise zieht. Nachsieht, ob der Hafen noch steht. Ob alles seine Ordnung hat. Es ist ein innerer Drang, seit die Bomben runtergekracht sind und alles in Fetzen rissen.
Sein ganzes Leben hat er hier verbracht. Er liebt die Stadt mehr als sich selbst, als seine Frau, sogar als seinen Hund. Aber jetzt wächst sie wie Kraut und Rüben; überall wird gebuddelt, abtransportiert, neu gebaut. Er erkennt sie nicht mehr. Das Einzige, das immer gleich bleibt, ist das Wasser.
Er stellt sich so hin, dass die Wellen bis zu seinen Schuhspitzen schwappen. Blickt raus, auch wenn er nur den Nebel sieht, aus dem auf Finkenwerder die Kräne ragen. Er lauscht dem Klang der Elbe, die anders klingt als jeder andere Fluss. Wie ein Mahnen. Aber hin und wieder singt sie auch, eine weiche, dunkle Melodie.
Wenn man tot ist, ist man tot, das hat er irgendwann mal wen sagen hören.
Aber wenn man lebendig ist, ist man dann wirklich lebendig?
Und während er darüber nachsinnt, ob er noch am Leben ist oder nicht, den Gedanken dann fortschiebt, denn falls er tot wäre, würde sich all dies dumme Denken von selbst erledigen, sieht er ihn. Den flachsblonden Schopf, so hell, dass er selbst klatschnass noch wie ein Kornfeld leuchtet. Die Schultern darunter haben etwas Knöchernes an sich, aber auch etwas, das aussieht wie unachtsam zusammengesetzt, nachdem man es kaputtgemacht hatte.
Er hört sich hektisch atmen, als er hinrennt, nach dem Jungen greift, den ihm der Fluss fast vor die Füße spült, ihn in den Sand zieht. Als er das Gesicht sieht, zuckt er zusammen. Es erinnert an das einer Puppe, der die Kinder übel mitgespielt haben. Bleichwächserne Haut, da, wo noch Haut ist. Und überall ist Grün, vielleicht Algen oder so was. Er versucht, dem Jungen die Augen zu schließen, die nirgends mehr hingucken, aber es funktioniert nicht. Dafür hat er jetzt Krümel an den Händen, kleine, fettig wirkende Hautkrümel. Er würgt und erbricht sich ein Stück weiter in den Sand.
Und dann hebt er die Stimme. Fällt in die Klagemelodie der Elbe ein, übertönt sie schließlich, bis er nur noch heiser schreit.
1 Davidwache, Hamburg-Sankt Pauli
Freitag, 8. Juli 1949, 7:52 Uhr
»Manchmal denk ich, du kannst hellsehen, Ida.« Verblüfft schüttelte Rotschopf Meyerlich, mit dem sie im Flur der Davidwache um ein Haar zusammengeprallt wäre, den Kopf. »Als könnste riechen, dass was im Busch is.«
Ida, die nur deswegen gerannt war, weil sie sonst zu spät zur Arbeit gekommen wäre, rückte sich die Uniform zurecht, die ihr beim Absteigen vom Fahrrad verrutscht war. Hoffentlich klang sie nicht allzu neugierig: »Was ist denn im Busch?«
Mit finsterer Miene setzte ihr Kollege den Tschako auf und klopfte sich die Seiten ab: Knüppel, Schließketten, alles an seinem Platz. »Ich an deiner Stelle würd da nech hin. Rennste nur dem Chef inne Arme. Und dann hagelt’s Probleme.«
Das wusste Ida durchaus. Sie plus Vorgesetzter, das bedeutete Schwierigkeiten. Aber wenn Johann Meyerlich sagte, es sei was im Busch, wollte sie wissen, was.
»Wenn ich da nichts zu suchen hätte, wäre ich wohl kaum hier, oder?« Kampflustig sah sie ihn an. »Wo müssen wir hin?«
Bei dem Wort wir zuckte Meyerlich zusammen.
»Keine Bange«, beruhigte sie ihn. »Ich bin vor dir da und tue so, als würde ich dich nicht kennen.« Was so etwas von albern war, schließlich arbeiteten sie seit drei Jahren zusammen. Aber Meyerlich schluckte den Köder.
»Versprochen?«
Ida nickte.
»Also, da in Övelgönne, vor Lührs Gaststätte. Totes Kind.«
Schlagartig wurde Ida ernst. »In Ordnung. Wir sehen uns da.«
Die beiden Worte hallten in ihr nach, als sie draußen wieder aufs Fahrrad stieg, in die Pedale trat und über das holprige Pflaster der Reeperbahn in Richtung Hafen fuhr. Von da an ging es am Wasser entlang, das trotz der morgendlich-kühleren Temperaturen modrig roch.
Eine Viertelstunde später sah sie im Morgennebel den roten Ziegelbau des Union-Kühlhauses auftauchen. Dahinter säumten reetgedeckte Fischerkaten den Sandstrand von Övelgönne. Sie ließ den Blick schweifen: noch niemand von der Kriminalpolizei anwesend, ebenso wenig wie das Mordauto – so wurde das Gefährt des Gerichtsmediziners genannt. Sie war die Erste.
Nachdem sie ihr Rad gegen eine halbhohe Mauer gelehnt hatte, versuchte sie, im feuchten Sand jemanden zu entdecken. Wo war das Kind, hatte Meyerlich gesagt? Vor Lührs Gaststätte, die gar nicht mehr so hieß. Als Ida in die Richtung stapfte, konnte sie erst mal überhaupt niemanden ausmachen. Doch dann sah sie eine Frau winken.
»Haben Sie die Polizei verständigt?«, rief Ida, als sie nah genug herangekommen war.
»Nee, nee, mein Mann. Er … hat den Anblick nich so gut abgekonnt, daher bin ich … Ich hab gesagt, ich pass auf. Sie sind die Kriminalpolizei?« Die Frau, Mitte 70, schätzte Ida, mit verlebtem Gesicht und freundlichen braunen Augen, rang die Hände und sah sich immer wieder um.
Wonach, erkannte Ida, als sie bei ihr ankam: ein kleiner Hügel im Sand, von einer Öljacke bedeckt.
»Ida Rabe«, stellte sich Ida vor. »Wie ist Ihr Name?«
»Gerda Schwarz. Mein Mann hat den Jungen … Heute Morgen, als er unterwegs war, hat er ihn aus’m Wasser gezogen.«
»Wo ist denn Ihr Mann jetzt?«
»Kippt sich einen hinter die Binde, nehm ich an«, flüsterte Frau Schwarz. »So was kann er nich gut ab, so ’nen toten … Jungen.«
»Das verstehe ich.« Wer konnte das schon? »Sie sagten, dass Ihr Mann ihn aus dem Wasser gezogen hat.« Tatsächlich sah Ida nun, als sie näher trat, auch die Schleifspuren im Sand, daneben Fußabdrücke. »Das Ölzeug hier, trug der Junge das?«
»Nee, das hat mein Mann … das hat er draufgelegt. Weil er den Anblick so schrecklich fand. Er musste ja auch kurz weg, mich rufen, damit ich aufpass. Da dachte er, er legt lieber was drauf.«
»In Ordnung. Das ist also die Jacke Ihres Mannes?«
Die Frau nickte. »Ja, isse.«
Unter dem Ölzeug sah Ida nackte, dürre Beine rausstaken. Ging man nur von ihnen aus, würde sie sagen, dass das Kind keine sieben Jahre alt war. Ida musste sich zwingen, ruhig und gefasst zu erscheinen, als sie der Dame vorschlug, ein Stück entfernt zu warten.
»Aber ich muss doch …«
»Sie müssen nicht mehr aufpassen. Aber warten Sie, bis ich zu Ihnen komme, ja?«
»Ja, sicher. Sicher, mach ich.« Eilig ging Frau Schwarz weg, offensichtlich froh, ein wenig Abstand zwischen sich und den traurigen Fund ihres Mannes zu bringen.
Währenddessen wappnete sich Ida innerlich, das Ölzeug anzuheben. Allzu viel Zeit konnte sie sich dafür nicht lassen, das war ihr klar, denn wenn erst die Kollegen anrollten, die am Fundort einer Leiche erwünscht waren – ganz im Gegensatz zu ihr –, würde sie keinen Blick mehr auf das Kind werfen können.
Sie holte den Bleistift aus der Tasche, atmete tief ein und ging neben der Erhebung im Sand in die Hocke. Behutsam zog sie die Jacke in die Höhe. Ein durchdringender fauliger Geruch stieg auf und ließ sie zurückweichen. Sie legte die Finger an ihre Nase und zwang ihre Übelkeit in die Knie.
Wie ein Häuflein Knochen, die von grün schimmernder Haut bedeckt waren, lag der Junge auf dem Rücken im Sand, die Arme seitlich am Körper angelegt. Sein Oberkörper unter dem in Fetzen daran klebenden Hemd war aufgedunsen. Dennoch erkannte Ida deutlich die Rippen, die spitzen Ellbogen. Dort, wo sich Haut und Muskeln lösten und den Blick auf die Knochen öffneten, sah sie Kerben, ganze Spalte, die dort nicht hätten sein dürfen.
Sie ließ den Blick nach oben wandern. Nasses hellblondes Haar klebte an dem aufgedunsenen Gesicht. Teils wirkte die Haut wie von einer dicken Fettschicht bedeckt, wächsern und krümelig. Fettwachs – hatte Ares es so genannt? Wenn Ida sich richtig erinnerte, trat es erst nach längerem Verbleiben im Wasser auf.
Ida schaute weiter. Die Stirn und die Nasenspitze, zumindest was sie davon noch ausmachen konnte, waren abgeschürft. Als sie sich vorbeugte, um den Jungen näher zu betrachten, entdeckte sie in den Wunden winzige Kiesel. Gerichtsmedizinerin war sie natürlich nicht, aber ihr Freund Ares war einer, daher war ihr klar, dass die Abschürfungen durch eine Gewalttat entstanden sein könnten, vielleicht aber war der Junge auch in seichtem Gewässer von der Strömung mitgezogen worden und dabei mit dem Gesicht über den Boden geschrappt.
Vor seinem Mund hatte sich Schaum gebildet. Seine Augen waren glanzlos, von einem dunklen, unwirklich erscheinenden Braun, das über die Grenzen der Pupillen hinwegzugehen schien. Er trug Fetzen einer dunklen Hose, am Arm hatte sich heller Stoff mit der Haut verwebt.
Langsam richtete sich Ida wieder auf und ließ den Blick über den Sand gleiten. Frau Schwarz war noch da, Meyerlich und die anderen Kollegen aber hatten sich immer noch nicht blicken lassen. Zwar war es selbst für die Polizei nach wie vor schwierig, ein Auto aufzutreiben, doch die Kriminalpolizei besaß Wagen, und es wunderte Ida, dass sie nicht schon das erste Motorbrummen in der Ferne hörte.
Stattdessen nur Möwengeschrei und das leise Lied der an den Strand schlagenden Wellen. Sie holte ihr Merkbuch heraus und begann zu schreiben.
»Totenflecken vorderseitig. Linkes Ohr abgenagt oder auf andere Weise zerstört.« Auch eine Schiffsschraube könnte die Verletzung verursacht haben. »Das verbleibende Ohr auffällig abstehend.« Ein flachsblonder Junge mit Segelohren. Sie kannte einen, erinnerte sie sich. Ob das Kind, das vom Wasser so grauslich zugerichtet vor ihr lag, Theo sein könnte? Theo, der in Wirklichkeit gar nicht so hieß. Ihre Kollegin Heide Brasch und sie hatten ihn nur so genannt, weil er nicht sprach und entweder nicht schreiben konnte oder wollte.
Flachsblond war auch er gewesen. Auffällig mager. Große, abstehende Segelohren. Eine Himmelfahrtsnase.
An einem Winternachmittag, Januar oder Februar dieses Jahres, hatten Heide und sie den Kleinen in einem Hauseingang nahe dem Schaarmarkt entdeckt. Im ersten Moment hatten sie beide geglaubt, dass er tot sei, derart bleich war er gewesen und hatte, reglos in eine viel zu dünne Jacke gehüllt, dagesessen.
Glücklicherweise ein Irrtum. Sie hatten ihn in ein Kinderheim gebracht. Was hoffentlich hieß, dass dieser Junge hier nicht Theo war. Ida erinnerte sich noch, wie er sich mit beiden Händen das Brot in den Mund gestopft hatte, das sie ihm gegeben hatten. Gar nicht hinterhergekommen war er, so gierig hatte er gekaut und geschluckt. Und dabei keinen Mucks von sich gegeben. Nicht mal geschmatzt hatte er. Und später, als sie ihn im Winterhuder Waisenhaus abgaben, hatte er ihnen nur reglos nachgesehen, mit diesen riesigen leeren Augen …
Das Geräusch zuschlagender Autotüren kündigte Idas Kollegen an. Als sie den Kopf hob, sah sie ihren Vorgesetzten Bruno Pfaffenkamp durch den Sand auf sich zustaken. Seiner langen Beine wegen erinnerte er sie immer an einen Kranich. Direkt hinter ihm folgten Wachtmeister Simon und Wachtmeister De Nève, die Pfaffenkamp vergangenes Jahr aus dem Polizeipräsidium mitgebracht hatte, als er die Leitung der Davidwache übernahm.
»Rabe!«, bellte er. »Was haben Sie hier verloren?«
Statt darauf zu antworten, sagte Ida betont ruhig: »Die Zeugin Frau Schwarz wartet dort hinten. Ihr Mann hat den Jungen tot aus dem Wasser geborgen und an Land gezogen. Er hat uns den Fund gemeldet und seine Frau gebeten, solange aufzupassen. Wie es aussieht, lag der Junge länger im Wa…«
»Habe ich Sie um eine Bestandsaufnahme gebeten? Sie sind zum Knöpfe-Annähen gut, Rabe, wenn wir Glück mit Ihnen haben, oder auch zu gar nichts. Machen Sie, dass Sie mir aus den Augen kommen!«
Sollte der Mann denken, was er wollte – die Weibliche Polizei war durchaus zu etwas nutze. Heide und sie gingen regelmäßig Streife und kannten so ziemlich jede Familie im Viertel. Gab es mit den Kindern schwerwiegendere Probleme oder hatten die Kinder welche mit ihren Eltern, kamen die Leute, Jungen und Mädchen damit in das kleine Kellerbüro an der Reeperbahn. Und weil natürlich immer noch über anderes geschnackt wurde, wussten Heide und Ida außerdem, wer mit wem verwandt war, wer mit wem Zoff hatte und wessen Herz für wen schlug.
Ihren Ärger runterschluckend, bemühte sie sich um einen möglichst neutralen Ton. »Womöglich weiß ich, wer das Kind ist. Heide Brasch und ich haben im Winter einen Jungen ähnlichen Alters ins Kinderheim an die Meenkwiese gebracht. Soll ich nachfragen, ob er noch dort ist?«
»Soll ich nachfragen, ob er noch dort ist?«, äffte Pfaffenkamp sie mit verstellter Stimme nach. »Sollen Sie nicht, Rabe! Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgaben!«
»Dann bringen Sie sie zu mir ins Büro?«
Das brachte ihn aus dem Konzept. »Äh, wen?«
»Ihre Uniformjacken. Und alles andere, was neue Knöpfe braucht.«
Aus dem Hintergrund war unterdrücktes Kichern zu hören. De Nève und Simon schienen die Show zu genießen.
»Machen Sie, dass Sie hier wegkommen!«, schrie Pfaffenkamp, den Hals zu doppelter Größe angeschwollen. »Ansonsten stelle ich Sie ab heute Nachmittag frei.«
Er war schlimmer als ihr ehemaliger Vorgesetzter Hildesund, schoss es Ida nicht zum ersten Mal durch den Kopf. Wobei, das stimmte nicht ganz. Immerhin hatte Bruno Pfaffenkamp nicht auf sie geschossen – anders als Hildesund. Aber was nicht war, konnte ja noch werden …
Nach einem letzten Blick auf den Jungen drehte Ida sich um. Sie hoffte nur, dass die drei wenigstens gute Arbeit leisten würden. Wieso war Pfaffenkamp überhaupt hier aufgetaucht? Der verließ sein Büro doch nur, wenn er mit Orden behängt wurde. Ein totes Kind am Elbstrand klang eher nicht nach Prestige …
Die Erklärung, jedenfalls eine mögliche, folgte auf dem Fuß. Als Ida wieder am Union-Kühlhaus vorbeikam, wo früher Fisch und verderbliche Waren aus Übersee gekühlt wurden, nach dem Krieg aber britische Soldaten eingezogen waren, sah sie einen blitzblank geputzten weinroten Adler Trumpf anrollen; dahinter folgte fast beschämt Ares’ so staubiges wie zerdelltes Auto. Der Gerichtsmediziner wuchtete seinen den Hungerjahren zum Trotz stämmigen Körper vom Fahrersitz, warf einen abfälligen Blick auf die schicke Limousine, aus der zwei Reporterfritzen stiegen, die ziemlich ranghoch sein mussten – wer schließlich konnte sich ein solches Gefährt leisten? –, und kam dann auf Ida zu.
»Hat Pfaffenkamp endlich eingesehen, dass du doch was taugst, oder warum bist du hier?«, fragte er lächelnd.
»Ich war schneller als er. Und um auf deine erste Frage zu antworten: Er hat mich weggeschickt, um meine weiblichen Tugenden zu verbessern.«
»Oh, oh.« Grinsend fuhr sich Ares durch sein dunkles, wild gelocktes Haar. »Obacht, Herr Pfaffenkamp, das kann nur Rache bedeuten.« Beim Blick über den Strand fiel sein Lächeln allerdings in sich zusammen. »Ein totes Kind also, hm?«
Ida nickte. »Könnte seit über einem Monat im Wasser gelegen haben. Aber auch davon abgesehen sieht er … Er sieht schlimm aus. Und was ich erkennen konnte, hat bei mir den Eindruck erweckt, als wäre er misshandelt worden.«
»Das werde ich rausfinden, Ida. Und ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn du jetzt gehst. Nicht dass ich nicht mit deinem Chef in den Ring steigen würde – aber schlussendlich bedeutet das nur Ärger für dich.«
Ares hatte recht. Als Ida den Kopf drehte, sah sie aus dem Augenwinkel Pfaffenkamp in ihre Richtung steuern. Immerhin redete De Nève mit Frau Schwarz und stand nicht nur blöd herum. Diese Aufgabe hatte Wachtmeister Simon übernommen, dessen Gehirnmasse ausgewalzt auf eine Briefmarke gepasst hätte.
Dass solche Kerle hübsch Karriere machen durften, während Heide und Ida seit Pfaffenkamps Amtsantritt in ihrem Kellerbüro zu versauern drohten … Aber Lamentieren hatte noch nie jemandem geholfen, traurigen Gedanken nachhängen auch eher selten, daher stieg Ida auf ihr Rad und fuhr los, Pfaffenkamps honigsüße Stimme noch bis zum Fischmarkt im Ohr, wie er die Reporter begrüßte: »Ein trauriger Anlass, werte Herren. Totes Kind, wahrscheinlich lag es seit Längerem im Wasser. Entdeckt von einem Herrn, dessen Frau dort drüben wartet. Sie redet bestimmt mit Ihnen. Frau Schwarz ist ihr Name …«
Grimmig trat Ida in die Pedale, und statt sich weiter über Pfaffenkamp zu ärgern, dachte sie an Theo, den Jungen, der hoffentlich in dem Kinderheim in Winterhude Anschluss gefunden hatte – das und womöglich auch seine Sprache. Sie würde Frau Roth anrufen, die Heimleitung. Das hätte sie ohnehin längst tun wollen.
Wieder nagte das schlechte Gewissen an ihr. Warum hatte sie nicht vorher schon mal den Hörer in die Hand genommen? Aber es gab so viele Kinder und so wenige Eltern, so kam es ihr zumindest mittlerweile vor. So viel Leid und Hunger und Traurigkeit. Sie konnten sich einfach nicht um jedes Kind, das sie fanden und mithilfe des Jugendamtes unterbrachten, im Nachhinein noch weiter kümmern. Dann bräuchte der Tag 50 Stunden.
*
»Entschuldige, dass ich so spät dran bin, Heide! Hat Meyerlich schon berichtet? Warum ist er eigentlich gar nicht aufgetaucht?«
Mit einem Rumms warf Ida die Bürotür hinter sich zu. Heide, die an ihrem Schreibtisch saß und wie das lebendig gewordene Elend aussah – gelblich schimmerndes Gesicht und verschwitzte Stirn, an dem ihr das hellblonde Haar klebte –, hob abwehrend die Hände. »Macht nichts, Ida, wir haben sowieso nichts zu tun. Und was soll Johann mir berichtet haben?«
Ida ließ sich auf ihren Stuhl sinken und sah ihre Kollegin düster an. »Ein totes Kind, in Övelgönne, angeschwemmt. Und ich hab das Gefühl, dass wir den Jungen kennen.«
Mit besorgter Miene beugte Heide sich vor. »Wer?«
Angespannt heftete Ida den Blick auf das winzige Fenster, durch das goldene Sonnenstrahlen fielen. Das helle Licht wirkte tröstlich, und Trost brauchte sie durchaus, während sie an die mitleiderregende leblose Gestalt im Elbsand dachte – an das flachsblonde Haar, den schmächtigen, übel zugerichteten Körper.
»Erinnerst du dich an Theo?«
Nachdenklich neigte Heide den Kopf.
»Der blonde Junge aus dem Hauseingang in der Neustadt«, versuchte ihr Ida auf die Sprünge zu helfen. »Helles Haar. So mager, dass du sagtest, man könnte durch ihn durchgucken. Hat keinen Mucks von sich gegeben, egal wie sehr wir es auch versucht haben.«
Jetzt ging Heide ein Licht auf. »Klar!« Doch ihre Miene verdüsterte sich augenblicklich. »Wir haben ihn ins Heim zu Frau Roth gebracht, oder?«
Ida nickte. »Ich hab schon angerufen, aber niemanden erreicht. Nach dem Streifgang versuche ich es noch mal.«
»Aber du weißt nicht genau, ob er es war. Ich meine, wir wüssten doch davon, oder? Wenn er weggelaufen wäre oder so?«
Darauf sagte Ida nichts und Heide runzelte die Stirn. »Nee, du hast ja recht. Sogar wenn die hier angerufen hätten, wäre die Nachricht nicht zu uns durchgedrungen. Verdammter Pfaffenkamp.«
»Sollen wir?«, fragte Ida. »Es ist Freitag. Ich möchte es hinter mich bringen, solange ich noch über ein bisschen Lebenskraft verfüge.«
Sie redete von dem Streifgang, zu dem Pfaffenkamp sie beide verdonnert hatte. Sonst hielt er ja nichts von ihren Fähigkeiten, doch sie an einen der schlimmsten Orte auf dem Kiez, wenn nicht gar in ganz Hamburg, zu schicken, um »Gesicht zu zeigen«, brachte er dennoch fertig.
»Ja, lass uns los.« Doch als Heide aufstand, sah sie eher nicht danach aus, als könnte sie in nächster Zeit irgendwohin aufbrechen. Ihr schien schwindelig zu sein, denn sie stützte sich mit der einen Hand an ihrem Tisch ab, während sie mit der anderen nach ihrem Hals griff, als wenn sie würgen müsste.
»Was ist denn mit dir los?«
»Nix.« Heides beruhigendes Lächeln wirkte reichlich verrutscht. »Warte, gleich geht’s wieder.«
»Nee, nee, das lass mal schön bleiben. Setz dich.«
»Ich lasse dich nicht allein da runtergehen!«
»Ich finde wen anders. Hondratschek zum Beispiel.« Der ihr sicher vor Freude um den Hals fallen würde. Aber egal. In diesem Zustand würde Heide im Tiefbunker zu Hackfleisch verarbeitet werden, das war sonnenklar.
So richtig einverstanden war Heide zwar nicht, das kleine Kellerbüro zu hüten, aber nachdem Ida ihr vorgeschlagen hatte, noch mal das Winterhuder Kinderheim anzurufen und, falls Theo noch dort war, die anderen Einrichtungen abzutelefonieren, wo ein Junge vermisst werden könnte, gab sie schließlich nach. Also ging Ida nach oben und versuchte, nicht daran zu denken, was ihr bevorstand. Sie fand den Kollegen Hondratschek in seinem Büro, wo er sich, als ahnte er, was auf ihn zukam, hinter seinem Telefon versteckte.
»Du hast garantiert große Lust, mich in den dunkelsten, gefährlichsten, übelriechendsten Bunker zwischen München und Flensburg zu begleiten, nicht wahr?« Wo sie im Übrigen nach dem Jungen fragen konnte, fiel ihr ein. Glücklicherweise kam es zwar so gut wie nie vor, dass sich ein Kind dort unten aufhielt, aber wenn sie schon mal da waren, konnte sie das ja in Erfahrung bringen.
»Och nö, Ida!«, protestierte Hondratschek. »Ich wollte grade Kaffeepause machen.«
»Was ja wohl heißt, dass du sonst nichts zu tun hast.«
»Ich hab tonnenweise Akten auf dem Tisch!«
Sie mochte Hondratschek, der alles stets sehr bedächtig, aber trotzdem nicht sonderlich gründlich tat. Jetzt aber ging ihr seine Faulheit auf die Nerven. »Ich hab keine Zeit, mit dir zu diskutieren. Lass es uns hinter uns bringen.«
Mosernd folgte er ihr durch den langen Flur auf den Wachraum eins zu, am Tresen und den Holzbänken vorbei, auf denen immer jemand saß oder lag, der die Sicherheit der Davidwache dem wilden Pflaster der Reeperbahn vorzog, und die paar Stufen zur Straße hinunter, wo grelles Sonnenlicht sie empfing.
»Hab gehört, da gab’s ’n totes Kind«, murmelte Hondratschek. »Wasserleiche?«
»Ja«, antwortete Ida knapp, während sie den Eingang des Tiefbunkers ansteuerte, der keine 50 Meter von der Davidwache entfernt lag.
»Sah schlimm aus?«
»Allerdings.«
»Also länger im Wasser gewesen.«
»Kennst du dich damit aus?«, fragte sie interessiert.
»Mit Wasserleichen? Gott bewahre, nee. Dein Freund hat aber sicher viel dazu zu sagen.«
Das kommentierte Ida nicht. Wer ihr Freund war und wer nicht, ging selbst einen netten Kollegen wie Hondratschek nichts an. Aber natürlich würde Ares ihr einiges zu erzählen haben, zusätzlich zu dem wenigen, was sie wusste: dass ein im Wasser aufgefundener Körper die Frage nach dem Todeszeitpunkt und dem Grund des Ablebens erheblich erschwerte. Es kam auf die Jahreszeit an, auf Sonnenstunden, Wolkenbrüche, das Strömungsverhalten des Gewässers, auf den Fischbestand, die Anzahl und Größe von Schiffen, deren Schrauben weitere Verletzungen hervorrufen konnten, Wasserinsekten, Wasservögel und, und, und.
Wieder sah sie den toten Jungen vor sich und versuchte, das Bild mit ihrer Erinnerung an Theo abzugleichen. Wie er an diesem Wintertag, an dem sie ihn fanden, im Hauseingang gekauert hatte. Dieses Bild hatte sich ihr ins Gedächtnis gebrannt, vor allem, weil er der Welt so abgewandt gewirkt hatte. Nicht ein einziges Mal hatte er Heide oder Ida angeguckt, sondern immer das Gesicht abgewendet oder, wenn das nicht möglich war, die Augen geschlossen. Ohne Gegenwehr oder Anzeichen von Angst war er aufgestanden, als sie ihn dazu aufgefordert hatten, und ihnen gefolgt. Dann aber war etwas Seltsames passiert: Als sie an der Haltestelle der Straßenbahn 36 vorbeigekommen waren, hatte sich seine Geschwindigkeit verändert. Immer langsamer war er auf die kleine Gruppe Menschen zugegangen, die dort wartete, und hatte sich neben einen älteren Herrn in Trenchcoat und Hut gestellt. Ohne ihm auch nur einen Blick zu schenken, hatte er an dessen Mantel gezupft und dann nach der Hand des Mannes gegriffen, der die Polizistinnen so verblüfft wie hilflos angestarrt hatte.
Ida zwang ihre Gedanken wieder zurück ins Hier und Jetzt. Sie hatten die Treppe erreicht, die zum Höllenschlund führte, wie die Polizisten der Davidwache den Tiefbunker nannten, und Ida brauchte jetzt alle Aufmerksamkeit, wenn sie runterging, andernfalls kam auch sie als Hackfleisch wieder hoch.
Hondratschek tastete nach seinem Knüppel, den er unter dem Gürtel trug. Auch Ida wäre gern bewaffneter, als sie es mit ihrer Schließkette war, doch das war den Frauen bei der Polizei nicht erlaubt. Ida und ihr Kollege sahen sich kurz an, nickten, dann betraten sie gleichzeitig die erste Stufe.
Zwei Stockwerke unter der Erde umfasste Ida den Griff ihrer Taschenlampe fester. Hondratschek bollerte gegen die Eisentür und stieß sie auf.
»Moin!«, brüllte er in die Dunkelheit. »Alles gut bei euch hier unten?«
Merke: je lauter, desto besser.
Den einen Fuß im Türspalt, wartete Ida trotzdem erst mal ab. Nach Urin, Erbrochenem und Alkoholdunst riechende Luftschwaden zogen an ihr vorbei. Im Dunkel blieb es still; die Männer, die tief unter der Erde hausten, schienen die Luft anzuhalten.
Obwohl Ida bezweifelte, dass einer von ihnen wusste, welcher Wochentag heute war, hatten sie womöglich mit Heide und ihr gerechnet. Hondratschek war also ein Störfaktor, das sollte sie im Hinterkopf behalten. Zumal es meist Heide war, die hier für Frieden sorgte, während sich Ida schon mal auf eine Diskussion einließ …
Heute nicht, nahm sie sich vor. Einmal durchmarschieren, nachgucken, ob es Verletzte, Kranke oder sogar Tote gab, und dann nichts wie zurück ans Licht.
Da erst mal niemand auf die Barrikaden ging und stattdessen leises Grollen und Husten laut wurde, ließ Ida mit einigem Widerwillen die Tür zufallen. Schwärze, die nur vom Schein ihrer Taschenlampe durchbrochen wurde, umfing sie. Auf dem Boden lag Unrat, eine todesstarre Ratte, verschmutzte, zerrissene Kleidung. Nur flüchtig ließ sie den Lichtkegel über die Eisenbetten wandern, die in einer unendlich erscheinenden Reihe nebeneinanderstanden. Auf den wenigsten lagen Matratzen. Mancher behalf sich mit Stroh oder Stoffresten. Die Gesichter, die sie anleuchtete, waren so schmutzig, als wären sie alle gerade aus einem Kohlenschacht heraufgeklettert.
Verlorene Seelen allesamt, auf rostigen Bettgestellen in der Finsternis eingepfercht. Nicht, dass sie nicht rausgehen dürften. Aber die wenigsten der Männer hier, die keinen anderen Rückzugsort fanden als diesen, wollten irgendwann wieder zurück nach oben. Zu Maulwürfen wurden sie, soffen, schliefen, aßen hier, urinierten in die Ecken oder ins Bett, siechten dahin.
Es war eine Katastrophe. Und davon abgesehen, dass der Senat die Polizei einmal wöchentlich auf Streife herschickte, wurde nichts unternommen.
Hondratschek und Ida blieben so dicht beieinander, dass sich ihre Ärmel berührten.
»Einer von Ihnen krank oder verletzt?«, rief Ida. »Gab es Schlägereien? Oder ist heute Nacht wer beklaut worden?«
Niemand antwortete, was sie als gutes Omen auffasste. Als sie selbst noch im Bunker gelebt hatte – dem an der Feldstraße allerdings, dem Hochbunker und schon allein deswegen im Vergleich zu diesem quasi ein Ort des Frohsinns –, waren die Leute morgens in Scharen auf die Reviere gerannt. Immer war nachts was passiert. Meist Kleinkram wie geklaute Strümpfe, Schuhe, entwendetes Kinderspielzeug und so, aber auch da hatte hin und wieder jemand tot auf seiner Matte gelegen.
Doch das war weit seltener vorgekommen als hier.
»Alles in Ordnung bei dir?«, fragte sie Melchior, der im zweiten Bett nahe der Tür wohnte. Sein unbekleideter Oberkörper war so mager, dass sie jeden Rippenbogen einzeln erkennen konnte. »Willst du dir nicht was anziehen?«
»Immerhin sind Weibsbilder da, meinste, die können meinen Anblick nich ertragen?«, fragte er kichernd. »Obwohl, bei dir weiß man das ja nich so genau, ne, ob Mädchen oder Kerl?«
»Das weiß man nicht, nee«, gab sie ihm recht, weil das das Einfachere war und sie ohnehin kein Problem damit hatte, wenn er seine Scherze machte. Er war einer der Netteren. Der immerhin manchmal zu einem Gespräch bereit und imstande war, also nutzte sie ihre Chance.
»War in der letzten Zeit mal ein Junge hier? Hellblond, sieben bis zehn Jahre alt, abgemagert und auch sonst nicht gut beisammen? Vielleicht hat er auch nicht geredet. Klingelt bei dir was?«
Weil Melchior nicht mal so aussah, als würde er ihr zuhören, wackelte sie mit der Taschenlampe, sodass der Lichtstrahl auf seiner Nase herumhüpfte. »Es ist wichtig. Streng dein hübsches Köpfchen an.«
»N Junge? Dem würden die hier doch die Haut vom Leib ziehen«, kicherte Melchior. Seine Augen waren knopfrund und dunkelbraun. Auf seinem spitzen Kinn spross eisgrauer Wildwuchs. Wann immer Ida ihm ins Gesicht leuchtete, musste sie an ein Frettchen denken. »Jaja, Haut abziehen und überm Feuerchen grillen. Mhm, fein, fein, wir sind hier doch die Hexen!« Melchior lachte immer wilder, sodass die Männer in den Nebenbetten unruhig wurden.
»Was’n los?«, schrie ein Mann dumpf, der augenscheinlich unter einem Stoffberg lag. »Kann man nich ma drei Minuten seine Ruhe ham?«
»Klappe«, sagte Ida zu niemand Bestimmtem. Heute war offenbar keiner der Tage, an denen mit Melchior zu reden war.
Ein Stück weiter wedelte jetzt auch Hondratschek ungeduldig mit der Taschenlampe, um ihr zu bedeuten, dass sie sich ranhalten sollte. Er wollte zu seinem Kaffee zurück.
Verärgert, weil sie aus Melchior nichts Hilfreiches herausbekommen hatte, schloss Ida sich ihrem Kollegen auf dem Weg an den Bettenreihen vorbei an und versuchte, den schwarz glänzenden Pfützen auszuweichen und nur durch den Mund zu atmen. Dabei pochte ihr der Gedanke durch den Kopf, was mit Kindern hier unten wohl wirklich geschah, sollte sich mal eines hierher verirren.
Seit Kriegsende waren beim Deutschen Roten Kreuz fast eine halbe Million vermisster Minderjähriger gemeldet worden. 500 000. Eine unvorstellbare Zahl. Wie viele davon in Hamburg? Wie viele in Sankt Pauli, dem Auffangbecken der Verlorenen? Wo versteckten sie sich? Denn die, die sie in Hauseingängen fanden, konnte man an zwei Händen abzählen.
Plötzlich sauste etwas an ihnen vorbei und gleich darauf ertönte ein lautes Klirren. Ida zuckte zusammen und leuchtete hektisch in die Dunkelheit, entdeckte aber niemanden, der etwas nach ihnen geworfen haben könnte.
»Verdammt noch mal, wer war das?«, brüllte Hondratschek neben ihr.
Als sie sich umdrehte, erfasste der Lichtstrahl nicht weit von ihnen einen Scherbenhaufen.
»Komm her, du Dreckskerl!« Damit verschwand Hondratschek in der Finsternis.
Verdammt, genau das sollte nicht passieren!
Während sie sich zwang, nicht in Panik zu verfallen, leuchtete Ida in fünf Augenpaare. Lautlos standen die Männer auf und bildeten einen Halbkreis, der sich langsam auf sie zubewegte.
Während sie gegen den Drang ankämpfte, nach hinten auszuweichen, murmelte sie lautlos vor sich hin: »Keine Schwäche zeigen, keine Schwäche zeigen.«
Keiner sprach. In der Luft hingen nicht mehr nur der Geruch nach Urin, Schweiß und billigem Tabak; jetzt roch sie auch die Aggression, den Hass auf alles und jeden, vor allem aber auf eine Polizistin, die die Frechheit besaß, hier reinzumarschieren und sich aufzuspielen.
Keine Schwäche zeigen, keine Schwäche zeigen. Oder war das nicht vielleicht sogar das Beste, was sie tun konnte?
Aus diesem Impuls heraus ließ sie die Taschenlampe sinken. Satte Schwärze umfing sie außerhalb des Lichtkegels, der nur noch den Boden erhellte. Nun spürte sie die Nähe der Männer mehr, als dass sie jemanden sah, und hoffte, dass sie nicht beim nächsten Schritt in ein offenes Messer lief. Ihre Hände zitterten, während sie eine Zigarette aus ihrer Uniformtasche nestelte. Vor Anspannung biss sie die Zähne zusammen, sodass ein Knirschen ertönte.
Die Dunkelheit um sie herum erschien ihr wie ein unendliches Loch, und für einen Moment war sie nicht sicher, ob sie überhaupt auf zwei Füßen stand oder fiel und fiel und fiel.
»Hat einer von euch Pissnelken Feuer? Ich brauch ’ne Beruhigungszigarette, und zwar nicht da oben, sondern jetzt.«
Atemlos lauschte sie auf eine Reaktion. Manchmal war diese Art Gegenangriff genau das Richtige – genauso gut könnte sie gerade aber auch einen der größten Fehler ihres Lebens gemacht haben.
Weil keiner muckte – sie hörte auch kein Kleiderrascheln, nichts, das so klang, als ginge jemand im Finstern auf sie zu –, beschloss sie erst mal weiterzumachen. In Teufels Küche hatte sie sich schließlich schon häuslich eingerichtet. Was sollte jetzt noch passieren?
»Streichhölzer, Zippo, irgendwas? Ich weiß, dass ich euch mit einem Zug von meiner Kippe nicht bestechen kann. Aber ich würde mich einfach gern ein bisschen mehr zu Hause fühlen. Auch wenn zu Hause ehrlich gesagt zu den schlimmeren Orten gehört, die ich bisher kennengelernt hab.«
»Ha!«
Inständig hoffte sie, dass dieses Ha! tatsächlich leicht belustigt geklungen hatte und keinen Angriff ankündigte. Was in aller Welt trieb Kollege Hondratschek eigentlich? Schnitt er sich die Fußnägel?
»Im Dunkeln rauchen«, redete sie weiter. »Deswegen komm ich drauf. Hab ich andauernd gemacht, schon als Winzling. Weil mich meine Mutter so oft in den Keller gesperrt hat. Der Keller war kleiner als das Haus, das drüberstand, und noch älter. Vielleicht hat es lange Zeit nur ihn gegeben, und meine Vorfahren haben da drin gehaust. Die Mauersteine waren rund, abgeschliffen von dem Wasser, das ständig daran runtergelaufen ist. Ich weiß noch genau, wie sie sich angefühlt haben. Kalt und feucht. Drinnen war es wie in einem Grab.«
Sie bildete sich ein, den muffigen Atem der Männer riechen zu können.
»Musstet ihr früher auch in den Keller?«
Keiner antwortete.
»Bei mir war es nicht mal Strafe. Meine Mutter fand, ich sollte wissen, wie es sich anfühlen würde, wenn ich etwas täte, das verboten war. Eine Art vorgezogene Strafe also. Jeden Sonntag zwei Stunden. Das erste Mal, glaube ich, war ich vier.«
Mit jeder Minute, die verstrich, wuchs ihre Sorge, dass Hondratschek womöglich halb tot in einer Ecke lag. Sie hörte nichts, sah seinen Lichtstrahl nicht. Wo steckte er?
Angespannt starrte sie in die Finsternis. Immer noch leuchtete ihre Taschenlampe ein Fleckchen Erde zu ihren Füßen an, immer noch gab es nur Schwärze drum herum. Und ein Rascheln, dicht neben Idas Ohr, das ihr das Blut in den Adern stocken ließ. Dann: ein ratschendes Geräusch. Eine kleine Flamme flackerte auf. Ein paar Zentimeter von ihrer Nase entfernt tauchte eine schwielige, vor Dreck starrende Hand mit schwarzen Nägeln auf.
»Willste jetzt Feuer, oder nich?« Die Stimme klang, als käme sie aus den Tiefen der Erde und sei jahrhundertelang nicht mehr benutzt worden.
Vor Erleichterung hätte Ida am liebsten laut aufgelacht, verkniff es sich aber. Stattdessen beugte sie sich vor. Kurz darauf glomm das Ende der Chesterfield auf; sie inhalierte, dann reichte sie die Kippe an den Kerl weiter, der das Streichholz zu Boden hatte fallen lassen, wo es in einer Pfütze erlosch.
»Hast wat von ’nem blonden Jungen erzählt, wa?«, fragte er in breitem Berlinerisch, nachdem er einen Zug genommen hatte. »Nem Hanswurst, halb totgeprügelt?«
Augenblicklich war ihre Angst um die eigene Haut wie weggefegt. »Hast du ihn gesehen? Hier?«
»Kostet wat, Frollein.«
»Und was?«
»Kippen.«
»Erst will ich wissen, ob du mich verscheißerst. Schieb ein paar Einzelheiten rüber.«
Zögernd starrte er sie an, zuckte dann aber mit den Schultern. »Nee, so watt mach ik nich. Ik mein, der könnt’s echt gewesen sein, aber welche von den Blagen sehen nich so aus? Dürre und kaputt sind sie doch alle. Aber nachher drehste mir ’n Strick draus. Also vergiss es.«
»Rabe!« Hondratscheks Lichtkegel erfasste sie. Schützend hielt sie sich die Hand vor die Augen. »Alles klar, Kollegin?«
»Jaja«, sagte Ida und wedelte ihn ungeduldig weg. »Ich komme gleich. Also, erzähl«, forderte sie den Kerl erneut auf.
»Erst die Kippen.«
Widerwillig zog Ida ihr silbernes Zigarettenetui hervor. Drei hatte sie noch für die nächsten Tage. Eine zwackte sie ab und hielt sie ihm hin.
»Noch eine.«
»Da. Und jetzt Mund auf. Ich will was hören.«
»Willste, wa? Aber kriegst nüscht. Auf Wiedersehen, werte Dame, beehren Sie uns bald wieder.« Sie hörte ihn förmlich grinsen.
Wütend starrte Ida ihm nach, als er sich umdrehte und auf eines der hinteren Betten zuwankte. Aber ihm nachgehen? So verrückt war nicht mal sie.
*
»Frau Roth ist im Urlaub«, empfing Heide Ida, als die in ihr winziges Loch von Kellerbüro zurückkehrte.
Mist! Frau Roth war eine der wenigen Kinderheimleiterinnen, die auskunftsfreudig war und nicht so tat, als führe sie eine hochgeheime Organisation. Mühsam ihren Stolz wieder zusammensammelnd, der ihr gerade unten im Bunker abhandengekommen war, setzte sich Ida an ihren Tisch. »Ich höre?«
»Am Apparat hatte ich den Hausmeister. Ein unsympathischer Kerl«, fuhr Heide fort. »Er hat behauptet, nicht einen einzigen Jungen im Heim mit Namen zu kennen und daher keinen Schimmer zu haben, ob es jemanden gibt, der von uns als Theo vorgestellt wurde.«
»Wie bitte? Ernst Bolte?«, fragte Ida ungläubig. Selten war ihr ein freundlicherer Mensch untergekommen als der Hausmeister, der seit Jahrzehnten im Heim an der Meenkwiese nach dem Rechten sah.
»Eben nicht«, sagte Heide. »Es ist ein neuer. Herr Bolte scheint Geschichte zu sein.«
Mist, verdammter. Ernst Bolte wäre der Nächste gewesen, den sie gefragt hätte.
»Glaubst du, wir können mit ein paar der anderen Kinder reden? Davon abgesehen muss es doch auch so was wie eine Vertretung von Frau Roth geben.«
»Klar, gibt es. Aber die ist heute krank. Frau Roth kommt aber ohnehin Montag wieder. Bis dahin müssen wir uns also gedulden, ich glaube nämlich nicht, dass wir auf Begeisterung stoßen, wenn wir uns die Lütten im Heim vorknöpfen. Und ich sag dir, wenn uns dann auch noch dieser neue Hausmeister querkommt, sehe ich rot.«
»Du?« Ida grinste. »Dich als wilden Stier hätte ich da unten eben gut gebrauchen können.«
Sofort riss Heide alarmiert die Augen auf, doch Ida beruhigte sie. »Sowohl Hondratschek als auch ich leben noch. Aber ein bisschen Ärger hatte ich schon. Einer von den traurigen Gestalten hat mich um zwei Zigaretten gebracht, weil er behauptet hat, in letzter Zeit einen blonden Jungen gesehen zu haben. War natürlich erstunken und erlogen. Mistkerl.«
Nachdenklich sah Heide sie an. »Die Idee ist gar nicht so übel. Rumzufragen, meine ich. Schließlich haben wir Zeit – bis Montag, weil erst dann Frau Roth zurückkommt, aber auch, weil ich rein gar nichts auf dem Tisch habe und du ebenso wenig, Pfaffenkamp sei Dank. Also, sollen wir?« Sie stand auf, und diesmal sah sie zu Idas Erleichterung nicht so aus, als würde sie gleich aus den Latschen kippen.
»Schaffst du das denn? Es wird heute bestimmt wieder so heiß wie in den letzten Tagen.«
»Mach dir mal um mich keine Sorgen. Johann hat mir einen Tee gebracht, jetzt fühle ich mich nicht mehr wie ein lebender Wackelpeter.«
»Gottlob.«
Wenig später grasten sie den Fischmarkt ab, verlegten sich dann auf die Palmaille und fragten sich beinahe bis zum Altonaer Bahnhof vor. Die Leute lauschten interessiert, schüttelten aber unisono die Köpfe. Klar, alle hatten mal einen blonden Jungen irgendwo gesehen. Aber gab es blonde Jungs nicht an jeder Ecke?
Mittlerweile war es fast zwölf. Die Mittagshitze verwandelte die Straßen in bullige Öfen. Immer wieder sah Ida besorgt zu ihrer Kollegin hinüber, die sich von Häuserschatten zu Häuserschatten rettete. Genug für heute. Sie würden morgen weiterfragen.
»Der noch«, widersprach ihr Heide und zeigte auf einen lumpigen Gesellen, der, die Ellbogen auf die Fensterbank gelehnt, aus seinem Fenster im Hochparterre starrte. »He, Sie, können Sie uns helfen?«
»Ich bin gar nicht da.«
»Nun, ich frage Sie trotzdem: Haben Sie in den letzten Wochen oder Monaten einen Jungen gesehen, flachsblond, auffällig dürr, mit Segelohren?«
»Sonst noch ’n paar Auffälligkeiten?«, fragte der Mann nach kurzem Nachdenken. »Nicht dass ich euch was sag. Nur aus Interesse.«
»Er hat nicht geredet.«
»Jau, den hab ich gesehen.«
Ida verkniff sich den Hinweis, dass er mit ihnen gar nicht hatte sprechen wollen. Stattdessen kam sie Heide zuvor: »Wann und wo?«
»Och, das … Nee, das weiß ich so genau nicht mehr.«
»Also haben Sie sich das nur ausgedacht.«
Entrüstet nahm er die Ellbogen von der Fensterbank und plusterte sich auf. »Hab ich nicht! Ich hab den gesehen. Brauch nur manchmal ’n büschen, um die Erinnerungen zu melken, kapiert?«
»Kapiert«, antwortete Ida, um Geduld bemüht.
»Ah! Jetzt hab ich’s. Da is so ’n Jesus Christus hinten auf Waltershof. Der kann die Lahmen gehen machen und so ’n Quatsch.«
»Haben Sie oder haben Sie nicht einen blonden Jungen gesehen, der wirkte, als würde es ihm sehr, sehr schlecht gehen?«
»Sag ich doch! Die schippern da zu Hunderten hin, jeden Tag. Habt ihr Tomaten auf den Augen oder warum wisst ihr das nicht?«
»Also noch mal für die Begriffsstutzigen«, sagte Heide, bevor Ida wütend kontern konnte. »Wer schippert nach Waltershof und warum, und was hat das mit einem blonden Jungen zu tun?«
»Ja, also, begriffsstutzig seid ihr aber wirklich! Es gibt da so ’n Hof auf der Insel, gleich da drüben, andere Elbseite. Da hat sich ’n Wunderheiler niedergelassen. Seitdem sinken die Bötchen immer fast, weil sie so voll sind und alle rüberwollen. Und wo ’n Wunderheiler is, sind die Kranken nicht weit, oder? Wie es der Zufall nu will, vertändle ich manchmal meine Zeit damit, mich an die Landungsbrücken zu setzen. Früher war das langweilig. Nur die Hafenarbeiter, die an Bord und wieder runtergekrochen sind. Aber jetzt wird fürs Auge richtig was geboten! Weiber, so viele, dass einem das Herz höher schlägt. Und ’ne Menge Blagen. Alle krank.«
»Unter diesen kranken Kindern war also ein blonder, auffällig dünner Junge, der nicht geredet hat?«
Dass Heide da so tapfer weiterfragte! Idas Kopf hatte schon auf Durchzug gestellt. Leute, die so geschwollen daherredeten und eigentlich nichts sagten, raubten ihr den letzten Nerv.
»Exakt. Und das weiß ich, weil er zu mir kam.« Zufrieden knallte der Mann die Ellbogen wieder aufs Fensterbrett.
»Und was wollte er von Ihnen?«, fragte Heide.
»Weiß ich nicht. Aber er stand plötzlich neben mir, so ’n Junge, der aussah wie ’n Grashalm im Sturm. Herzzerreißend, echt. Hat seine Hand in meine geschoben – ich sag Ihnen, ich hab vielleicht ’n Schreck gekriegt! Wusste ja nicht, ob der mich beklauen will oder was. Auch wenn bei mir nix zu holen ist. Jedenfalls: Hat er nicht versucht. Stand nur da und hat meine Hand gehalten, was wirklich … seltsam war.«
Nachdenklich sahen Heide und Ida sich an.
»Wann haben Sie ihn am Hafen gesehen?«, fragte Ida.
»Och, das war … Puh … Muss noch mal das Gedächtnis melken, dauert ’n Moment.«
Ungeduldig verzog Ida das Gesicht, beherrschte sich aber.
Endlich sagte er: »Muss im Mai gewesen sein. Hat geregnet an dem Tag, wie aus Eimern, und alle vorher auch. Noch nicht so ’ne Hitze wie jetzt, wo einem die Ohren versengt werden.«
Mai. Das war zwei Monate her. Und zwei Monate im Wasser reichten, um eine Leiche so aussehen zu lassen wie die des Kindes am Övelgönner Strand, nahm Ida an, während es ihr den Magen zusammenzog. Viel lieber hätte sie gehört, dass er was von letzter Woche gesagt hätte. Dann hätte der tote Junge im Sand nicht Theo sein können, zumindest wenn man annahm, dass der Kerl vor ihnen tatsächlich Theo gesehen hatte.
»Können Sie uns erklären, was es mit diesem Hof auf sich hat?«, bat Heide.
»Also, ich denk ja, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht«, nuschelte er. »Aber wissen tu ich nix. Find’s nur komisch, dass da alle hinwollen, die ganzen hübschen Deerns mit ihren Kindern.«
»Aber irgendwas müssen Sie doch gehört haben«, insistierte Ida. »Sonst kämen Sie doch nicht drauf, dass es da nicht mit rechten Dingen zugehen kann.«
»Die Leute reden halt. Und die reden, dass das der Teufel ist.« Er nahm die Ellbogen wieder hoch, zuckte mit den Achseln und knallte das Fenster zu.
*
»Dass wir davon nichts wussten!«, murmelte Ida auf dem Weg zurück zur Wache. »Die Landungsbrücken liegen keine zehn Minuten zu Fuß vom Revier entfernt.«
»Ich war in letzter Zeit selten am Wasser«, erwiderte Heide, die mit einem Mal vollkommen erschöpft klang.
»Sollen wir eine Pause einlegen?«
»Ach was, es geht schon.«
»Hak dich wenigstens ein.« Ida hielt ihr den Arm hin.
Heide nahm ihn und musterte Ida prüfend. »Dir spukt was im Kopf rum, oder?«, fragte sie.
»Na ja, Waltershof liegt ja mehr oder minder gegenüber dem Strand von Övelgönne. Da ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Mensch von einem Ufer ans andere treibt, quer zur Strömung. Andererseits fließt genau da der Köhlbrand in die Elbe. Wenn der Junge also zum Beispiel am Anleger in Waltershof, der ja im Köhlbrand liegt, ins Wasser gegangen und von da in den Hauptfluss getrieben ist …« Frustriert zuckte sie mit den Schultern. »Na ja, klingt alles ziemlich weit hergeholt.«
»Ich würde sagen, dass wir diese Frage der Kriminalpolizei überlassen sollten.«
»Von der ich übrigens nicht das Geringste am Strand gesehen hab«, warf Ida ein. »Weißt du, wer übernimmt?«
»Wer sollte mir das denn verraten haben? Mein Vater hat, wie du weißt, keine Standleitung in unser Büro. Aber ich schätze, dass ich es rauskriegen kann.« Schweigend schlichen sie durch die brütende Hitze voran. Dann unterbrach Heide die Stille. »Das mit der Hand … Es war Theo, oder?«
Ida sagte nichts. Sie wollte lieber nicht darüber nachdenken.
»Was aber trotzdem nicht heißen muss, dass Theo auch der tote Junge ist.«
»Stimmt.«
»Auf Waltershof nachfragen sollten wir trotzdem.«
»Er könnte aber auch nach Steinwerder rübergefahren sein. Die Fähre legt dort auch an.«
»Ja, aber was ist schon auf Steinwerder? Ein paar Trocken- und ein paar Schwimmdocks. Was sollte er dort gewollt haben?«
Dem konnte Ida nichts entgegensetzen. Steinwerder war Ödland. Was sollte ein Junge dort verloren haben?
»Wollen wir gleich rüber?«, fragte Heide matt. Ihre Wangen hatten eine knallrote Farbe angenommen, während ihre Augen fiebrig glänzten.
»Für dich ist es doch viel zu heiß, Heide. Du siehst immer noch krank aus. Du gehörst nicht auf eine Fähre, sondern ins Bett.«
Den restlichen Weg redete Ida derart mit Engelszungen auf ihre Kollegin ein, dass diese schließlich nachgab. Nachdem sie am Wachtresen Bescheid gegeben hatte, wankte sie in Richtung Hafen davon.
»Soll ich nicht Johann fragen, ob er dich begleiten kann?«, rief Ida ihr nach. »Oder ich komme mit!«
»Jetzt mach mal nicht so ein Theater. Ich hab eine Erkältung und werde sicher nicht daran sterben. Wenn wir beide weg sind, lacht sich Pfaffenkamp doch nur ins Fäustchen. Und wenn er spitzkriegt, dass mich Johann nach Hause bringt, wird es richtig ungemütlich.«
Ihre Liaison hielten die beiden lieber unter Verschluss – verständlich bei einem Vorgesetzten wie Pfaffenkamp. Trotzdem sah Ida ihr besorgt nach.
»Kurier dich ja aus! Ich will dich morgen nicht im Büro sehen, wenn du so schwach auf den Beinen bist wie jetzt.«
Heide winkte nur und ging weiter.
Zurück auf der Wache, stattete Ida Johann Meyerlich einen Besuch ab. Erstens, um vorsichtig anzuklopfen, ob er nicht früher gehen könne, um sich um seine Freundin zu kümmern. Und zweitens schien er so etwas wie einen Seltsame-Gestalten-Radar zu besitzen. Nachdem er ihr versprochen hatte, so bald wie möglich nach Heide zu sehen, setzte sie hinterher: »Hast du mal von einer Art modernem Jesus gehört, der auf der anderen Elbseite Kranke heilt?«
»Du, ich hab grad ganz andere Sachen an der Backe, Ida.«
»Wunderheiler«, beharrte sie. »Waltershof?«
Johann seufzte, pustete sich eine rote Haarsträhne aus der Stirn und ließ die Akte, in die er vertieft gewesen war, mit einem Seufzer auf seinen Schreibtisch fallen. »Jau, da soll sich so einer rumtreiben. Der und sein Hofstaat. Haste von dem noch nech gehört? Is ’ne Riesensache. Jeder, der auch nur ’n Husten hat, will da hin und wundergeheilt werden.«
»Eine Goldgrube also. Ist das überhaupt legal?«
»Ja, und jetzt kommt’s: Der will nix dafür. Der behandelt die Leude umsonst. Da wüsste ich jetzt kein Gesetz, das einem so was verbietet.«
Ungläubig runzelte sie die Stirn.