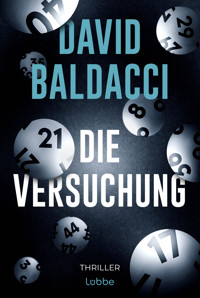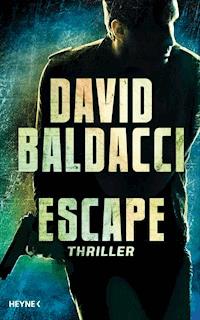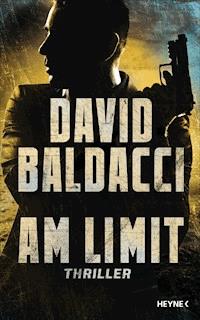
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Puller
- Sprache: Deutsch
Der erste Fehler: sie zu ermorden. Der zweite Fehler: ihn entkommen zu lassen.
John Puller ist der beste Ermittler der Militärpolizei. Sein neuer Fall trifft ihn persönlich: Seine geliebte Tante deutet in einem Brief dubiose Machenschaften in ihrem Heimatort an. Sofort macht sich Puller auf den Weg zu ihr nach Paradise, Florida – und findet sie leblos auf, ertrunken. Anders als die Polizei vor Ort mag Puller nicht an einen Unfall glauben. Und tatsächlich häufen sich bald die Hinweise auf ein Verbrechen von gigantischen Ausmaßen.
Die kompliziertesten Fälle vertraut das US-Militär stets seinem profiliertesten Spezialermittler an, John Puller. Doch diesmal ist Puller persönlich betroff en: Seine Tante, die im bilderbuchschönen Paradise, Florida, lebt, schreibt in einem Brief, dass hinter der blitzblanken Fassade ihres Heimatortes Schreckliches geschieht. Puller reist sofort an, um Näheres zu erfahren – und findet seine Tante tot auf. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, Puller aber ist überzeugt davon, dass seine Tante gewaltsam zum Schweigen gebracht wurde. Er beginnt in Paradise zu ermitteln und findet bald Hinweise auf ein gewaltiges Verbrechen.
Immer wieder kreuzen sich seine Wege dabei mit denen eines hünenhaften Mannes, der offensichtlich auch in die Machenschaften verstrickt ist. Hält er den Schlüssel zu dem grauenhaften Geheimnis in der Hand?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
Die kompliziertesten Fälle vertraut das US-Militär stets seinem profiliertesten Spezialermittler an, John Puller. Doch diesmal ist Puller persönlich betroffen: Seine Tante Betsy, die im wunderhübschen Paradise, Florida, lebt, schreibt in einem Brief, dass hinter der blitzblanken Fassade ihres Heimatortes Schlimmes geschieht, und bittet um Hilfe. Puller stand ihr stets sehr nahe, in seiner Jugend hat sie ihm die Mutter ersetzt. Sofort reist er an, um Näheres zu erfahren – und findet Betsy tot auf. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, Puller aber ist überzeugt davon, dass seine Tante gewaltsam zum Schweigen gebracht wurde. Gegen den expliziten Willen der örtlichen Behörden beginnt er in Paradise zu ermitteln. Und tatsächlich findet er bald Hinweise auf ein gewaltiges Verbrechen.
Immer wieder kreuzen sich seine Wege dabei mit denen eines hünenhaften Mannes, der offensichtlich auch in die Machenschaften verstrickt ist. Hält er den Schlüssel zum Geheimnis von Paradise in der Hand?
Zum Autor
David Baldacci, geboren 1960 in Virginia, arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist in Washington, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sämtliche Thriller von ihm landeten auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern in 80 Ländern zählt er zu den weltweit beliebtesten Autoren. Zuletzt im Heyne Verlag erschienen ist der erste Band der Serie um John Puller: Zero Day.
David Baldacci
AM LIMIT
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Forgotten bei Grand Central Publishing / Hachette Book Group Inc., New York
Copyright © 2012 by Columbus Rose, Ltd.
Copyright © 2015 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Fotos von shutterstock/ostill
Redaktion: Wolfgang Neuhaus
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-13974-2 V004
www.heyne-verlag.de
Für Tante Peggy, ein Engel auf Erden,
falls es je einen gab.
1
Er sah aus wie ein Mann, der befürchtete, dass bald sein letztes Stündchen schlagen würde.
Er hatte guten Grund für diese Annahme. Die Aussichten, dass es tatsächlich sein letzter Abend auf Erden war, lagen bei fünfzig zu fünfzig. Je nachdem wie die nächste Stunde verlief, standen seine Chancen vielleicht noch schlechter, so gering war der Spielraum für Fehler.
Das Röhren der zwei Motoren, die das Boot mit nahezu vollem Schub vorantrieben, verscheuchte die nächtliche Stille über dem Meer. Zu dieser Jahreszeit ging es auf dem Golf von Mexiko normalerweise nicht so ruhig und friedlich zu, denn die Hochphase der Hurrikan-Saison war angebrochen. Doch bisher hatte keiner der zahlreichen Stürme, die sich auf dem Atlantik zusammenbrauten, ein beständiges Zentrum gebildet und war zum Golf vorgestoßen. Sämtliche Küstenbewohner drückten die Daumen und hofften, dass es so blieb.
Der Fiberglas-Rumpf durchschnitt das dunkle Wasser wie eine scharfe Klinge. Das Boot konnte zwanzig Passagiere aufnehmen, aber dreißig waren an Bord. Sie hielten sich verzweifelt an allem fest, was sie zwischen die Finger bekamen, um nicht über Bord zu gehen. Ein hoffnungslos überladenes Boot, das mit einer Geschwindigkeit im Grenzbereich dahinjagte, war auch auf ruhiger See unberechenbar.
Dem Captain war das Wohlbefinden seiner menschlichen Fracht herzlich gleichgültig. Ihm ging es vor allem um das eigene Überleben. Eine Hand auf dem Steuerrad, die andere am Gashebel, warf er einen besorgten Blick auf den Geschwindigkeitsanzeiger.
Komm schon, du schaffst das!, machte er sich Mut. Du kriegst das hin!
Vierzig Knoten die Stunde, gut siebzig Stundenkilometer. Er schob den Gashebel vor, erhöhte das Tempo langsam auf fünfundvierzig, näherte sich der absoluten Höchstgeschwindigkeit. Selbst mit den zwei Heckmotoren würde er kaum schneller fahren können, ohne den Benzintank vorzeitig zu leeren. Und hier gab es keine Jachthäfen, in denen man nachtanken konnte.
Trotz des Fahrtwinds war es heiß hier draußen. Wenigstens musste man sich keine Sorgen um Moskitos machen – nicht bei dieser Geschwindigkeit und so weit vom Land entfernt.
Der Captain ließ den Blick über die Passagiere schweifen und zählte rasch die Köpfe, obwohl er die Zahl bereits kannte. Er hatte vier bewaffnete Leute dabei, die die menschliche Fracht im Auge behielten. Bei einer Meuterei wäre das Zahlenverhältnis fünf zu eins zugunsten der Passagiere, aber die hatten keine Maschinenpistolen. Ein einziges Magazin könnte sie alle ins Jenseits befördern, und es wäre immer noch Munition übrig. Außerdem handelte es sich vor allem um Frauen und Kinder, weil die am gefragtesten waren.
Nein, der Captain machte sich keine Sorgen um eine Meuterei.
Er machte sich Sorgen über den Zeitplan.
Er schaute auf das beleuchtete Ziffernblatt seiner Uhr. Es wurde knapp, so viel stand fest. Sie hatten den letzten Außenposten spät verlassen. Dann hatte ihr Bootsnavi dreißig nervenaufreibende Minuten lang verrücktgespielt und sie in die falsche Richtung geschickt. Der Golf von Mexiko war verdammt groß und sah fast überall gleich aus. Nirgends eine Landmarke, die bei der Navigation helfen konnte. Außerdem befuhren sie Schifffahrtswege fernab der großen Routen. Ohne ihren elektronischen Navigator waren sie aufgeschmissen. Genauso gut hätten sie ein Flugzeug ohne Instrumente durch dichten Nebel fliegen können. Das konnte nur in einer Katastrophe enden.
Aber sie hatten den Plotter wieder hinbekommen und den Kurs korrigiert. Der Captain hatte sofort vollen Schub auf beide Motoren gegeben und dann noch eine Schippe draufgelegt, bis an die Belastungsgrenze. Nun huschte sein Blick immer wieder zum Armaturenbrett: Öltemperatur, Treibstoffreserve, Temperaturanzeige. Eine Panne hier draußen bedeutete das Ende. Die Küstenwache konnten sie schwerlich um Beistand bitten.
Der Captain schaute auf die roten und grünen Navigationslichter am Bug, die einzigen Farbtupfer in der schwarzen, mondlosen Nacht. Dann blickte er zum Himmel, hielt Ausschau nach elektronischen Beobachtern, die sein Boot ausspähten und eine Flut digitaler Daten an irgendeine ferne Zentrale schickten. Die Eingreiftruppe, die darauf reagierte, würden er und seine Leute erst hören, wenn es zu spät war: Die Schnellboote der Küstenwache würden sie in die Zange nehmen, entern und sofort wissen, was hier ablief. Und dann würde er viel Zeit im Knast verbringen, vielleicht den Rest seines Lebens.
Aber die Küstenwache war nicht sein größtes Problem. Es gab andere Leute, die ihm wirklich Angst einjagten.
Der Captain erhöhte die Geschwindigkeit auf fast fünfzig Knoten und sprach ein stummes Gebet, dass ihm die Motoren nicht um die Ohren flogen. Noch ein Blick auf die Uhr. Dann schaute er wieder nach vorn auf die Wasseroberfläche, die unter dem Boot dahinhuschte, während er stumm die Minuten zählte.
»Sie werden mich den Haien zum Fraß vorwerfen«, stieß er hervor.
Nicht zum ersten Mal bedauerte er, sich auf dieses riskante Geschäft eingelassen zu haben. Aber er kassierte so viel bei der Sache, dass er nicht hatte Nein sagen können, trotz des Risikos. Außerdem hatte er bereits fünfzehn solche Fahrten gemacht. Noch einmal so viele, und er konnte sich auf einen schönen ruhigen Landsitz auf den Florida Keys zurückziehen und wie ein König leben – was viel erstrebenswerter war, als mit bleichen Touristen aus dem Norden aufs Meer zu schippern, die einen Thunfisch oder Marlin angeln wollten, bei rauer See aber nur sein Boot vollkotzten.
Aber erst muss ich diese Fuhre ans Ziel bringen.
Lautlos zählte der Captain weitere Minuten ab, wobei er immer wieder einen Blick auf die Armaturen warf.
Scheiße!
Der Treibstoff ging zur Neige. Die Anzeige näherte sich bedenklich der Reserve. Der Captain fühlte, wie sein Magen sich verkrampfte. Sie hatten zu viel Gewicht. Und das Problem mit dem Navigationssystem hatte sie eine Stunde Zeit, viele Seemeilen und wertvollen Treibstoff gekostet. Trotz einer stillen Reserve von zehn Prozent, die der Captain jedes Mal drauflegte, um sicherzugehen, reichte es wahrscheinlich nicht.
Wieder ein Blick auf die Fracht. Die meisten waren Frauen und Teenager, aber es waren auch stämmige Männer darunter, jeder gut zwei Zentner schwer. Und einer war ein wahrer Riese. Aber ein paar von ihnen über Bord zu werfen, um das Treibstoffproblem zu lösen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Genauso gut hätte er sich die Maschinenpistole an den Kopf halten und abdrücken können.
Der Captain überschlug noch einmal die Berechnungen wie ein Flugzeugpilot die Frachtliste. Letztendlich war es dieselbe Frage, egal, ob man auf dem Wasser fuhr oder 10.000 Meter darüber flog.
Reicht der Treibstoff, um ans Ziel zu kommen?
Der Captain bemerkte, dass einer seiner Männer ihn beobachtete, und winkte ihn zu sich. Der Mann hörte sich an, was der Captain zu sagen hatte, und meinte: »Das wird knapp.«
»Ja, verdammt. Und wir können nicht einfach Leute über Bord werfen«, sagte der Captain.
»Stimmt. Die Auftraggeber haben die Liste. Wenn wir Leute über Bord werfen, können wir gleich hinterherspringen.«
»Ach? Erzähl mir lieber mal was Neues!«, fuhr der Captain ihn an.
Dann traf er eine Entscheidung und verringerte den Schub. Die beiden Schrauben drehten sich geringfügig langsamer, die Geschwindigkeit ging auf vierzig Meilen zurück. Aber damit war das Boot noch immer sehr schnell; auf dem Wasser gab es für das bloße Auge kaum einen Unterschied zwischen vierzig und siebenundvierzig Meilen. Aber das war nicht der Punkt, sondern der geringere Treibstoffverbrauch. Der konnte den Ausschlag geben, ob sie es schafften oder nicht. Waren sie erst am Ziel, konnte sie auftanken, und die Rückfahrt mit nur fünf Mann an Bord stellte kein Problem mehr dar.
»Lieber ein bisschen später ankommen als gar nicht«, sagte der Captain.
Doch seine Worte klangen hohl, was dem anderen Mann nicht entging. Er umklammerte seine Waffe fester.
Der Captain wandte den Blick ab. Angst überkam ihn, schnürte ihm die Kehle zu. Für die Leute, die er belieferte, war das Timing entscheidend. Zu spät zu kommen, selbst wenn es nur ein paar Minuten waren, konnte schlimme Folgen haben. Sehr schlimme Folgen. In diesem Fall war nicht einmal die riesige Gewinnspanne das Risiko wert. Schließlich konnten Tote kein Geld mehr ausgeben.
Als eine halbe Stunde später die Motoren zu stottern begannen, weil sie Luft statt Treibstoff einsogen, sah der Captain sein Ziel vor sich. Wie der gigantische Thron eines Meeresgottes ragte es in den düsteren Himmel.
Wir sind da.
Ziemlich verspätet, aber sie hatten es geschafft.
Die Passagiere starrten mit großen Augen auf das stählerne Ungetüm, das vor ihnen aufragte. Obwohl es nicht das erste Gebilde dieser Art war, das sie zu Gesicht bekamen, war es ein monströser Anblick, besonders bei Nacht. Sogar dem Captain jagte es noch immer Angst ein, trotz der vielen Fahrten, die er bereits unternommen hatte. Er würde schnellstens seine Ladung absetzen, auftanken und dann nichts wie weg, Richtung Heimat. Sobald seine menschliche Fracht von Bord war, war sie nicht mehr sein Problem.
Er nahm den Schub zurück und legte vorsichtig an einer Metallplattform an, die mit der riesigen Konstruktion verbunden war. Nachdem die Seile gesichert waren, griffen Hände ins Boot und zogen die Passagiere auf die Plattform, die leicht auf und ab schaukelte.
Der Captain ließ den Blick schweifen.
Seltsam.
Das größere Schiff, das normalerweise wartete, um Männer, Frauen und Kinder an Bord zu nehmen, war nirgends zu sehen. Es musste bereits mit einer anderen Fuhre aufgebrochen sein.
Nachdem der Captain mehrere Papiere unterschrieben und sein Geld in Gestalt eingeschweißter Plastikbündel kassiert hatte, warf er einen letzten Blick auf die Passagiere, die eine lange Stiege hinaufgetrieben wurden. Sie wirkten verschreckt und verängstigt.
Sie haben auch allen Grund dazu, ging es dem Captain durch den Kopf. Die armen Schweine wissen genau, was mit ihnen geschieht und dass kein Mensch sich für sie interessiert.
Sie waren nicht reich.
Sie waren nicht mächtig.
Sie waren die Vergessenen.
Ihre Zahl wuchs exponentiell, während die Welt immer schneller und selbstverständlicher akzeptierte, dass es auf der einen Seite die Reichen und Mächtigen gab, auf der anderen Seite den großen Rest. Und die Mächtigen bekamen fast immer, was sie wollten.
Als der Captain eines der Plastikbündel öffnete, erstarrte er. Er begriff nicht sofort, was er sah. Als ihm klar wurde, dass er kein Geld in der Hand hielt, sondern Zeitungspapier, hob er den Blick.
Die Mündung der Maschinenpistole war direkt auf ihn gerichtet, keine drei Meter entfernt, gehalten von einem Mann, der auf Neptuns Thron stand. Auf so kurze Entfernung war eine MP eine mörderische Waffe.
Wie sich Augenblicke später zeigte.
Dem Captain blieb noch die Zeit, die Hand zu heben, als könnten Fleisch und Knochen die Geschosse abwehren, die schneller auf ihn zukamen, als ein Jumbojet fliegen konnte. Sie trafen ihn mit fürchterlicher Wucht. Zwanzig Salven schlugen fast zur gleichen Zeit in seinen Körper ein und zerfetzten ihn.
Die Wucht des Kugelhagels riss ihn von den Füßen und schleuderte ihn über das Schandeck. Bevor er in den Wellen versank, gesellten seine vier Männer sich zu ihm. Das, was von ihnen übrig war. Ihre zerfleischten Körper verschwanden in den schwarzen Tiefen, ein Festmahl für die Haie.
Manchmal war Pünktlichkeit nicht nur eine Tugend, sondern eine Frage von Leben und Tod.
2
Treibstoff, Öl und Wasser wurden aus dem Boot abgepumpt. Dann wurde es versenkt, damit sich kein Ölfilm auf der Wasseroberfläche bildete, den Patrouillenflugzeuge der Küstenwache und der Drogenfahndung bemerken könnten.
Tagsüber sah die verlassene Bohrinsel einfach … nun ja, verlassen aus. Von dem menschlichen Vieh war nichts zu sehen. Sie befanden sich allesamt im Hauptgebäude, sorgfältig abgeschirmt vor allen Blicken. Frische Lebensmittel wurden nur nachts gebracht. Tagsüber kamen sämtliche Aktivitäten zum Erliegen. Das Risiko, gesehen zu werden, war einfach zu groß.
Es gab Tausende verlassener Bohrinseln im Golf, die auf den Abriss oder die Umwandlung in künstliche Riffe warteten. Obwohl die Gesetze vorschrieben, dass der Abriss oder die Umwandlung binnen eines Jahres nach Aufgabe der Bohrinsel stattfinden mussten, verstrich in den meisten Fällen wesentlich mehr Zeit. Bis dahin standen die Plattformen – groß genug, um Hunderte von Menschen zu beherbergen – einsam auf hoher See und konnten von profitgierigen Kriminellen genutzt werden, die Landestellen brauchten, um ihre kostbare Fracht übers Meer zu transportieren.
Während das Boot langsam in den Tiefen des Golfs versank, wurde seine menschliche Fracht steile Treppen hinaufgescheucht. Man hatte die Leute im Abstand von dreißig Zentimetern aneinandergefesselt. Die Jungen hatten Schwierigkeiten, mit den Erwachsenen Schritt zu halten. Stürzten sie, stieß man sie zurück in die Reihe und schlug sie auf Schultern und Arme. Mit äußerster Sorgfalt achteten die Peiniger darauf, nicht die Gesichter der Gefangenen zu treffen.
Ein Mann war wesentlich größer als seine Leidensgefährten. Beim Marsch die Stahltreppen hinauf hielt er den Blick starr auf den Boden gerichtet. Er war über zwei Meter groß, mit breiten Schultern, schmalen Hüften und harten, sehnigen Muskeln. Ober- und Unterschenkel waren kräftig wie die eines Profisportlers, und er hatte das abgezehrte Gesicht eines Menschen, der in seiner Jugend hatte hungern müssen. Der Mann würde einen guten Preis erzielen, auch wenn die Mädchen aus naheliegenden Gründen mehr einbrachten. Schließlich zählte allein der Profit, und mit den Mädchen, vor allem mit den jüngeren, ließ sich das meiste Geld machen – mindestens zehn Jahre lang. In dieser Zeit würden sie ihren Besitzern Millionen Dollar einbringen.
Das Leben des hünenhaften Mannes würde vergleichsweise kurz sein. Er würde sich buchstäblich zu Tode schuften müssen. Zumindest glaubten das seine Entführer. Deshalb hatte man ihn als Ware mit geringer Gewinnspanne eingestuft. Die Mädchen hingegen bezeichnete man als »Gold«.
Der Hüne schien vor sich hin zu murmeln, aber niemand in seiner Umgebung konnte die Sprache verstehen. Er verfehlte eine Stufe, stolperte. Sofort droschen die Bewacher mit Schlagstöcken auf seine Schultern und Beine ein. Ein Hieb traf sein Gesicht. Blut spritzte ihm aus der Nase. Das Aussehen des riesenhaften Mannes war den Bewachern offensichtlich egal.
Der Hüne rappelte sich auf, ging weiter, murmelte wieder vor sich hin. Die Schläge schienen ihm nichts auszumachen.
Direkt vor ihm ging ein junges Mädchen. Sie hatte rasch über die Schulter geschaut, doch der hünenhafte Mann hatte ihren Blick nicht erwidert. Die ältere Frau, die hinter ihm ging, schüttelte den Kopf, flüsterte ein Gebet in Spanisch, ihrer Muttersprache, und bekreuzigte sich.
Wieder stolperte der Mann, wieder hagelte es Schläge. Die Wächter brüllten ihn an, schlugen mit ihren rauen Händen auf ihn ein. Erneut ließ der Riese die Bestrafung über sich ergehen, kämpfte sich hoch, ging weiter. Und murmelte wieder vor sich hin.
Eine Sekunde lang erhellte ein Blitz den Himmel im Osten. Ob der Mann das grelle Licht als göttliche Aufforderung zum Handeln betrachtete, war unmöglich zu sagen. Doch was er vorhatte, war unmissverständlich.
Er stieß einen Wächter mit solcher Kraft zur Seite, dass der Mann übers Geländer kippte und drei Meter tief auf die Stahlplattform stürzte. Beim Aufprall brach er sich das Genick.
Unbemerkt hatte der Hüne sich das Messer aus dem Gürtel des Wächters geschnappt. Nur deshalb hatte er ihn angegriffen. Ehe die anderen Wächter ihre Waffen hochreißen konnten, hatte der Mann schon seine Fesseln durchtrennt und sich eine Schwimmweste geschnappt, die am Treppengeländer von einem Haken hing. Er schlüpfte hinein und sprang gegenüber von der Stelle, wo der Wächter abgestürzt war, in die Tiefe.
Er landete nicht auf hartem Stahl, sondern tauchte in das warme Wasser des Golfs.
Sekunden später zerfetzten mehrere Salven MP5-Geschosse die Wasseroberfläche und verursachten Hunderte winziger Schaumkronen. Ein paar Minuten später machte sich ein Boot auf die Suche nach dem Mann, aber der war spurlos verschwunden. In der Dunkelheit konnte er in jede Richtung geschwommen sein, und die Fläche, die abgesucht werden musste, war riesig.
Schließlich kehrte das Boot zurück. Das Wasser des Golfs beruhigte sich wieder.
Die Verfolger gingen davon aus, dass der Mann tot war.
Wenn nicht, würde er es bald sein.
Das menschliche Vieh, jetzt nur noch vierundzwanzig Stück, trotte weiter zu den Zellen, in die man sie einsperren würde, bis ein anderes Boot sie abholte. Jeweils zu fünft steckte man sie in einen Käfig zu anderen Verlorenen, die ebenfalls auf die Fahrt zum Festland warteten. Auch sie waren Ausländer, Männer und Frauen sämtlicher Altersstufen, allesamt arm oder Außenseiter der Gesellschaft. Manche waren gezielt ausgesucht und gejagt worden, andere hatten einfach nur Pech gehabt, dass sie jetzt hier waren.
Aber hier auf der Bohrinsel, das war erst der Anfang. Es würde noch viel schlimmer kommen, wenn sie diesen Ort verließen.
Die Wächter, auch sie größtenteils Ausländer, nahmen niemals Blickkontakt zu dem menschlichen Vieh auf. Sie nahmen nicht einmal deren Existenz zur Kenntnis, abgesehen von den kurzen Augenblicken, wenn sie ihnen Teller mit Essen und Wasserkanister in die Käfige schoben. Die Gefangenen waren namenlose Gegenstände, die eine Zeit lang im Golf von Mexiko trieben.
Sie hockten sich hin. Einige starrten zwischen den Gitterstäben der Käfige hindurch, die meisten aber hielten den Blick zu Boden gerichtet. Sie hatten resigniert, wollten sich nicht mehr wehren oder einen Weg in die Freiheit finden. Sie schienen ihr Schicksal akzeptiert zu haben.
Die ältere Frau, die hinter dem Hünen gegangen war, schaute sporadisch nach unten zur Oberfläche des Meeres. Aus dem eingeschränkten Blickwinkel ihres engen Gefängnisses hätte sie unmöglich etwas im Wasser wahrnehmen können, doch ein-, zweimal glaubte sie, etwas gesehen zu haben, tat es dann aber als Einbildung ab.
Als Essen und Wasser kamen, aß und trank sie die kleine Ration, die man ihr zugeteilt hatte. Dabei dachte sie über den riesigen Mann nach, der den Fluchtversuch gewagt hatte. Im Stillen bewunderte sie seinen Mut, auch wenn er ihn das Leben gekostet hatte. Wenigstens war er frei. Der Tod war viel besser als das, was sie erwartete.
Ja, vielleicht hat er wirklich Glück gehabt, dachte die Frau, steckte sich ein Stück Brot in den Mund und trank einen Schluck von dem warmen Wasser im Plastikbecher.
Und vergaß den Mann.
Der Hüne schwamm eine halbe Meile von Neptuns Thron entfernt durch den nächtlichen Golf. Er schaute zurück in Richtung der Bohrinsel, die für ihn längst unsichtbar geworden war. Er hatte gar nicht vorgehabt, eine so lange Strecke bis zur Küste zu schwimmen. Ursprünglich hatte er ein Flugzeug von Texas nach Florida nehmen wollen. Sein derzeitiges Dilemma war das Ergebnis unvorsichtigen Verhaltens, das ihn zum Opfer gemacht hatte.
Aber er musste aufs Festland, also blieb ihm keine Wahl, als zu schwimmen.
Er rückte die Schwimmweste zurecht, die viel zu klein für ihn war, aber für den nötigen Auftrieb sorgte. Dabei trat er Wasser und versuchte, sich so wenig wie möglich zu bewegen, um Kräfte zu sparen. Dann drehte er sich um und ließ sich auf dem Rücken treiben, denn mit der Dunkelheit kamen die Haie; jede Bewegung lockte sie an. Aber irgendwann würde er schwimmen müssen. Und trotz der Gefahr durch die Haie war die Nacht die beste Zeit dafür. Das Tageslicht würde ihn noch mehr Gefahren aussetzen, die größtenteils von Menschen verursacht wurden.
Er blickte zum Himmel, orientierte sich am Stand der Sterne und schlug den Weg zum Festland ein. Hin und wieder blickte er zurück in die Richtung, in der sich die Bohrinsel befand. Er versuchte, sich ihre Position in der Weite des Golfs einzuprägen. Es war unwahrscheinlich, aber vielleicht musste er sie eines Tages wiederfinden.
Seine Schwimmstöße waren kräftig und scheinbar mühelos. Durch den Auftrieb der Weste konnte er dieses Tempo stundenlang halten. Das musste er auch, wollte er sein Ziel erreichen. Und das hatte er vor, denn er hatte beschlossen, eine potenzielle Katastrophe in einen Vorteil zu verwandeln.
Er würde dieselbe Richtung einschlagen, in die ihn zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes Schnellboot gebracht hätte. Vielleicht würde er vor seinen Mitgefangenen an ihrem Zielort eintreffen – vorausgesetzt, die Haie machten ihm keinen Strich durch die Rechnung, indem sie ihm die Beine abrissen und ihn verbluten ließen, einsam und allein in der nächtlichen Weite des Golfs.
Mit der Zeit wurden seine Schwimmstöße zu einer Art Reflex – eine Bewegung, die ganz von selbst erfolgte, sodass er die Gedanken auf andere Dinge richten konnte. Das Schwimmen würde eine lange, kräftezehrende und gefahrvolle Angelegenheit sein. Auf jedem Meter konnte der Tod lauern. Aber er hatte Schlimmeres überlebt. Er musste hoffen, dass es auch diesmal reichte.
Bisher hatte es in seinem Leben, das mehr von Tragödien und Schmerzen geprägt war als von Normalität, noch jedes Mal gekappt. Wenn es diesmal nicht klappte, hatte er eben Pech gehabt.
Stoisch akzeptierte er sein Schicksal.
Und schwamm weiter.
3
Die alte Frau war hochgewachsen, doch während der letzten zehn Jahre hatte ihre Wirbelsäule sich gekrümmt, was sie sechs Zentimeter Körpergröße gekostet hatte. Das Haar trug sie kurz geschnitten, was ihrem Gesicht einen strengen Ausdruck verlieh – ein Gesicht, in dem sechsundachtzig Lebensjahre, zwanzig davon an der heißen Küste Floridas, ihre Spuren hinterlassen hatten.
Die Frau bewegte sich mithilfe eines Gehgestells voran. Zwei Tennisbälle, über die beiden Vorderbeine gestülpt, sorgten für zusätzliche Stabilität. Ihre großen Hände umklammerten die Gummigriffe. Über der Schulter hing ihre Handtasche. Groß und voluminös, drückte sie gegen den Körper der Frau. Ihre Schritte waren zielstrebig, der Blick unverwandt nach vorn gerichtet, was ihr einen Ausdruck der Entschlossenheit verlieh.
Auf der Straße machten die Leute ihr freiwillig Platz. Einige belächelten die vermeintlich schrullige alte Dame, die sicher ein bisschen verrückt war und der es bestimmt nichts bedeutete, was andere über sie dachten.
Tatsächlich war es der Frau völlig egal, was andere über sie dachten.
Und sie war alles andere als verrückt.
Ihr Ziel war nun direkt vor ihr. Ein Briefkasten. Sie stellte das Gehgestell davor ab und stützte sich mit der freien Hand gegen das stabile Eigentum der Post der Vereinigten Staaten. Mit der anderen Hand griff sie in die Tasche und zog einen Brief hervor. Ein letztes Mal schaute sie auf die Adresse.
Sie hatte viel Zeit in diesen Brief investiert. Die junge Generation mit ihren Tweets und Facebook, den SMS und E-Mails, für die es weder richtiger Grammatik noch vernünftiger Worte bedurfte, würde nie verstehen, dass man sich für einen handgeschriebenen Brief Zeit nehmen musste. Zumal wenn es um außergewöhnliche Dinge ging, wie in ihrem Fall.
Der Name des Adressaten war in Druckbuchstaben geschrieben, damit er so gut wie möglich zu lesen war. Auf diese Weise wollte die alte Frau sichergehen, dass der Brief sein Ziel nicht verfehlte:
General John Puller sen. (i.R.)
Sie schickte ihn an das Veteranenkrankenhaus, das seit längerer Zeit sein Zuhause war. Mit seiner Gesundheit stand es nicht zum Besten, wie die alte Dame wusste, aber sie wusste auch, dass er ein Mann war, der sich durchzuschlagen verstand, sonst hätte er es beim Militär nicht so weit gebracht.
Er war ihr Bruder. Ihr jüngerer Bruder.
Große Schwestern waren für ihre kleinen Brüder immer etwas Besonderes. In ihrer gemeinsamen Kindheit hatte John sich jede erdenkliche Mühe gegeben, ihr, Betsy, das Leben zur Hölle zu machen. Er hatte ihr eine endlose Reihe böser Streiche gespielt, hatte sie vor ihren Freundinnen lächerlich gemacht und mit ihr um die Liebe ihrer Eltern konkurriert. Doch je größer sie beide geworden waren, umso mehr hatte es sich ins Gegenteil verkehrt, wollte John die Boshaftigkeiten gegenüber seiner älteren Schwester wettmachen.
Betsy konnte sich darauf verlassen, dass John auch diese Sache regelte. Und was noch viel wichtiger war – er hatte einen Sohn, ihren Neffen, der sich ausgesprochen gut darauf verstand, Dingen auf den Grund zu gehen. Bestimmt würde dieser Brief den Weg in seine Hände finden. Betsy hoffte, dass er nach Paradise kam. Es war lange her, seit sie ihren Neffen das letzte Mal gesehen hatte, viel zu lange.
Betsy öffnete die Klappe des Briefkastens und beobachtete, wie der Brief in den Metallschacht rutschte. Sie schloss die Klappe und öffnete sie dann noch zweimal, um sicherzugehen, dass der Brief tatsächlich unten im Kasten lag.
Schließlich drehte sie das Gehgestell herum und trat den Rückweg zum Taxistand an. Ihr Lieblingstaxifahrer hatte sie an ihrem Haus abgeholt und würde sie jetzt zurückfahren. Sie konnte zwar noch selbst fahren, hatte heute Abend aber darauf verzichtet.
Der Briefkasten stand am Ende einer Einbahnstraße. Für den Taxifahrer war es einfacher gewesen, dort zu parken und Betsy das kurze Stück zum Briefkasten zu Fuß gehen zu lassen. Natürlich hatte er sich angeboten, den Brief für sie einzuwerfen, aber sie hatte abgelehnt. Nein, das musste sie selbst erledigen. Außerdem hatte sie die Bewegung gebraucht.
Der Fahrer war viel jünger als sie, erst Ende fünfzig. Er trug eine altmodische Chauffeurskappe, aber der Rest seiner Kleidung war ausgesprochen leger: khakifarbene Shorts, blaues Polohemd, Segeltuchschuhe. Seine Haut war so dunkel, dass sie aussah wie nach endlosen Stunden auf der Sonnenbank oder wie in einer Reklame für ein Bräunungsmittel.
»Vielen Dank, Jerry«, sagte Betsy, als sie nun mit seiner Hilfe auf die Rückbank stieg. Jerry klappte das Gehgestell zusammen und lud ihn in den Kofferraum, bevor er einstieg.
»Alles in Ordnung, Mrs. Simon?«
»Ich hoffe es«, erwiderte sie. Zum ersten Mal sah sie nervös aus und fühlte sich auch so.
»Möchten Sie jetzt nach Hause?«
»Ja, bitte. Ich bin müde.«
Jerry drehte sich im Sitz um und musterte sie. »Sie sehen blass aus. Vielleicht sollten Sie mal zum Arzt gehen. Davon gibt’s in Florida ja mehr als genug.«
»Vielleicht tue ich das. Aber jetzt nicht. Ich brauche nur ein bisschen Ruhe.«
Jerry fuhr die alte Dame zurück zu ihrer kleinen Wohnsiedlung am Strand, die den wenig originellen Namen »Sunset by the Sea« trug, »Sonnenuntergang am Meer«.
Der Fahrer brachte sie bis vor ihr Haus in der Orion Street und führte sie dann zur Tür. Das Haus war typisch für diesen Teil Floridas, ein zweistöckiges Gebäude aus beige verputzten Betonziegeln mit einem roten Terrakottadach und einer Garage, die Platz für zwei Wagen bot. Das zweihundertneunzig Quadratmeter große Haus verfügte über drei Schlafzimmer; das von Betsy lag direkt neben der Küche. Eigentlich war das Haus viel zu groß für sie, aber sie wollte nicht ausziehen. Es würde ihr letztes Zuhause sein, das wusste sie schon seit langer Zeit.
Auf einem kleinen Rasen vor dem Haus stand eine Palme inmitten von Ziersteinen. Hinter dem Gebäude grenzte ein Zaun das Grundstück ein, außerdem gab es einen kleinen Gartenbrunnen und eine Bank mit einem Tisch, an dem Betsy Kaffee trinken und den kühlen Morgen oder die letzten Strahlen des Abendsonne genießen konnte. Zu beiden Seiten standen Häuser, die sich kaum voneinander unterschieden. Sunset by the Sea war in allem ziemlich gleich, als hätte der Bauherr eine große Maschine benutzt, die Häuser am Fließband ausspuckte, sodass man sie überall in den Vereinigten Staaten einfach in die Landschaft stellen konnte.
Ein Stück hinter Betsys Haus lag das Meer. Es war nur eine kurze Fahrt oder ein längerer Spaziergang bis zum weißen Sand der Emerald Coast.
Es war Sommer. Um achtzehn Uhr herrschten hier noch über zwanzig Grad – immerhin zehn Grad weniger als zur Mittagszeit, was für Paradise, Florida, der Normalzustand war.
Paradise, dachte Betsy. Ein alberner Name. Dennoch traf er die Sache ziemlich genau. Die meiste Zeit war es hier wunderschön. Und Betsy zog Wärme jederzeit der Kälte vor. Wer tat das nicht? Vermutlich hatte man Florida deshalb erfunden. Und Paradise erst recht. Das war auch der Grund, dass die Kokser jeden Winter in Scharen hierherkamen.
Betsy setzte sich ins Wohnzimmer und betrachtete die Erinnerungen eines ganzen Lebens. An den Wänden und auf Regalbrettern waren Fotos von Freunden und Familie. Am längsten verharrte ihr Blick auf einem Bild ihres Mannes. Sie hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Lloyd verliebt. Er war der geborene Verkäufer gewesen. Vermutlich hatte er sich auch ihr, Betsy, bestens verkauft. Er hatte sich immer viel erfolgreicher dargestellt, als er in Wirklichkeit war. Er war ein guter Verkäufer gewesen, ohne Zweifel, aber ein noch besserer Geldverschwender, wie Betsy hatte herausfinden müssen. Aber er war witzig, brachte sie zum Lachen, hatte keine gewalttätige Ader und trank nicht übermäßig.
Und er hatte sie geliebt. Soweit Betsy wusste, hatte Lloyd sie nie betrogen, obwohl er in seinem Job ständig auf Reisen war, sodass sich ihm bestimmt zahlreiche Gelegenheiten geboten hatten, das Ehegelöbnis zu vergessen.
Sie vermisste ihren Lloyd.
Erst nach seinem Tod hatte Betsy erfahren, dass er eine Lebensversicherung in beträchtlicher Höhe laufen hatte. Sie hatte das Geld in die Aktien zweier Unternehmen investiert, Apple und Amazon – die beiden A auf ihrem Auszug, wie Betsy sie gern nannte. Die Investition hatte ihr genug eingebracht, um die Hypothek auszulösen und sich mit viel mehr Geld, als die Rentenversicherung allein ihr gebracht hätte, ein schönes Leben zu ermöglichen.
Betsy bereitete sich einen Eistee und eine leichte Mahlzeit zu. Ihr Appetit war auch nicht mehr, was er mal gewesen war. Dann sah sie fern und schlief vor dem Gerät ein. Als sie erwachte, war sie einen Augenblick lang desorientiert und schüttelte den Kopf, um ihn freizubekommen.
Zeit fürs Bett, sagte sie sich.
Mithilfe ihres Gehgestells stemmte sie sich hoch und schlurfte in Richtung Schlafzimmer. Sie würde sich noch ein paar Stunden aufs Ohr legen und dann aufstehen, um mit dem neuen Tag wieder von vorn anzufangen. Das war jetzt ihr Leben.
In diesem Moment bemerkte sie eine schattenhafte Bewegung hinter sich, hatte aber keine Gelegenheit mehr, sich bedroht zu fühlen.
Es war Betsy Puller Simons letzte Wahrnehmung auf Erden.
Der Schatten, der hinter ihr aufragte.
Wenige Minuten später war in ihrem Garten ein lautes Platschen zu hören.
4
Das Timing hätte nicht besser sein können. Ein paar letzte Schwimmstöße, und der riesenhafte Mann spürte festen Boden unter den Füßen.
Er hatte Glück gehabt. Zwei Stunden nach der Flucht von der Bohrinsel hatte ihn ein kleines Fischerboot aus dem Wasser geholt. Die Fischer hatten keine Fragen gestellt. Sie gaben ihm zu essen und zu trinken und nannten ihm ihre Position. Indem er den Kurs zurückverfolgte, bekam der Riese eine bessere Vorstellung vom Standort der Bohrinsel draußen im Golf. Er konnte die Gefangenen dort nicht vergessen. Sie würden verschwunden sein, bevor er dorthin zurückkehren konnte, aber andere würden ihren Platz einnehmen.
Das Fischerboot fuhr zuerst weiter aufs Meer; schließlich konnten die Fischer nicht alles stehen und liegen lassen, um den Schiffbrüchigen auf kürzestem Weg zu seinem Ziel zu bringen.
Auf der Fahrt half der Hüne den Männern bei der Arbeit, um sich wenigstens ein bisschen für ihre Hilfe erkenntlich zu zeigen. Die Fischer staunten über seine Kraft und schienen ihn ungern gehen zu lassen.
Als sie zu der Stelle gelangten, an der er von Bord gehen musste, weil das Fischerboot unmöglich bis ans Ufer konnte, zeigten die Fischer ihm die Richtung, in der sich das Festland befand. Sie gaben ihm eine Schwimmweste, die besser passte als die von der Bohrinsel, und er sprang ins Meer und schwamm los. Bei einem letzten Blick zurück sah er, wie einer der Fischer sich bekreuzigte.
Als er die Küste erreichte, waren seine Muskeln verkrampft, sein Körper dehydriert. Sein Kopf und seine Schultern schmerzten noch immer von den Schlägen der Wächter und dem Sprung von der Ölplattform, und die Prellungen und Schnittwunden brannten vom Salzwasser.
Aber er lebte.
Und war an Land.
Endlich.
Die Dunkelheit verbarg seine langen Schritte durch die letzten flachen Wellen, bis er den weißen Sand der Emerald Coast an Floridas Panhandle erreichte, den »Pfannengriff« im Nordwesten des Staates. Er schaute nach rechts und links, ob sich zu dieser späten Stunde noch Leute am Strand aufhielten, entdeckte aber niemanden. Dann erst ließ er sich auf die Knie sinken, rollte sich auf den Rücken und nahm lange, tiefe Atemzüge, während er hinauf zum sternenklaren Himmel blickte.
Er dankte Gott, dass Er ihn am Leben gelassen hatte. Er war bereits viele Stunden geschwommen, als das Fischerboot ihn gefunden hatte. Angesichts der Größe des Golfs von Mexiko war allein das schon ein Wunder gewesen. Ohne göttliche Fügung hätte er keine Überlebenschance gehabt, schon wegen der Haie. Und seine Entführer hatten ihn nicht verfolgt. Auch das musste er in seine Gebete mit einschließen.
Und jetzt hatte er schon wieder Glück, dass der Strand verlassen dalag.
Aber das stimmte nicht ganz.
Diesmal schien Gott etwas übersehen zu haben.
Der hünenhafte Mann kauerte sich hin, als er hörte, dass jemand näher kam.
Wieder lauschte er.
Ja, da kam jemand.
Er streckte sich lang aus und bedeckte sich mit Sand, ließ seinen gut zwei Meter großen, hundertdreißig Kilo schweren Körper mit den weißen Körnchen verschmelzen.
Es waren zwei Personen, das verrieten ihm die Stimmen.
Ein Mann und eine Frau.
Ganz leicht hob er den Kopf und schaute in ihre Richtung. Sie gingen nicht mit ihrem Hund spazieren. Wieder ein Grund für ein Dankgebet. Ein Hund hätte ihn gewittert.
Solange sie ihn nicht entdeckten, würde er nichts unternehmen. Und selbst wenn sie ihn sahen, würden sie vermutlich annehmen, dass er einfach nur am Strand lag und den Abend genoss.
Andererseits bestand bei seiner Größe immer die Möglichkeit, dass die Leute in Panik gerieten, das wusste er nur zu gut. Hinzu kam, dass er nach seiner langen Reise auf dem Meer ziemlich mitgenommen aussehen musste.
Er spannte jeden Muskel an und wartete darauf, dass die beiden an ihm vorbeigingen.
Sie waren jetzt auf zehn Meter herangekommen. Die Frau blickte in seine Richtung. Das Mondlicht war nicht besonders hell, aber es reichte aus.
Er hörte, wie sie etwas rief und dann aufgeregt zu ihrem Begleiter sprach.
Erst dann sah er, dass die Frau gar nicht in seine Richtung blickte.
Eine schlanke Gestalt trat aus der Deckung einer Düne.
Ein dumpfer Knall, und der Mann stürzte in den Sand. Die Frau fuhr herum, wollte davonlaufen.
Ein weiterer Knall. Auch die Frau fiel zu Boden.
Die Gestalt steckte die Pistole weg, während sie sich den beiden im Sand liegenden Gestalten näherte. Sie packte die Hände der Frau und zerrte sie vier Meter weit ins Wasser. Der Körper versank und wurde vom Gezeitenstrom hinaus aufs Meer gezogen.
Dann kam der Mann an die Reihe.
Die Gestalt blieb nahe am Wasser stehen und betrachtete die Wellen, vergewisserte sich vermutlich, dass die Körper nicht wieder angespült wurden. Dann drehte sie sich um und verschwand auf dem Weg, auf dem sie gekommen war.
Der Hüne hielt sich flach an den Boden gedrückt. Du hättest ihnen helfen müssen, schoss es ihm durch den Kopf. Aber alles war so schnell gegangen, dass er ihren Tod niemals hätte verhindern können.
Und manchmal war Gott mit anderen Dingen beschäftigt, das wusste er nur zu gut. Gott war oft beschäftigt gewesen, wenn er ihn gebraucht hatte. Andererseits brauchten viele Menschen Gottes Hilfe. Er war nur einer von Milliarden, die hin und wieder um göttlichen Beistand baten.
Er wartete, bis er sicher sein konnte, dass der Schütze verschwunden war. Er hatte keine Ahnung, warum das Pärchen hatte sterben müssen oder wer sie ermordet hatte. Es ging ihn auch nichts an.
Aber jetzt konnte er nicht mehr am Strand bleiben. Er eilte zur Uferpromenade und entdeckte ein Fahrrad, das an einen Pfosten gekettet war. Er riss den Pfosten aus dem Boden und löste die Kette. Nachdem er sie um den Rahmen des Rades gewickelt hatte, stieg er in den Sattel und fuhr los.
Die Straßen der Stadt hatte er größtenteils im Gedächtnis. Er hatte eine Unterkunft, wo er sich umziehen, ausruhen, essen und den Wasserbedarf seines Körpers stillen konnte.
Dann konnte er seinen Kreuzzug beginnen, der wahre Grund für sein Kommen.
Als der Hüne in der Nacht verschwand, murmelte er wieder vor sich hin. Er betete um Vergebung, weil er dem Paar nicht geholfen und ihren Angreifer getötet hatte. Er war ein Ass im Töten, vielleicht sogar der Beste. Aber das bedeutete nicht, dass es ihm gefiel.
Er war ein Riese von Gestalt, aber sanftmütig. Es sei denn, es gab Gründe, dass er böse wurde.
Er hatte solche Gründe. Mehr als genug.
Solange er hier war, würde er alles andere als sanft sein.
Seine Wut war das Einzige, was ihn antrieb. Das Einzige, was ihn wirklich am Leben erhielt.
Er fuhr weiter, während die beiden Leichen langsam hinaus aufs Meer gezogen wurden.
5
John Puller bog scharf links ab und fuhr über die schmale zweispurige Straße. Auf der Rückbank saß Unab, ein fetter, orange und braun gescheckter Kater, der eines Tages unerwartet in Pullers Leben gewandert war und es vermutlich genauso unerwartet wieder verlassen würde. Deshalb war Unab nach dem militärischen Begriff »Unerlaubte Abwesenheit« benannt.
John Puller, ein ehemaliger Ranger, war Spezialagent der Criminal Investigation Division, kurz CID, der Militärstrafverfolgungsbehörde der Army. Derzeit bearbeitete er keine Fälle. Nach den dramatischen Erlebnissen in einer kleinen Bergbaustadt in West Virginia, die ihn und viele andere Menschen um ein Haar das Leben gekostet hätten, hatte er sich ein wenig Urlaub gegönnt.
Puller fuhr auf den Parkplatz seines Apartmenthauses in der Nähe von Quantico, Virginia, wo das Hauptquartier der CID zusammen mit der 701. M.P. Group untergebracht war, Pullers Einheit bei der Militärpolizei. Die Nähe erleichterte die Fahrt zur Arbeit, auch wenn Puller sich nur selten in Quantico aufhielt. Viel öfter reiste er durchs Land und untersuchte Verbrechen, die Angehörige der US Army verübt hatten. Leider gab es viele solche Fälle.
Er parkte den Wagen, einen schnittigen, vom Militär zur Verfügung gestellten Malibu, holte seinen Rucksack aus dem Kofferraum, öffnete die hintere Beifahrertür und wartete geduldig, bis Unab langsam herauskam. Der Kater folgte ihm hinauf zu seiner Wohnung. Puller lebte auf fünfundfünfzig Quadratmeter gerader Linien und geringster Unordnung. Er hatte den größten Teil seines Erwachsenendaseins beim Militär verbracht; jetzt, mit Mitte dreißig, war seine Abneigung gegen Nachlässigkeiten jeder Art unwiderruflich in ihm eingebrannt.
Er kümmerte sich um Futter und Wasser für Unab, holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank, setzte sich in seinen Ledersessel, legte die Füße hoch und schloss die Augen. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal eine Nacht durchgeschlafen hatte, und beschloss, sofort etwas dagegen zu unternehmen.
Die letzten Wochen hatten es nicht gut mit Puller gemeint. Er hatte fast fünf Kilo verloren, weil ihm der Appetit fehlte. Doch körperlich war er mit seinen knapp zwei Metern Größe und zwei Zentnern Gewicht noch immer fit. Er hatte jeden Test bestanden, den das Militär hinsichtlich Kraft, Ausdauer oder Schnelligkeit verlangte. Doch psychisch ging es ihm nicht besonders. Und er war nicht sicher, dass es ihm in dieser Hinsicht jemals wieder gut gehen würde. An manchen Tagen glaubte er es, an anderen Tagen nicht. Heute war einer der anderen Tage.
Puller war verreist, um nach den höllischen Erlebnissen in West Virginia wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Es hatte nicht funktioniert. Es ging ihm eher noch schlechter. Die zurückgelegten Meilen hatten ihm lediglich zu viel Zeit zum Grübeln gelassen, und er wollte nicht mehr grübeln. Er wollte etwas tun, das ihn in die Zukunft führte, nicht in die Vergangenheit.
Sein Handy klingelte. Er schaute auf die Anzeige im Display.
USDB. Die United States Disciplinary Barracks in Fort Leavenworth, Kansas. Das Gefängnis für die gefährlichsten Kriminellen des Militärs.
Puller kannte diesen Knast gut. Er hatte ihm oft genug einen Besuch abgestattet. Sein älterer und einziger Bruder Robert würde dort den Rest seines Lebens verbringen. Noch länger, wenn es nach dem Pentagon gegangen wäre.
»Hallo?«
Eine resolute Frauenstimme sagte: »Bitte warten Sie.«
Im nächsten Augenblick hörte Puller eine andere Stimme. Eine Stimme, die er nur zu gut kannte. Sie gehörte Bobby, einem ehemaligen Major in der Air Force, den ein Kriegsgericht wegen Verrats verurteilt hatte. Weshalb sein Bruder sich dieses Verbrechens schuldig gemacht hatte, wusste Puller nicht. Und wenn, hätte er kein Verständnis dafür aufgebracht.
Sein Schädel begann zu pochen. »Hallo, Bobby.«
»Wo steckst du?«
»Bin eben erst zurückgekommen«, erwiderte Puller gereizt. »Habe gerade die Füße hochgelegt. Was ist los?«
»Wie war die Fahrt? Ist der Kopf wieder klar?«
»Mir geht’s gut.«
»Bist du sicher?«
»Nein.«
»Was ist los?«
»Nichts.«
»Du willst mich abwimmeln, stimmt’s? Schon in Ordnung. Macht mir nichts aus.«
Normalerweise freute Puller sich, mit seinem Bruder zu sprechen, denn ihre Anrufe waren selten. Aber dieses Mal wollte er einfach nur mit seinem Bier im Sessel sitzen und an nichts denken.
»Was ist los?«, fragte Bobby noch einmal, diesmal energischer.
»Okay, okay, du sprichst laut genug«, sagte Puller. Leg endlich auf, verdammt, ich will nicht reden.
»Ich würde dir ja nicht auf die Nerven gehen, wäre ich nicht angerufen worden.«
Puller klappte den Sessel nach vorn und stellte das Bier ab.
»Was für ein Anruf war das? Der alte Herr?«
Im Leben der Brüder Puller gab es nur einen alten Herrn: John Puller senior, genannt Durchbruch-Puller, Drei-Sterne-General und Legende auf dem Schlachtfeld. Er war ein alter Bastard und Anhänger der Patton-Strategie, die lautet: Mach den Gegner gnadenlos platt.
Nun aber befand sich der einstige Kommandeur der legendären 101. Airborne Division in einem Veteranenkrankenhaus, weil er unter kurzen, aber intensiven Anfällen von Demenz und längeren Phasen von Depression litt. Die Demenz war vermutlich auf das Alter zurückzuführen, die Depressionen darauf, dass er keine Uniform mehr trug und keinem Soldaten mehr Befehle erteilen konnte – mit der Folge, dass er keinen Sinn mehr im Leben sah. Durchbruch-Puller existierte nur aus einem Grund: um Soldaten zum Sieg zu führen. Zumindest sah er sich selbst so. Seine Söhne hätten dieser Einschätzung uneingeschränkt zugestimmt.
»Ja, der Alte«, antwortete Bobby. »Jemand hat für ihn aus dem Krankenhaus angerufen. Er konnte dich nicht erreichen, also hat er sich bei mir gemeldet. Aber ich kann hier schlecht weg, um ihn zu besuchen.«
»Worum ging es bei dem Anruf? Ist es wieder schlimmer geworden mit der Demenz? Ist er hingefallen und hat sich die Hüfte gebrochen?«
»Weder noch. Ich glaube nicht, dass es um ihn selbst geht. Sie haben nicht klar und deutlich gesagt, was Sache ist. Vermutlich, weil Vater sich ihnen gegenüber unklar ausgedrückt hat. Irgendwie geht es wohl um einen Brief, den er bekommen hat, aber beschwören kann ich das nicht.«
»Ein Brief? Von wem?«
»Keine Ahnung. Deshalb rufe ich an. Du wohnst in der Nähe, du könntest dich danach erkundigen. Angeblich war er sehr aufgebracht.«
»Die Leute in der Klinik wussten nicht, was in dem Brief steht?«
»Nein.«
»Wie kann das sein?«
»Das weißt du doch«, erwiderte Robert. »Unser Vater mag alt und senil sein, aber wenn er nicht will, dass man seine Briefe liest, dann liest man sie auch nicht. Selbst in seinem Alter und in seinem Zustand kann er Leuten noch ganz schön in den Arsch treten. Es gibt keinen Arzt in der Veteranenklinik, der es mit ihm aufnehmen könnte.«
»Okay. Ich fahre hin.«
»Lassen wir den ganzen Mist mal beiseite, John«, sagte Bobby. »Geht es dir wirklich gut?«
»Wenn wir den ganzen Mist beiseitelassen, dann nein. Mir geht es beschissen.«
»Und was willst du dagegen tun?«
»Ich bin in der Army.«
»Und das bedeutet?«
»Dass ich einfach weitermache, wie jeder Soldat.«
»Du könntest mit jemandem reden. Die Army hat Spezialisten für solche Probleme. Du musstest in West Virginia zu viel Dreck fressen. Das würde jeden aus dem Gleichgewicht bringen. Es ist wie eine posttraumatische Belastungsstörung.«
»Ich brauche niemanden«, sagte Puller. »Ich komme allein zurecht.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher.«
»Pullers sprechen nicht über ihre Probleme.« Er konnte Bobby vor sich sehen, wie er verständnislos den Kopf schüttelte.
»Ist das Familienregel Nummer drei oder vier?«
»Nummer eins«, erwiderte Puller. »Jedenfalls im Augenblick. Und für mich.«
6
Als Puller über die Flure im Veteranenkrankenhaus ging, fragte er sich, ob er eines Tages auch hier landen würde. Der Anblick der alten, kranken, invaliden Soldaten deprimierte ihn noch mehr.
Vielleicht wäre eine Kugel in den Kopf besser, sollte ich je so weit kommen.
Er wusste, wo sein Vater untergebracht war, und konnte den Schreibtisch der Schwester umgehen. Er hörte den Alten schon, bevor er ihn sah. John Puller senior hatte immer eine Stimme wie ein Megafon gehabt, und weder das Alter noch die Krankheit hatten etwas daran ändern können. Seine Stimme schien sogar noch schneidender zu sein als früher.
Die Tür zum Zimmer seines Vaters öffnete sich, und eine sichtlich genervte Schwester trat heraus.
»Mein Gott, bin ich froh, Sie zu sehen.« Sie blickte zu Puller hoch. Er trug keine Uniform, aber die Schwester hatte ihn anscheinend mühelos erkannt.
»Wo liegt das Problem?«, fragte er.
»Er ist das Problem«, erwiderte die Schwester. »Er hat die letzten vierundzwanzig Stunden immer wieder nach Ihnen gefragt. Er gibt keine Ruhe.«
Puller legte die Hand auf den Türknauf. »Er hatte drei Generalssterne. Es ist immer persönlich, und Männer wie er lassen niemals etwas auf sich beruhen. Das liegt in ihrer Natur.«
»Viel Glück«, sagte die Schwester.
»Glück hat nichts damit zu tun.« Puller trat ein und schloss die Tür hinter sich.
Im Zimmer lehnte er den breiten Rücken an die Wand und ließ den Blick schweifen. Der Raum war klein, vielleicht zehn Quadratmeter, wie eine Gefängniszelle. Tatsächlich war er ungefähr so groß wie der Ort, den Pullers Bruder für den Rest seines Lebens sein Zuhause nennen würde.
Die Möbel bestanden aus einem Krankenhausbett, einem Nachttisch aus Holz, einem Vorhang zum Schutz der Privatsphäre und einem Stuhl, der noch unbequemer war, als er aussah. Dann gab es noch ein Fenster, einen winzigen Wandschrank und ein Bad mit Haltestangen und einer Vielzahl von Notrufknöpfen.
Und schließlich war da Pullers alter Herr selbst, John Puller senior, ehemaliger Kommandeur der wohl berühmtesten Einheit der Army, der Screaming Eagles: die Fallschirmjäger der 101. Airborne Division.
»XO, wo haben Sie gesteckt, verdammt noch mal?«, fragte Puller senior und starrte seinen Sohn an, als würde er ihn über Kimme und Korn anvisieren. »XO«, ausführender Offizier – so nannte er ihn meistens.
»Ich hatte einen Auftrag, Sir. Bin gerade erst zurückgekommen. Wie ich hörte, gibt es ein Problem, Sir.«
»Da haben Sie verdammt recht.«
Puller trat einen Schritt vor und blieb neben dem Bett stehen, auf dem sein Vater lag. Er trug ein weißes T-Shirt und eine lose sitzende blaue Krankenhaushose. Einst so groß wie sein Sohn, war der alte Mann auf etwas über eins fünfundachtzig geschrumpft. Er war noch immer groß, aber bei Weitem nicht mehr der Beinahe-Hüne, der er einst gewesen war. Ein weißer, weicher Haarkranz verlief um seinen Kopf herum; oben war alles kahl. Seine Augen waren von einem eisigen Blau und wechselten zwischen lodernder Intensität zu völliger Leere, manchmal binnen weniger Sekunden.
Die Ärzte waren sich nicht einig, was Puller senior nun genau fehlte. Offiziell wollte es niemand als Alzheimer bezeichnen, nicht einmal als Demenz. Die Ärzte umschrieben es mit »Alterserscheinungen«.
Puller hoffte nur, dass sein Vater heute klar genug war, um ihm von dem Brief zu erzählen. Oder ihm zumindest erlaubte, dass er ihn sich ansah.
»Sie haben einen Brief bekommen, Sir?«, fragte er nachdrücklich. »Eine streng geheime Meldung? Vielleicht aus dem Pentagon?«
Pullers Vater war seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten aus der Army ausgeschieden, schien sich dessen aber nicht bewusst zu sein. Puller hatte herausgefunden, dass es die Dinge erleichterte, wenn er so tat, als wäre sein Vater noch immer beim Militär.
Das beruhigte den alten Mann, und es brachte die Unterhaltung in Schwung. Puller kam sich dabei zwar albern vor, aber die Ärzte hatten ihm erklärt, es sei eine sinnvolle Vorgehensweise, kurzfristig zumindest. Und vielleicht war alles, was Pullers Vater noch geblieben war, kurzfristig.
Der alte Mann nickte und schaute grimmig drein. »Möglicherweise, XO, möglicherweise. Hat mich beunruhigt.«
»Dürfte ich die Meldung lesen, Sir?«
Sein Vater zögerte, blickte zu ihm hoch, wobei er den Ausdruck eines Mannes zeigte, der sich nicht sicher war, was oder wen er anschaute.
»Dürfte ich die Meldung lesen, General?«, fragte Puller erneut, leiser diesmal, aber auch energischer.
Sein Vater zeigte auf sein Kissen. »Darunter. Hat mich beunruhigt.«
»Jawohl, Sir. Darf ich, Sir?«
Puller zeigte auf das Kissen. Sein Vater nickte und setzte sich auf.
Puller trat vor und nahm das Kissen hoch. Darunter lag ein aufgerissener Briefumschlag. Puller nahm ihn und betrachtete ihn. Die Adresse war in Druckbuchstaben geschrieben. Der Brief war an seinen Vater gerichtet. In diesem Veteranenkrankenhaus. Abgestempelt in einem Ort namens Paradise, Florida. Der Ortsname klang irgendwie vertraut. Puller las den Namen des Absenders in der oberen linken Ecke des Umschlags.
Betsy Puller Simon.
Deshalb hörte es sich vertraut an. Betsy war seine Tante, die Schwester seines Vaters. Sie war fast zehn Jahre älter als ihr Bruder. Lloyd Simon war ihr Mann gewesen. Er war vor vielen Jahren verstorben. Damals war Puller junior gerade nach Afghanistan abkommandiert worden. Er erinnerte sich, dass sein Vater ihn über den Tod seines Onkels informiert hatte. Seit damals hatte Puller nicht oft an Betsy gedacht.
Warum eigentlich?, fragte er sich.
Nun, jetzt hatte sie seine Aufmerksamkeit.
Sie hatte an ihren Bruder geschrieben, den General. Und der war aufgebracht. Puller hoffte, dass es nicht um ein verschwundenes Haustier oder offene Rechnungen ging. Oder dass seine alte Tante noch einmal heiratete und den Wunsch hatte, dass ihr jüngerer Bruder als Brautführer fungierte. Das war ein Ding der Unmöglichkeit.
Puller zog das einzelne Blatt Papier aus dem Umschlag und faltete es auseinander. Es war dickes Papier mit einem hübschen Wasserzeichen. In fünf Jahren wurde so etwas wahrscheinlich nicht mehr hergestellt. Wer schrieb heute noch Briefe?
Puller konzentrierte sich auf die spinnenhafte Handschrift. Der Brief war mit blauer Tinte geschrieben, sodass die Schrift über dem cremefarbenen Untergrund zu schweben schien.
Das Schreiben bestand aus drei Absätzen. Puller las alle drei, und das zweimal. Seine Tante hatte mit den Worten geendet: »Alles Liebe, Johnny. Betsy.«
Johnny und Betsy?
Es machte seinen Vater beinahe menschlich.
Beinahe.
Puller wusste jetzt, warum die Lektüre des Briefes seinen Vater so sehr aus der Fassung gebracht hatte. Seine Schwester war offensichtlich verängstigt gewesen, als sie den Brief geschrieben hatte.
In Paradise, Florida, ging irgendetwas vor, was ihr nicht gefiel. Sie kam nicht auf Einzelheiten zu sprechen, aber was sie geschrieben hatte, reichte vollkommen, um Pullers Interesse zu wecken. Mysteriöse Geschehnisse in der Nacht. Leute, die nicht waren, was sie zu sein schienen. Das unbestimmte Gefühl, dass etwas nicht stimmte.
Namen hatte Betsy keine genannt. Doch sie hatte den Brief mit der Bitte um Hilfe beendet. Aber die sollte nicht von ihrem Bruder kommen.
Sie hat ausdrücklich um meine Hilfe gebeten, dachte Puller.
Betsy musste gewusst haben, dass er Ermittler bei der Army war. Vielleicht hatte ihr Bruder es ihr erzählt. Vielleicht hatte sie es selbst herausgefunden. Schließlich war es kein Geheimnis, was John Puller tat.
Puller faltete den Brief zusammen und steckte ihn ein. Sein Vater schaute mittlerweile auf das kleine Fernsehgerät, das an einem Metallarm befestigt an der Wand hing. Gerade lief Der Preis ist heiß. Puller senior schien fasziniert zu sein – der Mann, der nicht nur die 101. kommandiert, sondern den Befehl über ein ganzes Korps gehabt hatte, fünf Divisionen im Kampfeinsatz, insgesamt fast 100.000 hervorragend ausgebildete Soldaten. Und jetzt galt seine ganze Aufmerksamkeit einer Fernsehshow, in der Leute den Preis von irgendwelchem Krempel erraten mussten, um irgendwelchen Krempel zu gewinnen.
»Darf ich den Brief behalten, General?«, fragte Puller.
Jetzt, da er herbeizitiert worden war und sowohl den Brief wie auch die Angelegenheit anscheinend fest im Griff hatte, schien sein Vater nicht mehr interessiert oder beunruhigt zu sein. Er fuchtelte mit der Hand herum, eine unbestimmte Geste, die besagte: Du kannst gehen.
»Kümmern Sie sich darum, XO. Erstatten Sie mir Bericht, wenn die Sache erledigt ist.«
»Danke, General. Ich werde mein Bestes tun, Sir.«
Obwohl sein Vater ihn nicht anschaute, salutierte Puller schneidig, machte auf dem Absatz kehrt und ging. Bei ihrer letzten Begegnung hatte er sich einfach umgedreht und das Zimmer verlassen, verbittert und angewidert zugleich, woraufhin der alte Mann ihn als »Schütze Arsch« beschimpft und ihm nachgebrüllt hatte. Aber das schien er vergessen zu haben. Zusammen mit vielen anderen Dingen. In Pullers Erinnerung jedoch war diese Szene noch immer lebendig.
Als Pullers Hand sich auf den Türknauf legte, sagte sein Vater: »Kümmern Sie sich um Betsy, XO, sie ist ein guter Mensch.«
Puller schaute zu seinem Vater. Der alte Mann starrte ihn an. Seine kalten blauen Augen blickten so klar wie einst. Er befand sich nicht mehr im Der Preis ist heiß-Land, sondern im Hier und Jetzt.
»Wird gemacht, Sir. Sie können sich darauf verlassen.«
Auf dem Weg nach draußen begegnete Puller dem Arzt seines Vaters, einem kleinen Mann mit beginnender Glatze. Er war ein guter Mediziner, der hier für eine weitaus geringere Bezahlung schuftete, als sein Studium in Yale ihm in der freien Wirtschaft eingebracht hätte.
»Wie macht er sich?«, wollte Puller wissen.
»So gut, wie man es erwarten kann. Sein körperlicher Zustand ist noch immer erstaunlich. Ich würde nicht beim Armdrücken gegen ihn antreten wollen. Aber im Oberstübchen scheinen die Dinge weiterhin in Schieflage zu sein.«
»Und man kann nichts dagegen tun?«
»Ihr Vater bekommt die Medikamente, die man Patienten in seinem Zustand normalerweise verabreicht. Natürlich ist eine Heilung ausgeschlossen. Derzeit ist es uns nicht einmal möglich, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, obwohl es einige vielversprechende Ansätze gibt. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich glaube, für Ihren Vater wird es ein langer Abstieg nach unten, John. Und dieser Abstieg könnte sich im Laufe der Zeit beschleunigen. Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten habe.«
Puller bedankte sich bei dem Arzt. Das alles war ihm nicht neu, trotzdem fragte er bei jedem Besuch. Vielleicht glaubte ein Teil von ihm, dass die Antwort eines Tages anders ausfiel.
Er verließ das Krankenhaus und ging zu seinem Wagen. Nun ja, eigentlich gehörte der Wagen der United States Army, aber er war die United States Army, also lief es vermutlich auf dasselbe hinaus.
Unterwegs holte er den Brief wieder hervor. Seine Tante hatte ihre Telefonnummer in Paradise angegeben; das war hilfreich. Als Puller seinen Wagen erreichte, setzte er sich auf die Motorhaube, holte das Handy hervor und gab die Nummer ein.
Er gehörte nicht zu denen, die etwas aufschoben, wenn sie es sofort erledigen konnten.
Es klingelte viermal, dann schaltete sich die Voicemail ein. Puller hinterließ seiner Tante eine Nachricht und steckte das Handy weg.
Auf der Motorhaube seines Malibu sitzend las er den Brief ein drittes Mal. Ein beunruhigender Brief. Aber er hatte bis jetzt nur einmal versucht, Betsy zu erreichen. Vielleicht war sie gerade beim Arzt. Alte Leute verbrachten viel Zeit bei Ärzten. So hatte er es schon bei seinem Vater erlebt.
Puller seufzte. In vieler Hinsicht war das nicht sein Problem. Vermutlich hatte sein Vater den Brief längst vergessen. Und er, Puller, hatte Betsy lange nicht gesehen. Sie war kein Teil seines Lebens mehr.
Aber früher, in seiner Kindheit und Jugend, war sie es gewesen. Eine Art Ersatz für eine Mutter, die nicht da war, weil sie nicht da sein konnte.
Obwohl sehr viel Zeit vergangen war, konnte Puller sich lebhaft an Tante Betsy erinnern. An bestimmte Augenblicke. Wenn er etwas gebraucht hatte, das es in seinem Leben nicht gab, war Betsy für ihn da gewesen. Dinge, die kleine Jungs nun mal brauchen. Dinge, für die Väter nicht sorgen konnten, selbst wenn sie immer für ihre Kinder da waren, was auf Pullers Vater allerdings nicht zutraf. Der war viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, Tausenden von Männern zu befehlen, bestimmte Dinge so zu tun, wie er selbst sie zu tun pflegte.
Betsy Simon hatte diese Leere gefüllt. Damals war sie sehr wichtig für Puller gewesen. Er hatte mit ihr über alles gesprochen, Probleme und Triumphe. Betsy war eine wunderbare Zuhörerin gewesen. Und Puller hatte im Lauf der Zeit erkannt, dass die Ratschläge, die sie ihm während des Erwachsenwerdens gegeben hatte, so meisterhaft erteilt worden waren, dass er sie für seine eigenen Ideen hielt.
Noch hatte er Urlaub. Niemand erwartete ihn zurück. Und er konnte dieser Sache nicht einfach den Rücken zuwenden. Betsy erst recht nicht.
Und es ging nicht allein um Altruismus. Ein Teil von ihm fragte sich, ob Betsy ihm noch einmal durch eine schwere Zeit hindurchhelfen konnte. Die schwere Zeit, die er im Moment durchlebte. Das hatte nicht nur mit seinem Vater zu tun, es ging vor allem um die Ereignisse in West Virginia. Puller hatte noch nie richtig mit jemandem darüber gesprochen, nicht einmal mit seinem Bruder. Auch wenn er Bobby gegenüber das Gegenteil behauptet hatte – es gab Dinge, über die er reden musste. Ihm fehlte nur jemand, bei dem er sich sicher genug fühlte.
Vielleicht konnte seine Tante diese Lücke füllen. Wieder einmal.
Wie es aussah, musste Puller ins Paradies.
7
Es gab viele Möglichkeiten, nach Paradise zu kommen. Puller entschied sich für einen Flug mit der Delta Airlines über Atlanta, der ihn viereinhalb Stunden nach seinem Aufbruch in Washington zum Northwest Florida Regional Airport brachte. Der Flughafen befand sich auf regierungseigenem Gelände innerhalb der Eglin Air Force Base, einem der größten Luftwaffenstützpunkte der Welt; Puller hatte ihn während seines Aufenthalts auf der Rangerschule schon einmal besucht.
In diesem Teil Floridas galt Sommerzeit, deshalb nahm er sich auf dem Weg zum Schalter der Hertz-Autovermietung einen Moment Zeit, um seine Uhr umzustellen. Der Sommerzeit zufolge war es jetzt zehn Uhr dreißig. Er hatte eine Stunde gewonnen. Es herrschten bereits über sechsundzwanzig Grad.
»Willkommen an der Emerald Coast«, begrüßte ihn die Frau hinter dem Hertz-Schalter. Sie war klein und stämmig, ihr graues krauses Haar war braun gefärbt.
»Ich hatte mit ›Willkommen im Paradies‹ gerechnet«, erwiderte Puller.
Sie lächelte ihn an. »Wahrscheinlich sage ich das manchmal. Aber die Stadt ist vierzig Minuten von hier entfernt, und ich versuche den Spruch zu variieren.«
»Ich schätze, mit der Zeit wird selbst das Paradies ein bisschen langweilig.«
»Ja, gut möglich. Möchten Sie ein Cabrio? Das will eigentlich jeder. Ich habe eine wunderschöne Corvette, die gerade wieder reingekommen ist.«
»Wie teuer?«
Als die Frau den Preis nannte, schüttelte Puller den Kopf. »Kann ich mir nicht leisten. Die Army zahlt mir nicht genug.«
»Sie sind bei der Army?«
»Seit dem College.«
»Mein Sohn auch. Er ist Ranger.«
»Ich war Ausbilder bei den Rangers und dann zwei Jahre auf der anderen Straßenseite bei der 75. aus Fort Benning, bevor ich in den Nahen Osten abkommandiert wurde.«
»Die Rangers ebnen den Weg.«
»Der Meinung war ich auch immer, egal, was die Marines und die SEALs sagen.«
Sie musterte ihn in nachdenklichem Schweigen. »Möchten Sie die Corvette immer noch?«
»Wie schon gesagt, Ma’am, das sprengt mein Budget.«
»Wie viel können Sie denn zahlen?«
Puller sagte es ihr.
»Dann reicht es für die Corvette.« Sie tippte auf der Tastatur ihres Computers.
»Dürfen Sie das?«
»Ich hab’s gerade eben getan. Und das Navi gibt es kostenlos dazu.«
»Vielen Dank.«
»Ich habe Ihnen zu danken.«