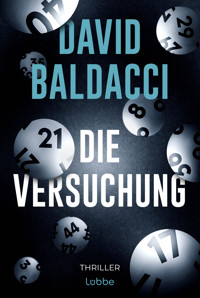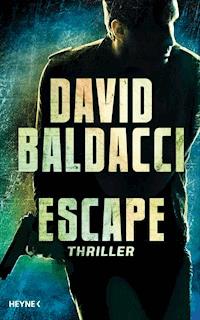9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Will Robie
- Sprache: Deutsch
David Baldaccis tödlichster Held ist zurück: Auftragskiller Will Robie
Will Robie und seine Partnerin Jessica Reel, die zwei besten Profikiller ihres Landes, erhalten vom Präsidenten einen heiklen Auftrag: Sie sollen Nordkoreas unberechenbaren Führer ausschalten. Während sie sich auf ihre Mission vorbereiten, wird Jessica von den Geistern ihrer Vergangenheit eingeholt, die alle bedrohen, die ihr nahestehen. Doch damit nicht genug, denn plötzlich taucht ein neuer, unbekannter Feind auf: eine Frau mit eigener Abschussliste. Und auf der stehen auch Will und Jessica.
Mit "Im Auge des Todes" hat Bestsellerautor David Baldacci den dritten Band seiner spannenden Thriller-Reihe um den Auftragskiller Will Robie vorgelegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Will Robie und seine Partnerin Jessica Reel, die zwei besten Profikiller ihres Landes, erhalten vom Präsidenten einen heiklen Auftrag: Sie sollen Nordkoreas unberechenbaren Führer ausschalten. Während sie sich auf ihre Mission vorbereiten, wird Jessica von den Geistern ihrer Vergangenheit eingeholt, die alle bedrohen, die ihr nahestehen. Doch damit nicht genug, denn plötzlich taucht ein neuer, unbekannter Feind auf: eine Frau mit eigener Abschussliste. Und auf der stehen auch Will und Jessica.
ÜBER DEN AUTOR
David Baldacci, geboren 1960, war Strafverteidiger und Wirtschaftsanwalt, ehe er 1996 mit Der Präsident (verfilmt als Absolute Power) seinen ersten Weltbesteller veröffentlichte. Seine Bücher wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und erschienen in mehr als achtzig Ländern. Damit zählt er zu den Top-Autoren des Thriller-Genres. Er lebt mit seiner Familie in Virginia, nahe Washington, D.C.
DAVID BALDACCI
IM AUGE DES TODES
Thriller
Will Robies dritter Fall
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Target«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Columbus Rose, Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Heike Rosbach, Nürnberg
Umschlaggestaltung: Mediabureau di Stefano, Berlin
Umschlagmotiv: © Nik Keevil/Arcangel
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2301-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Coach Ron Axselle, weil er ein so toller Mentor und Freund ist
KAPITEL 1
Vierhundert Menschen lebten hier, die meisten für den Rest ihres sterblichen Daseins.
Und dann würde die Hölle sie holen, für alle Ewigkeit.
Die Wände bestanden aus dickem Beton, und an den Innenseiten waren sie mit abstoßenden Graffiti bedeckt, die einem in all ihrer Obszönität nichts ersparten. Und so wie sich Schlamm in der Kanalisation absetzte, wurde auch die Dreckschicht an den Wänden mit jedem Jahr immer dicker. Die Stahlgitter waren zerschrammt und schartig, doch von Menschenhand dennoch nicht zu brechen. Es hatte zwar Ausbrüche gegeben, allerdings in den letzten dreißig Jahren nicht mehr. Nicht, nachdem es außerhalb der Mauern keinen Ort mehr gab, an dem man Zuflucht fand. Die Menschen, die da draußen lebten, waren kaum freundlicher als die drinnen.
Und sie hatten sogar mehr Waffen.
Der alte Mann erlitt einen weiteren schweren Hustenanfall und spuckte Blut, was genauso beredt Zeugnis über seinen Zustand ablegte wie jede Diagnose eines erfahrenen Arztes. Er wusste, dass er starb. Die einzige Frage war, wann. Aber er musste durchhalten. Er hatte noch etwas zu erledigen, und eine zweite Gelegenheit würde er dafür nicht bekommen.
Earl Fontaine war groß, war früher aber noch größer gewesen. Sein Körper war geschrumpft, als der Krebs Metastasen gebildet hatte und ihn von innen auffraß. Sein Gesicht war stark zerfurcht, von der Zeit verwüstet und von vier Schachteln Menthol-Zigaretten am Tag sowie schlechter Ernährung, aber hauptsächlich von einem bitteren Gefühl der Ungerechtigkeit. Seine Haut war von den Jahrzehnten an diesem Ort, den die Sonne nicht erreichte, dünn und käsig.
Mit Mühe setzte er sich in seinem Bett auf und betrachtete die anderen Insassen des Gefängniskrankenhauses. Es waren nur sieben, und keiner von denen war so schlecht dran wie er. Sie würden diese Station vielleicht aufrecht gehend verlassen. Er war über dieses Stadium hinaus. Doch trotz seines ernsten Zustands lächelte er.
Ein anderer Häftling bemerkte Earls glücklichen Gesichtsausdruck. »Verdammt, worüber lächelst du, Earl? Verrat uns doch mal, was so lustig ist.«
Earl ließ das Grinsen auf seinem breiten Gesicht abklingen. Das gelang ihm trotz der Schmerzen in seinen Knochen. Er hatte das Gefühl, als würde sie jemand mit einer stumpfen Säge durchtrennen.
»Ich komm hier raus, Junior«, sagte er.
»Scheiße«, sagte der andere Häftling, der in diesen Mauern ohne offensichtlichen Grund als Junior bekannt war. Er hatte in drei Bundesstaaten fünf Frauen, die das Pech gehabt hatten, ihm über den Weg zu laufen, vergewaltigt und ermordet. Die Behörden arbeiteten wie verrückt daran, seine aktuelle Erkrankung zu heilen, damit er sein offizielles Hinrichtungsdatum in zwei Monaten einhalten konnte.
Earl nickte. »Ich komm hier raus.«
»Und wie?«
»In einem Sarg, Junior, genau wie dein dünner Arsch.« Earl kicherte, und Junior schüttelte den Kopf und starrte wieder verdrossen auf seine Infusionsschläuche. Sie ähnelten denen, durch die die tödlichen Chemikalien fließen würden, die in der Todeszelle von Alabama seinem Leben ein Ende bereiten würden. Schließlich wandte er den Blick ab, schloss die Augen und schlief sofort ein, als wolle er sich schon mal auf den tiefsten Schlaf überhaupt einstellen, der in genau zwei Monaten kommen würde.
Earl lehnte sich zurück und rasselte mit der Kette, die mit dem einen Ende an der Handschelle um sein rechtes Handgelenk und mit dem anderen an einem dicken, aber verrosteten Eisenring in der Wand befestigt war.
»Mit mir geht’s zu Ende«, rief er heiser. »Holt schon mal die Sargträger, damit sie mich rausschleppen.« Er bekam einen weiteren Hustenanfall, der erst nachließ, als ein Pfleger zu ihm trat und ihm ein Glas Wasser, eine Pille und einen Klaps auf den Rücken gab. Dann half er Earl, sich aufzusetzen.
Der Pfleger wusste wahrscheinlich nicht, warum Earl im Gefängnis saß. Hätte er es gewusst, hätte es wohl auch keine Rolle gespielt. Jeder Häftling in diesem Hochsicherheitsgefängnis hatte etwas so entsetzlich Schreckliches getan, dass alle Wärter und Mitarbeiter hier in dieser Hinsicht völlig unempfindlich geworden waren.
»Jetzt krieg dich wieder ein, Earl«, sagte der Pfleger. »Du machst es nur noch schlimmer.«
Earl beruhigte sich, lehnte sich ins Kissen zurück und betrachtete den Mann dann ruhig. »Erzähl keinen Quatsch. Was soll bei mir denn noch schlimmer werden?«
Der Pfleger zuckte mit den Achseln. »Alles kann schlimmer werden. Daran hättest du vielleicht mal denken sollen, bevor du das angestellt hast, was dich hierhergebracht hat.«
»He, Kleiner«, sagte Earl, mit einem Mal voller Energie, »kannst du mir was zu qualmen geben? Schieb die Kippe einfach zwischen meine Finger und zünd sie an. Ich sag auch keinem, dass ich sie von dir hab. Ich schwör’s bei allem Scheiß, der mir heilig ist, obwohl ich kein gottesfürchtiger Mann bin.«
Der Pfleger erbleichte allein bei der Vorstellung. »Äh … ja, vielleicht, wenn wir noch 1970 schreiben würden. Um Himmels willen, du hängst am Sauerstoffgerät, Earl. Sauerstoff ist explosiv. Der macht bumm.«
Earl grinste, enthüllte dabei verfärbte Zähne und viele Lücken zwischen ihnen. »Verdammt, mir ist es lieber, in die Luft zu fliegen, als von dem Scheiß in mir bei lebendigem Leib aufgefressen zu werden.«
»Ach? Aber den anderen vielleicht nicht. Das ist das Problem. Die meisten Leute denken nur an sich.«
»Nur eine Zigarette, Kleiner. Ich rauch gern Winston. Hast du Winstons? Das ist mein letzter Wunsch. Wie meine letzte Mahlzeit. So ist das verdammte Gesetz.« Er rasselte mit der Kette. »Eine letzte Kippe. Du musst sie mir geben.« Er rasselte lauter. »Her damit.«
»Du stirbst an Lungenkrebs, Earl«, sagte der Pfleger. »Was meinst du, wo du den herhast? Ich geb dir ’nen Hinweis. Man nennt sie aus verdammt gutem Grund Sargnägel. Jesus, Maria und Josef! Du bist so dumm, dass du dem lieben Gott danken kannst, weil du überhaupt so lange gelebt hast.«
»Nun gib mir schon die Zigarette, du kleines Arschloch!«
Der Pfleger war offensichtlich mit Earl fertig. »Ich muss mich um viele Patienten kümmern. Lassen wir’s dabei bewenden. Was meinst du, alter Mann? Oder muss ich einen Wärter rufen? Albert hat heute auf der Krankenstation Dienst, und der ist ja nicht gerade dafür bekannt, sehr mitfühlend zu sein. Er zieht dir eins mit dem Schlagstock über, ob du nun krank bist und stirbst oder nicht, und reicht dann seinen Bericht ein, und niemand wird ihn anzweifeln. Der Typ ist unheimlich, und ihm ist alles scheißegal. Das weißt du, oder?«
»Weißt du, warum ich hier bin?«, fragte Earl, bevor der Pfleger sich von seinem Bett abwenden konnte.
Der Mann grinste. »Mal überlegen. Weil du im Sterben liegst und der Staat Alabama jemanden wie dich nicht freilässt, damit du in ein Hospiz kommst, obwohl du ihn einen Haufen Geld für Medikamente kostest?«
»Nein, nicht hier in der Krankenstation«, sagte Earl. Seine Stimme klang leise und kratzig. »Ich red vom Knast. Gib mir noch ein Glas Wasser. Wasser krieg ich doch an diesem gottverdammten Ort, oder?«
Der Pfleger goss eine Tasse voll, und Earl trank sie gierig aus und wischte sich das Gesicht ab. »Sitz seit über zwanzig Jahren hinter Gittern«, sagte er voller angestauter Energie. »Zuerst nur lebenslänglich in ’nem Bundesknast. Aber dann haben sie die Todesstrafe für mich beantragt. Verdammte Arschlöcher von Anwälten. Und der Staat hat mich am Arsch gepackt. Die Bundesbehörden ließen sie machen. Ließen sie einfach machen. Hab ich denn keine Rechte? Verdammt, ich hab nix, wenn sie das einfach machen können. Verstehst du, was ich sagen will? Nur, weil ich sie umgebracht hab. Hatte ein schönes Bett im Bundesgefängnis. Und schau mich jetzt an. Ich hab den Krebs bestimmt wegen diesem Scheißort gekriegt. Das weiß ich genau. Der hängt hier in der Luft. Zum Glück hab ich nie diesen Aids-Scheiß gekriegt.« Er runzelte die Stirn und senkte die Stimme. »Du weißt, jede Menge Leute hier haben diese Krankheit.«
»Hm-hm«, machte der Pfleger, der auf seinem Laptop schon eine andere Krankenakte aufgerufen hatte. Das Gerät lag auf einem Rollwagen mit verschlossenen Fächern, in denen sich Medikamente befanden.
»Das sind zwei Jahrzehnte plus jetzt fast zwei Jahre«, sagte Earl. »Eine verdammt lange Zeit.«
»Ja, du bist gut im Kopfrechnen, Earl«, sagte der Pfleger abwesend.
»Der erste Bush war noch Präsident, aber dieser Junge aus Arkansas hat ihn dann bei den Wahlen geschlagen. Hab’s im Fernsehen gesehen, als ich hierherkam. Das war 1992. Wie hieß er noch mal? Es hieß, er sei ein Halbnigger.«
»Bill Clinton. Und er ist kein Halbneger. Er hat nur Saxofon gespielt und ging manchmal in eine afrikanisch-amerikanische Kirche.«
»Genau. Der war’s. Seitdem bin ich hier.«
»Ich war sieben.«
»Was?«, bellte Earl. Er kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können, und rieb sich geistesabwesend den schmerzenden Bauch.
»Als Clinton gewählt wurde, war ich sieben«, sagte der Pfleger. »Meine Momma und mein Daddy waren hin und her gerissen. Sie waren natürlich Republikaner, aber er war ein Junge aus dem Süden. Ich glaube, sie haben für ihn gestimmt, wollten es aber nicht zugeben. Spielte auch keine Rolle. Das ist schließlich Alabama. Wenn ein Liberaler hier gewinnt, friert die Hölle zu. Hab ich recht?«
»Sweet home Alabama.« Earl nickte. »Hab hier lange gelebt. Hatte eine Familie hier. Aber ich komm aus Georgia, mein Sohn. Ich bin ein Georgia-Pfirsich, klar? Kein Alabama-Junge.«
»Schon klar.«
»Aber ich wurde in diesen Knast hier gesteckt, weil ich in Alabama was angestellt hab.«
»Natürlich hast du das. Aber das ist kein großer Unterschied. Georgia, Alabama, das ist doch fast einerlei. Oben in New York oder Massachusetts würd dich das nicht den Arsch kosten. Und im Ausland schon gar nicht.«
»Und was ich getan hab«, sagte Earl atemlos und rieb noch immer seinen Bauch. »Ich kann keine Juden, Farbigen und Katholiken leiden. Und auch keine Presbyterianer.«
Der Pfleger sah ihn an. »Presbyterianer?«, sagte er amüsiert. »Was zum Teufel haben die dir denn getan, Earl? Das ist ja so, als würdest du die Amish hassen.«
»Die haben wie Schweine gequiekt, die geschlachtet werden, ich schwör’s bei Gott. Hauptsächlich Juden und Farbige.« Er zuckte mit den Achseln und wischte sich mit dem Hemdsärmel gedankenverloren den Schweiß von der Stirn. »Verdammt, das ist die Wahrheit, ich hab nie einen Presbyterianer getötet. Die fallen einfach nicht auf, verstehst du? Aber ich würd einen umbringen, wenn ich Gelegenheit dazu hätte.« Sein Lächeln wurde breiter, drang bis in seine Augen vor. Und dieser Ausdruck verriet, dass Earl Fontaine trotz seines Alters und seiner Krankheit ein Killer war. Noch immer. Und immer ein Mörder bleiben würde, bis zum Tag seines Todes, der nicht schnell genug kommen konnte, wenn es nach gesetzestreuen Bürgern ging.
Der Pfleger schloss ein Fach seines Wägelchens auf und nahm ein paar Medikamente heraus. »Warum willst du denn so was machen? Die Leute haben dir doch gar nichts getan.«
Earl hustete Schleim hoch und spuckte ihn in seine Tasse. »Sie haben geatmet«, sagte er grimmig. »Das hat mir genügt.«
»Und deshalb bist du wohl zu Recht hier. Aber du musst deinen Frieden mit Gott machen, Earl. Sie sind alle Gottes Kinder. Du musst das hinbiegen. Du wirst ihn bald sehen.«
Earl lachte, bis er husten musste. Dann beruhigte er sich, und seine Gesichtszüge schienen wieder klar zu werden. »Ein paar Leute kommen mich besuchen.«
»Wie schön, Earl«, sagte der Pfleger, während er dem Häftling im benachbarten Bett ein Schmerzmittel verabreichte. »Familienangehörige?«
»Nein. Ich hab meine Familie umgebracht.«
»Warum? Waren sie Juden oder Presbyterianer oder Farbige?«
»Ich krieg heut Besuch«, sagte Earl. »Ich bin noch nicht erledigt.«
»Hmm.« Der Pfleger blickte auf den Monitor eines anderen Häftlings. »Schön, dass du die Zeit nutzt, die dir bleibt, alter Mann. Die Uhr läuft. Für uns alle.«
»Krieg heut Besuch«, sagte Earl. »Hab’s an der Wand da eingetragen. Siehst du?« Er zeigte auf die Betonwand, auf der er mit dem Fingernagel die Farbe abgekratzt hatte. »Sechs Tage, haben sie gesagt, dann werden sie mich besuchen. Ich hab sechs Striche dort gemacht. Bin gut mit Zahlen. Mein Verstand funktioniert noch.«
»Na, dann grüß sie mal von mir«, sagte der Pfleger, als er den Wagen davonschob.
Wenig später schaute Earl zur Tür des Krankensaals. Dort waren zwei Männer erschienen. Sie trugen dunkle Anzüge und Hemden, und ihre schwarzen Schuhe waren blank poliert. Der eine hatte eine Brille mit schwarzer Fassung auf der Nase. Der andere sah aus, als käme er frisch von der Highschool. Beide hielten Bibeln in den Händen und hatten sanfte, ehrfurchtsvolle Gesichter aufgesetzt. Sie wirkten ehrenwert, friedlich und gesetzestreu.
In Wirklichkeit waren sie nichts dergleichen.
Earl machte sie auf sich aufmerksam. »Sie kommen mich besuchen«, murmelte er. Sein Kopf war plötzlich völlig klar. Mit einem Mal hatte er wieder ein Ziel im Leben. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er starb, doch er hatte trotzdem ein Ziel.
»Hab meine Familie umgebracht«, sagte er. Aber das war nicht ganz richtig. Er hatte seine Frau ermordet und ihre Leiche im Keller ihres Hauses vergraben. Man hatte sie erst Jahre später gefunden. Deshalb war er hier und zum Tode verurteilt worden. Er hätte wohl ein besseres Versteck finden können, doch das war nicht seine Priorität gewesen. Er war damit beschäftigt gewesen, andere Menschen zu töten.
Die Bundesregierung hatte den Staat Alabama den Prozess führen, ihn für schuldig erklären und wegen Mordes zum Tode verurteilen lassen. Er war in die Todeszelle des Bundesstaats Alabama gekommen, die sich in der Holman Correctional Facility in Atmore befand. Seit 2002 richtete der Staat Alabama Verurteilte offiziell durch eine tödliche Injektion hin. Aber einige Befürworter der Todesstrafe rieten dazu, wieder zum elektrischen Stuhl zurückzukehren, um denen, die in der Todeszelle warteten, ultimativ Gerechtigkeit angedeihen zu lassen.
Doch Earl scherte das nicht. Seine Beschwerden und Revisionsanträge hatten die Hinrichtung so lange hinausgezögert, dass sie wegen seiner Krebserkrankung jetzt nicht mehr vollzogen würde. Ironischerweise schrieb das Gesetz vor, dass ein Häftling bei guter Gesundheit sein musste, um hingerichtet werden zu können. Doch das hatte ihn nur vor einem schnellen, schmerzlosen Tod bewahrt, sodass er nun wegen seines Lungenkrebses, der sich im ganzen Körper ausgebreitet hatte, eines wesentlich längeren und schmerzhafteren natürlichen Todes sterben würde. Manche nannten das süße Gerechtigkeit. Er nannte es nur Scheißglück.
Er winkte den beiden Männern in den Anzügen zu.
Er hatte seine Frau getötet, das traf zu. Und er hatte viele andere umgebracht, so viele, dass er sich an die genaue Anzahl nicht mehr erinnerte. Juden, Farbige, vielleicht ein paar Katholiken. Vielleicht hatte er auch einen Presbyterianer ermordet. Verdammt, er wusste es nicht mehr. Seine Opfer hatten ja keine Ausweise bei sich getragen, auf denen die Glaubensrichtung aufgeführt war. Jeder, der ihm in den Weg kam, musste sterben. Und er hatte dafür gesorgt, dass ihm so wenige Menschen wie nur möglich in den Weg kamen.
Jetzt war er an eine Wand gekettet und sah dem Tod ins Auge. Doch er musste noch etwas erledigen.
Genauer gesagt, er musste noch einen Menschen töten.
KAPITEL 2
Die Männer hätten kaum angespannter wirken können. Man hatte den Eindruck, die Last der ganzen Welt ruhe auf ihren Schultern.
Gewissermaßen stimmte das auch.
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika saß in dem Sessel am Kopfende des kleinen Tisches. Sie befanden sich im abgeschotteten Situation Room, dem Kommunikationszentrum im Keller des Westflügels des Weißen Hauses, das manchmal auch als »Holzschuppen« bezeichnet wurde. Der Komplex war in Präsident Kennedys Amtszeit nach dem Schweinebucht-Fiasko eingerichtet worden. Kennedy war der Ansicht, dass er dem Militär nicht mehr vertrauen konnte, und wollte seinen eigenen Geheimdienststab, der die Berichte des Pentagons analysieren sollte. Man hatte Trumans Kegelbahn für den Komplex geopfert, der 2006 grundlegend renoviert worden war.
In der Kennedy-Ära war der Situation Room mit einem einzigen Analytiker der CIA besetzt. Er schob 24-Stunden-Schichten und hat auch dort geschlafen. Später war das Kommunikationszentrum um den Heimatschutz und das Büro des Stabschefs des Weißen Hauses erweitert worden. Doch geleitet wurde der Komplex vom Stab des Nationalen Sicherheitsrats. Fünf »Watch Teams«, die jeweils aus einem Pool von etwa dreißig sorgfältig überprüften Männern ausgewählt wurden, kümmerten sich rund um die Uhr um die Kommunikation. Ihre Aufgabe war es vor allem, den Präsidenten und seinen Führungsstab täglich über wichtige Themen zu informieren und eine sofortige und sichere weltweite Kommunikation zu gewährleisten. Der Komplex verfügte für den Fall, dass der Präsident auf Reisen war, sogar über eine sichere Verbindung zur Air Force One.
Der eigentliche Situation Room selbst war groß, bot mehr als dreißig Personen Platz und verfügte über eine riesige Videowand. Vor der Renovierung hatte die Holztäfelung der Wände aus Magahoni bestanden. Nun waren die Mauern hauptsächlich mit »Flüstermaterialien« verkleidet, die vor elektronischer Überwachung schützten.
Aber an diesem Abend waren die Männer nicht in dem großen Konferenzraum, und auch nicht im Briefing-Raum des Präsidenten. Sie hielten sich in einem kleinen Besprechungszimmer auf, das über zwei Bildschirme an der Wand und darüber eine Reihe von Weltzeituhren verfügte. Der Raum war mit Sesseln für sechs Personen ausgestattet.
Nur drei davon waren besetzt.
Von seinem Platz aus konnte der Präsident direkt die Bildschirme betrachten. Rechts von ihm saß Josh Potter, der Nationale Sicherheitsberater, links neben ihm Evan Tucker, der Chef der CIA.
Das waren alle. Der Kreis der Personen, die von dieser Sache wissen durften, war äußerst begrenzt. Doch bald würde sich eine vierte Person über eine sichere Video-Verbindung zuschalten. Das Personal, das sich normalerweise im Kontrollraum aufhielt, war über dieses Meeting und die eingehende Kommunikation nicht informiert. Nur eine Person schaltete die Funkverbindung. Und selbst diese Person bekam nicht mit, was gesprochen wurde.
Normalerweise wäre der Vizepräsident bei solch einem Treffen anwesend. Doch wenn das, was sie vorhatten, schiefging, würde er vielleicht den Posten an der Spitze übernehmen müssen, weil man gegen den Präsidenten dann ein Amtsenthebungsverfahren einleiten würde. Also mussten sie ihn hier raushalten. Falls der Präsident sein Amt aufgeben musste, wäre das schrecklich für das Land. Falls dann auch noch der Vizepräsident aus dem Amt gejagt würde, wäre die Katastrophe perfekt. Nach der Verfassung würde das Amt dann an den Sprecher des Abgeordnetenhauses übergehen. Und niemand wollte, dass der Vorsitzende der vielleicht zerrüttetsten Gruppe in ganz Washington plötzlich das Land führte.
Der Präsident räusperte sich. »Das könnte von großer Tragweite sein«, sagte er, »vielleicht sogar der Untergang.«
Potter nickte, Tucker ebenfalls. Der Präsident sah den CIA-Chef an. »Ist das bombensicher, Evan?«
»Bombensicher, Sir. Eigenlob stinkt zwar, aber das ist der Lohn für fast drei Jahre Geheimdienstarbeit unter den schwierigsten Bedingungen, die man sich nur vorstellen kann. Das wurde, offen gesagt, noch nie zuvor gemacht.«
Der Präsident nickte und sah zu den Uhren über den Bildschirmen. Dann blickte er auf seine eigene Uhr und stellte sie minimal nach. Wie es schien, war er in den letzten fünf Minuten um Jahre gealtert. Alle amerikanischen Präsidenten mussten Entscheidungen treffen, die die Welt erschüttern konnten. In vielerlei Hinsicht gingen die Erfordernisse dieses Amtes einfach über die Fähigkeiten eines Normalsterblichen hinaus. Aber die Verfassung schrieb vor, dass nur eine Person das Amt innehatte.
Er atmete lange und tief aus. »Das muss hinhauen.«
»Jawohl, Sir«, sagte Potter.
»Es wird hinhauen«, bekräftigte Tucker. »Und die Welt wird danach viel besser dran sein. Ich habe eine Liste von Dingen«, fügte er hinzu, »die ich vor meinem Lebensende noch erledigen möchte. Und das ist die Nummer zwei darauf, gleich hinter dem Iran. Und in gewisser Hinsicht sollte es die Nummer eins sein.«
»Wegen der Atomwaffen«, sagte Potter.
»Natürlich. Der Iran hätte gern Atomwaffen. Diese Arschlöcher haben schon welche. Mit einer Reichweite, die unserem Festland immer näher kommt. Glauben Sie mir, wenn wir das durchziehen, wird Teheran aufhorchen und es zur Kenntnis nehmen. Vielleicht schlagen wir sogar zwei Fliegen mit einer Klappe.«
Der Präsident hob eine Hand. »Ich kenne die Geschichte, Evan. Ich habe alle Akten gelesen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht.«
Der Bildschirm leuchtete auf, und eine Stimme kam aus dem in die Wand eingelassenen Lautsprechersystem. »Mr. President, die Verbindung steht.«
Der Präsident schraubte den Verschluss einer Wasserflasche auf, die vor ihm auf dem Tisch stand, und trank einen großen Schluck. Dann stellte er die Flasche wieder ab. »Also los«, sagte er knapp.
Der Bildschirm flackerte erneut und wurde dann hell. Sie sahen darauf einen kleinen Mann über siebzig mit einem tief zerfurchten und gebräunten Gesicht. Knapp unter seinem Haaransatz verlief ein weißer Rand; er stammte von der Mütze, die er normalerweise trug, um sein Gesicht vor der Sonne zu schützen. Aber er trug jetzt keine Uniform. Er war in eine graue Jacke mit steifem Kragen gekleidet.
Er sah sie geradewegs an.
»Danke, dass Sie eingewilligt haben, heute Abend mit uns zu sprechen, General Pak«, sagte Evan Tucker.
Pak nickte. »Es ist schön, Sie zu sehen«, sagte er in stockendem, aber einwandfrei artikuliertem Englisch, »von Angesicht zu Angesicht, sozusagen.«
Der Präsident versuchte, das Lächeln zu erwidern, war aber nicht mit dem Herzen dabei. Pak würde sterben, falls man ihn enttarnte. Aber auch der Präsident hatte eine Menge zu verlieren. »Wir wissen zu schätzen, dass wir diese Ebene der Kommunikation erreicht haben.«
Pak nickte. »Wir haben die gleichen Ziele, Mr. President. Wir sind schon zu lange isoliert. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Platz am Tisch der Welt einnehmen. Das sind wir unserem Volk schuldig.«
»Wir stimmen dieser Einschätzung völlig zu, General Pak«, sagte Tucker ermutigend.
»Was die Details betrifft, kommen wir gut voran«, sagte Pak. »Sie können mit Ihrem Teil der Angelegenheit beginnen. Sie müssen Ihre besten Agenten schicken. Selbst mit meiner Hilfe wird das Ziel sehr schwer zu treffen sein.« Pak hob den Zeigefinger. »Das ist die Zahl der Gelegenheiten, die wir bekommen werden. Nicht mehr und nicht weniger.«
Der Präsident sah zu Tucker und dann zurück zu Pak. »Bei einer Sache dieser Größenordnung werden wir nur unsere besten Leute schicken.«
»Und wir sind uns sowohl bei den Informationen als auch bei der Unterstützung völlig sicher?«
Pak nickte. »Absolut sicher. Wir haben die Informationen an Ihre Leute weitergegeben, und sie haben sie bestätigt.«
Potter warf Tucker einen Blick zu. Der Chef der CIA nickte.
»Falls es herauskommt«, sagte Pak. Alle Blicke richteten sich auf ihn. »Falls es herauskommt, werde ich mit Sicherheit mein Leben verlieren. Aber, Amerika, euer Verlust wird viel größer sein.«
Er sah den Präsidenten direkt an und ließ sich einen Augenblick lang Zeit, um seine Worte sorgfältig abzuwägen. »Deshalb habe ich um diese Videokonferenz gebeten, Mr. President. Ich werde nicht nur mein Leben opfern, sondern auch das meiner Familie. So ist es hier üblich. Also benötige ich Ihre vollständige und uneingeschränkte Zusicherung, dass wir, falls wir nun den nächsten Schritt machen, gemeinsam und vereint handeln, ganz gleich, was auch geschehen wird. Sie müssen mir in die Augen sehen und mir sagen, dass dies der Fall ist.«
Das Blut schien aus dem Gesicht des Präsidenten zu weichen. Er hatte während seiner Amtszeit viele wichtige Entscheidungen treffen müssen, doch keine war so schwierig oder möglicherweise folgenreich wie diese.
Er sah weder Potter noch Tucker an, sondern hielt den Blick auf Pak gerichtet. »Sie haben mein Wort«, antwortete er mit klarer, fester Stimme.
Pak lächelte und zeigte dabei wieder seine perfekten Zähne. »Das musste ich hören. Also dann … gemeinsam!« Er salutierte, und der Präsident antwortete darauf mit einer zackigen Geste.
Tucker drückte auf einen Knopf an der Konsole, und der Bildschirm wurde wieder dunkel.
Der Präsident atmete hörbar aus und lehnte sich in das Lederpolster seines Stuhls zurück. Er schwitzte, obwohl es kühl im Raum war, und wischte sich einen Tropfen Feuchtigkeit von der Stirn. Was sie vorhatten, war ganz eindeutig illegal. Ein Vergehen, das ein Amtsenthebungsverfahren nach sich ziehen konnte. Und im Gegensatz zu den Präsidenten, die sich bislang mit einem solchen Verfahren konfrontiert sahen, hegte er keine Zweifel, dass der Senat ihn schuldig sprechen würde.
»In die Bresche ritten die fünfhundert«, flüsterte der Präsident kaum vernehmlich, doch Potter wie auch Tucker hörten ihn und nickten zustimmend.
Der Präsident beugte sich vor und sah Tucker an. »Wir haben für Fehler keinerlei Spielraum. Nicht den geringsten. Und wenn es auch nur das leiseste Anzeichen gibt, dass die Sache auffliegt …«
»Sir, dazu wird es nicht kommen. Wir haben da drüben zum ersten Mal einen Agenten in so hoher Position. Wie Sie wissen, hat es letztes Jahr einen Attentatsversuch auf den Obersten Führer gegeben. Als er mit dem Wagen durch die Straßen der Hauptstadt fuhr. Aber das war ein stümperhafter Versuch von einer niedrig angesiedelten internen Gruppe und hatte nichts mit uns zu tun. Wir werden schnell und sauber zuschlagen. Und Erfolg haben.«
»Ist Ihr Team schon vor Ort?«
»Wir stellen es gerade zusammen und werden es dann überprüfen.«
Der Präsident warf ihm einen scharfen Blick zu. »Überprüfen? Wen wollen Sie einsetzen, verdammt noch mal?«
»Will Robie und Jessica Reel.«
»Robie und Reel?«, platzte Potter heraus.
»Sie sind die absolut Besten, die wir haben«, sagte Tucker. »Sehen Sie sich doch an, was sie in Syrien mit Ahmadi gemacht haben.«
Potter musterte Tucker scharf. Er kannte jedes Detail dieser Mission. Daher wusste er auch, dass weder Reel noch Robie sie hätten überleben sollen.
»Aber mit Reels Background …«, sagte der Präsident leise. »Was sie angeblich getan hat. Die Möglichkeit, dass sie …«
Tucker unterbrach ihn. Normalerweise wäre das unerhört gewesen. Man ließ den Präsidenten ausreden. Aber an diesem Abend schien Evan Tucker nur zu sehen und zu hören, was er sehen und hören wollte.
»Sie sind die Besten, Sir, und wir brauchen dabei die Besten. Wie ich schon sagte, werden wir sie mit Ihrer Erlaubnis auf Herz und Nieren prüfen, um sicherzustellen, dass sie einen Job auf höchstem Niveau abliefern. Sollten sie jedoch bei der Überprüfung durchfallen, steht ein anderes Team bereit, das fast genauso gut und auf jeden Fall der Aufgabe gewachsen ist, diese Mission durchzuführen. Aber klar den Vorzug hat Team A.«
»Warum bringen Sie nicht einfach das Backup-Team zum Einsatz?«, fragte Potter. »Dann wäre diese Überprüfung doch unnötig.«
Tucker sah den Präsidenten an. »Wir müssen es aus einer Vielzahl von Gründen genau so durchziehen. Gründe, die Sie natürlich nachvollziehen können.«
Tucker hatte sich seit Wochen penibel auf diesen Moment vorbereitet. Er hatte den Werdegang des Präsidenten analysiert, seine Zeit als Oberbefehlshaber, hatte sogar ein altes psychologisches Profil des Mannes in die Hände bekommen, das erstellt worden war, als er vor vielen Jahren für den Kongress kandidierte. Der Präsident war klug und fähig, aber doch nicht ganz so klug und ganz so fähig. Das hieß, er hatte einen Komplex. Er gab nicht gerne zu, dass er nicht immer die klügste und sachkundigste Person im Raum war. Man konnte diese Eigenschaft als Stärke verstehen. Tucker wusste jedoch, dass sie eine ernste Schwäche war, die man ausnutzen konnte.
Und er nutzte sie in diesem Augenblick aus.
Der Präsident nickte. »Ja. Ja, ich kann sie nachvollziehen.«
Tuckers Gesicht blieb ausdruckslos, doch innerlich atmete er erleichtert auf.
Der Präsident beugte sich vor. »Ich respektiere Robie und Reel. Andererseits haben wir hier nicht den geringsten Spielraum für Fehler, Evan. Also überprüfen Sie die beiden gründlich und vergewissern Sie sich, dass sie dafür absolut geeignet sind. Oder Sie setzen das Team B ein. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Völlig klar«, sagte Tucker.
KAPITEL 3
Will Robie fand keinen Schlaf und starrte die Decke seines Schlafzimmers an, während es draußen geradezu wie aus Kübeln goss. Sein Kopf pochte noch stärker, und die Schmerzen hörten auch nicht auf, als der Regen aufhörte. Schließlich stand er auf, zog sich an, schlüpfte in eine lange Regenjacke mit Kapuze und verließ sein Apartment am Dupont Circle in Washington, D.C.
Er ging fast eine Stunde durch die Dunkelheit. Zu dieser frühen Stunde waren kaum Leute unterwegs. Im Gegensatz zu anderen Großstädten war Washington eine Stadt, die durchaus schlief. Zumindest der Teil, den man sehen konnte. Jener Teil, der zur Regierung gehörte, der unterirdisch und in Betonbunkern und harmlos wirkenden Flachbauten existierte, schlief nie. Diese Menschen waren zu dieser frühen Stunde so hart bei der Arbeit, wie sie es auch tagsüber sein würden.
Drei Männer Anfang zwanzig näherten sich von der anderen Straßenseite. Robie hatte sie schon gesehen, abgeschätzt und wusste, was sie von ihm verlangen würden. Es waren keine Cops in der Gegend. Keine Zeugen.
Er hatte keine Zeit für so etwas. Und kein Verlangen danach. Er drehte sich um und schritt direkt auf sie zu.
»Werden Sie verschwinden, wenn ich Ihnen etwas Geld gebe?«, fragte er den Größten der drei. Er hatte etwa seine Größe, ein Ein-Meter-achtzig-Brocken von neunzig auf der Straße abgehärteten Kilos.
Der Mann schob seine Windjacke zurück und enthüllte eine schwarze Sig-9-Millimeter im Hosenbund, der tief auf seinen Hüften hing. »Kommt drauf an, wie viel.«
»Hundert?«
Der Mann sah seine beiden Kumpane an. »Mach zwei draus, und du kannst weitergehen, Alter.«
»Ich habe keine zweihundert.«
»Behauptest du. Dann werden wir dich direkt hier mal abziehen.«
Er wollte zur Waffe greifen, doch Robie hatte sie ihm schon aus dem Bund gezogen und ihm gleichzeitig die Hose heruntergezerrt. Der Mann stolperte in den Hosenbeinen.
Der Mann rechts neben ihm zog ein Messer und sah dann erstaunt zu, wie Robie ihn zuerst entwaffnete und danach mit drei schnellen Schlägen, zwei in die rechte Niere, einen ans Kinn, niederstreckte. Nachdem der Mann auf den Bürgersteig gesunken war, versetzte Robie ihm noch einen Tritt an den Kopf.
Der dritte Mann rührte sich nicht.
»Scheiße«, rief der Wortführer, »bist du ein Ninja?«
Robie schaute auf die Sig in seiner Hand. »Sie ist nicht anständig ausbalanciert und verrostet. Ihr müsst euch besser um eure Waffen kümmern, oder sie werden euch im Stich lassen, wenn es darauf ankommt.« Er richtete die Pistole auf den Mann. »Wie viele habt ihr noch?«
Der dritte Mann wollte in seine Tasche greifen.
»Runter mit der Jacke«, befahl Robie.
»Es ist kalt und regnet«, protestierte der Mann.
Robie drückte ihm die Sig an die Stirn. »Ich bitte dich nicht noch einmal.«
Der Mann zog die Jacke aus und ließ sie in eine Pfütze fallen. Robie hob sie auf und nahm eine Glock heraus.
»Ich sehe die Wurfsterne an euren Knöcheln«, sagte er. »Her damit.«
Sie gaben sie ihm. Robie steckte alle ein.
Er schaute den Mann an. »Seht ihr, wohin die Gier euch führt? Ihr hättet den Hunni nehmen sollen.«
»Wir brauchen unsere Waffen!«
»Ich brauche sie dringender.« Robie spritzte mit dem Fuß dem Bewusstlosen Wasser aus der Pfütze ins Gesicht. Er erwachte, setzte sich ruckartig auf und stand dann zittrig auf. Er schien nicht zu wissen, was vor sich ging, hatte wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung.
Robie winkte wieder mit der Pistole. »Da entlang. Ihr alle. Nach rechts in die Gasse.«
Der großgewachsene Mann wirkte plötzlich nervös. »He, Alter, es tut uns leid, okay? Aber das hier ist unser Revier. Wir gehen Streife. Das ist unser Lebensunterhalt.«
»Ihr wollt einen Lebensunterhalt? Sucht euch einen richtigen Job, bei dem ihr nicht Passanten die Waffe vors Gesicht halten und ihnen abnehmen müsst, was euch nicht gehört. Jetzt verschwindet! Und keine Fragen mehr!«
Sie drehten sich um und marschierten los. Als einer der Männer sich umdrehen und zurückschauen wollte, schlug Robie ihm mit dem Griff der Sig an den Kopf. »Augen geradeaus. Dreht euch noch mal um, und ihr habt ein drittes Auge im Hinterkopf, durch das ihr schauen könnt.«
Robie hörte, wie der Atem der Männer schneller ging. Ihre Beine waren wie aus Pudding. Sie dachten, sie würden zu ihrer Hinrichtung marschieren.
»Schneller!«, bellte Robie.
Sie beschleunigten ihre Schritte.
»Noch schneller. Aber nicht rennen.«
Die drei Männer sahen idiotisch aus, als sie schneller zu gehen versuchten, ohne in einen Laufschritt zu fallen.
»Jetzt lauft!«
Sie rannten los, bogen an der nächsten Kreuzung nach links ab und waren verschwunden.
Robie drehte sich um und ging in die entgegengesetzte Richtung. Er bog in eine Gasse, sah einen Müllcontainer und warf die Jacke und die Waffen hinein, nachdem er die Munition herausgenommen hatte. Die Kugeln ließ er in einen Gully fallen.
Er erlebte nicht oft so ruhige, friedliche Augenblicke und mochte es nicht, wenn sie gestört wurden.
***
Robie ging weiter und erreichte den Potomac River. Das war kein müßiger Spaziergang. Er war aus einem bestimmten Grund hierhergekommen.
Er zog einen Gegenstand aus der Tasche seiner Regenjacke und betrachtete ihn, ließ einen Finger über die polierte Oberfläche gleiten.
Es war ein Orden, die höchste Auszeichnung, die die Central Intelligence Agency für Heldenmut im Einsatz vergab. Robie hatte ihn für eine Mission in Syrien bekommen, die er gemeinsam mit einer anderen Agentin unter größtem persönlichem Risiko ausgeführt hatte. Sie hatten es gerade noch lebend nach Hause geschafft.
Es war der Wunsch gewisser Personen in der Agency gewesen, dass sie es nicht lebendig zurückschafften. Eine dieser Personen war Evan Tucker, und dass er gehen würde, war nicht wahrscheinlich, denn er war zufällig der Chef der CIA.
Die andere Agentin, die den Orden erhalten hatte, war Jessica Reel. Sie war der eigentliche Grund, wieso Tucker wollte, dass sie nicht lebend zurückkehrten. Reel hatte Angehörige ihrer eigenen Agency getötet. Und zwar aus gutem Grund, aber manchen Leuten war das egal. Evan Tucker war einer von ihnen.
Robie fragte sich, wo sich Reel im Augenblick befand. Als sie sich verabschiedet hatten, war ihr künftiges Verhältnis keineswegs klar gewesen. Robie hatte ihr seine bedingungslose Unterstützung gewährt, zumindest das, was er dafür hielt. Doch Reel schien nicht in der Lage zu sein, so eine Geste auch zu honorieren. Daher die Ungewissheit beim Abschied.
Er nahm die Kette des Ordens in die Hand und wirbelte das Stück Metall immer schneller herum. Dann schaute er zur dunklen Oberfläche des Potomac. Es war windig; er sah ein paar Schaumkronen. Er fragte sich, wie weit er den höchsten Orden der CIA in die Tiefen des Flusses schleudern konnte, der die Hauptstadt der USA vom Bundesstaat Virginia trennte.
Der Orden wirbelte mehrmals durch die Luft. Doch am Ende warf Robie ihn nicht auf den Fluss hinaus. Er steckte das Metall wieder ein. Warum, wusste er nicht genau.
Er hatte sich gerade wieder auf den Rückweg gemacht, als sein Handy summte. Er holte es hervor, warf einen Blick auf den Bildschirm und verzog das Gesicht.
»Robie«, sagte er kurz und bündig.
Er kannte die Stimme nicht. »Bitte warten Sie. Die Stellvertretende Direktorin Amanda Marks möchte Sie sprechen.«
Bitte warten Sie? Seit wann lässt die elitärste aller geheimen Agencys ihr Personal »Bitte warten Sie!« sagen?
»Robie?«
Die Stimme war spröde und scharf wie eine neue Klinge, und Robie entdeckte einen eigenartigen Unterton in ihr. Er kündete sowohl von gewaltigem Vertrauen als auch von dem Drang, sich zu beweisen. Das war für ihn eine potenziell tödliche Kombination, denn Robie würde im Außeneinsatz ihre Befehle ausführen, während sie ihn auf einem Computermonitor in der sicheren Entfernung von Tausenden Kilometern beobachtete.
»Ja?«
»Wir brauchen Sie hier. So schnell wie möglich.«
»Sie sind die neue SD?«
»Das steht zumindest an meiner Tür.«
»Eine Mission?«
»Wir unterhalten uns, wenn Sie hier sind. Langley«, fügte sie hinzu, was auch nötig war, da die CIA über zahlreiche Niederlassungen verfügte.
»Sie wissen, was mit den letzten beiden Stellvertretenden Direktoren passiert ist?«
»Schaffen Sie einfach Ihren Arsch hierher, Robie.«
KAPITEL 4
Jessica Reel konnte ebenfalls nicht schlafen. Und am Eastern Shore war das Wetter genauso schlecht wie in Washington. Sie starrte auf die Stelle, wo ihr Haus einst gestanden hatte, bevor es zerstört wurde. Sie hatte das selbst getan. Sie hatte versteckte Sprengladungen angebracht, und Will Robie hatte die Explosion ausgelöst, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Es war unglaublich, dass aus so grimmigen Umständen eine Partnerschaft entstehen konnte.
Sie zog die Kapuze zum Schutz gegen Regen und Wind enger zu und stapfte über den schlammigen Boden, während das Wasser der Chesapeake Bay im Westen weiter gegen die kleine Landzunge schlug.
Als sie und Robie auseinandergegangen waren, hatte sie sich voller Hoffnung, aber auch verloren gefühlt. Diese Empfindungen waren so verwirrend gewesen, dass sie sich nicht sicher war, von welchem Ende sie sie angehen sollte. Falls das überhaupt möglich war. Seit sie erwachsen war, war eigentlich die Arbeit ihre ganze Welt gewesen. Jetzt wusste Reel nicht mehr genau, ob sie überhaupt noch eine Welt oder einen Job hatte. Die Agency wollte nichts mehr von ihr wissen. Deren Führung wollte sie nicht nur los sein, sondern sogar tot sehen.
Wenn sie ihren Job dort aufgab, ermächtigte sie die Agency damit sozusagen, sie für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Doch was für eine Zukunft hatte sie, wenn sie blieb? Wie lange würde sie das überleben? Wie sah ihre Ausstiegsstrategie aus?
Alles beunruhigende Fragen, auf die es offenbar keine schnellen Antworten gab.
Die letzten paar Monate hatten sie alles gekostet, was sie hatte. Ihre drei engsten Freunde. Ihren Ruf bei der Agency. Vielleicht sogar ihre Art zu leben.
Aber sie hatte auch etwas gewonnen. Oder jemanden.
Will Robie, ursprünglich ihr Widersacher, war zu ihrem Freund, ihrem Verbündeten geworden, die einzige Person, auf die sie zählen konnte. Und das, obwohl Reel es nie über sich gebracht hatte, leichten Herzens oder voller Überzeugung auf jemanden zu setzen.
Aber Robie kannte das Leben, das sie führte, ebenso gut wie sie. Seines sah genauso aus. Diese Erfahrung würden sie stets miteinander teilen. Er hatte ihr Freundschaft angeboten, eine Schulter, an die sie sich lehnen konnte, falls es jemals so weit kommen sollte.
Doch ein Teil von ihr wollte sich noch immer von so einem Angebot zurückziehen, den Weg weiterhin allein gehen. Sie wusste noch nicht, wie sie auf dieses Angebot reagieren würde. Vielleicht würde sie es niemals wissen.
Sie schaute zum Himmel hoch und ließ sich die Regentropfen ins Gesicht prasseln. Sie schloss die Augen, und Bilder stürmten auf sie ein. Alle von Personen, und jede davon tot. Einige waren unschuldig, andere nicht. Zwei waren von jemand anderem getötet worden, alle übrigen durch ihre Hand gestorben. Eine, ihre Mentorin und Freundin, lag in einem Koma, aus dem sie nie mehr erwachen würde.
Alles war sinnlos. Und alles war wahr. Und Reel war machtlos, etwas daran zu ändern.
Sie zog den Orden mit der Kette aus ihrer Tasche und sah ihn an. Es war der gleiche wie der, mit dem Robie ausgezeichnet worden war. Sie hatten ihn für denselben Auftrag bekommen. Sie hatte auf Befehl der Agency den Todesschuss abgegeben, Robie hatte ihr die Flucht ermöglicht, nachdem sie fast umgekommen wäre. Zum Verdruss einiger weniger Mächtiger in der Agency hatten sie es dann tatsächlich zurück in die Vereinigten Staaten geschafft.
Der Orden war eine bedeutungslose Geste.
In Wirklichkeit wollten sie ihr eine Kugel in den Kopf jagen.
Sie ging zum Ufer und beobachtete, wie das Wasser der Bucht Gischt über das Land schäumte.
Reel warf den Orden so weit aufs Meer hinaus, wie sie konnte. Dann wandte sie sich ab, noch bevor er auf der Wasseroberfläche aufschlug. Metall trieb nicht oben. Er würde augenblicklich versinken.
Doch dann drehte sie sich noch einmal um und zeigte dem versinkenden Orden, der CIA im Allgemeinen und Evan Tucker im Besonderen den Stinkefinger.
Vor allem deshalb war sie hergekommen. Sie wollte den Orden in die Bucht werfen. Und dieser Ort war ihr Zuhause gewesen, falls sie überhaupt je eines gehabt hatte. Sie hatte nicht vor, noch einmal hierher zurückzukehren. Sie war gekommen, um sich ein letztes Mal umzusehen, vielleicht auch, um mit etwas abzuschließen. Doch sie hatte nicht das Gefühl, dass hier etwas sein Ende gefunden hatte.
Im nächsten Augenblick zog sie ihre Waffe und ging in die Hocke.
In das Geräusch der Brandung mischte sich ein anderes.
Ein Fahrzeug hielt bei den Ruinen ihres Strandhauses.
Es gab keinen Grund, dass irgendjemand sie hier besuchte. Wenn hier jemand auftauchte, führte er Übles im Schilde.
Sie rannte zu der einzigen Deckung, die sich ihr bot: ein Stapel verfaultes Holz, der am Wasser aufgeschichtet worden war. Sie kniete nieder und stützte die Waffe auf dem obersten Scheit ab. Sie selbst konnte zwar kaum etwas erkennen, doch die anderen verfügten vielleicht über Nachtsichtgeräte, die alles deutlich zeigen würden, auch ihre Position.
Es gelang ihr nur, die Bewegungen der Besucher nachzuvollziehen, indem sie deren dunkle Silhouetten aus der Schwärze der Umgebung herausfilterte. Sie konzentrierte sich auf eine Stelle und wartete, bis die sich bewegenden Gestalten diesen Punkt erreichten. Mithilfe dieser Methode zählte sie vier von ihnen. Sie ging davon aus, dass alle bewaffnet, mit Ohrhörern ausgerüstet und zu einem bestimmten Zweck hier waren: ihrer Eliminierung.
Sie würden sie in die Zange zu nehmen versuchen, konnten aber nicht in ihren Rücken gelangen, wenn sie nicht in das kalte und sturmgepeitschte Wasser der Bucht springen wollten. Reel konzentrierte sich auf andere Stellen und wartete darauf, dass sie sie erreichten. Das tat sie mehrmals, bis die anderen sich auf zwanzig Meter genähert hatten.
Sie fragte sich, warum die Besucher dicht beieinander blieben. Normalerweise bestand bei einem Angriff die Taktik darin, sich zu trennen. Mehrere kleine Gruppen, die aus allen Himmelsrichtungen auf sie zukamen, könnte sie nicht im Auge behalten. Doch solange sie zusammenblieben, musste sie den Fokus nicht auf mehrere Stellen gleichzeitig richten.
Sie überlegte gerade, ob sie schießen sollte oder nicht, als ihr Telefon summte.
Sie wollte nicht rangehen, nicht, wenn vier Bewaffnete ihr gerade auf die Pelle rückten.
Doch es konnte Robie sein. So kitschig es klang, vielleicht war das die Möglichkeit, sich von ihm zu verabschieden, die sich bislang so noch nicht geboten hatte. Und vielleicht würde er sich auf die Spur ihrer Mörder setzen und sie für sie töten.
»Ja?«, sagte sie ins Telefon. Die rechte Hand mit der Glock und die Augen hielt sie dabei auf die Unbekannten gerichtet, die weiter langsam näher kamen.
»Bitte bleiben Sie am Apparat. SD Amanda Marks möchte Sie sprechen«, sagte eine tüchtig klingende Stimme.
»Was zum …«, setzte Reel an.
»Agent Reel, hier ist Amanda Marks, die neue Stellvertretende Direktorin der Central Intelligence Agency. Sie müssen sofort nach Langley kommen.«
»Ich bin im Augenblick ziemlich beschäftigt, Madam«, erwiderte Reel sarkastisch. »Aber vielleicht wissen Sie das ja schon«, fügte sie barsch hinzu.
»Vier Agenten befinden sich zurzeit bei Ihrem Strandhaus am Eastern Shore. Ich korrigiere mich, dort, wo Ihr Strandhaus früher stand. Sie sind lediglich da, um Sie nach Langley zu begleiten. Denken Sie nicht einmal daran, sich mit ihnen anzulegen oder ihnen am Ende gar was anzutun.«
»Haben sie vor, mir was anzutun?«, fauchte Reel. »Denn es ist mitten in der Nacht, und ich habe keine Ahnung, woher sie wissen, dass ich hier bin. Außerdem verhalten sie sich ziemlich heimlichtuerisch.«
»Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Daher handeln sie mit Bedacht. Was Ihren Aufenthaltsort betrifft, haben wir uns vergewissert, dass Sie nirgendwo sonst sind.«
»Und warum soll ich so schnell wie möglich nach Langley kommen?«
»Das erklären wir Ihnen, wenn Sie hier sind.«
»Geht es um eine neue Mission?«
»Wenn Sie hier sind, Agent Reel. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass diese Verbindung sicher ist.«
»Und wenn ich mich entschließe, nicht zu kommen?«
»Wie ich Agent Robie schon sagte …«
»Sie haben Robie ebenfalls zu sich beordert?«
»Ja. Er gehört dazu, Agent Reel.«
»Und Sie sind wirklich die neue SD?«
»Ja.«
»Wissen Sie, was mit den letzten beiden passiert ist?«
»Genau diese Frage hat Agent Robie mir auch gestellt.«
Trotz allem musste Reel lächeln. »Und was haben Sie gesagt?«
»Dasselbe, was ich Ihnen jetzt sage. Schaffen Sie einfach Ihren Arsch hierher.«
Die Verbindung wurde unterbrochen.
KAPITEL 5
Ein paar Stunden später traf Jessica Reel in Langley ein. Der Tag war angebrochen, es regnete nicht mehr, doch ihre Stimmung hatte sich nicht gebessert.
Sie brachte die Sicherheitskontrollen hinter sich und betrat ein Gebäude, das sie gut kannte.
In mancher Hinsicht zu gut.
Man führte sie zu einem Raum, in dem bereits ein vertrautes Gesicht auf sie wartete.
»Robie«, sagte sie knapp und setzte sich neben ihn.
»Jessica«, sagte Robie und deutete ein Nicken an. »Ich nehme an, du hast auch eine Einladung erhalten.«
»Es war keine Einladung, es war ein Befehl. Haben sie dir auch ein paar Trottel auf den Hals geschickt, die dich hierherbringen sollten?«
Er schüttelte den Kopf.
»Dann vertrauen sie dir wohl mehr als mir.«
»Wir vertrauen Ihnen beiden gleichermaßen.« Die Tür ging auf, und eine Frau Anfang vierzig mit schulterlangem braunem Haar und einem Tablet in der Hand kam herein. Sie war zierlich, etwa eins fünfundsechzig groß und vielleicht fünfzig Kilo schwer, aber schlank und fit, und ihr drahtiger Körperbau deutete auf eine Kraft hin, die ihre Größe Lügen strafte.
Die Stellvertretende Direktorin Amanda Marks. Sie gab jedem von ihnen die Hand, während Robie und Reel einen amüsierten Blick wechselten.
»Ich danke Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind.«
»Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich nicht gekommen«, sagte Reel. »Die vier Typen, die Sie mir auf den Hals gehetzt haben, haben mir keine andere Möglichkeit gelassen.«
»Trotzdem weiß ich Ihre Kooperation zu schätzen«, erwiderte Marks scharf.
»Ich dachte, nach der letzten Mission hätten wir etwas Erholung verdient.«
»Die haben Sie bekommen. Der Urlaub ist vorbei.«
»Also eine neue Mission?«, sagte Reel misstrauisch.
»Noch nicht«, erwiderte Marks. »Eins nach dem anderen.«
»Was soll das heißen?«, fragte Reel.
»Das heißt, dass Sie beide sich etwas unterziehen müssen, das ich … Überprüfung nennen möchte. Oder Rekalibrierung.«
Robie und Reel wechselten noch einen Blick. »Instrumente werden rekalibriert.«
»Sie sind Instrumente. Die der Agency.«
»Und warum genau müssen wir rekalibriert werden?«, fragte Reel.
Marks hatte bislang keinen Blickkontakt mit ihnen hergestellt, nicht einmal, als sie sich die Hände geschüttelt hatten. Sie hatte entweder zu Boden oder über ihre Schultern geschaut. Das war verwirrend, aber für Robie wie auch Reel kam diese Taktik nicht unerwartet.
Nun sah Marks sie direkt an. Und für Robie hatte sie die Augen einer Frau, die an einem Punkt ihrer Karriere einmal viel Zeit hinter einem Zielfernrohr mit großer Reichweite verbracht hatte.
»Wollen Sie wirklich Ihre und meine Zeit verschwenden, indem Sie so einen Scheiß fragen?«, sagte sie mit leiser, beherrschter Stimme.
Bevor einer von ihnen antworten konnte, fuhr sie schon fort. »Sie beide sind abtrünnig geworden.« Sie sah wieder Reel an. »Sie haben einen unserer Analysten und meinen Vorgänger getötet.«
Dann nahm sie Robie ins Visier. »Und Sie haben sie unterstützt, nachdem wir Sie losgeschickt haben, um sie zu eliminieren. Nach dieser Situation mussten wir die Entscheidung treffen, ob wir Sie eliminieren oder rehabilitieren. Wir entschieden uns dazu, Sie zu rehabilitieren. Ich behaupte nicht, dass ich mit dieser Entscheidung einverstanden bin, aber ich bin hier, um sie umzusetzen.«
»Was vermutlich etwas damit zu tun hat, dass wir die höchste Auszeichnung der CIA erhalten haben«, sagte Robie.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Marks. »Ich habe auch so einen Orden in meiner Schreibtischschublade liegen. Aber das ist Geschichte. Mich interessieren nur die Gegenwart und die Zukunft. Ihre Zukunft. Man hat Ihnen ein unglaubliches Angebot gemacht. Es gibt ein paar Leute, die Sie unbedingt fertigmachen wollen, damit sie andere Pläne umsetzen können.«
»Ich kann mir denken, wer an deren Spitze steht«, sagte Reel. »Evan Tucker, Ihr Boss.«
»Und es gibt andere, die hoffen, dass Sie Erfolg haben und wieder produktive Mitarbeiter der Organisation werden.«
»Und welchem Lager gehören Sie an?«, hakte Robie nach.
»Keinem. Ich bin die Schweiz. Ich werde Sie durch Ihre Rehabilitierung führen, doch der Ausgang hängt allein von Ihnen ab. Mir ist es völlig gleichgültig, wie die Sache ausgeht. Daumen hoch, Daumen runter, keine Veränderung, das interessiert mich nicht die Bohne.«
Reel nickte. »Wie tröstlich. Aber Sie erstatten Evan Tucker Bericht.«
»Genau genommen erstattet jeder hier ihm Bericht. Aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie eine faire Chance bekommen werden, sich vollständig zu rehabilitieren. Ob Sie das schaffen oder nicht, kommt ausschließlich auf Sie an.«
»Und wessen Idee war das?«, fragte Robie. »Falls Tucker dahintersteckt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verlauf in irgendeiner Weise fair sein wird.«
»Ohne in die Einzelheiten zu gehen, kann ich Ihnen versichern, dass auf allerhöchster Ebene ein Kompromiss erzielt wurde. Sie haben mächtige Freunde, Mr. Robie. Sie wissen genau, von wem ich spreche. Aber es haben auch mächtige Kreise gegen Sie beide Stellung bezogen.« Sie sah Reel an. »Einige wollen nichts lieber, als Sie für Ihre Taten hinrichten zu lassen. Bitte unterbrechen Sie mich, falls ich mich nicht völlig klar ausdrücke.«
Weder Robie noch Reel sagten etwas.
»Diese Gruppen sind aufeinandergeprallt«, fuhr Marks fort, »und das Ergebnis war dieser Kompromiss. Rehabilitierung. Oder Tod, falls Sie es nicht schaffen. Es hängt von Ihnen ab. Meiner bescheidenen Ansicht zufolge ist das ziemlich großzügig.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand offen gegen den Präsidenten gestellt hat«, sagte Robie.
»Die Politik ist ein schmutziges, unbarmherziges Geschäft, Agent Robie. Im Vergleich zu ihr steht der Geheimdienstsektor noch verhältnismäßig ehrenwert da. Es trifft natürlich zu, dass der Präsident der fünfhundert Kilo schwere Gorilla ist, aber auf diesem Spielfeld laufen auch noch einige andere ziemlich große Männchen herum. Der Präsident hat eine Agenda, die er durchsetzen will, und das bedeutet, dass er Zugeständnisse machen muss. Im großen Gefüge der Dinge sind Sie und Agent Reel nicht so wichtig, dass man Sie nicht als Verhandlungsmasse einsetzen würde, um die Agenda des Präsidenten voranzutreiben. Ob Sie nun einen Orden bekommen haben oder nicht. Können Sie mir folgen?«
»Was genau bedeutet Rehabilitierung in diesem Zusammenhang?«, fragte Robie.
»Wir fangen ganz von vorn an. Wir müssen Sie in jeder nur erdenklichen Hinsicht neu bewerten. Körperlich, seelisch und geistig. Wir werden ziemlich tief in Ihre Köpfe schauen. Wir werden feststellen, ob Sie noch haben, was man benötigt, um sich im Außeneinsatz durchzusetzen.«
»Ich dachte, wir hätten das in Syrien bewiesen«, warf Reel ein.
»Das war nicht Teil des Kompromisses. Eine einmalige Sache, und selbst dabei haben Sie die Befehle nicht befolgt.«
»Wenn wir sie befolgt hätten, wären wir jetzt beide tot«, stellte Robie klar.
»Auch das ist mir völlig egal. Der Teil, der nach der Befehlsverweigerung folgte, hat zu dem, was nun folgen wird, beigetragen.«
Sie schaltete ihr Tablet ein und tippte auf den Bildschirm. Robie bemerkte, dass ihre Nägel bis zur Fingerspitze abgeschnitten waren und keinen Hauch von Lack aufwiesen. Das Bild einer Heckenschützin kam ihm wieder in den Sinn.
Sie sah zu ihm hoch. »Sie haben sich schwere Verbrennungen an Armen und Beinen zugezogen.« Dann sah sie Reel an. »Das war Ihre Schuld. Nicht, dass das jemanden interessieren würde. Wie kommen Sie mit diesen Verletzungen klar?«
»Ich komme schon klar.«
»Das reicht nicht«, sagte Marks. »Sie beide sind von einem fahrenden Zug gesprungen. Das hat bestimmt Spaß gemacht.«
»Mehr Spaß als die Alternative«, erwiderte Reel.
»Sie haben während dieses … äh … Abenteuers Freunde verloren«, fuhr die Stellvertretende Direktorin fort. »Wie ich es verstanden habe, machen Sie die Agency dafür verantwortlich.«
»Ihr Personal war zumindest zum Teil dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen sollte.«
»Wenn Sie eine erfolgreiche Rehabilitierung absolvieren wollen, müssen Sie darüber hinwegkommen«, erwiderte Marks scharf und wandte sich wieder an Robie. »Sie wurden losgeschickt, um Reel zu finden. Sie haben sie gefunden, aber nicht zurückgebracht. Sie haben sich mit ihr zusammengetan und damit gegen die Befehle der Agency verstoßen.«
»Ich bin meinem Gefühl gefolgt, und es erwies sich als richtig.«
»Um es noch einmal zu sagen: Während Ihrer Rehabilitierung werden Sie entscheiden müssen, wem gegenüber Sie letzten Endes loyal sind, Robie. Beim nächsten Mal könnte Ihr Bauchgefühl falsch sein. Und wo stehen Sie und die Agency dann?«
Sie wartete nicht darauf, dass Robie antwortete, sondern fuhr fort, ohne Luft zu holen. »Die Rehabilitierung wird für uns alle sehr schwer sein. Ich werde Sie auf jedem Schritt des Weges begleiten. Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen.«
»Und was geschieht in dem Fall?«, fragte Reel schnell.
»Dann werden wir die angemessenen Schritte gegen Sie einleiten.«
»Ich muss eine Kaution stellen und bekomme einen fairen Prozess?«, fragte Reel.
Marks schaute auf. »Ich habe nichts von rechtlichen Schritten gesagt, oder?«
»Also heißt es: Friss oder stirb?«, sagte Robie.
»Sie können es ausdrücken, wie Sie wollen. Aber letztlich liegt die Wahl allein bei Ihnen. Wie werden Sie sich also entscheiden?«
Robie und Reel wechselten einen Blick. Dann nickte Reel. Robie tat es ihr gleich.
»Eine ausgezeichnete Wahl«, sagte Marks.
»Wo wird diese Rehabilitierung stattfinden?«, fragte Reel.
»Oh, tut mir leid, habe ich das nicht erwähnt?«
»Nein, haben Sie nicht«, sagte Reel kurz und bündig.
»Sie wird an einem Ort stattfinden, den Sie beide wohl gut kennen.« Sie hielt inne, ließ sich einen Augenblick Zeit und sah von einem zur anderen.
»Die Burner Box, wie wir sie nun nennen«, sagte sie mit einem leichten Lächeln. »Wir brechen in vierundzwanzig Stunden auf.«
KAPITEL 6
»Wie lange wirst du weg sein?«, fragte Julie Getty.
Robie sah auf seinen Teller hinab und antwortete nicht sofort. Sie saßen in einem winzigen Schnellimbiss in Washington, nicht weit von der Schule der fünfzehn Jahre alten Julie entfernt. Robie blieben noch etwa acht Stunden, bevor man ihn und Reel zur Burner Box bringen würde. Julie hatte sich gefreut, von ihm zu hören; ihre Freude hatte sich jedoch schnell gelegt, als sie erfuhr, dass er hier war, um sich zu verabschieden, jedenfalls für eine Weile.
»Ich weiß es nicht genau.« Robie schob das Essen auf dem Teller hin und her. »Das steht noch nicht fest«, erklärte er.
»Und du kannst mir natürlich nicht sagen, wohin du gehst«, meinte sie resignierend.
»Es ist … ein Trainingsgelände.«
»Wofür brauchst du noch Training? Ich meine, du bist doch schon klasse bei dem, was du tust, Will.«
»Weißt du, das ist so, als würde ich noch mal auf die Schule gehen, meine Ausbildung fortsetzen. Viele Profis tun das.« Er zögerte. »Selbst in meiner Branche.«
Sie betrachtete ihn kritisch, und er wich ihrem Blick genauso entschieden aus.
»Machst du diese Fortbildung allein?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Kommt diese Frau mit? Jessica?«
Robie zögerte kurz. »Ja«, antwortete er dann.
»Also steckt ihr beide in Schwierigkeiten?«
Robie warf ihr einen scharfen Blick zu. Sie erwiderte ihn mit einem Ausdruck, der besagte, dass seine Überraschung überflüssig war.
»Ich habe viel Zeit mit dir verbracht, Will. Als man versucht hat, uns zu töten. Als du schlecht drauf warst. Als du nicht mehr viele Optionen hattest, es dir aber trotzdem gelungen ist, uns aus der Klemme zu befreien.«
»Worauf willst du hinaus?«, fragte er mit aufrichtiger Neugier.
»Du wirkst wie jemand, der keinen Ausweg mehr sieht. Und das sieht dir gar nicht ähnlich. Also muss es wirklich schlimm sein.«
Robie sagte nichts, während Julie mit dem Strohhalm in ihrem Glas spielte. »Ich habe vor einer Weile in der Zeitung gelesen, dass Ferat Ahmadi, dieser verrückte Syrer, der da drüben die Macht an sich reißen wollte, erschossen wurde. Man hat nie herausgefunden, wer ihn getötet hat.«
Robie schwieg weiterhin.
»Ich werde dich nicht fragen, ob du und Jessica etwas damit zu tun hattet. Ich weiß, dann wirst du wieder nur diesen leeren Blick aufsetzen. Aber wenn du was damit zu tun hattest, war deine Mission scheint’s erfolgreich. Also muss es etwas anderes sein. Hat es mit Jessica zu tun?«
»Warum fragst du das?«, sagte Robie plötzlich.
»Weil es für dich in deiner Agency gut lief. Bis sie auftauchte.«
»Ich kann dir da nicht ganz folgen, Julie.«
»Weil ich sie … na ja … Ich mag sie. Ich glaube, sie ist ein guter Mensch.«
»Das glaube ich auch«, sagte Robie und biss sich dann auf die Zunge.
Julie lächelte. »Cool.«
»Was?«
»Du lässt bei mir die Deckung fallen. Dir muss wirklich etwas an ihr liegen«, fügte sie in ernsterem Tonfall hinzu.
»Ich kann nachempfinden, was sie durchmacht«, sagte Robie diplomatisch.
»Also ist sie deine Freundin?«
»Ja.«
»Du musst auf deine Freunde aufpassen, Will.«
»Ich versuche es, Julie. Ich versuche es wirklich.«
»Wirst du jemals wirklich all diesen Scheiß los sein?«
»Ich wünschte, ich wüsste es.«
***
Als sie das Restaurant verlassen und Robie Julie abgesetzt hatte, summte sein Telefon. Es war Reel. »Ich glaube, wir müssen reden.«
»Okay.«
»Aber du wirst verfolgt, und ich hätte gern etwas Privatsphäre.«
Robies Blick huschte zum Rückspiegel. Ihm fiel ein Wagen hinter ihm auf. Zwei Fahrzeuge befanden sich zwischen ihnen.
»Okay. Mal sehen, was ich tun kann.«
»Nicht nötig. Ich kümmere mich darum.«
»Dann bist du also auch hinter mir?«
»Musst du das wirklich fragen? Wie geht es Julie?«
»Sie macht sich Sorgen. Wo sollen wir uns treffen?«
»Für den Fall, dass jemand mithört … unser bevorzugter Ort bei Regen.«
»Habe verstanden.«
»Bieg an der nächsten Kreuzung rechts ab. Drück aufs Gas, sobald du die Gasse erreichst.«
Robie unterbrach die Verbindung und trat aufs Gaspedal. Er bog rechts ab, und sein Beschatter folgte ihm.
Er kam an der Gasse vorbei und beschleunigte. Die Lücke zwischen ihm und dem Verfolger wurde größer. Im Rückspiegel beobachtete Robie, wie ein Sattelschlepper auf die Kreuzung rollte und sie blockierte.
Er hörte, wie Bremsen quietschten und eine Hupe dröhnte.
»Gut gemacht, Jessica«, murmelte er.
Er drückte weiter aufs Gas, bog ein paar Mal ab, erreichte dann die Constitution und fuhr am Washington Monument vorbei, das nach dem Erdbeben nun nicht mehr in ein Gerüst eingekleidet und wieder wie der Eiffelturm angestrahlt war. Manche Menschen waren der Ansicht, man hätte das Gerüst besser stehen lassen sollen.
Nachdem er fünf Minuten später insgesamt fünf Mal abgebogen war, lenkte er den Wagen an den Bordstein, schob den Hebel auf Parken, schaltete den Motor ab und stieg aus. Er ging zu dem Auto, das vor ihm stand, und setzte sich auf den Beifahrersitz. Jessica Reel ließ den Motor an und fuhr los.
»Wohin?«, fragte er.
»Nirgendwohin. Ich will nur in Bewegung bleiben, während wir uns unterhalten.«
»Worüber unterhalten?«
»Die Burner Box.«
»Wir waren beide schon da, Jessica.«
»Und du willst wirklich noch einmal dorthin?«
»Ich glaube nicht, dass wir da die Wahl haben.«
»Du hast die Wahl, Will. Eigentlich wollen sie nur mich. Ich gehe. Du musst nicht mit rein.«
»Mitgegangen, mitgefangen.«
Sie fuhr an den Straßenrand und schaltete den Motor aus. »Wenn du glaubst, mir einen Gefallen zu tun, indem du mich begleitest … das tust du nicht. Da muss ich mir nur noch um ein Problem mehr Sorgen machen.«
»Wann habe ich je verlangt, dass du dir um mich Sorgen machst?«
»Du weißt, wovon ich rede. Es ist besser, wenn ich allein gehe.«