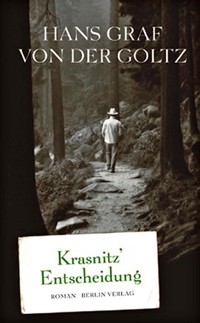Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Lazarett, dem Ort der Todesnähe, dämmert Andreas zwischen Schlaf und Tagträumen vor sich hin. Der Arzt, der hier an Gottes Stelle tritt, hatte in Stalingrad den Tod gesucht. Nun gibt er Andreas noch eine Frist. Doch warum weiterleben? Marianne, die Mutter seines Kindes, hat ihn aus Angst vor dem Alleinsein verlassen. Die Schulkameraden waren noch im April 1945 bei der Schlacht um die Seelower Höhen gestorben. Gibt es einen Weg zurück? Sensibel, bildmächtig und mit einer Wucht, die auf den existenziellen Kern gerichtet ist, stemmt sich diese Prosa gegen das Vergessen. Ergeben Begriffe wie Verantwortung und Liebe noch einen Sinn, wenn im Krieg das Fundament der Werte zutiefst erschüttert ist? Hans Graf von der Goltz hat mit einer Präzision, die nur die Poesie erreichen kann, eine ergreifende Erzählung geschrieben. In einer Sprache, die wie schwebend Atmosphären zaubert, nähert er sich auf der Basis eigenen Erlebens elementaren Situationen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Graf von der Goltz
Am Rande der Zeiten
Eine Erzählung gegen das Vergessen
Saga
Im Lazarett, dem Ort der Todesnähe, dämmert Andreas zwischen Schlaf und Tagträumen vor sich hin. Der Arzt, der hier an Gottes Stelle tritt, hatte in Stalingrad den Tod gesucht. Nun gibt er Andreas noch eine Frist. Doch warum weiterleben? Marianne, die Mutter seines Kindes, hat ihn aus Angst vor dem Alleinsein verlassen. Die Schulkameraden waren noch im April 1945 bei der Schlacht um die Seelower Höhen gestorben. Gibt es einen Weg zurück? Sensibel, bildmächtig und mit auf den existenziellen Kern gerichteter Wucht stemmt sich diese Prosa gegen das Vergessen.
Der Mann, der mich schlafen ließ, musste doch ein Gott gewesen sein. Er hatte seine trockene Hand auf meine Stirn gelegt und gesagt: »Schlafen Sie jetzt!«
Und ich schlief. Es war gut, zu schlafen. Warum hatte der Gott ein so ernstes Gesicht? Er hatte es gesagt, und ich schlief, und es war gut. Er trug einen weißen Kittel. Die trockene Hand war noch da, als das Gesicht schon ganz weit und hoch über mir schwebte. Es entfernte sich immer mehr. Ich fiel tiefer hinein in meinen Schlaf. Noch war es da, ein Schimmer, Wolken, ein Stern ...
Ich lag unter einer geräumigen Stahlglocke. Ich hatte diesen ganzen Raum für mich. Das Echo meines Gesangs kam von weither. Ich ließ mich treiben, ohne die Grenzen zu erreichen. Hoch oben wurde mir schwindelig und ich kehrte rasch in meine Ruhe zurück. Ich war allein und still und im vollkommenen Glück.
Manchmal irrten Stimmen durch meinen Raum. Es war nicht recht deutlich, ob sie von außen gegen die Stahlwände prallten oder ob sie hier innerhalb des Raumes ihren unsichtbaren Ursprung hatten. Es waren verirrte Stimmen, sonst nichts. Ich hatte mich nicht um sie zu kümmern. Sie verloren sich schnell. In meiner Stille verwehte die flüchtige Spur ihres unsicheren Weges.
Es war der Gott, der mich schlafen ließ. Er hatte ein ernstes Gesicht, als er mir das Glück gab: Schweben. Stille ...
*
Wie aber war ich hergekommen? Zu diesen weißen Göttern? Verloren als ein Mensch? War ich das noch, ein Mensch? Allein? Es muss doch die anderen gegeben haben. Lebende und Tote. Wo waren sie, die Toten? Ist keiner mit mir gekommen? Oder hat jeder seine eigenen Götter, seinen eigenen Tod? Und die Massengräber, von denen sie sprachen?
Warum ließ er mich schlafen, der Gott? Damit wir einander vergessen können? Die Menschen und die Götter.
Ich war den ganzen Tag gewandert. In der schrägen Sonne des Spätnachmittags erkannte ich das Ende des Tales. Ich würde es um Mitternacht erreichen, wenn ich weiterginge. Ich wollte nicht weitergehen und setzte mich an den Wegrand. Ameisen hatten ihre breite Straße über den Weg gebaut. Morgen würde ich zum Ende des Tales wandern. Es blühte um mich her. Von nahen Felsen strömte es warm zurück. Der Sommer war lang. Vielleicht lag hinter den Bergen der Herbst. Ich musste verweilen.
So weit weg war die Stimme. Zwischen uns lag das Tal. Ein Sommerweg. Oder das Ende, vor dem mein Name stand.
»Sehen Sie nur diese Ameisen!« Ich hatte ein Hölzchen genommen und half damit einer Verirrten auf die breite Straße zurück.
»Sie haben nicht mehr viel Zeit!«, erwiderte die Stimme.
Ich lachte. Doch dann blickte ich auf: Etwas Trauriges lag in dieser Stimme. Der weiße Kittel stand aufrecht vor mir. Ernst sah das bereits vertraute Gesicht auf mich herab.
»Herr Doktor«, sagte ich und wollte ihm freundlich zunicken, »Herr Doktor, wir sollten die Ameisen verfolgen, einen Sommer lang ihren Weg verfolgen.« Und mit einem Hölzchen half ich wieder, so gut ich es vermochte.
Als ich aufblickte, war ich allein. Vom Tal herauf wurde es Abend. Die Berge vor mir, am Ende des Tales, hielten das Licht noch lange.
Keine Stimme sprach –
*
Der Vater war doch gerade erst gefallen. Als Sanitätsoffizier in Russland, an der Spitze eines Verwundetentransportes. So lautete die Nachricht. Und bald darauf war die Mutter verschwunden, für immer. Man habe sie abgeholt, hieß es. Zwei Männer in Zivil, während er in der Schule war.
»Gestapo wahrscheinlich«, sagte man. Aber niemand wusste Genaues. Und niemand sprach mit ihm. Niemand wollte etwas von ihm wissen. Er war sechzehn Jahre alt. Er ging in die Schule. Er schwieg.
Bis Marianne, die Kunstlehrerin, ihn ansprach. Andreas tat ihr leid. Er war fünf Jahre jünger als sie. Sie ging mit ihm nach Hause, half ihm beim Kochen, beim Aufräumen.
Einmal fragte sie ihn, ob seine Mutter vielleicht Jüdin sei. Sie fragte mit mitleidiger Stimme. Und als er nur den Kopf geschüttelt hatte, ein wenig erschrocken, fragte sie ihn noch, ob die Mutter vielleicht etwas gegen die »Partei« gesagt hätte.
Doch als er auch jetzt nur mit den Schultern gezuckt hatte, hörte sie auf mit den Fragen. Für immer. Er hatte keine Mutter mehr. Die Lehrerin kam einfach mit ihm, Tag für Tag. Und es vergingen nur noch wenige Tage, bis sie ihn küsste. Und bald wurde Liebe daraus. Für beide zum ersten Mal.
Er war kaum siebzehn geworden, als sie ihm auf dem gewohnten Weg von der Schule zu seiner Wohnung eröffnete, sie sei nun schwanger, ruhig, als sei das selbstverständlich.
Er erschrak nicht, er dachte nur nach. Sie wartete, blickte ihn nicht an.
Als er die Wohnungstür hinter sich geschlossen und den Schlüssel zweimal herumgedreht hatte, fragte er nur, ohne Marianne dabei anzusehen, ob sie nun heiraten würden?
Sie nahm ihn in ihre Arme, küsste ihn. Sie würden wohl noch warten müssen! Jahre! Sie sprachen nicht mehr darüber. Ihm war das recht. Fast war er erleichtert.
Dann kam der Brief. Er hatte ihn eingesteckt. Denn es war der Tag, an dem das Kind geboren worden war.
»Dein Sohn!«, rief Marianne ihm entgegen. Er wusste, sein Gesicht hätte nun strahlen müssen. Aber da war dieser Brief.
»Freust du dich nicht?«, fragte sie. Vielleicht braucht er einfach Zeit, dachte sie.
Dann konnte er den Brief nicht mehr verbergen. Er zog ihn aus der Tasche, entfaltete ihn und hielt ihn ihr entgegen. »Mein Einberufungsbefehl!«, rief er.
»Zum Militär? Mit siebzehn Jahren?« Sie schrie beinahe, während sie das Baby fest an ihre Brust presste.
»In einer Woche in der Kaserne!« Seine Stimme zitterte.
Würde das Kind noch einen Vater haben?, war alles, was sie in diesem Augenblick denken konnte. Andreas spürte das. Er versuchte, so zu denken wie Marianne. Es gelang ihm nicht. Die Angst gewann heimlich überhand ...
*
Warum hattet ihr mich damals schon gerufen. Mit eurem: »Sie haben nicht mehr viel Zeit!« Das ich nicht verstehen will. Da die Götter sich mehr und mehr verwandelten in Stimmen hinter Stahlwänden, mir ihren flüchtigen Spuren: »Drei bis vier Jahre vielleicht!« Sie standen in langen Kapuzen um mein Bett herum. Sie hatten keine Gesichter. Der weiße Kittel und hoch oben ungreifbar der strenge Blick. Er ließ mich schlafen. Die Kapuzen wandten sich ab.
*
Ich hatte die Brandung hinter mir. Die See war grau und ruhig. Was aber tat ich hier? Ich legte mich zurück. Eine leichte Dünung nahm das Boot in langsam kreisende Bewegung. Sie war kaum spürbar, wenn man auf dem Boden des Bootes lag. Der Himmel stand auf dem Bootsrand wie eine lichte Säule, reglos und ohne sichtbare Wandlung. Um den Strand zu sehen, hätte ich mich aufsetzen müssen. Ich hatte kein Verlangen nach dem Strand und war froh, dass auch seine Laute verschwommen blieben. Sie ließen sich auflösen in der ungewissen Transparenz des Traumes.
Am Strand lauerte die Zeit. Ich versuchte, mich zu erinnern. Die Sonne flirrte über den Sand. Wind trieb ein Stück Zeitungspapier träge vor sich her. Die Zeit hatte kein Gesicht. Sie wurde von eckigen Zeigern zerschnitten. Tausend farblose Fetzen wehten über den Horizont. Die Zeit lag zwischen Zeigern. Eine Stunde. Ein Tag. Ein Jahr.
Ferner Gesang künstlicher Stimmen. Über dem Boot stand der Himmel, reglos und ohne sichtbare Wandlung. Eine lichte Säule über stetig kreisender Bewegung.
*
Über dem Bett an der Wand hängt ein schweigsamer Mann. Er hat den Kopf in versonnener Betrachtung zur Seite geneigt und blickt an meinem Aufschauen vorbei in die einsame Welt des Leides, die zu tragen er geschaffen wurde. Er ist fern und unberührt von den Gebeten. Nur nachts, wenn die Dunkelheit mich von seinem Blick befreit, bete ich zu seinen Armen, die weit ausgebreitet sind. Ein wortloses Gebet ohne Antwort. Aber manchmal, glaube ich, kommt etwas an. Dann öffne ich plötzlich die Augen und lasse dieses große Dunkel gewähren.
Die Wände stehen weiß um mich herum und öffnen sich den Bildern. Dort ist das Haus. Gegen den Abendhimmel treten seine Umrisse stark hervor. Am Zaun steht das Kind und winkt. Ich gehe mit freudigen Schritten in seine Richtung und rufe. Doch ich bin noch zu weit entfernt. Es kann mich nicht hören. Ich beginne zu laufen, aber ich komme nicht näher heran. Das Kind winkt. Ich gerate außer Atem und bleibe stehen.
»Gleich wird es müde werden«, denke ich. Da lässt es langsam und sichtlich enttäuscht den Arm sinken und wendet sich ab und dem Haus zu. Nach ein paar Schritten setzt es sich auf den Kiesweg und spielt mit den Steinen. Ich warte, aber es blickt nicht mehr auf.
Allmählich beginnt es zu dämmern. In der Haustür erscheint Marianne. Sie muss dem Kinde gerufen haben, denn es erhebt sich zögernd, ohne den Blick sogleich von den Steinen zu lösen, und wandert bedächtig und mit ein wenig zu großen Schritten in das Haus. Einen Augenblick steht der Lichtschein der Tür vor der dunklen Silhouette des Hauses.
Ich verharre ohne Bewegung unter der Reglosigkeit der Sterne ...
Schlaf geht durch die Alleen. Unter den Moosen wartet die Zeit. Im Mondschatten der Mauern verklingen die geschäftigen Schritte. Hinter verschlossenen Gittern, die in der Ruhe noch knarren, greifen die Hände ins Leben. Fische springen aus Sternenwassern, und ein Bogen der Lust spannt sich über dem Land. Durch ein weißes Tor zieht das Erkennen in den schwerelosen Traum ...
Sie stand mir gegenüber an der Wand. Um ihre Lider zuckte es, aber sie weinte jetzt nicht mehr. Ich sah, dass sie gern geweint hätte, und ich wusste, dass sie weinen würde, nachdem sie