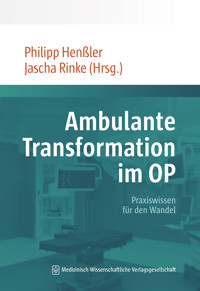
Ambulante Transformation im OP E-Book
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Gesundheitssektor verändert sich rasant: Stationäre Eingriffe gehen zurück, ambulante Operationen gewinnen immer stärker an Bedeutung. Der Fachkräftemangel, steigende Kosten und der demografische Wandel stellen Krankenhäuser und Praxiskliniken vor große Herausforderungen. Neue technologische Entwicklungen und veränderte Patientenbedürfnisse verstärken diese Veränderungen zusätzlich. Besonders OP-Bereiche stehen im Fokus des Wandels. Doch die Umsetzung erfordert weit mehr als die bloße Verlagerung von Operationen – sie erfordert eine grundlegende Transformation von Abläufen, Strukturen und Denkweisen. Eine enge Verzahnung ambulanter und stationärer Leistungen, moderne OP-Planung und interdisziplinäre Zusammenarbeit werden essenziell, um eine zukunftssichere Versorgung zu gewährleisten. Das Buch „Ambulante Transformation im OP“ begleitet Klinikleitungen und Entscheidungsträger auf diesem Weg. Es liefert praxisnahe Strategien zur erfolgreichen Einführung ambulanter OP-Strukturen, von der Wettbewerbsanalyse über OP-Planung und Prozessoptimierung bis hin zu wirtschaftlichen und regulatorischen Aspekten. Erfahrene Experten aus der Praxis teilen ihre Expertise und geben wertvolle Einblicke in erfolgreiche Transformationsprozesse. Neben fachlichem Know-how werden auch die organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen beleuchtet. Das Buch zeigt, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit, effiziente Prozessgestaltung und smarte Raumkonzepte zu einer erfolgreichen Transformation beitragen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Philipp Henßler | Jascha Rinke (Hrsg.)
Ambulante Transformation im OP
Praxiswissen für den Wandel
mit Beiträgen von
A. Bertram | F. Dunkel | C. Ehser | S.J. Elmshäuser | J. Graf | P. Henßler | M. Heurich | J.M. Hodek | R. Hoheisel | S. Holter | A.O. Kern | C. Kurscheid | B. Mierau | C. Nitschke | B. Poweleit | M. Reggentin | P. Rettig | A. Rinke | J. Rinke | R. Schmid | C. Schneekloth | W. Schöner | A. Wasner | R. Wasner | N. Wisniowski | M. Zebulka-Rinke
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Die Herausgeber
Philipp Henßler
RINKE+HENSSLER GmbH
Kirchheim unter Teck
Jascha Rinke
RINKE+HENSSLER GmbH
Düsseldorf
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstr. 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-992-9 (eBook: PDF) ISBN 978-3-95466-993-6 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2025
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Daher kann der Verlag für Angaben zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen (zum Beispiel Dosierungsanweisungen oder Applikationsformen) keine Gewähr übernehmen. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Dennis Roll, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout & Satz: Meta Systems Publishing & Printservices GmbH, Wustermark
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Cover: © MEDIK Hospital Design GmbH
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Geleitwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die deutsche Krankenhauslandschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Herausforderungen wie der demografische Wandel, der medizinisch-technische Fortschritt, steigende Patientenerwartungen und nicht zuletzt die ökonomischen Rahmenbedingungen erfordern ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir Krankenhäuser und ihre zentralen Bereiche betreiben und die Patientenversorgung gestalten. Als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) sehe ich es als eine unserer zentralen Aufgaben an, diese Veränderungen aktiv zu begleiten und die Kliniken auf diesem Weg zu unterstützen.
Das vorliegende Fachbuch „Ambulante Transformation im OP“ greift ein Thema auf, das für die Zukunft unserer Krankenhäuser von entscheidender Bedeutung ist: die zunehmende Verlagerung von stationären hin zu ambulanten Operationen. Diese Entwicklung ist nicht nur eine Antwort auf gesundheitspolitische und ökonomische Vorgaben, sondern vor allem eine Chance, die Flexibilität in der Patientenversorgung weiter zu verbessern, die Effizienz unserer Krankenhäuser zu steigern und den sich verändernden Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden.
Die ambulante Transformation ist jedoch kein Selbstläufer. Sie erfordert eine umfassende Anpassung von Prozessen, Infrastrukturen und personellen Strukturen. Viele Krankenhäuser stehen vor der Herausforderung, ihre traditionellen Operationsbereiche so umzugestalten, dass sie sowohl stationäre als auch ambulante Eingriffe effizient und sicher durchführen können. Dieses Buch bietet hierfür einen praxisnahen Leitfaden, der auf fundiertem Fachwissen und konkreten Erfahrungen aus der Praxis basiert.
Die ambulante Chirurgie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Eingriffe, die früher einen stationären Aufenthalt erforderten, können heute ambulant durchgeführt werden. Dies bringt Vorteile für die Patienten, die kürzere Liegezeiten und eine schnellere Rückkehr in ihr gewohntes Umfeld erleben, aber auch für die Krankenhäuser, die ihre Ressourcen effizienter einsetzen können. Doch die Umsetzung dieser Veränderungen ist komplex. Sie erfordert nicht nur technische und infrastrukturelle Anpassungen, sondern auch eine Neuorganisation von Arbeitsabläufen und eine Weiterentwicklung der personellen Kompetenzen.
Dieses Buch vereint die Expertise von Fachleuten aus den Bereichen Medizin, Pflege, Medizintechnik und Infrastruktur. Es bietet nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen und Praxisbeispiele, die als Inspiration und Orientierungshilfe dienen können. Die Beiträge der Expertinnen und Experten zeigen, dass die ambulante Transformation im Operationssaal eine interdisziplinäre Aufgabe ist, die nur durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden kann.
Als Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßen wir Initiativen wie diese, die den Wissenstransfer fördern und die Krankenhäuser bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen unterstützen. Wir sind überzeugt, dass die ambulante Transformation im Operationssaal ein zentraler Baustein für die Zukunftsfähigkeit unserer Krankenhäuser ist. Sie ermöglicht es uns, den steigenden Anforderungen an eine moderne, patientenorientierte und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung gerecht zu werden. Dabei ist zu beachten: Die ambulante Transformation im Operationssaal ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein langfristiger Prozess, der kontinuierliche Anpassungen und Innovationen erfordert. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Effizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit zu finden, ohne dabei die Bedürfnisse der Patienten und des Personals aus den Augen zu verlieren. Dieses Buch soll Ihnen dabei helfen, diesen Prozess aktiv zu gestalten und die Chancen, die sich daraus ergeben, bestmöglich zu nutzen.
Als Deutsche Krankenhausgesellschaft werden wir uns auch in Zukunft dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche ambulante Transformation zu schaffen. Dazu gehören nicht nur politische und finanzielle Aspekte, sondern auch die Förderung des Wissenstransfers und der Vernetzung zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen. Wir sind überzeugt, dass nur durch eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten – von den Krankenhäusern über die Politik bis hin zu den Patienten – eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung gelingen kann.
Dr. Gerald Gaß
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft
Im Juni 2025
Vorwort
Als wir uns vor einigen Jahren intensiver mit der ambulanten Versorgung beschäftigten, war das weniger strategisches Kalkül als vielmehr eine Reaktion auf das, was uns in der Realität tagtäglich begegnete: ineffiziente Abläufe, starre Strukturen, teils defizitäre Leistungserbringung – und ein wachsender Widerspruch zwischen medizinischem Fortschritt und dem realen Klinikalltag. Was uns zunächst unabhängig voneinander bewegte – Philipp Henßler als Klinikdirektor, Jascha Rinke als Praxisklinikgeschäftsführer – wurde rasch zur gemeinsamen Mission: den Wandel nicht nur zu verwalten, sondern aktiv zu gestalten.
Philipp Henßler versuchte in seiner Rolle als Klinikdirektor mit Bordmitteln auf das zu reagieren, was heute als „ambulante Transformation“ bezeichnet wird. Doch tatsächlich fühlte es sich anfangs selten nach echter Transformation an – eher nach Flickschusterei: Stationäre Strukturen wurden notdürftig angepasst, Prozesse blieben kompliziert, Räume zu groß, Teams teils überfordert. Es war, als wolle man einen schwerfälligen Tanker während der Fahrt in ein Schnellboot verwandeln.
Jascha Rinke dagegen hatte als Geschäftsführender Gesellschafter in der Praxisklinik, einem OP-Zentrum mit Privatklinik nach § 30 GewO, bereits die funktionierenden Strukturen und Prozesse geschaffen: kurze Wege, effiziente Abläufe, eingespielte Teams. Was funktionierte, war das operative Setting – was herausforderte, waren der rechtliche Rahmen und die Vergütung. Denn die Praxisklinik als Organisationsform existierte im Gesetz nur wenig konkret. Abrechnungsmechanismen waren bürokratisch erschwert. Der Alltag war fortschrittlich, die Systemlogik aber hinkte hinterher.
Diese unterschiedlichen Perspektiven haben unser Verständnis der ambulanten Transformation geprägt. Heute wissen wir: Ambulante Versorgung ist kein einfacher Umbau des Bestehenden. Sie ist ein tiefgreifender Wandel – technisch, organisatorisch, kulturell. Und genau deshalb braucht es das Zusammenspiel verschiedener Sichtweisen, Erfahrungen und Professionen.
Die Idee zu diesem Buch ist aus genau diesem Geist entstanden. Es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis. Geschrieben von Klinikgeschäftsführern, OP-Managern, Pflegedirektoren, OTAs, Ärzten, Architekten, Rechtsanwälten und Gesundheitsökonomen. Menschen, die selbst mitten im Wandel stehen. Die gestalten – nicht kommentieren.
Dieses Buch ist kein theoretischer Sammelband, sondern ein Werkzeugkasten. Es bündelt konkretes Praxiswissen für den Wandel, Erfahrungsberichte, Modelle, Learnings und Umsetzungshilfen. Es richtet sich an alle, die mit der Transformation ihres OPs befasst sind – egal, ob sie am Anfang stehen oder schon mittendrin. Und es versteht sich als Einladung: zum Nachdenken, zum Nachmachen und zum mutigen Vorangehen.
Ambulante Versorgung ist heute kein optionales Zusatzgeschäft mehr. Sie wird – ob wir wollen oder nicht – ein integraler Bestandteil der Krankenhauslandschaft der Zukunft. Und sie birgt große Chancen: für mehr Flexibilität, effizientere Nutzung von Ressourcen, kürzere Verweildauern und eine patientenzentrierte Versorgung.
Aber: Der Weg dorthin ist anspruchsvoll. Ambulante Transformation bedeutet eben nicht nur Umstrukturierung, sondern auch Kulturwandel. Sie verlangt neue Denkweisen, neue Rollenbilder – und manchmal auch den Abschied von lange gepflegten Selbstverständlichkeiten.
Unsere eigene Reise begann mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen: die eine tief verankert im stationären System, die andere geprägt durch ambulantes Denken. Heute sehen wir, wie sehr sich beides ergänzt. Ambulante Transformation gelingt nicht im Silo – sondern nur, wenn sektorübergreifend gedacht und gehandelt wird.
Wir danken allen Mitautorinnen und Mitautoren, die in diesem Buch ihre Perspektiven teilen – offen, realistisch und immer mit dem Blick auf die Praxis. Sie alle machen dieses Buch zu dem, was es ist: ein Kompendium des Handelns. Kein Hochglanz-Versprechen, sondern ehrliche Erfahrungswerte.
Und wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sich mit diesem Buch auf den Weg machen. Vielleicht suchen Sie Inspiration. Vielleicht praktische Hilfe. Vielleicht eine Bestätigung für das, was Sie ohnehin schon tun. Was auch immer Sie antreibt – wir wünschen Ihnen Mut, gute Mitstreitende und die nötige Klarheit, um den Wandel aktiv zu gestalten.
Dieses Buch ist unser gemeinsamer Beitrag dazu.
Philipp Henßler und Jascha Rinke
Im Juni 2025
Inhalt
I Entwicklung im Gesundheitswesen
1 Die Bedeutung der ambulanten Transformation im OP: Zukunftssicherheit durch Flexibilität, smarte Prozesse und Effizienz Philipp Henßler
2 Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen: Von der Trennung in ambulanten und stationären Sektor hin zur Unterscheidung zwischen standardisierbaren und nicht standardisierbaren Leistungen Jascha Rinke
3 Herausforderungen und Chancen der Ambulantisierung Nora Wisniowski, Pia Rettig und Clarissa Kurscheid
4 INTERVIEW: Demografischer Wandel und seine Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung Axel Olaf Kern und Philipp Henßler
5 Ambulante Transformation im internationalen Vergleich: Angebot und Nachfrage im Gesundheitswesen Jan-Marc Hodek
6 Ambulante Transformation als Zukunftsmodell Philipp Henßler
Lessons Learned: Ambulantisierung strategisch verstehen – und gezielt handeln
II Analyse und Planung
1 Markt, Mensch, Mehrwert: Ambulante Operationen strategisch positionieren Stefan J. Elmshäuser
2 Analyse von Struktur- und Leistungsdaten: (Ambulante) Potenziale erkennen und nutzenManuel Heurich
3 Short-Track statt stationär: Wie Clusterung und Erfahrung neue Versorgungspfade eröffnen Achim Bertram und Jascha Rinke
4 OP-Planung für die ambulante Transformation: Herausforderungen und Lösungsansätze Jens Graf
5 Machbarkeitsstudie und Anforderungsprofil: Von der Idee eines ambulanten OP-Zentrums zur Umsetzung Philipp Henßler und Jascha Rinke
Lessons Learned: Ambulante Transformation beginnt mit Analyse – und endet mit realistischer Planung
III Konzeption und Umsetzung
1 Die clevere Planung des OP Björn Mierau und Martin Zebulka-Rinke
2 Wirtschaftlichkeitsberechnung OP: Zahlen, Daten, Fakten Wolfgang Schöner
3 INTERVIEW: Zwischen Evidenz und Tradition: Hygienekonzepte im OP neu denken Reimund Hoheisel und Jascha Rinke
4 Rechtliche Rahmenbedingungen für ambulante OP-Zentren Angélique Rinke
5 Optimierung von Prozessen und Raumfunktionen: Veränderung gestalten Frederik Dunkel und Jascha Rinke
Lessons Learned: Vom Konzept zur Umsetzung – ambulante OPs realisierbar planen
IV Betrieb und kontinuierliche Optimierung
1 INTERVIEW: Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Expertenwissen nutzen: Ambulante OP-Prozesse im Krankenhaus aus Sicht der Anästhesie Roger Schmid und Jascha Rinke
2 Projektmanagement: Projektentwicklung und Projektsteuerung zur Integration ambulanter OPs in BestandsstrukturenRainer Wasner und Andreas Wasner
3 Ambulantes Operieren im Krankenhaus und Deckungsbeitrag – geht das? Sven Holter
4 Erfolgsfaktor Führung: Personalstrategien für die ambulante OP-Transformation aus Sicht eines Pflegedirektors Bernd Poweleit
5 Evaluation und Benchmarking im OP: Verbessern statt nur messen Marc Reggentin
Lessons Learned: Betrieb bedeutet nicht Routine, sondern gezielte Steuerung
V Ambulante Transformation in der Praxis: Erfahrungsberichte und Erfolgsmodelle
1 Praxisklinik im Wandel: Ambulante Operationen als Erfolgsmodell Carsten Nitschke
2 Short-Track statt stationär: Wie Clusterung und Erfahrung neue Versorgungspfade eröffnen Carsten Schneekloth und Jascha Rinke
3 Ambulante Versorgung neu denken: Zwischen Erwartung, Realität und Systemgrenzen Christian Ehser und Jascha Rinke
Lessons Learned: Erfahrung ersetzt Theorie nicht – aber sie zeigt, was funktioniert
VI Fazit
1 Ambulante Transformation als gemeinsame Aufgabe – ein realistischer Ausblick Philipp Henßler und Jascha Rinke
VII Checklisten
Checkliste: Short‑Track‑Prozess für standardisierbare OP‑Fälle
Checkliste: Grundsätzliche Realisierbarkeit eines OP-Zentrums im Bestandsgebäude
Checkliste: Wirtschaftliches Potenzial der Ambulantisierung im OP erkennen und heben
Checkliste: Ambulante OPs erfolgreich integrieren – Projektziele klar steuern
Das Autoren-Team
Sachwortverzeichnis
I Entwicklung im Gesundheitswesen
1 Die Bedeutung der ambulanten Transformation im OP: Zukunftssicherheit durch Flexibilität, smarte Prozesse und Effizienz Philipp Henßler
1.1 Warum wir über ambulante OP-Strukturen neu nachdenken müssen
Seit fast drei Jahrzehnten gibt es den AOP-Katalog – 1994 eingeführt mit dem Ziel, planbare Eingriffe aus dem stationären Bereich in ambulante Settings zu überführen. Ich selbst habe als Klinikdirektor über viele Jahre hinweg erlebt, wie wenig Relevanz dieses Instrument im Klinikalltag hatte. Die stationäre Logik war zu dominant, die Vergütung zu lukrativ, die Prozesse auf DRG optimiert. Ambulante Operationen wurden „mitgemacht“, aber nie in die strategische Steuerung integriert – weder in der Investitionsplanung noch im Personalmodell.
Diese Haltung holt uns jetzt ein – schrittweise, schmerzhaft, aber unausweichlich. Die laufende Erweiterung des AOP-Katalogs und der teilweise Umstieg von DRG auf sektorengleiche Pauschalen wie die Hybrid-DRG stellt die bisherigen Denk- und Betriebsmodelle infrage. OP-Strukturen, die gestern noch gut funktioniert haben, stoßen plötzlich an ihre Grenzen – wirtschaftlich, personell und organisatorisch.
Ich erinnere mich an unzählige Diskussionen im Leitungsteam, in denen wir ambulante Leistungen als „zusätzlichen Aufwand mit fraglicher Rendite“ behandelt haben. Und ich verstehe jeden Geschäftsführer, der sich bis heute mit der Frage quält, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Ambulante Eingriffe bringen oft geringe Einzelerlöse, fordern aber hohe Anpassungsleistungen vom gesamten Haus. Trotzdem bin ich überzeugt: Ambulante OPs sind kein Zusatz. Sie sind der Lackmustest dafür, ob ein Haus flexibel, effizient und wandlungsfähig genug ist, um in der nächsten Systemlogik zu bestehen.
„Das bin ich.“ – mögen sich Kollegen aus der Klinikleitung beim Lesen denken. Genau das war mein Ziel: die Realität abzubilden, wie sie ist – mit allen Zielkonflikten zwischen Wirtschaftlichkeit, Strukturvorgaben und Personalengpässen.
Und gleichzeitig zu zeigen: Ambulantisierung ist keine Pflichtaufgabe, sondern eine strategische Chance.
Wer ambulante Eingriffe konsequent in die Struktur und Prozesswelt integriert – trotz schwacher Einzelerlöse –, investiert in die Resilienz des gesamten Hauses. In eine Logik, die schneller, klarer und anpassungsfähiger ist als das, was uns in der DRG-Ära stark gemacht hat. Und vielleicht entsteht dabei sogar etwas, das wieder echten klinischen Gestaltungswillen freisetzt – nicht nur betriebswirtschaftliche Reaktion. Parallel hat das neue Mindset positive Auswirkungen auf das stationäre Setting.
Warum jetzt gehandelt werden muss
Mehrere Aspekte erhöhen aktuell den Handlungsdruck. Die wichtigsten Einflussfaktoren lassen sich wie folgt zusammenfassen (s. auch Abb. 1).
Abb. 1 Druck auf das System OP – sechs Hebel, die gleichzeitig wirken (eigene Darstellung)
Ambulante Eingriffe stehen unter politischer Beobachtung. Mit dem KHVVG, der Ausweitung des AOP-Katalogs und der Einführung der Hybrid-DRG wächst der Erwartungsdruck, Sektorengrenzen zu überwinden – auch wenn die Rahmenbedingungen noch nicht flächendeckend tragfähig sind.
Patienten fragen verstärkt ambulante Versorgung nach. Vor allem bei planbaren Eingriffen steigt die Erwartung an kurze Wege, eine geringe Verweildauer und eine schnelle Rückkehr in den Alltag unter Berücksichtigung der Versorgungssituation zu Hause.
Der Personalmangel lässt klassische stationäre OP-Logik an ihre Grenzen stoßen.
Ambulante Kapazitäten schaffen mehr Beweglichkeit in der Leistungssteuerung. Sie entlasten nicht automatisch die DRG-Bereiche – aber sie ermöglichen es Häusern, auf veränderte Fallzahlen, zusätzliche Nachfrage und Leistungsgruppen flexibler zu reagieren.
Der Medizinische Dienst verschärft die Prüfung stationärer Behandlungsnotwendigkeit. Immer mehr Eingriffe werden als fehlbelegt eingestuft – mit direkten Erlösverlusten. Ambulante Alternativen zu haben, wird zunehmend zur Voraussetzung für wirtschaftliche Absicherung.
Investitionsentscheidungen müssen heute zukunftsfest sein. Wer jetzt in starre stationäre OP-Kapazitäten investiert, riskiert, in fünf Jahren an der Realität vorbei geplant zu haben. Ambulant gedachte Konzepte sind keine Nische, sondern eine Absicherung gegen Fehlentwicklung.
1.2 Ambulantisierung ist kein Projekt – sondern eine Strukturfrage
Viele Krankenhäuser behandeln Ambulantisierung wie ein weiteres Projekt auf der langen To-do-Liste. Ein paar Fälle identifizieren, Raum umwidmen, Prozesse anpassen – fertig. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Ambulante Transformation ist keine Maßnahme, sondern eine tiefgreifende Strukturfrage.
Denn die Frage lautet nicht: „Was können bzw. müssen wir ambulant machen?“, sondern: „Sind unsere OP-Strukturen überhaupt dafür gemacht?“Die Antwort lautet oft: Nein.
Die Realität sieht so aus: Ambulante Patienten durchlaufen dieselben Umbett-Schleusen, dieselben Vorbereitungsbereiche, dieselben Dokumentationsprozesse – obwohl ihre Versorgung viel standardisierter und zeiteffizienter erfolgen könnte. Die bestehende Infrastruktur stammt aus einer DRG-Welt. Doch ambulante Eingriffe folgen anderen Regeln – zeitlich, räumlich und wirtschaftlich.
Typisches Beispiel aus dem Alltag
Ein ambulanter Eingriff dauert 25 Minuten.
Die Umkleide- und Schleusenzeit, ggf. Nutzung Bettenschleuse: 20 Minuten.
Der Transferweg durch das Haus: 5 Minuten hin, 5 Minuten zurück.
Fazit: Die Struktur ist teurer als die Operation.
Ambulante OPs brauchen keine Ausnahmegenehmigung. Sie brauchen eigene Bedingungen.
Praxistipp: Checkliste – Warnsignale für strukturelle Untauglichkeit
Es ist kein separater Pfad für ambulante Patienten vorhanden.
Ambulante Eingriffe stören den stationären Ablauf oder umgekehrt.
Die Kapazität des Aufwachraums reicht nicht aus, Stau und Wartezeiten entstehen.
Es gibt keinen klar definierten Tagesverlauf für ambulante Patienten.
Personal springt zwischen ambulanter und stationärer Logik hin und her.
Eine wirtschaftliche Bewertung des ambulanten OP-Settings fehlt vollständig.
Kernaussage: Ambulantisierung braucht keine neue Haltung – sondern ein neues Betriebssystem.
1.3 Flexibilität im OP als Schlüssel zur Zukunftssicherheit
Krankenhäuser sind traditionell auf Stabilität ausgelegt: feste Belegzeiten, festes Personal, feste Abläufe. Doch in einem Gesundheitswesen, das sich ständig wandelt – regulatorisch, ökonomisch und gesellschaftlich –, wird diese Stabilität schnell zur Starrheit. Zukunftssicherheit entsteht heute nicht durch Größe oder Marktanteil, sondern durch Anpassungsfähigkeit. Und die beginnt im OP.
Ein flexibles OP-Setting ist die Voraussetzung, um ambulante Leistungen effizient zu erbringen – auch dann, wenn sich Fallzahlen, Leistungsgruppen oder gesetzliche Rahmenbedingungen kurzfristig ändern. Diese Flexibilität entsteht nicht durch „gute Organisation“, sondern durch gezielte Strukturentscheidungen: räumlich, prozessual und personell.
Nicht die größte Klinik wird bestehen, sondern die anpassungsfähigste.
Was bedeutet Flexibilität im OP konkret?
Die ambulante Zukunft braucht keine Improvisation im Bestand, sondern klare, belastbare Strukturen. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Short-Track-OP: eine organisatorisch und räumlich getrennte Einheit für elektive stationäre und ambulante Eingriffe – unabhängig vom Zentral-OP, in dem komplexe und ungeplante Notfalloperationen erfolgen. So entstehen eindeutige Patientenspuren, kurze Wege, minimierte Wechselzeiten und ein separater Takt für Personal und Prozesse.
Diese Struktur macht den OP zur adaptiven Einheit – nutzbar für verschiedene Fachrichtungen, externe Partner oder als eigenständige ambulante Säule im Haus.
Typische Merkmale flexibler OP-Konzepte
Schleusensystem als zentrales Element
redundante, standardisierte OP-Säle
intelligente Vor- und Nachbereitung
dezentrale Lagerhaltung und kurze Wege
modulare Personalkonzepte mit klarer Rollentrennung
wirtschaftlich und organisatorisch klar abgegrenzte Einheiten
Zusammengefasst:
Flexibilität heißt nicht: „Wir können alles irgendwie.“ Flexibilität heißt: „Wir haben Strukturen, die verschiedene Szenarien sicher und effizient ermöglichen. Je nach Erfordernis können wir die Kapazitäten flexibel verteilen.“
1.4Prozesse – der unterschätzte Hebel
Viele Häuser starten die Ambulantisierung mit baulichen Überlegungen – weil diese greifbar, sichtbar und langfristig wirksam scheinen. Doch was oft unterschätzt wird: Nicht der Grundriss entscheidet über Effizienz, sondern der Ablauf. Ambulante Versorgung ist eine Prozessdisziplin. Wer Prozesse nicht neu denkt, wird auch mit einem optimierten Raumkonzept keine Wirkung erzielen.
Der stationäre Alltag ist geprägt von hoher Varianz: unterschiedliche Fälle, flexible Tagesverläufe, variable Personalbesetzungen. Ambulante OPs hingegen brauchen Standardisierung – von der Anmeldung bis zur Entlassung. Das bedeutet: Weniger Spielräume, mehr Klarheit. Und das wiederum verlangt, Prozesse aktiv zu gestalten – nicht einfach zu übernehmen.
Ein guter Prozess macht den Unterschied zwischen wirtschaftlich und belastend.
Wichtige Prozesshebel in ambulanten OP-Strukturen
Schleusenlogik: Separierung von Patienten- und Personalwegen – mit möglichst wenigen Schnittstellen
Standardisierung: feste Abläufe für Einleitung, OP, Nachbereitung und Entlassung
Taktung: zeitlich abgestimmte Slots mit klarer Personal- und Raumzuordnung
Materiallogistik: Vorbereitung und Wiederaufbereitung räumlich nah, mit kurzen Reaktionszeiten
Vorbereitung und Nachsorge: möglichst viele Prozessschritte außerhalb des OP (z.B. Prämedikation, Aufklärung, Entlassgespräch)
Hinweis zur Realität
Der Neubau eines ambulanten OPs ist nach aktueller Förderlogik nicht direkt förderfähig. Umso wichtiger ist es, Prozesse in bestehenden Strukturen so zu gestalten, dass ambulante Eingriffe auch ohne Neubau effizient erbracht werden können. Wer ambulant denkt, muss prozessorientiert planen – nicht nur bauen.
Reflexionsfragen für Klinikleitungen
Wie viele Minuten vergehen zwischen Eintreffen und OP-Beginn – und wie viel davon ist Prozessverschwendung?
Wie viele Personen sind involviert und wie oft muss der Patient umgelagert werden?
Gibt es täglich mehr Ausnahmen als Standards?
Ambulantisierung beginnt nicht mit dem Bagger, sondern mit dem Ablauf. Prozesse sind kein Nebenschauplatz – sie sind der operative Kern des Erfolgs.
1.5Wirtschaftlichkeit und Betrieb – ambulant lohnt sich nur, wenn man es ernst meint
Ambulante Operationen gelten als strategisch wichtig – aber wirtschaftlich oft als zweifelhaft. Und ja: Viele Eingriffe sind aktuell unterdurchschnittlich vergütet, vor allem im Vergleich zur stationären DRG-Welt. Doch daraus den Schluss zu ziehen, Ambulantisierung lohne sich nicht, greift zu kurz. Ambulant lohnt sich – wenn man es richtig macht. Es braucht klare Standards und Organisation, um mit der knappen Vergütung zurecht zu kommen.
Das Problem ist neben der oft nicht ausreichenden Vergütung die unklare Betriebskalkulation. Häufig wird ambulant „nebenbei“ betrieben – in bestehenden OPs, mit bestehendem Personal, ohne angepasste Prozesse. Die Folge: Versteckte Kosten, geringe Fallzahlen, ineffiziente Abläufe. Kein Wunder, dass unter dem Strich wenig übrig bleibt.
Ein OP, der für DRGs gebaut wurde, und insbesondere seine Nebenflächen können ambulant nicht effizient sein – egal wie gut der Dienstplan ist.
Was es braucht, damit ambulante OPs wirtschaftlich tragfähig sind
klarer Betriebsansatz: ambulante Eingriffe als eigene Leistungseinheit – mit eigenem Prozess, Personal und Controlling
transparente Kalkulation: Fixkosten, Verbrauch, Zeitaufwand, OP-Auslastung und Belegungszeit differenziert betrachten
flexibles Betriebsmodell: kombinierbar mit externer Nutzung (z.B. durch Belegärzte, MVZ, Kooperationspartner wie niedergelassene Ärzte)
klare Steuerung: OP-Zeit ist wertvoll – sie muss als Ressource aktiv geplant und bewirtschaftet werden.
skalierbare Struktur: Ambulante Leistungen müssen auch bei 100, 500 oder 2.000 Eingriffen im Jahr effizient funktionieren.
Typische Fehler
Es wird mit Einzelfällen geplant, statt mit Fallgruppen und Taktung.
Man überträgt stationäre Logik auf ambulante Abläufe – ohne Kostentransparenz.
Die tatsächliche Belegung (Nutzung vs. Standby) wird nicht gemessen.
Erlöse werden überschätzt, Overhead und Stillstand unterschätzt.
Ambulantisierung ist wirtschaftlich kein Selbstläufer – aber sie kann sich lohnen. Entscheidend ist, ob man bereit ist, ambulant wirklich anders zu denken: im Prozess, in der Struktur und im Betrieb. Halbherzige Modelle erzeugen Frust. Klare Modelle erzeugen Wirkung.
1.6 Fazit: Ambulant im OP braucht Haltung, Struktur und Konsequenz
Ambulantisierung im OP ist keine technische Aufgabe, kein Projekt nur für die zweite Reihe und auch keine rein politische Agenda. Sie ist eine strategische Richtungsentscheidung – mit direkten Konsequenzen für Struktur, Betrieb, Prozess und Kultur. Wer sie nicht trifft, wird sie irgendwann aufgezwungen bekommen. Und das ist der ungünstigste Zeitpunkt, um zu reagieren.
Ambulante OPs sind heute wirtschaftlich (noch) unterrepräsentiert – aber strategisch überlebenswichtig. Sie machen ein Krankenhaus anpassungsfähig, schnell und attraktiv für Patienten und Personal. Sie sind das Gegenmodell zur starren DRG-Welt – und genau deshalb ein möglicher Ausweg in einer unsicheren, sich wandelnden Zukunft.
Ambulant bedeutet nicht nur anders – es bedeutet besser, wenn man es richtig macht.
Drei Merksätze zum Mitnehmen:
Ohne Flexibilität keine Zukunft. Wer heute starre OP-Strukturen betreibt, zahlt morgen doppelt – mit Ineffizienz und Inflexibilität.
Ambulante Transformation beginnt im Prozess. Gebäude helfen nichts, wenn Abläufe chaotisch bleiben.
Wirtschaftlich ist nur, was konsequent gedacht ist. Halbe Lösungen kosten mehr als sie bringen.
Dieser Beitrag ist keine Anleitung. Er ist eine Einladung – zum Umdenken. Als Krankenhausdirektor habe ich selbst erlebt, wie schmerzhaft der Weg weg von der DRG-Welt sein kann. Aber ich habe auch gesehen, welches Potenzial entsteht, wenn man Ambulantisierung konsequent als Chance begreift.
Wenn Sie beim Lesen dachten: „Das bin ja ich“, dann ist das kein Zufall.
Dann ist jetzt der Moment, die richtigen Fragen zu stellen.
Literatur
Haserück A et al. (2022) Medizinische Versorgung: Chance Ambulantisierung, Dtsch Arztebl 119(37): A1507–A1516., URL: https://www.aerzteblatt.de/archiv/medizinische-versorgung-chance-ambulantisierung-f16e61ac-ec93-41fb-8708-326ed836da3c (abgerufen am 04.02.2025)
IGES Institut (2022) Gutachten nach § 115b Abs. 1a SGB V Ambulantisierungspotenzial stationärer Krankenhausleistungen. URL: https://www.iges.com/sites/igesgroup/iges.de/myzms/content/e6/e1621/e10211/e27603/e27841/e27842/e27844/attr_objs27932/IGES_AOP_Gutachten_032022_ger.pdf (abgerufen am 05.02.2025)
RINKE+HENSSLER GmbH (2025) Interne Konzeptfolien und Projektpräsentationen zur ambulanten Transformation im OP
Statistisches Bundesamt (2023) Gesundheitsausgaben 2022 – Schnellmeldung. Wiesbaden [Datenstand: 12,9% des BIP = 498,1 Mrd. €]. URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_167_236.html (abgerufen am 10.02.2025)
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) (2024) Ambulante ärztliche Versorgung zukunftssicher aufstellen. URL: https://www.vdek.com/magazin/ausgaben/2024-03/ambulante-versorgung-zukunftssicher-aufstellen.html (aufgerufen am 01.02.2025)
2 Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen: Von der Trennung in ambulanten und stationären Sektor hin zur Unterscheidung zwischen standardisierbaren und nicht standardisierbaren Leistungen Jascha Rinke
2.1 Einleitung und persönliche Standortbestimmung
Als Betreiber einer intersektoralen Versorgungseinheit konnte ich über viele Jahre hinweg erleben, wie tief die sektorale Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung im deutschen Gesundheitswesen verwurzelt ist. Ursprünglich hatte diese klare Trennung ihre Berechtigung in der Sicherstellung unterschiedlicher Versorgungsniveaus. Krankenhäuser sollten die komplexeren, intensiveren und ressourcenaufwendigeren Fälle übernehmen, während der ambulante Sektor vor allem für unkomplizierte Eingriffe vorgesehen war (Gellrich 2005). Doch im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass die strikte Abgrenzung zunehmend an ihre Grenzen stößt und ineffiziente Strukturen fördert, statt sie abzubauen (Schulte 2009).
In der täglichen Praxis meiner Einrichtung wurde schnell deutlich, dass nicht die sektorale Einordnung eines Patientenfalls entscheidend sein sollte, sondern vielmehr die Frage, ob es sich um einen planbaren (elektiven) oder nicht planbaren (akuten oder zu komplexen) Eingriff handelt. Die Notwendigkeit einer solchen Unterscheidung ergab sich dabei unmittelbar aus der betrieblichen Realität: Steigende Patientenzahlen, zunehmender Kostendruck und vor allem der Mangel an qualifiziertem Personal veranlassten uns frühzeitig dazu, Prozesse möglichst schlank, effizient und patientenorientiert zu gestalten. Dabei haben sich Best-Practice-Modelle intersektoraler Versorgungszentren als besonders geeignet erwiesen, um Lösungen zu entwickeln, die auch für Krankenhäuser wegweisend sein können.
Diese Erkenntnisse gelten umso mehr, als dass der stationäre Sektor in Deutschland nachweislich mit großen Ineffizienzen kämpft. Zahlreiche Studien weisen auf hohe Anteile von ambulant-sensitiven Krankenhausfällen und vermeidbaren stationären Aufnahmen hin, die durch geeignete Prozessorganisation und -optimierung deutlich reduziert werden könnten (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2020). Die Folgen dieser Ineffizienzen sind nicht nur betriebswirtschaftlich nachteilig, sondern haben auch aus volkswirtschaftlicher Sicht negative Konsequenzen: unnötig lange Krankenhausaufenthalte führen zu erhöhten Infektionsrisiken, längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten und damit zu höheren Kosten für die gesamte Volkswirtschaft (Robert Koch-Institut 2019; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2021).
Zudem ist die sektorale Trennung längst nicht mehr zeitgemäß, wenn man bedenkt, dass sowohl medizinisch-technische Entwicklungen als auch die zunehmend knappen Ressourcen des Gesundheitswesens eine stärkere Integration der Versorgungsbereiche verlangen. Der Paradigmenwechsel hin zu einer Unterscheidung zwischen elektiven und ungeplanten Eingriffen, verbunden mit einer konsequenten Standardisierung und Optimierung der Behandlungsprozesse, bietet hier enorme Chancen. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus bin ich davon überzeugt, dass dieser Wandel alternativlos ist, um Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Gesundheitsversorgung in Deutschland nachhaltig zu sichern und weiterzuentwickeln.
Diese Ausarbeitung skizziert daher den Weg von der traditionellen Sektorentrennung hin zu einer modernen, differenzierten und prozesszentrierten Denkweise, die auch Krankenhäusern wertvolle Impulse und konkrete Handlungsempfehlungen liefern kann.
2.2 Historische Grundlagen und notwendiger Wandel
Die heutige sektorale Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung lässt sich historisch bis zu den Anfängen des Sozialgesetzbuches (SGB V) zurückverfolgen. Ursprünglich war diese Trennung darauf ausgelegt, klare Zuständigkeiten und Finanzierungsmechanismen im Gesundheitswesen zu schaffen. Krankenhäuser wurden für komplexe, zeit- und kostenintensive Behandlungen finanziert, während die ambulante Versorgung auf leichtere Fälle und kleinere Eingriffe beschränkt war (Schulte 2009).
Mit Einführung des DRG-Systems (Diagnosis-Related-Groups) Anfang der 2000er-Jahre wurde das stationäre Versorgungssystem grundlegend reformiert, um Krankenhausleistungen pauschal nach Diagnosegruppen abzurechnen. Diese Neuregelung führte jedoch unbeabsichtigt zu Fehlanreizen: Krankenhäuser waren nun verstärkt ökonomisch motiviert, möglichst viele Fälle stationär aufzunehmen, selbst wenn diese medizinisch auch ambulant behandelt werden konnten (Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2020).
Zunehmend sichtbar wurde damit auch ein zentraler Schwachpunkt des traditionellen Modells: Einige Krankenhausaufnahmen sind ambulant-sensitiv, könnten also ohne Qualitätseinbußen ambulant erfolgen, sofern die häusliche Versorgung es zulässt. Solche stationären Aufenthalte belasten jedoch unnötig das Gesundheitssystem – sowohl finanziell als auch durch erhöhte Risiken für Patienten wie etwa Infektionen oder längere Rekonvaleszenzzeiten (Robert Koch-Institut 2019).
Die bestehende Vergütungsstruktur verstärkt diese Problematik zusätzlich. Ambulante Operationen sind seit Jahren deutlich niedriger vergütet als dieselben Eingriffe im stationären Sektor, was eine kaum durchlässige Sektorengrenze schafft. Dies führt dazu, dass Krankenhäuser viele Eingriffe aus mitunter ökonomischen Gründen bevorzugt stationär anbieten, obwohl eine ambulante Versorgung medizinisch möglich wäre (Bundesministerium für Gesundheit 2021).
Vor diesem Hintergrund sind internationale Vorbilder hilfreich, um die Potenziale einer integrierten Versorgung zu verdeutlichen. Länder wie die Niederlande, Schweden und Dänemark haben bereits vor Jahren erfolgreich intersektorale Versorgungsstrukturen etabliert, die durch höhere Effizienz und verbesserte Qualität gekennzeichnet sind. Diese internationalen Erfahrungen zeigen, dass eine konsequente Integration der Versorgungssektoren und ein differenzierter Umgang mit elektiven und ungeplanten Fällen praktikabel, patientenfreundlich und ökonomisch vorteilhaft sein kann (OECD 2020).
2.3Standardisierbar vs. nicht standardisierbar: Prozessinnovation und Qualitätssteigerung
Im aktuellen Gesundheitssystem ist die Differenzierung zwischen standardisierbaren und nicht standardisierbaren Eingriffen von entscheidender Bedeutung, um Krankenhausprozesse effizient zu gestalten und die Versorgungsqualität nachhaltig zu steigern. Elektive Eingriffe, also planbare Operationen, ermöglichen eine umfassende Standardisierung von Abläufen, während ungeplante Eingriffe, wie Notfälle, eine deutlich höhere Flexibilität und eine rasche Ressourcenverfügbarkeit erfordern. Abbildung 1 veranschaulicht die Bedarfsanalyse auf Basis von Krankenhausroutinedaten.
Abb. 1 Clusterung von Operationen (RINKE+HENSSLER GmbH)
Durch die Zuordnung von Eingriffen zu vordefinierten Clustern wird eine Trennung zwischen standardisierbaren und nicht standardisierbaren Operationen ermöglicht. Aus dieser Differenzierung lassen sich konkrete Flächen- und Kapazitätsbedarfe für die jeweiligen Funktionsbereiche im Short-Track-Konzept sowie im klassischen Zentral-OP ableiten.
Angesichts des sogenannten „AOP-Dilemmas“ zeigt sich eindrücklich, wie vielschichtig die aktuellen Vergütungsstrukturen und deren Auswirkungen sind. Ambulante Operationen werden seit Jahren nicht kostendeckend honoriert, was Krankenhäuser aus ökonomischen Gründen dazu veranlasst, Eingriffe bevorzugt stationär anzubieten. Gleichzeitig fordert die Politik eine Steigerung der ambulanten Eingriffe, obwohl diese derzeit nur geringe Umsätze generieren und notwendige Investitionen in die Infrastruktur – die zudem nicht förderfähig sind – kritisch zu bewerten sind. Die daraus resultierende ineffiziente Nutzung von Ressourcen unterstreicht die Dringlichkeit einer neuen Denkweise. Nur durch eine differenzierte Betrachtung von elektiven und ungeplanten Eingriffen lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen.
Natürlich gibt es bereits heute in Krankenhäusern etablierte Konzepte wie Same-Day-Surgery, die eine erste Separierung elektiver Operationen ermöglichen. Dieser Ansatz jedoch geht deutlich weiter: Alle standardisierbaren elektiven Operationen, einschließlich solcher, die traditionell stationär behandelt wurden – wie beispielsweise Knie-Totalendoprothesen (Knie-TEPs) – können konsequent in einem Short-Track-OP-Setting abgebildet werden. Dabei durchläuft auch der geplante stationäre Patient präoperativ einen standardisierten, im Grunde „ambulanten“ Prozess. Die Patienten kommen erst am Operationstag in das operative Zentrum, absolvieren den standardisierten, patientenzentrierten Prozess und werden erst nach Abschluss des Aufenthalts im Aufwachraum auf die Station verlegt. Optimalerweise geschieht dieser Transfer mittels eines wendigen Carriers auf eine gemischte Kurzliegerstation. Auf diesen Stationen muss die Betreuung dieser vergleichsweise „gesunden Kranken“ nicht durchgehend von examiniertem Pflegepersonal erfolgen. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf Serviceorientierung, modernen Schmerzkonzepten und frühzeitiger individueller Mobilisation. Auch bei dieser Betrachtung befinden wir uns derzeit in einem Dilemma, da die Vorgaben der Pflegepersonalregelung 2.0 (PPR 2.0) und die damit verbundenen Pflegepersonaluntergrenzen eine flexible Personalstrukturierung nahezu unmöglich machen. Krankenhäuser werden dazu verpflichtet, konsequent ausreichend examiniertes Pflegepersonal einzustellen, um die gesetzlich festgelegten Mindeststandards zu erfüllen – andernfalls drohen Strafzahlungen. Dieser generische Gesetzesvorstoß, der alle Prozesse einheitlich regelt, lässt kaum Raum für innovative und bedarfsorientierte Versorgungskonzepte, was uns vor erhebliche Herausforderungen stellt.
Dieses innovative Short-Track-Konzept bietet Krankenhäusern mehrere entscheidende Vorteile: Standardisierbare Operationen gelangen bereits frühzeitig in einen effizienten, wirtschaftlichen und patientenzentrierten Prozess, während gleichzeitig stationäre Eingriffe weiterhin als solche abrechenbar bleiben. Darüber hinaus ermöglicht diese Prozessgestaltung eine flexible Anpassung an zukünftige gesetzliche Veränderungen, etwa hinsichtlich Ambulantem Operieren (AOP), Hybrid-DRG-Modellen und ähnlichen Neuregelungen. Die Erfahrungen aus meiner Praxisklinik bestätigen eindrucksvoll, dass durch klare Prozessdefinitionen und eine konsequente Standardisierung der Abläufe nicht nur die Versorgungsqualität steigt, sondern auch auf Veränderungen im Vergütungssystem und regulatorische Anforderungen dynamisch reagiert werden kann.
Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor sind individuelle Betriebskonzepte, bei denen der gesamte Patientenprozess „vom Bordstein zum Bordstein“ gedacht wird. Dieser Ansatz beginnt bereits bei der Anreise des Patienten, beispielsweise durch eine klare und intuitive Wegeführung, ausreichende und nah gelegene Haltemöglichkeiten, und reicht über alle Schritte bis hin zur Abreise nach Abschluss der Behandlung. In der Praxis bedeutet das konkret, dass Angehörige die Möglichkeit haben, Patienten bequem am Eingang abzusetzen, bevor sie selbst parken. Wege sind barrierefrei und verständlich ausgeschildert, um Stresssituationen zu minimieren. Patienten erleben bereits bei Ankunft eine effiziente Aufnahme mit minimalen Wartezeiten.
Wichtig ist ebenso die organisatorische Trennung präoperativer und postoperativer Patienten zur Stressreduzierung und zur Wahrung der Privatsphäre. Ein gut strukturiertes Umkleidesystem und angenehme Wartebereiche tragen wesentlich zur Entspannung bei. Ebenso bedeutsam ist ein klares und effizientes Entlassmanagement, welches den Patienten unmittelbar nach Abschluss der Behandlung, bereits im Aufwachraum, versorgt und anschließend sicher begleitet – beispielsweise durch einen kontrollierten Wartebereich im Eingangsbereich, bis die Angehörigen das Fahrzeug bereitgestellt haben.
Neben der Patientenlogistik spielt die operative Logistik eine entscheidende Rolle: Materialversorgung, Sterilgutaufbereitung sowie die internen Transportprozesse müssen so geplant und optimiert werden, dass keinerlei Wartezeiten entstehen und jede benötigte Ressource zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Dabei helfen digitale Unterstützungssysteme, automatisierte Materialversorgungsketten und schlanke Lagerhaltung, die Effizienz deutlich zu erhöhen.
Eine konsequent vom „Bordstein zum Bordstein“ gedachte Logistik fördert nicht nur eine erhebliche Prozessbeschleunigung und Effizienzsteigerung, sondern verbessert auch signifikant das Patienten- und Mitarbeitererlebnis. Diese ganzheitliche Sichtweise sorgt nachhaltig für eine hohe Versorgungsqualität und trägt maßgeblich zum langfristigen Erfolg und zur Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtung bei.
2.4Vergütungsmodelle und ihre Auswirkungen auf Versorgungsangebote
Die derzeit geltenden Vergütungsmodelle im deutschen Gesundheitswesen stellen einen zentralen Stolperstein für eine effiziente und patientenzentrierte Versorgung dar. Das historisch gewachsene System aus DRGs für stationäre und EBM für ambulante Leistungen erzeugt seit Jahren problematische Fehlanreize. Die Bundesärztekammer weist darauf hin, dass insbesondere das DRG-System Anreize zur Erhöhung der Fallzahlen schafft, die Qualität der Indikationsstellung mindert und Aktionismus belohnt (Bundesärztekammer 2023). Insbesondere das Ambulante Operieren (AOP) ist davon betroffen, da die ambulanten Eingriffe systematisch unterfinanziert sind. Eine Studie des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) zeigt, dass im Durchschnitt 34% der anfallenden Kosten für ambulante Operationen und stationsersetzende Eingriffe im Krankenhaus nicht durch die Erlöse gedeckt sind (Deutsches Krankenhausinstitut 2023). Dies zwingt Krankenhäuser und Praxiskliniken häufig dazu, Eingriffe stationär durchzuführen, obwohl sie medizinisch und organisatorisch problemlos ambulant erfolgen könnten.
Die Einführung der Hybrid-DRG nach § 115f SGB V sollte zwar kurzfristig eine Lösung bieten, hat aber bislang nur wenig Abhilfe geschaffen. Diese Mischform der Vergütung zwischen stationärer DRG und ambulantem EBM-Entgelt ist aktuell nicht ausreichend praxisnah kalkuliert. Ein zentraler Konstruktionsfehler der Hybrid-DRG liegt darin, dass sie Sachkosten beinhaltet, wodurch weitere Fehlanreize entstehen und die ohnehin angespannte finanzielle Situation der Krankenhäuser noch verschärft wird. Zudem ist eine perspektivische Absenkung der Hybrid-DRG auf das Niveau des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) geplant, was aus wirtschaftlicher Perspektive unrealistisch erscheint, da die realen Kosten in keiner Weise angemessen abgebildet werden.
Die Folgen dieser Unterfinanzierung sind erheblich. Insbesondere kleinere und mittlere Einrichtungen könnten zunehmend gezwungen sein, bestimmte Eingriffe nicht mehr anzubieten, da diese bei aktuellen Vergütungssätzen keinen positiven Deckungsbeitrag erzielen können. Besonders betroffen sind Operationen, die trotz aller möglichen Effizienzsteigerungen und Prozessoptimierungen nicht kostendeckend realisiert werden können. Damit wird nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen gefährdet, sondern auch die flächendeckende, wohnortnahe Patientenversorgung.
Vor einigen Jahren gab es hierzu einen vielversprechenden Vorstoß der Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) grundlegend zu novellieren und an die realen Kosten anzupassen. Im Zuge dieses Vorhabens beauftragte das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) Gutachten bei externen Experten, um die tatsächlichen Kostenstrukturen besser zu erfassen. Ich selbst konnte in diesem Kontext die aktuellen Investitions- und Betriebskosten für die Erstellung und den Betrieb eines Muster-OP-Zentrums nach KBV-Vorgaben berechnen. Dabei sollten insbesondere die individuellen Kosten der Infrastruktur in den verschiedenen Fachgruppen sowie die Aufwendungen für Sterilgutaufbereitung, Hygiene und Material exakt ermittelt werden. Nur so kann eine adäquate und realistische Aufteilung dieser Kosten unter den unterschiedlichen, am Prozess beteiligten Akteuren erfolgen. Gleichzeitig zeigt sich, dass eine effektive Zusammenarbeit aktuell durch strukturelle Hürden stark erschwert wird.
Leider scheiterte dieser vielversprechende Ansatz letztlich bereits innerhalb der eigenen Reihen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen), was viele Akteure sehr enttäuschte. Somit ist es bis heute nicht möglich, die Vergütung ambulanter Operationen transparent und nachvollziehbar in die relevanten Bestandteile Honorar Operateur, Honorar Anästhesie, Infrastruktur sowie Hygiene und Sterilgutaufbereitung aufzuteilen. Von einem realistischen Bezug zu den tatsächlichen Kosten einer ambulanten Operation, vergleichbar mit der Kalkulation im DRG-System, bleibt man somit weit entfernt.
Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die gemeinsame Selbstverwaltung auch künftig nicht eigenständig in der Lage sein wird, die notwendigen grundlegenden Entscheidungen und Maßnahmen im Rahmen der Transformation des Systems umzusetzen. Um einen echten Paradigmenwechsel herbeizuführen, ist daher eine grundlegende Weiterentwicklung der Vergütungssystematik notwendig. Ein nachhaltiger Ansatz könnte in einer integrierten, pauschalierten Vergütung liegen, welche die realistischen Kosten sowohl für ambulante als auch stationäre Eingriffe berücksichtigt und dabei insbesondere die gestiegenen Ausgaben für Infrastruktur, Sterilgutaufbereitung, Materialien, Energie sowie die Personalkosten einbezieht.
Ein solches Vergütungssystem würde den Einrichtungen ermöglichen, wirtschaftlich solide zu planen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen. Außerdem würde es erlauben, flexibel auf regulatorische Veränderungen und neue gesetzliche Rahmenbedingungen zu reagieren. Nur durch eine zeitgemäße Anpassung der Vergütungsstrukturen, verbunden mit einer konsequenten Standardisierung der operativen Abläufe, können Krankenhäuser und andere operative Zentren langfristig effizient, patientenzentriert und nachhaltig wirtschaftlich arbeiten.
2.5Umsetzungsstrategie und politischer Ausblick
Trotz der widrigen finanziellen und regulatorischen Rahmenbedingungen können Krankenhäuser bereits heute ambulante und kurzstationäre Eingriffe kosteneffizient und in hoher Qualität durchführen. Dies setzt jedoch voraus, dass diese Operationen nicht in den klassischen stationären Strukturen und von denselben Teams durchgeführt werden, die für traditionelle stationäre Abläufe verantwortlich sind. Stattdessen bedarf es spezialisierter und gezielt geschulter Teams sowie neuartiger, standardisierter Prozessabläufe, die speziell auf ambulante und kurzstationäre Eingriffe zugeschnitten sind.
Um eine nachhaltige und erfolgreiche Transformation sicherzustellen, sollten Krankenhäuser frühzeitig damit beginnen, notwendige Investitionen in spezialisierte Infrastruktur und Personalentwicklung zu tätigen. Nur durch die frühzeitige und konsequente Einführung standardisierter Abläufe und die Schaffung separater, klar definierter Prozesscluster für standardisierbare Eingriffe können Krankenhäuser zukünftig flexibel und effizient auf Änderungen im Gesundheitswesen reagieren und bereits heute erhebliche Effizienzgewinne realisieren.
Ein wesentlicher Schritt dieser Umsetzungsstrategie umfasst zunächst die gründliche Analyse bestehender Krankenhausstrukturen und -prozesse, um vorhandene Optimierungspotenziale zu identifizieren. Die Entwicklung klarer Prozesscluster, welche standardisierbare von nicht standardisierbaren Eingriffen trennen, stellt dabei den Kern der operativen Strategie dar.
Ein ebenso entscheidender Faktor für den Erfolg dieses Wandels ist die frühzeitige und umfassende Einbindung aller Mitarbeitergruppen – von Ärzten und Pflegepersonal bis hin zur Verwaltung. Meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass transparente Kommunikation, begleitende Schulungen und eine offene Unternehmenskultur essenziell sind, um die Mitarbeitenden aktiv in den Transformationsprozess einzubeziehen und dauerhaft zu motivieren.
Zusätzlich sind ein kontinuierliches Monitoring und die iterative Optimierung der Prozesse im Sinne des PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) von zentraler Bedeutung. Nur so können Anpassungen frühzeitig erkannt, notwendige Veränderungen umgesetzt und Prozesse dauerhaft effizient gehalten werden.
Parallel dazu bedarf es aber auch politischer Unterstützung und der Schaffung neuer regulatorischer Rahmenbedingungen, um diesen Paradigmenwechsel zu fördern und dauerhaft abzusichern. Die bisherige Erfahrung verdeutlicht klar, dass die gemeinsame Selbstverwaltung allein diese grundlegenden Veränderungen nicht eigenständig bewältigen kann. Vielmehr sind politische Impulse erforderlich, um sektorenübergreifende Versorgungsmodelle zu ermöglichen und konsequent weiterzuentwickeln. Ein erster wichtiger Schritt wäre dabei die praxisnahe und wirtschaftlich tragfähige Weiterentwicklung der Hybrid-DRGs und ähnlicher innovativer Vergütungskonzepte, welche realistische Kostenstrukturen berücksichtigen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der notwendige Paradigmenwechsel hin zu standardisierten, effizienten und patientenzentrierten Versorgungsprozessen nur gelingen kann, wenn sowohl auf operativer Ebene der Krankenhäuser als auch auf politischer und regulatorischer Ebene aktiv zusammengearbeitet wird. Die Transformation ist somit nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Einrichtungen, sondern vor allem essenziell für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Patientenversorgung.
Literatur
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2021) Arbeitsunfähigkeitszeiten in Deutschland – volkswirtschaftliche Auswirkungen und Trends. URL: https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitswelt-und-Arbeitsschutz-im-Wandel/Krankheit-und-Arbeitsfaehigkeit/Arbeitsunfaehigkeit/arbeitsunfaehigkeit_node.html (abgerufen am 20.03.2025)
Bundesärztekammer (2023) Finanzielle Fehlanreize im Gesundheitssystem gefährden Patientenwohl. URL: https://www.bundesaerztekammer.de/presse/informationsdienste/informationsdienst-baekground/detail/finanzielle-fehlanreize-im-gesundheitssystem-gefaehrden-patientenwohl (abgerufen am 23.03.2025)
Bundesministerium für Gesundheit (2021) Gutachten zur ambulanten und stationären Vergütung operativer Leistungen im deutschen Gesundheitswesen. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/gutachten-verguetung-operativer-leistungen.html (abgerufen am 20.03.2025)
Deutsches Krankenhausinstitut (2023) Ambulante Operationen und stationsersetzende Eingriffe in Kliniken sind stark unterfinanziert. URL: https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/ambulante-operationen-und-stationsersetzende-eingriffe-in-kliniken-sind-stark-unterfinanziert (abgerufen am 23.03.2025)
Gellrich S (2005) Modelle der sektorenübergreifenden Integration in der Gesundheitsversorgung. Dissertation, Universität Bremen, Bremen
OECD (2020) Health at a Glance 2020: OECD Indicators. OECD Publishing Paris. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2020_4dd50c09-en (abgerufen am 20.03.2025)
Robert Koch-Institut (2019) Gesundheitliche Risiken durch nosokomiale Infektionen in Deutschland. URL: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/NosokomialeInfektionen/nosokomiale_infektionen_node.html (abgerufen am 14.03.2025)
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2020) Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung. In: SVR Gesundheit (Hrsg.) Gutachten 2020: Gesundheitsversorgung in Deutschland – Integration und Digitalisierung. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, S. 165–212
Schulte G (2009) Rechtliche Stellung der Praxiskliniken im SGB V. In: Schulte G (Hrsg.) Sektorenübergreifende Versorgung: Entwicklung, Herausforderungen und Chancen. Springer Berlin, S. 275–289
3 Herausforderungen und Chancen der Ambulantisierung Nora Wisniowski, Pia Rettig und Clarissa Kurscheid
3.1 Ambulantisierung im Reformstau: Zwischen Potenzial und strukturellen Hürden
Das deutsche Gesundheitswesen steht vor einem umfassenden Reformbedarf, der durch eine Vielzahl nicht abgeschlossener Reformvorhaben aus der Legislaturperiode der Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP (2021–2024) deutlich wird. Zwar wurde die Krankenhausreform angestoßen, jedoch bleibt sie hinter den Erwartungen zurück und bedarf erheblicher Verbesserungen, um sektorenübergreifende Versorgungsbedarfe zu decken. Verschärft wird diese Situation durch die zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen (personell, finanziell und ökologisch) ist eine Umgestaltung des Systems unumgänglich.
Durch legislative Maßnahmen wie die Krankenhausreform (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz – KHVVG) und das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPflEG, Inkrafttreten 29.12.2022) soll der Anteil ambulant erbrachter Leistungen erhöht werden. Dies kann jedoch nicht ohne eine strukturelle und prozessuale Umgestaltung realitätsnah umgesetzt werden.
Einer der wesentlichen Hintergründe für die Problemlage ist das ungleiche Verhältnis der Krankenhausfördermittel, die von den Bundesländern zur Verfügung gestellt wurden, zu den Bruttogesamtkosten, die die Krankenhäuser haben. Bei einer retrospektiven Betrachtung der genannten Fördermittel wurden diese in den letzten zwanzig Jahren zunächst kontinuierlich von den Ländern verringert und haben sich ab 2005 auf niedrigem Niveau stabilisiert und erst seit 2017 langsam gesteigert, sodass sie 2023 wieder auf dem Niveau von 1993 lagen (vdek 2025). Infolgedessen entstand ein massiver Investitionsstau im stationären Bereich.
Weiterhin verpasste der Gesetzgeber in den letzten zwanzig Jahren, strukturelle Veränderungen einzuführen und beispielsweise das ambulante Operieren oder andere Maßnahmen, die die Versorgungslandschaft an das vorherrschende Krankheitspanorama anpassen, zu fördern.
Historisch betrachtet wurde das Potenzial für den Einsatz des ambulanten Operierens Ende des letzten Jahrhunderts erkannt. Deutschland und auch andere Länder verankerten dies gesetzlich und setzten diese Maßnahme zum Abbau von Wartezeiten und zur Senkung der Kosten ein. Deutschland führte im Jahr 1992 den § 115b SGB V ein und beauftragte die Selbstverwaltung mit der Definition der Rahmenbedingungen und der Erstellung eines Katalogs für ambulante Eingriffe. Diese Maßnahmen folgten derselben Motivation wie die Einführung des stationären Fallpauschalensystems (Averill et al. 1993; Sosial- og helsedepartementet 1996).
Trotz der ähnlichen Ausgangszeitpunkte hat sich die Intensität der Umsetzung dieses Instruments in den verschiedenen Industrienationen sehr unterschiedlich entwickelt. Während einige Länder (Dänemark, Frankreich, Norwegen) rasch Fortschritte erzielten und umfassende Strukturen für das ambulante Operieren etablierten, verlief die Implementierung in anderen Ländern langsamer und weniger konsequent (Deutschland, Österreich, Schweiz). Diese Unterschiede lassen sich auf verschiedene gesundheitspolitische Prioritäten, finanzielle Ressourcen und organisatorische Rahmenbedingungen zurückführen.
Insbesondere Norwegen und Dänemark schufen sehr früh einen einheitlichen und sektorengleichen Leistungsbereich mit einheitlicher Vergütung. England und Frankreich dagegen forcierten das ambulante Operieren mit finanziellen Anreizen und Förderprogrammen. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die benannten Länder sukzessive die ambulante Leistungserbringung vorangebracht haben. Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der Leistungen waren insbesondere das Fallzahlvolumen, der Schweregrad und die kurzen Verweildauern. Mit kontinuierlichem Beobachten der Ergebnisse wurde die Anzahl der Leistungen orientiert an den genannten Faktoren ausgeweitet. In Deutschland dagegen wurde zwar das ambulante Operieren eingeführt, aber eine konsequente strukturelle Veränderung wurde nicht umgesetzt, stattdessen hielt der Gesetzgeber an den bestehenden Strukturen fest. Dies führte dazu, dass die unterschiedlichen Vergütungssystematiken im ambulanten und im stationären Bereich eine Ausweitung nicht entstehen ließen.





























