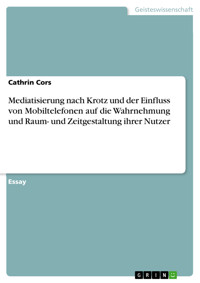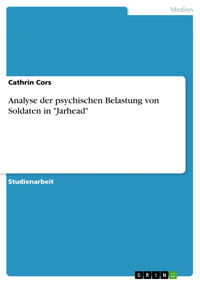
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Film und Fernsehen, Note: 2,3, Leuphana Universität Lüneburg, Sprache: Deutsch, Abstract: ‚Medienkultur und Kommunikation in Theorie und Praxis‘ beinhaltet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Spielfilm „Jarhead, willkommen im Dreck“, der 2005 vom Regisseur Sam Mendes produziert wurde und auf der Buchvorlage von Anthony Swofford und damit auf einer wahren Begebenheit basiert. Dieser Film wird für die Hausarbeit ausgewählt, da er im Seminar behandelt wurde und wegen persönlichem Interesse von Bedeutung ist. Die Fragestellung lautet: Worin liegt die psychische Belastung der jungen Soldaten im Krieg und wie wird diese im Film dargestellt? Es wird untersucht welche Geschehnisse oder das Ausbleiben welcher Geschehnisse die Soldaten im Irak geprägt haben. Damit verbunden ist die Beschäftigung mit der Frage, warum diese neue Ebene den Films, die hauptsächlich auf der Darstellung der Psyche junger Soldaten basiert, für „Jarhead“ gewählt wurde. Es soll analysiert werden, durch welche Motive im Film sich Zuschauer und Rezipienten an den Film erinnern, nachdem sie ihn geschaut haben. Zu beantworten gilt es, auf welche Weise es dem Film gelingt, mit den kollektiven Erinnerungen an den Irakkrieg zu brechen und weshalb der Film auf einer neuen Darstellungsweise von Kriegsfilmen basiert. Der Krieg wird hier weniger thematisiert, da vielmehr Wert auf das Ausbleiben des Kampfes und den Umgang der Soldaten mit dieser Situation gelegt wird. Objektiv betrachtet wirkt dieses Ausbleiben der direkten Konfrontation mit dem Feind positiv und sollte laut unserem Verständnis von Krieg dankbar angenommen werden. In der nachfolgenden Arbeit soll mit Hilfe einer Filmanalyse und einer beispielhaften Schlüsselszene geklärt werden, worin die psychische Belastung der Marines liegt und wie es dem Film gelingt, sie dem Zuschauer zu vermitteln und sie an das kollektive Gedächtnis zu überliefern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
1.Fragestellung
2. Definition „kollektives Gedächtnis“
3. Historischer Hintergrund
4. Einführung in den Film
4.1. Inhaltsangabe
4.2. Eingrenzung des Materials und Vorgehen
5. Filmanalyse
5.1. Hierarchien im Krieg
5.2. Soldatenbild
5.3. Schlüsselszene: Kriegsende
5.4. Trauma
5.5. Erinnerung durch den Film
6. Fazit
7. Bibliographie
1.Fragestellung
Die Fragestellung zu dem Seminar „Spielfilme als Orte kollektiver Erinnerung“ zum Modul ‚Medienkultur und Kommunikation in Theorie und Praxis‘ beinhaltet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Spielfilm „Jarhead, willkommen im Dreck“, der 2005 vom Regisseur Sam Mendes produziert wurde und auf der Buchvorlage von Anthony Swofford und damit auf einer wahren Begebenheit basiert. Dieser Film wird für die Hausarbeit ausgewählt, da er im Seminar behandelt wurde und wegen persönlichem Interesse von Bedeutung ist.
Die Fragestellung lautet: Worin liegt die psychische Belastung der jungen Soldaten im Krieg und wie wird diese im Film dargestellt? Es wird untersucht welche Geschehnisse oder das Ausbleiben welcher Geschehnisse die Soldaten im Irak geprägt haben. Damit verbunden ist die Beschäftigung mit der Frage, warum diese neue Ebene den Films, die hauptsächlich auf der Darstellung der Psyche junger Soldaten basiert, für „Jarhead“ gewählt wurde. Es soll analysiert werden, durch welche Motive im Film sich Zuschauer und Rezipienten an den Film erinnern, nachdem sie ihn geschaut haben. Zu beantworten gilt es, auf welche Weise es dem Film gelingt, mit den kollektiven Erinnerungen an den Irakkrieg zu brechen und weshalb der Film auf einer neuen Darstellungsweise von Kriegsfilmen basiert. Der Krieg wird hier weniger thematisiert, da vielmehr Wert auf das Ausbleiben des Kampfes und den Umgang der Soldaten mit dieser Situation gelegt wird.
2. Definition „kollektives Gedächtnis“
In dem medienwissenschaftlichen Seminar „Spielfilme als Ort kollektiver Erinnerung“ wurde sich mit der Darstellung von Kriegen und Genoziden in Spielfilmen beschäftigt. Im Zusammenhang damit wurde untersucht, inwiefern die Filme dazu verhelfen, die Erinnerung an Geschehnisse der Vergangenheit auch zukünftig zu erinnern und nicht zu vergessen. Auch bei „Jarhead“ handelt es sich um einen Erinnerungsfilm, der durch Vermittlung von Wissen und Erfahrungen das kollektive Gedächtnis indirekt entstehen lässt.
Zum sogenannten ‚kollektiven Gedächtnis‘ gibt es zwei Theorien, die im Folgenden beschrieben werden. Die erste Theorie stammt von Maurice Halbwachs zum ‚memoire collective‘ und die zweite Studie stammt von Aby Warburg.
In seinen Theorien spricht Halbwachs sich für eine soziale Bedingtheit des Gedächtnisses aus, die sich beispielsweise in Form eines Generationsgedächtnisses äußern kann. Zudem weitet er schließlich seinen Begriff ‚memoire collective‘ auf den Bereich der kulturellen Überlieferung und Traditionsbildung aus. Damit erreicht er den Bereich des Gedächtnisses, der heute von Aleida und Jan Assmann als „kulturelles Gedächtnis“ bezeichnet wird.[1]
Das Konzept von Aby Warburg unterscheidet sich grundlegend von Halbwachs‘ eher theoretischen Theorie, da es ihm hauptsächlich um die unbewusste und mit psychischen Prozessen verbundene Weitergabe durch bildhafte Symbolik und visuelle Kultur geht. In dem Punkt, dass Kultur von Menschen und deren Tätigkeit überliefert werde, sind sich die beiden Wissenschaftler aber einig.[2]
Der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann zu Folge setzte sich das Gedächtnis wiederum aus drei Dimensionen zusammen. Sie nennt das ‚individuelle Gedächtnis‘. das ‚soziale Gedächtnis‘ und ein ‚kulturelles-und auch kollektives Gedächtnis‘, das sämtliche Erfahrungen und Wissen, die Menschen gespeichert haben, auf eine materielle Ebene in Form von beispielsweise Büchern überträgt.[3]
Sowohl Warburg, Halbwachs und auch Assmann stimmen in ihren Theorien dahingehend überein, dass immer Menschen als Überlieferer nötig seien, um Erfahrungen und kulturelle Aspekte weiterzugeben oder in Form von Datenträgern zu speichern. Genannte Begrifflichkeiten wurden definiert, um sie im Laufe der Arbeit erwähnen zu können. Gestützt wird sich speziell auf die These, dass kollektive Erinnerung immer mit zwischenmenschlichen Interaktionen verbunden sei.