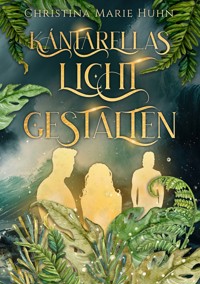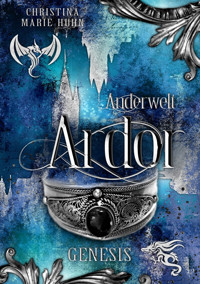
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die schüchterne Helene ist eine ganz normale Teenagerin der Achtzigerjahre. Sie interessiert sich für Make-up, Klamotten sowie Jungs und schläft gern am Wochenende aus. Sportlich ist sie überhaupt nicht, lieber sieht sie fern. Nur mit ihren Stöckelschuhen und ihrem Walkman ausgerüstet, verschlägt es sie ohne jede Vorwarnung in eine Anderwelt namens Ardor. Dort erwartet sie eine komplexe, mittelalterliche Kultur im Schatten eines bevorstehenden Kriegs. Wird ihr mithilfe des abtrünnigen Echsenreiters Jewlier und dem cleveren Flugreptil Arren die Rückkehr nach Hause gelingen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christina Marie Huhn
Anderwelt Ardor – Genesis
Buch:
Die schüchterne Helene ist eine ganz normale Teenagerin der Achtzigerjahre. Sie interessiert sich für Make-up, Klamotten sowie Jungs und schläft gern am Wochenende aus. Sportlich ist sie überhaupt nicht, lieber sieht sie fern.
Nur mit ihren Stöckelschuhen und ihrem Walkman ausgerüstet, verschlägt es sie ohne jede Vorwarnung in eine Anderwelt namens Ardor. Dort erwartet sie eine komplexe, mittelalterliche Kultur im Schatten eines bevorstehenden Kriegs.
Wird ihr mithilfe des abtrünnigen Echsenreiters Jewlier und dem cleveren Flugreptil Arren die Rückkehr nach Hause gelingen?
Autorin:
Christina Marie Huhn wurde als Kind zweier Kulturen im Dezember des Jahres 1970 in Frankfurt am Main geboren und wuchs bei ihren deutschen Großeltern auf.
Vom Beginn ihrer Kindertage an wird sie von ihrer Fantasie beflügelt. So saß sie zum Beispiel einst als unglückliche Siebenjährige im Schrank und suchte verzweifelt den Weg nach Narnia, der sich ihr leider nicht auftat. Seit ihrem achten Lebensjahr schreibt sie Erzählungen und Geschichten, hauptsächlich im Fantasy-Genre.
Ihr Leben ist von vielen beruflichen und privaten Umbrüchen geprägt und sie lebte sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland. Aktuell wohnt sie im ländlichen Steffenberg in Mittelhessen.
christina-marie-huhn.de
Von Christina Marie Huhn ist bisher folgendes Buch erschienen:
Kántarellas Lichtgestalten (Tredition)
© 2025 Christina Marie Huhn
Website: christina-marie-huhn.de
Korrektorat: Claudia Fluor, schreib-weise.ch Coverdesign und Umschlaggestaltung: Florin Sayer-Gabor, 100covers4you.com, unter Verwendung von Grafiken von Adobe Stock: anggasaputro08, Jukyelabs
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin,zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser,
ein herzliches Willkommen in der Welt von Helene! Im Vorfeld erzähle ich dir hier noch Trivia zur Entstehung der Geschichte, die du gleich lesen wirst:
Die Grundidee entstand 1984, als Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten in die Kinos kam. Ohne den Film zuvor gesehen zu haben, las ich in einer Zeitung einen Artikel darüber und das Motiv »Stöckelschuhe im Urwald« beeindruckte mich derartig, dass plötzlich Haylan und Jewlier in meinem Kopf auftauchten. Arrens Figur wurde ursprünglich von Marion Zimmer Bradleys Echsenwesen Aratak inspiriert.
Als Teenagerin begann ich, eine Version der Erzählung zu schreiben, welche ich nicht zum Abschluss brachte. Kurz vor Silvester 2020, unmittelbar nachdem ich die letzten Zeilen zu meinem Debutroman Kántarellas Lichtgestalten verfasst hatte, erstellte ich eine neue Datei mit dem Arbeitstitel Ardor. Der Abschluss meines Erstlings hatte ein regelrechtes Loch in meine Seele gesogen, sodass ich eine Kompensation brauchte. (Falls du die Lichtgestalten bereits kennst, verstehst du vielleicht, was ich meine.)
Im Gegensatz zum Drama rund um die junge Lehrerin Karin kommt Anderwelt Ardor wesentlich leichter und humorvoller daher. Jedenfalls griff ich die Grundidee der Stöckelschuhe auf und ließ mich treiben. Was geblieben ist, sind die drei Hauptprotagonisten sowie der Beginn im Westdeutschland der Achtziger, da die Erzählung in dieser Zeit verwurzelt liegt und ich sie dort belassen wollte.
Allen Lesenden, die diese Epoche erlebt haben, wünsche ich eine Menge Spaß bei den Flashbacks vom Walkman bis hin zum Opel Kadett!
Contentwarnung
Bevor du endgültig in die Geschichte eintauchst, solltest du wissen, dass zum einen das Thema einer Essstörung insbesondere zu Beginn des Buchs thematisiert wird.
Zum anderen denke ich persönlich zwar nicht, dass die Erzählung extrem blutrünstigen oder grausamen Content aufweist, doch kommen sowohl gewaltsame Tode als auch körperliche Misshandlung und sexuell motivierte Übergriffe vor.
Sehr empfindsame Personen sollten gegebenenfalls von der Lektüre absehen.
Christina Marie Huhn
Anderwelt Ardor
– Genesis –
~ Für meinen Dad Hellmut ~
Dieses Buch, das ich in der Weihnachtszeit 2020 zu schreiben begonnen hatte, sollte dich als Testleser erreichen. Doch bevor ich die Rohfassung überarbeitet hatte, bist du von mir gegangen. Nun wirst du diese Geschichte nie mehr lesen und mir deine Meinung dazu mitteilen können. Ich vermisse dich so sehr.
♥
Es ist Montag
Latein. Ich mag kein Latein. Es ist furchtbar langweilig. Okay, die Sprache ist tot. Und der Unterricht ist es auch, jedenfalls bei Frau Franzen. Aus purer Langeweile kritzle ich in dieser ersten Doppelstunde nach den Herbstferien ein Heer von aufwendigen Schnörkeln rund um das aktuelle Datum in mein Heft: Es ist der 14. Oktober 1985.
Und es ist Montag.
Kaum dass der Pausengong endlich ertönt, stopfe ich Lateinbuch, Heft und Mäppchen in den alten Aktenkoffer, den ich meinem Vater abgeschwatzt habe. Aktenkoffer finde ich total cool. Auf meinem prangen obendrein eine Menge bunter Aufkleber. Ich lebe gern, steht auf einem. Ironischerweise stammt der ausgerechnet von einer Zigarettenmarke. Ein quietschgelber Sticker, aus dessen Mitte ein Gesicht in Form einer orangefarbenen Sonne lacht, verkündet Atomkraft, nein danke. Diesen Aufkleber muss man haben, sonst ist man völlig out.
Nicht, dass ich mich politisch engagiere. Autofreie Sonntage oder Feminismuskampagnen sind mir völlig wurscht und vom Kalten Krieg, über den meine Eltern mit ihren Bekannten so oft diskutieren, fühle ich mich persönlich nicht betroffen. Make-up, Popstars und die Hitparade im Radio sind für mich viel interessanter. Jeden Freitagabend hocke ich pünktlich um 19 Uhr zu Die Schlager der Woche in Lauerstellung auf meinem Bett, halte den Kassettenrekorder aufnahmebereit auf dem Schoß und jage nach Liedern wie Solid von Ashford & Simpson oder Yesterday von Foreigner.
Wie immer trotte ich zusammen mit den Mädels, mit denen ich die Pausen verbringe, zuallererst zur Schultoilette. Eng gedrängt stehen Susanne, Alexandra, Martina und ich vor dem Spiegel und pudern die Nasen nach. Zudem kontrolliere ich sorgfältig, ob meine Wimperntusche noch in Ordnung ist. Schließlich mag ich nicht wie ein Pierrot aussehen.
Susanne erzählt, dass sie am Wochenende auf einer Party gewesen sei, bei der sie Stefan Schulze gesehen habe. Susanne steht voll auf Stefan. Sie hat ihn beim Tanztee kennengelernt, einer Veranstaltung an jedem Sonntagnachmittag in den Räumen der städtischen Traditions-Tanzschule.
Na ja, mir liegt das mit dem Getanze nicht so, nicht mal Discofox. Ich mag insgesamt keine Bewegung, bei der ich außer Atem komme. Lieber lese ich oder sehe fern.
Was Susanne angeht: Für sie gibt es seit diesem Tanztee nur noch ein Thema, nämlich ihren Schwarm.
Herr Maier öffnet die Tür zu den Toilettenräumen, erblickt unsere kleine Versammlung und scheucht uns auf den Pausenhof. Maulend latschen wir aus dem Gebäude nach draußen, wo uns die Oktoberkälte empfängt. Ich habe schon in der Lateinstunde gefroren. Jetzt im Freien herumzustehen, macht es nicht besser und ich verkrieche mich in meinen Jeansblouson mit dem Teddyfutter. Eine meiner Locken verhakt sich an einem der vielen bunten Buttons, die ich auf dem Revers trage. Bis ich sie endlich befreit habe, sind meine Finger eiskalt und ich schiebe die Hände tief in die Jackentaschen.
Die anderen Mädels frieren bestimmt genauso sehr wie ich, doch lauschen sie voller Sensationsgier Susannes langer Litanei über die süßen, himmelblauen Augen des Angebeteten. Ich hingegen höre nur mit halbem Ohr zu und lasse meinen Blick verstohlen zu einer Gruppe Jungs hinüberschweifen. Nur zehn Meter entfernt steht mein Schwarm, Marc Buchner, im dunkelgrauen Wollmantel mitsamt trendigem, schwarzweiß gemustertem Fransenschal, Jeans und Chucks. Er ist hochgewachsen, dunkelblond und trägt einen Haarschnitt wie Simon Le Bon, oben kurz und hinten lang. Soweit ich weiß, betreibt er irgendeinen krassen Kampfsport in seiner Freizeit, was ihn für mich beinahe zu einem Halbgott werden lässt.
Dass ich in Marc verschossen bin, würde ich nie zugeben. Das wäre ja megapeinlich! Er steht sowieso auf einen anderen Typ Mädchen als mich. Er ist mit Katja Weber zusammen. Die hat karminrot gefärbte Stoppelhaare, ein selbstsicheres Auftreten und wirkt mit ihren fünf Silberringen in jedem Ohr fast schon punkig. Außerdem ist sie eine leidenschaftliche Reiterin und gewinnt regelmäßig irgendwelche Trophäen. Sofern ich dem neidischen Getuschel meiner Freundinnen glauben kann, werden ihre Eltern bald ein eigenes Pferd für sie kaufen.
Wenn Marc mit Katja über den Schulhof schlendert, haben sie ihre kleinen Finger ineinander gehakt. Ach, was würde ich geben, um mit ihr zu tauschen. Nicht nur wegen Marc Buchner. Katja finden alle total cool.
Ich wäre auch gern cool.
Mathe, Klausurrückgabe.
»Und die Häläne. Sähr scheen.« Herr Popescu, unser Mathelehrer mit dem rumänischen Akzent, reicht mir das Pamphlet mit einem wohlwollenden Lächeln.
Ich nehme die Blätter entgegen und luge verstohlen nach der Note. Eins minus. Insgeheim freue ich mich, dennoch verstecke ich die Arbeit gleich hinten in meinem Matheheft, weil ich mich für die gute Note fast schäme.
Schon beugt sich Alexandra zu mir herüber. »Und? Was hast du?«
»Passt schon«, murmle ich verlegen.
»Du hast bestimmt wieder 'ne Eins.« Ihre Stimme klingt enttäuscht und ein bisschen neidisch. Sie hat vorhin nur eine Drei plus zurückbekommen und ist echt unglücklich. Für die Klausur hat sie viele Stunden gelernt, weil gute Noten für ihre Eltern extrem wichtig sind. Manchmal denke ich, dass die Bernhardts die Liebe zu ihrer Tochter über deren Notenspiegel definieren.
Ich selbst habe sehr gute Noten, meistens zumindest. Für Sport gilt dies nicht. Frustriert denke ich an die letzte Stunde: Volleyball. Wer hat sich diese Folter ausgedacht? Ich kann einen Ball weder werfen noch fangen und wie das mit dem Pritschen und Baggern gehen soll, ist mir vollkommen schleierhaft. Wenn ich überhaupt Ballkontakt habe, fliegt das blöde Ding unkontrolliert irgendwo hin. Sonnenklar, dass mich kein Mensch in seiner Mannschaft haben will.
Wegen dir haben wir verloren! Den ätzenden Spruch habe ich mir so oft anhören müssen. Und die häufige Wiederholung dieses motivierenden Erlebnisses macht keine bessere Sportlerin aus mir.
Wenn ich endlich mit der Schule fertig bin, werde ich nie wieder einen Fuß in eine Turnhalle setzen. Ganz bestimmt nicht!
Auf dem Heimweg sitze ich im Linienbus und schaue aus dem Fenster. Eine Weile beobachte ich meinen Mitschüler Markus Mitteldorf auf seinem Rennrad. Der Radweg verläuft direkt neben der Bundesstraße und Markus ist auf der Geraden genauso schnell unterwegs wie der behäbig fahrende Bus.
In solchen Momenten träume ich davon, auch so scheinbar mühelos zu radeln. Zugleich bin ich überzeugt, dass mir das Radfahren zu anstrengend wäre. Davon abgesehen habe ich ohnehin kein Rennrad, sondern ein Damenrad mit einer langweiligen Nabenschaltung. Etwas Uncooleres gibt es kaum. Meine Mutter ist vor zwei Jahren fast ausgeflippt, als ich wenigstens das peinliche, bunte Netz entfernt habe, das über die obere Hälfte des Hinterrads gespannt war. »Ein Damenrad ohne Netz ist verboten«, hat sie geschimpft und sich echt aufgeregt. So ein Schwachsinn. Ich trage keine Röcke. Wozu brauche ich bitte ein Netz?
Vielleicht sollte ich auf ein Rennrad sparen? Die sehen nämlich echt gut aus und außerdem ist da von vornherein kein Netz dran.
Am Abend sind meine heutigen Hausaufgaben endlich geschafft: Ich habe einen vierseitigen Aufsatz über die Weimarer Republik verfasst, ein Arbeitsblatt vollgepackt mit Aufgaben der Integralrechnung bearbeitet und eine maßstabsgetreue Skizze zur Funktion des menschlichen Auges angefertigt.
Uff.
Ich schalte ich den Fernseher ein. Montags läuft Ein Colt für alle Fälle, eine Serie, die ich gern anschaue und über die meine Freundinnen und ich am nächsten Tag in der Schule reden werden.
Während Colt Seavers' Figur über die Mattscheibe flimmert, esse ich zu Abend. Obwohl ich hungrig bin, erlaube ich mir nur einen Diätjoghurt zum Abendessen und tunke ein Stück Knäckebrot hinein. Auf keinen Fall darf ich zu viele Kalorien aufnehmen. Ich finde mich zu dick, zumal Susanne erzählt hat, dass sie nur 63 cm um die Taille misst. Mein eigener Taillenumfang beträgt 67 cm. Jeden Morgen stelle ich mich gleich nach dem Aufstehen auf die Waage. Heute habe ich 55 kg gewogen. Mein Traumgewicht liegt bei 50 kg. Je weniger ich wiege, umso attraktiver fühle ich mich. Ich träume davon, dass mich Marc Buchner wahrnehmen wird, wenn ich richtig schön dünn bin. Eventuell fragt er mich dann, ob ich mit ihm ins Kino gehen möchte? Sehnsuchtsvoll starre ich in den leeren Joghurtbecher.
Vor dem Schlafengehen lese ich. Das Buch heißt Herrin der Falken und entführt mich in eine vollkommen andere Welt. Ich mag die Geschichte, in der die als Mann verkleidete Protagonistin viele Abenteuer in einer mittelalterlichen Fantasiewelt auf einem fremden Planeten bestehen darf. Blöderweise habe ich morgen wieder Schule und muss pünktlich aufstehen, sodass ich um zehn das Licht ausschalte, obwohl ich echt gern weiterlesen würde.
Im Dunkeln wälze ich mich hin und her und kann nicht einschlafen. Mir graust es, weil um sechs Uhr in der Früh der Wecker klingelt. Wie hasse ich es, morgens müde zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als auszuschlafen!
Ich vergrabe meinen Kopf unter dem Kissen und sehne mich nach dem Wochenende.
Ein esoterisches Geschäft
Dienstagnachmittag. Heute fahre ich mit dem Bus in die Innenstadt. Solche Ausflüge unternehme ich am liebsten allein: Ohne murrende Begleitung kann ich spontan jeden Laden ansteuern, der mich interessiert, und so lange darin stöbern, wie ich Lust habe.
Vor ein paar Wochen musste ich in einem Geschäft für Deko-Gegenstände eine gefühlte Ewigkeit auf Susanne und Martina warten. Meine Freundinnen stießen beim Anblick von unechten, quietschbunten Riesenblumen, klobigen Obstschüsseln aus Plastik mit exotisch wirkender Bemalung und sonstigem staubfangendem Kitsch einen Begeisterungsschrei nach dem anderen aus. Ich selbst fand es todlangweilig und wäre am liebsten abgehauen.
Mein aktueller Plan beinhaltet, in der gut sortierten Kosmetikabteilung meines Lieblingskaufhauses einen dunkelgrünen Kajalstift zu kaufen, um den Schminktipp für ›Katzenaugen‹ umzusetzen, der in der neuesten Ausgabe der Bravo stand. Außerdem gibt es im selben Gebäude eine umfangreiche Abteilung für Modeschmuck. Schon beim bloßen Gedanken an das faszinierende Glitzern schicker Ohrringe atme ich schneller. Meine Mutter hat neulich mit gutmütigem Humor festgestellt, dass ich wie eine Elster sei: Hauptsache, es blinkt, und du rennst hin.
Zum Glück vertrage ich jede Art von unechtem Schmuck ohne Probleme. Susanne beneidet mich darum. Sie hat eine Nickelallergie und kann nur kleine, langweilige Stecker aus Gold benutzen.
Am Busbahnhof steige ich aus und drehe den Ton meines Walkmans leiser, um mich besser im Straßenverkehr zu orientieren, bevor ich in Richtung der Fußgängerzone abbiege. Aus meinen Kopfhörern schallt Shout von Tears for Fears. Begeistert summe ich die Melodie mit, bis der Ton nach ein paar Schritten mit einem dumpf leiernden Geräusch stoppt.
Bandsalat! So ein Mist!
Genervt steuere ich auf einen wuchtigen Blumenkübel aus Beton zu, lasse mich auf dem harten Rand nieder und fummle die Kassette, die einen Mitschnitt aktueller Hits aus dem Radio enthält, aus dem Gerät. Nachdem ich das verknautschte Magnetband entwirrt habe, durchsuche ich meine Taschen nach einem Stift, mit dessen Hilfe ich das Band wieder aufwickeln kann. Ich finde keinen, sodass ich die Spule der Kassette mühsam mit dem Zeigefinger drehe. Da mir die Lust auf Musik fürs Erste vergangen ist, schiebe ich den Bügel der Kopfhörer in den Nacken und verstaue das Abspielgerät in der Jackentasche.
Sobald ich aufstehe, protestieren meine Zehen in meinen todschicken, spitzen Wildlederstiefeletten mit den Fransen im Wildweststil und den Pfennigabsätzen. Die Schuhe sind total unbequem, doch sie sehen so schön stylisch an mir aus, besonders mit der engen Röhrenjeans. Ich fühle mich damit sehr fraulich und älter als meine sechzehn Jahre.
Immerhin werde ich bald siebzehn!
Mit leichtem Hinken und dem zarten Wunsch, vorhin doch besser die Chucks angezogen zu haben, passiere ich auf dem weiteren Weg zum Kaufhaus die Niederlassung einer amerikanischen Fast-Food-Kette, deren Name in Deutschland relativ unbekannt ist. Vermutlich ist dieses spezielle Restaurant in unserer Kreisstadt angesiedelt, weil hier jede Menge US-Soldaten stationiert sind.
Ob ich mir eine Portion Pommes gönne? Die Idee ist verlockend, denn im Lokal befindet sich neben dem Fach mit Papierservietten und Plastikstrohhalmen ein Riesenspender, aus dem man so viel Ketchup auf die Fritten drücken kann, wie man will. Im Gegensatz dazu gibt es woanders nur winzig kleine Portionsbeutelchen mit der Tomatentunke.
Ich esse gern ein paar Pommes zum Ketchup, witzle ich im Stillen und grinse breit. Am Ende entscheide ich, das Geld (und vor allem die Kalorien) lieber zu sparen, und marschiere stattdessen schnurstracks in das Warenhaus hinein, das schräg gegenüber liegt.
Als ich eine halbe Stunde später wieder auf die Straße trete, bin ich um zwei Paar auffällige, silberfarbene Ohrringe mit Strassbesatz und einen billigen, grünen Kajalstift reicher, dafür um rund zehn D-Mark ärmer. Mit einem befreiten Gefühl inhaliere ich die kühle Herbstluft. Im Kaufhaus riecht es stets recht abgestanden. Dabei frage ich mich, wie es jemand schafft, da drin den ganzen Tag lang zu arbeiten.
Mit dem Strom der Passanten lasse ich mich in die belebte Fußgängerzone hineintreiben, meine mittlerweile geschwollenen Zehen ignorierend, so gut ich kann. Um mich von der Vorstellung abzulenken, dass meine Füße in Schraubstöcken eingeklemmt seien, sehe ich mir die Auslagen in den Schaufenstern an. Unweit der Traditions-Buchhandlung bleibe ich stehen und entlaste meinen linken Fuß, dessen äußere Zehen inzwischen extrem gepeinigt sind. Wie ein Storch balanciere ich auf dem rechten Bein. Dabei entdecke ich im Menschengetümmel drei Jungs aus meinem Jahrgang: Hans, Max und Alex. Ich schlucke trocken. Wie reagiere ich, wenn sie auf mich zukommen und mit mir reden wollen? Ich habe keine Ahnung, was ich zu ihnen sagen soll. Und ich habe echt keinen Bock, mich zu blamieren! Panik brandet in mir auf und verdrängt die Qual meiner Füße. Spontan flüchte ich zum nächstgelegenen Ladeneingang.
Trotz des herbstlichen Wetters steht die Ladentür sperrangelweit offen. Würziger Geruch nach Räucherwerk wabert auf den Bürgersteig hinaus. Was ist denn das für ein Geschäft? Zuvor ist es mir nie aufgefallen. Fein geschnitzte Menschlein, festgehalten in einer verrenkten Tanzpose, eingefasst in kreisrunden Holzeinfassungen voller verschlungener Ornamente wetteifern in der Auslage mit fetten Drusen aus Amethyst. Daneben stehen messingfarbene Schüsseln in verschiedenen Größen. Esoterisch ist das erste Wort, das mir in den Sinn kommt.
Über der rechten oberen Ecke der Eingangstür hängt ein zierliches Windspiel mit eleganten, metallenen Röhren und wird sanft vom Luftzug bewegt. Melodisches Geläut erklingt, als ich den Laden mit hastigen Schritten betrete.
Sofort fesselt ein mannshoher Spiegel meinen Blick, der mich im Ganzen zeigt. Ich nutzte die Gelegenheit und checke mein Spiegelbild von Kopf bis Fuß: Die dunkelbraunen Naturlocken sitzen dank Haarspray brav an ihrem Platz. Für meine Haarpracht investiere ich jeden Tag mindestens zwanzig Minuten und Löwenmähne ist das Stichwort. Mit dieser Frisur eifere ich den Heldinnen in den Kinofilmen und den weiblichen Models in der Werbung nach. Inmitten des Lockengewirrs blitzen meine Lieblingsohrringe, beinahe schulterlange Hänger mit pink schillernden Blättern aus leichtem Metall. Meinen hellen Teint habe ich sorgfältig gepudert und versucht, die Wangen und das Kinn mit Rouge zu betonen, um meine breiten Kieferknochen zu kaschieren, die mein Gesicht für meinen Geschmack zu viereckig wirken lassen. Meine Kulleraugen habe ich heute mit lila Lidschatten akzentuiert. Angeblich ist Violett in allen Schattierungen aktuell bei dunkelbraunen Iriden wie den meinigen angesagt.
Gestern Abend hat mein Vater im Versuch, lustig zu sein, gemeint, ich sähe aus, als hätte ich ein Veilchen. Da er keine Ahnung von Modetrends hat, ließ ich seine Aussage so würdevoll an mir abperlen, wie ich nur konnte. Geärgert habe ich mich dennoch darüber!
Der fuchsiafarbene Lippenstift harmoniert mit dem Violett des Augen-Make-ups, ebenso mein rosafarbener, taillenkurzer Mohair-Pullover, der mich das Taschengeld eines ganzen Monats gekostet hat. Dazu trage ich einen breiten, silberfarbenen Glitzergürtel um den hochgeschnittenen Jeansbund. Mit der engen Jeans und den Stiefeletten sieht das Outfit einfach perfekt aus.
Hochzufrieden mit meinem Erscheinungsbild löse ich den Blick vom Spiegel und begutachte die Auslage genauer. In einem Regal stehen haufenweise Bücher. Astrologie-Graphologie, lese ich. Und: Ananas für Anfänger. Ich korrigiere mich: Es heißt ›Asanas‹. Was auch immer das ist.
Im hinteren Teil der Ladenräume wird Schmuck angeboten. Auf dem Weg dorthin schiebe ich mich an einem Tisch mit Audiokassetten vorbei. Phantasiereisen steht auf einem Schild darüber.
»Wie fantastisch«, murmle ich im Selbstgespräch.
Draußen bummeln in diesem Moment Alex, Hans und Max vorbei und unterhalten sich lebhaft gestikulierend miteinander. Sie würdigen das Schaufenster keines Blicks. Ich seufze befreit auf.
»Kann ich dir helfen?« Wie aus dem Boden gewachsen steht eine dürre Frau vor mir. Sie trägt eine knielange Weste, die wie ein Teil eines Flokatis aussieht. Fünf Ketten von beachtlicher Länge mit unförmigen Anhängern baumeln vor ihrer Brust. Daneben hängt eine Lesebrille an einer dünnen, geflochtenen Schnur. Ihre Füße stecken in Gesundheitssandalen, aus denen dicke Norwegersocken lugen. Die mausbraunen Haare sind hüftlang und mit silbergrauen Strähnen durchsetzt. Sie hat sie zu Zöpfen geflochten, was auf mich bei ihrem Alter ein wenig sonderbar wirkt. Zudem hält sie eine Pfeife in der Hand, aus der sich ein dünner Rauchfaden schlängelt. Entweder riecht der Pfeifenrauch gleichfalls nach dem Räucherwerk oder er wird davon komplett übertüncht.
»Ich, äh, wollte den Schmuck ansehen«, stottere ich überrumpelt.
»Schmuck befindet sich im hinteren Teil des Ladens. Suchst du etwas Bestimmtes?«
»Nein, ich wollte nur mal schauen.«
»Gern.« Sie verliert das Interesse an mir, lächelt routiniert und lässt mich stehen. Das Lächeln erreicht ihre eisblauen Augen nicht.
Seh-Hund, denke ich. Alexandras Mutter arbeitet in einem Modegeschäft und hat uns verraten, dass sie untereinander insgeheim die Kunden so nennen, die nur stöbern, aber nichts kaufen wollen.
Ich stöckle zu einer Glasvitrine, in der unterschiedliche Schmuckstücke liegen. Im Gegensatz zur Kaufhausware in der Abteilung für Modeschmuck gleicht hier kein Teil dem anderen. Ich bin fasziniert. Alles wirkt solide und hochwertig. Die meisten Stücke sind aus Silber gefertigt; Gold scheint nicht gefragt zu sein. Amulette mit einer weiß-blauen, an Augen erinnernden Bemalung sowie Kettenanhänger mit Halbedelsteinen in Form verschiedener verschnörkelter Symbole funkeln mich verlockend an. Vielfach gewundene Ringe und filigrane Ohrringe halten sich die Waage.
Eine Sektion der Auslage enthält nur Armreifen. Auf einem Podest neben der Vitrine präsentiert man ein besonders ausgefallenes Stück, gewunden um einen künstlichen Unterarm, der mit schwarzem Samt bezogen und nicht hinter Glas gesperrt ist. Der Reif ist breit und scheint schwer zu sein, wirkt wie durch Hammerschläge geformt und ist auf einer Seite offen, damit man ihn eng am Handgelenk tragen kann. Ihn zieren fünf schwarze Steine in fein gearbeiteten Fassungen, je zwei kleine Steine außen und ein größerer in der Mitte.
Onyx. Ich mag Onyx, seit ich gelesen habe, dass der Stein perfekt zu meinem Tierkreiszeichen passt. Ein Preisschild sehe ich nicht.
»Entschuldigung?«, rufe ich.
Niemand kommt.
»Was kostet das, bitte?«
Mir begegnet nur Schweigen.
Ich warte. Nach einer Minute unternehme ich einen neuen Versuch: »Kann ich den bitte mal anziehen?«
Keine Antwort.
Also gut. Ich kremple den linken Ärmel hoch und recke mich nach dem Ausstellungsstück. Mit einer übertrieben ausladenden Bewegung zupfe ich den Reif von der Halterung herunter und winde ihn um mein Handgelenk. Auf keinen Fall möchte ich wie eine Ladendiebin wirken, die ihn ohne Bezahlung einsteckt.
Das silberne Schmuckstück sitzt perfekt. Ich bin überrascht, dass es sich nicht kalt anfühlt. Im Gegenteil, es ist fast warm.
Komisch, als hätte es eben noch jemand angehabt. Aber außer mir und der Verkäuferin ist kein Mensch hier.
Um die Ware genauer anzusehen, begebe ich mich zurück in Richtung Ladeneingang, wo es heller ist. Der Duft des glimmenden Räucherstäbchens, das am Kassentisch in einer schmalen Holzhalterung steckt, ist hier weitaus penetranter als weiter hinten im Laden. Mir wird leicht schwindlig. Benebelt starre ich den Armreif an und habe den Eindruck, dass sich die Steine in der Größe verändern. Der mittlere erweckt den Anschein zu schrumpfen. Stattdessen wächst der Stein rechts außen im Durchmesser. Irritiert blinzle ich. Jetzt erst entdecke ich, dass altmodische Lettern im Silber über den Steinen eingraviert sind. Waren sie vorhin schon da? Ich habe sie gar nicht bemerkt. Um sie besser zu lesen, halte ich den Reif näher vor meine Augen. Die Gravur leuchtet weißlich und die verschnörkelten Lettern scheinen sich zu bewegen wie träge Schlangen.
Himmel, was ist in diesem Räucherzeug drin, frage ich mich in einem entfernten Winkel meines Bewusstseins und zwinkere mehrfach, denn das Entziffern fällt mir schwer.
Wie ein Anfänger buchstabiere ich.
A-R-D-O-R.
»Aar-door«, sage ich unbeholfen und wiederhole:»Ardor.«
Dann wird es dunkel.
Bitte, friss mich nicht
Auf einmal saß ich auf dem Hosenboden. War ich ohnmächtig geworden?
Mannomann, diese ätzenden Räucherstäbchen.
Meine Sicht kehrte zurück. Aber – halt – etwas stimmte hier nicht. Das war nicht der Laden, in den ich eingetreten war. Eigentlich war es gar kein Laden, sondern ...
Eine Höhle?
Vor mir klaffte ein unregelmäßiges Loch, das nach draußen führte. Tageslicht fiel herein und erhellte eine dunkelgraue, unbehauene Felswand im Eingangsbereich.
Ich hatte von miesen Trips reden hören. War das hier einer? Spontan stellte ich mir vor, wie ich bewusstlos auf dem Boden in dem Geschäft lag. Bestimmt rief schon irgendwer einen Krankenwagen. Wie peinlich war das denn?
Ich schlug die Hände vors Gesicht und bemerkte den Armreif. Überhaupt – ich trug dieselbe Kleidung wie eben noch beim Stadtbummel: die Jeansjacke, den schicken Pulli, die Jeans nebst Glitzergürtel und die Stiefeletten. Es kam mir befremdlich vor. Ich konnte mich an keinen einzigen Traum erinnern, in dem ich jemals meine Tagesmontur getragen hätte. Der Armreif erschien leichter als vorher. Er war auch anders warm, hatte bloß meine Körperwärme, wie ich es von normalem Schmuck aus Metall gewohnt war.
Mit einem leisen Ächzen rappelte ich mich hoch und stöckelte über den unebenen Höhlenboden auf das Licht zu. Dabei knickte mein linker Fuß zweimal hintereinander tüchtig um.
»Aua! Ach, Scheiße.« Dann schlug ich mir auf den Mund. Was, wenn ich nicht allein war?
Meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich direkt danach: Fast hatte ich den Eingang erreicht, als sich ein riesiger Schädel hereinschob. Obwohl das ohnehin spärliche Licht dadurch nochmals stark reduziert wurde, sah ich ihn allzu deutlich. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war: Das ist ein Drache!
Prompt saß ich wieder, weil ich vor lauter Schreck rückwärts umkippte. Auf dem Gesäß nach hinten rutschend, suchte ich Schutz in einer Nische an der Wand und hoffte inbrünstig, dass das Vieh mich weder witterte noch sah.
Weit gefehlt, liebe Helene! Die markanten Nüstern weiteten sich. Vermutlich war mein parfümiertes Deo, dessen schwere Duftmarke ›Magic Musk‹ versprach, daran nicht unschuldig.
Wider Erwarten zog sich das Untier ein paar Sekunden später zurück. Es wurde wieder heller. Ich ließ die Hand sinken, die ich instinktiv die ganze Zeit auf den Mund gepresst gehalten hatte, und starrte auf den Höhleneingang, in dem sich nun statt des Drachenkopfs eine Männersilhouette abzeichnete. Im Gegenlicht konnte ich erkennen, dass die Gestalt einen knielangen Überrock mit einem breiten Ledergürtel trug und einen länglichen Gegenstand umfasst hielt. War das etwa ein Schwert?
Erst ein Drache und jetzt der Bruder von Robin Hood, das ist echt ein mieser Trip! Zitternd wie Espenlaub gab ich mir Mühe, möglichst leise Luft zu holen.
»Wie hast du uns gefunden? Verdammt, wie kommst du überhaupt hierher? Zeig dich, Fremder, sonst mache ich dir Beine!« Seine Stimme klang nicht nur drohend, sondern auch jung, wenngleich reifer als die Stimmen meiner Mitschüler. Ich konnte ihn bestens verstehen, akustisch sowie die Sprache selbst. Obgleich die Wörter, die er in einem weichen Bariton rief, aus völlig unbekannten Silbenkonstellationen bestanden, erfasste ich ihre Bedeutung genau. Angsterfüllt presste ich meinen Rücken weiterhin krampfhaft an die Wand. Gleichzeitig wirbelten meine Gedanken wie wild durcheinander. Wo war ich? Warum konnte ich die fremde Sprache verstehen? Wie gefährlich war meine Situation? ›Beine machen‹ war normalerweise nichts Angenehmes.
Der Mann drehte sich halb um und sprach leiser, doch immer noch hörbar, zu jemand anderem: »Du meinst, es ist eine ›sie‹ und sie fürchtet sich? Ich frage mich, was sie hier sucht ... Ja, du hast recht.« Sodann erscholl seine Stimme in meine Richtung. »Dir geschieht nichts!«
Ich schwieg.
»Ich komme jetzt zu dir. Ich warne dich, tu nichts Unüberlegtes.«
Ich hatte nichts dergleichen vor. Verzweifelt hielt ich mir lieber die Augen zu wie ein kleines Kind. Ich sehe dich nicht und du siehst mich auch nicht.
Natürlich funktionierte es nicht. Schon stupste er meinen Unterschenkel an.
»Ah!«, gellte ich schrill, nicht vor Schmerz, sondern vor Schreck, weil die Berührung unerwartet kam.
»Ist schon gut. Ich sehe, dass du keine Bedrohung bist. Komm, steh auf.«
Ich ließ die Hände sinken und blickte voller Furcht zu ihm hoch. Er reichte mir die Hand. Zögernd ergriff ich sie. Sie war voller Schwielen, trocken und warm. Meine eigenen Finger kamen mir dagegen kalt und nass vor. Er zog mich auf die Füße. »Komm erst mal ins Licht, damit ich dich richtig sehen kann.«
»Okay«, brachte ich hervor und taumelte ins Freie. Ich knickte ein drittes Mal um. Vor lauter Panik bemerkte ich es kaum.
An einer grünlich-braun gefleckten, bauchigen Wand mit schillernden Schuppen kam ich zum Stehen. Nur, dass es keine Wand war. Es war die Flanke des Drachen. Und das Tier war gigantisch. Es reckte sein Haupt in meine Richtung. Seitlich an seinem Schädel, der fast dreieckig geformt war, machte ich gelb glänzende Augen mit längs stehenden, schlitzförmigen Pupillen aus. Im hellen Tageslicht, das mich nach der Dunkelheit im Inneren der Höhle blendete, waren sie sehr schmal. Nahe den Augen saßen zwei wulstige Erhebungen mit jeweils einem Loch in der Mitte. Ich nahm an, dass es sich um Ohren handelte. Zwischen den Nüstern oberhalb des spitzen Mauls entsprang eine dornige Knochenleiste, die nur mit dünner Haut überspannt war. Sie verlief zur Stirn und von dort aus weiter über den Scheitel und den langen Hals bis hin zum Rücken. Die zackigen Auswüchse wurden in der Mitte des Halses erst größer, dann wieder kleiner, bis sie unter den angelegten Schwingen verschwanden. Das Tier kauerte auf stämmigen Beinen, fast in der Manier von Peterle, Susannes Hauskater. Vorn besaß der Drache je vier, hinten drei breite Zehen, wobei die hinteren Zehen massiver im Vergleich zu den vorderen waren. Alle Zehen hatten prominente, hornige Auswüchse, die am ehesten Krallen glichen. Aus jeder Ferse wuchs ein Sporn aus demselben hornigen Material und am Rumpfende schloss sich ein langer, kraftvoll wirkender Schwanz an, welcher eine ähnliche Knochenleiste aufwies wie der Hals. Der Schwanz ringelte sich halb um den Liegeplatz der Kreatur. Es sah aus, als säße sie in einem Nest.
Das Ungeheuer öffnete sein Maul und offenbarte spitze Zähne. Sehr viele spitze Zähne.
Fleischfresser. Der Gedanke kam ungebeten. Pure Panik schlug über mich herein wie eine Woge. »Bitte, friss mich nicht!«
Das Maul schloss sich und eine flache, bläuliche Zunge fuhr mehrfach heraus und wieder hinein. Irrte ich mich, oder bogen sich die Mundwinkel des Reptilienmauls empor? Lachte das Biest etwa über mich? Der Mann lachte auf jeden Fall schallend, wie ich hörte. Ich fuhr zu ihm herum.
»Keine Bange, Arren wird dich gewiss nicht fressen. Mensch mag er nicht«, kicherte er.
Wie konnte sich der Kerl nur amüsieren, während ich hier Todesängste ausstand? Ärger wallte in mir auf, der die Angst verdrängte. Mit zusammengekniffenen Augen taxierte ich ihn. Er war hochgewachsen und maß cirka einen Meter neunzig. Seine Schultern waren breit, die Arme und Beine muskulös. Auch wenn er bei Weitem nicht so massig wie Arnold Schwarzenegger war, ließ er mich dennoch an die Muskelpakete denken, die ich auf dem Filmplakat von Conan der Barbar gesehen hatte. Er trug eine grasgrüne, ärmellose Tunika mit einem groben, langärmligen Hemd darunter, das vielleicht einmal weiß gewesen war, und eng anliegende, beigefarbene Stoffhosen. Weiche, hellbraune Lederstiefel mit breiter Krempe, deren Schaft fast bis zu seinen Knien reichte, vervollständigten das Bild. Am Gürtel staken zwei lange, umhüllte Messer neben einer abgewetzten Schwertscheide und einem handlichen Lederbeutel. Das schulterlange, wellige Haar war aschblond und wirkte ungekämmt. Er trug es zu einem losen Zopf gebündelt, der durch einen dünnen Lederriemen zusammengehalten wurde. Die ebenmäßigen Gesichtszüge waren kantig, die gerade Nase harmonierte mit den restlichen Proportionen des Gesichts. Seine Brauen waren dunkelblond und nicht zu buschig. Sie schirmten hellgraue, leicht schräge Augen, die von dichten, dunklen Wimpern gesäumt waren. Einen Bart hatte er zwar nicht, doch sein Kinn war stoppelig. Die Zähne, die er beim Lachen zeigte, waren weiß und sahen gesund aus. Lachtränen rannen ihm über das Gesicht. »Ja, Arren. Du hast vollkommen recht.« Er schnappte nach Luft. »Sie kann dir gar nicht schmecken.«
Das Riesenvieh legte seinen Kopf schief und sah ihn an.
Wäre der Drache kleiner, wäre er einem eifrigen Haustier nicht unähnlich, dachte ich verwirrt.
»Ich soll dir ausrichten«, wandte er sich an mich, »dass Arren kein Drache ist. Er ist ein Flugreptil. Oder nenne ihn wenigstens eine Echse.«
Ich starrte ihn an. Woher wusste er, dass ich den Drachen als einen solchen bezeichnet hatte? Und von wem sollte er etwas ausrichten?
Der Drache schnaubte. Es klang empört.
Der Mann verkündete: »Nein, er ist immer noch kein Drache. Und er möchte wirklich nicht so genannt werden. Es kränkt ihn. Außerdem hat er einen Namen. Er heißt Arren. Ach ja, Arren ist derjenige, von dem ich dir etwas ausrichten soll.«
Ungeheuerliches dämmerte mir: Dieses Vieh las meine Gedanken. Das durfte einfach nicht sein!
»Doch, es ist so«, erwiderte der Mann aufgeräumt. »Einige Flugreptile lesen Gedanken. Es kann für uns Reiter ausgesprochen vorteilhaft sein. – Arren freut sich, dass du ihn nicht mehr ›Drache‹ nennst, aber ›Vieh‹ empfindet er gleichfalls als unhöflich. Er bittet mich, dich zu erinnern, dass er dir seinen Namen schon mitgeteilt hat.«
Meinetwegen, dann eben Arren.
Das Tier – Flugreptil!, erinnerte ich mich – wackelte zufrieden mit dem Kopf, was einem Nicken sehr nahekam.
An nichts denken, an nichts denken, an nichts denken! Ich will nicht, dass irgendwer, egal wer, meine Gedanken liest.
»Keine Sorge, du gewöhnst dich daran.« Der Mann zwinkerte aufmunternd.
Das ist ja zum Haareraufen!
»Tu dies lieber nicht, sagt Arren. Deine Haare sehen gerauft genug aus. Jetzt erkläre uns bitte, wie du in unsere Höhle gelangt bist.« Sein Blick wanderte von meinem Scheitel bis zu meinen Schuhspitzen. Er runzelte die Stirn. »Du bist nicht von hier, oder? Bist du eine Gauklerin?«
»Warum das?«, gab ich erstaunt zurück. Besonders kunstfertig konnte ich bisher kaum gewirkt haben.
»Deine Kleidung. Sie ist recht sonderbar.« Er zeigte auf meine Stiefeletten. »Kann man darin überhaupt laufen? Es sieht abenteuerlich aus. Und was hast du da um den Hals?« Er deutete auf den Kopfhörer meines Walkmans. Dann schaute er mir ins Gesicht und stutzte. »Musstest du fliehen? Wer hat dich so zugerichtet?«
»Wieso zugerichtet?« Ich verstand nur Bahnhof.
»Deine Augen – sie sind beide blau und schwarz angelaufen. Bist du geschlagen worden? Hat man dir die Hände gefoltert?« Sein Blick richtete sich auf meinen fuchsiafarbenen Nagellack.
Ich erinnerte mich an meinen Vater mit seiner Assoziation eines Veilchens. Hatte er doch recht? Beleidigt entschloss ich: Die hatten allesamt von Mode keinen blassen Schimmer!
»Ich bin nicht verletzt. Das ist Lidschatten. Und Nagellack. Und das da ist ein Walkman.« Genervt zerrte ich das Gerät aus der Jackentasche und fuchtelte damit herum. Während ich das Kästchen in die Tasche zurückstopfte, fuhr ich in schroffem Tonfall fort: »Ich habe nur null Ahnung, wo ich hier bin. Und wer bist du überhaupt?«
»Verzeih mir, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Ich bin Jewlier. Und wie heißt du?«
»Ich bin Helene, Helene Klein.« Beim Aussprechen klang mein Name in meinen Ohren komisch. Außer meinem patzigen Tonfall hörte ich nur ›Haylan‹ heraus. Meine Gereiztheit nahm zu: Drachen, die Gedanken lasen, und Namen, die beim Sprechen eine Transformation erhielten.
Neben mir grunzte Arren unwirsch.
Entschuldigung, ich hab's gerafft! Düster versuchte ich, meinen Gedankenstrahl direkt in seine Richtung zu schicken. Dann stierte ich den Mann, der sich als Jewlier vorgestellt hatte, mit zusammengezogenen Brauen an. »Wo bin ich hier?«
»Wie du siehst, befindest du dich direkt vor unserer Höhle.« Er wies mit einer weit ausholenden Handbewegung auf den Höhleneingang.
Ist der so doof oder tut der nur so, um mich zu ärg... Ach, Mist, meine Gedanken werden gelesen! Am liebsten hätte ich losgeschrien und Gegenstände wie zum Beispiel Bücher gegen die Felswand geschleudert.
»Das macht keinen Sinn. Was willst du damit erreichen, wenn du Schriftrollen gegen die Wand wirfst? Sie gehen nur kaputt. Hast du jemals eine kopiert? Weißt du, wie viel Arbeit das ist?«
Anscheinend hatte das Tier – Arren, na gut, dann heißt es halt Arren! – ihm wieder unaufgefordert alles ausgeplaudert, was ich dachte. Zu allem Überfluss benahm sich dieser Mensch erwachsener als meine Eltern und machte mich von Minute zu Minute rasender.
»Bitte beruhige dich.« Er sprach ruhig und langsam mit mir, als ob er es mit einem Kleinkind zu tun hätte, was mich noch mehr aufbrachte. »Du wolltest nicht wissen, an welchem Platz du dich befindest, sondern wie das Land heißt. Das habe ich nun verstanden. Du bist in Ardor.«
Ein kalorienfreier Trip
Ardor.
Es war das Wort, das ich vom Armreif abgelesen hatte. Ich hob meinen Arm und inspizierte das Schmuckstück. Der größte Stein saß jetzt eindeutig rechts außen. Die Buchstaben der Gravur waren verschwunden, so sehr ich meinen Unterarm auch drehte und aus verschiedenen Winkeln, mal direkt vor der Nase, mal aus größerer Distanz, danach suchte. War es überdies möglich, dass die Steine durchsichtiger als zuvor aussahen?
Okay. Es ist ein Traum. Oder ein Trip. Ich werde bald erwachen, sprach ich mir selbst gut zu.
»Oh, Arren und ich sind quicklebendig«, sagte Jewlier und klang wieder grässlich vergnügt. Während er sprach, schob er sein Schwert zurück ins Futteral. Er war wohl endgültig überzeugt, dass ich zwar nervig, aber harmlos war. »Hast du Hunger?«
In all der Aufregung hatte ich nicht an meinen Magen gedacht. Ein dezentes Hungergefühl war durchaus vorhanden. Doch ich hatte heute schon fast 1200 Kalorien zu mir genommen.
»Nein«, log ich.
»Was sind Energiepunkte?«
Arren hatte schon wieder meine Gedanken geradewegs an ihn weitergegeben. Aus ›Kalorien‹ wurde ›Energiepunkte‹. Meinetwegen.
»Na ja, ich zähle Einheiten von dem, was ich esse. Ich bin zu dick. Und wenn ich weniger esse, nehme ich ab.«
Jewlier sah mich an, als ob ich ihm erzählt hätte, dass ich ein Gespenst sei. Seine Stimme klang ungläubig. »Zu dick? Du stammst wirklich nicht von hier. Wir in Ardor essen, wenn wir etwas bekommen. Wer über Reserven verfügt, kann sich glücklich schätzen, denn wer zu dünn ist, stirbt zuerst, sobald es eine Missernte und daraus folgend eine Hungersnot gibt.«
Missernte? Hungersnot? Ich dachte an die überquellenden Regale im heimischen Supermarkt, wo eine komplette Abteilung nur voller verschiedener Schokoladensorten oder Toastbrot war, sowie an unseren stets wohlgefüllten Kühlschrank zu Hause.
Echt ein mieser Trip. Auf der anderen Seite, im Traum kann ich essen, was ich will.
»Okay, ich esse was«, lenkte ich ein und bemühte mich, höflicher zu klingen.
Beinahe sofort bereute ich meine Entscheidung. Jewlier griff nach einer Ledertasche mit einem langen Gurt, die halb unter Arrens Vorderbeinen gelegen hatte, und holte einen gebratenen Kadaver heraus. Es sah aus, als ob es ein Hase gewesen sei. Oder eine Katze?
Er packte einen Hinterlauf, riss ihn ab und reichte ihn mir: »Hier, iss.«
Mit spitzen Fingern nahm ich das Ding entgegen und begutachtete es misstrauisch. Ekel wallte in mir auf.
»Das mag ich nicht, sorry.« Mit ausgestrecktem Arm hielt ich ihm das Fleisch wieder hin.
»Na gut, dann nicht«, meinte er munter, nahm es zurück und biss selbst hinein. Er kaute hungrig, ihm schien es zu schmecken. Dass ich das Mahl verschmäht hatte, störte ihn offensichtlich nicht.
Na gut, wenn es kein Traum ist und hier so weitergeht, nehme ich wenigstens automatisch ab!
Jewlier aß im Stehen. Ich zog es vor, mich hinzusetzen, und suchte mir einen einigermaßen flachen Stein, der nur wenig am Gesäß drückte. Zweifelnd taxierte ich den dunklen Eingang. »Wohnst du echt in der Höhle?«
»Klar«, nuschelte er mit vollem Mund. »Flugreptile sind in Ardor begehrt. Wenn Arren und ich schlafen, sind wir angreifbar. Die Höhle bietet uns Sicherheit.« Er wischte sich mit dem Hemdsärmel über den Mund. »Wir rätseln immer noch, wie es dir gelungen ist, hierher zu gelangen.«
»Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Eben war ich noch in so einem komischen, esoterischen Geschäft. Dann wurde es finster. Und jetzt bin ich hier. Einfach so.« Beim Sprechen wurde aus ›esoterisch‹ automatisch ›anderweltlich‹.
»Anderweltliches Geschäft ... Allmählich verstehe ich. Dann musst du eine Reisehilfe haben. Ich glaube, es ist dein Armreif. Lass mich mal sehen.« Er griff nach dem Schmuck. Seine Hände waren voller Bratenfett. Angewidert zog ich den Arm fort.
Er schaute mich verständnislos an, dann schien er zu lauschen. Offenbar informierte ihn Arren, dass ich keine Essensreste auf meiner Kleidung schätzte.
»Dann zeig mir dein Kleinod bitte selbst.«
»Hier.« Ich hielt ihm mein Handgelenk unter die Nase.
Er betrachtete das Schmuckstück eingehend. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Wenn dieser Schmuck, wovon ich ausgehe, deine Reisehilfe war, funktioniert sie momentan nicht mehr. Sie ist nur ein gewöhnlicher Gegenstand und benötigt einen Verstärker, um zu wirken. Erinnerst du dich an etwas anderes, bevor du gereist bist?«
Bin ich gereist? Irgendwie machte der Gedanke Sinn. Ich dachte nach.
»Ach ja, das Räucherstäbchen!« Das Wort ›Räucherstäbchen‹ blieb sinngemäß das Gleiche und erfuhr keine Korrektur, doch an seinem verwirrten Blick bemerkte ich, dass ich weiter ausführen musste. »Es ist ein dünnes Stück Holz, das intensiv riecht, wenn man es abbrennt.«
Er sah mich verständnislos an und zuckte mit den Schultern. »Ich denke, ich benötige Arrens Hilfe. Erinnere dich genau an dein Erlebnis. Am besten schließt du die Augen. Arren wird deine Erinnerung an mich übertragen.«
»Okay.« Erstaunlicherweise verwandelte dieses sonderbare Übersetzungswunder mein ›Okay‹ nicht in ein ›Ist gut‹ oder Ähnliches. Zwar mochte es die Sprachtransformation ›Helene Klein‹ nicht, jedoch ›Okay‹ war anscheinend ... völlig okay.
Folgsam schloss ich die Lider und rief mir die Minuten in dem Laden, so detailliert wie ich nur konnte, ins Gedächtnis. Als ich die Augen wieder öffnete, war Jewlier erneut am Kauen und schaute dabei nachdenklich drein. Den Rest seiner Mahlzeit, der aus abgenagten Knochen bestand, reichte er sodann an Arren weiter. Dieser nahm das Angebotene sachte mit den Lippen auf. Dann hörte ich es zwei- oder dreimal kräftig malmen. Beim genüsslichen Schlucken glitt eine dicke, halb durchsichtige Haut aus der Richtung seines Unterlids über seine Augen.
Faszinierend.
Jewlier wischte die Hände an der Hose ab.
Was für tolle Tischmanieren. Und eine Dusche hätte ihm auch mal wieder gutgetan! Kaum hatte ich diese Sätze gedacht, fiel mir das Gedankenlesen ein und ich schämte mich für die unverblümte Überlegung.
Anscheinend hatte ich Glück. Er ließ es unkommentiert und meinte stattdessen: »Wie ich geahnt habe: Der Schmuck ist eine Reisehilfe. Damit sie ihre Funktion aufnimmt, ist dieser spezielle Rauch vonnöten.«
»Äh, wie jetzt?«, stotterte ich. Räucherstäbchen gab es in x Noten. Für mich rochen sie alle gleich, besondere Erfahrung mit Räucherwerk hatte ich nicht. Ich hatte keine Idee, aus welchem Holz die nämlichen Stäbchen bestanden.
»Ja, natürlich«, sagte Jewlier unvermittelt zu Arren. »Entschuldige bitte.« Dann wandte er sich an mich. »Arren fliegt auf Nahrungssuche. Am besten kommst du mit mir in die Höhle. Hier wird es gleich ein bisschen turbulent.«
Er bugsierte mich in Richtung des Höhleneingangs. Gleichzeitig breitete das Reptil die Schwingen aus und schlug damit. Es entstand ein gewaltiger Luftstrom, der eine Menge Staub vom Boden aufwirbelte. Ich musste niesen und meine Augen tränten. Während ich mit Jewlier in die Höhle stolperte, stieß sich Arren kraftvoll mit den Beinen ab. Er erhob sich deutlich eleganter in die Luft, als ich es bei seiner Körperform jemals für möglich gehalten hätte.
»Arren hat dich gehört. Nenne ihn bitte nie wieder wuchtig oder unförmig. Das mag er nicht. Er weiß selbst, dass er kein schlankes Flugreptil aus den Landen im Osten ist. – Übrigens besteht der Kontakt zwischen dir und ihm nur, solange du in seiner Nähe bist. Er verliert dich in Kürze. Falls du einen Wunsch hast, musst du ihn ab sofort laut äußern, bis er wieder hier ist.«
»Okay ...« Jäh wurde mir die räumliche Nähe zu einem wildfremden Mann intensiv bewusst. Ich konnte mich nicht erinnern, außer im überfüllten Bus jemals so dicht bei einem Mann gestanden zu sein, der nicht zur Familie gehörte. Dazu war ich mit ihm hier allein. Ich schob mich dezent einige Schritte zur Seite. Dabei knickte ich prompt wieder um und strauchelte. »So ein blöder Mist!«
Bevor ich eine Stütze an der Felswand fand, fasste Jewlier nach meiner Taille und umfing mich. »Ich halte dich«, erklärte er überflüssigerweise.
Ich spürte seinen kraftvollen Arm und den muskulösen Brustkorb. Er roch nach Schweiß und dem Braten von vorhin. Angeekelt unternahm ich den Versuch, ihn wegzuschieben, was mir nicht gelang.
»Oh, kein Dank?«
»Nein. Ich komme super allein zurecht«, moserte ich. Der Kerl soll mich in Ruhe lassen!
In einem verborgenen Winkel meiner selbst rief ein leises Stimmchen, dass ich mich furchtbar zickig aufführte.
Außerdem, und da war ich mit dem Stimmchen völlig d'accord, kam ich in dieser Welt, sollte sie real sein, ganz sicher nicht allein zurecht.
Erste Schritte
Auf meinen Pfennigabsätzen stakste ich so würdevoll wie möglich wieder aus der Höhle hinaus. Und prallte voller Schreck zurück.
Wo vorhin die riesige Echse gekauert hatte, war der Blick nun frei. Ich befand mich auf einem schmalen Plateau inmitten einer steilen Bergwand. In der Tiefe lag ein urtümliches Tal, an dessen Grund sich ein wilder Bergbach entlangschlängelte, gesäumt von dürren Nadelbäumen. Das Wasser glitzerte zwischen wuchtigen Felsen, Geröll und Gestrüpp. Auf der Höhe des Plateaus gediehen nur ein paar niedrige, regelrecht mickrige Sträucher und vereinzelte, kümmerliche Gräser. So wie sie ausschauten, gelang es ihnen nur knapp, unter diesen kargen Bedingungen zu überleben. Der Schreck über meinen Standort ließ meine Knie gummiweich werden. Kraftlos setzte ich mich auf den Boden.