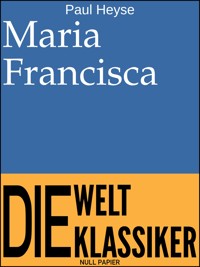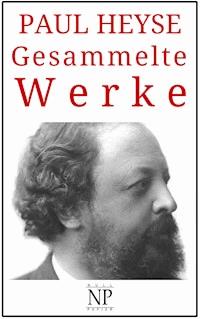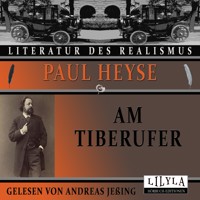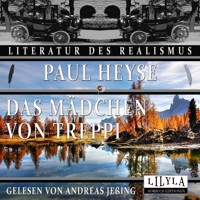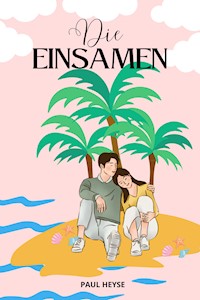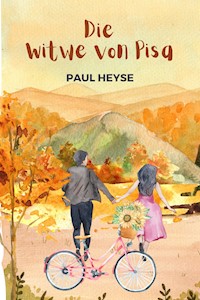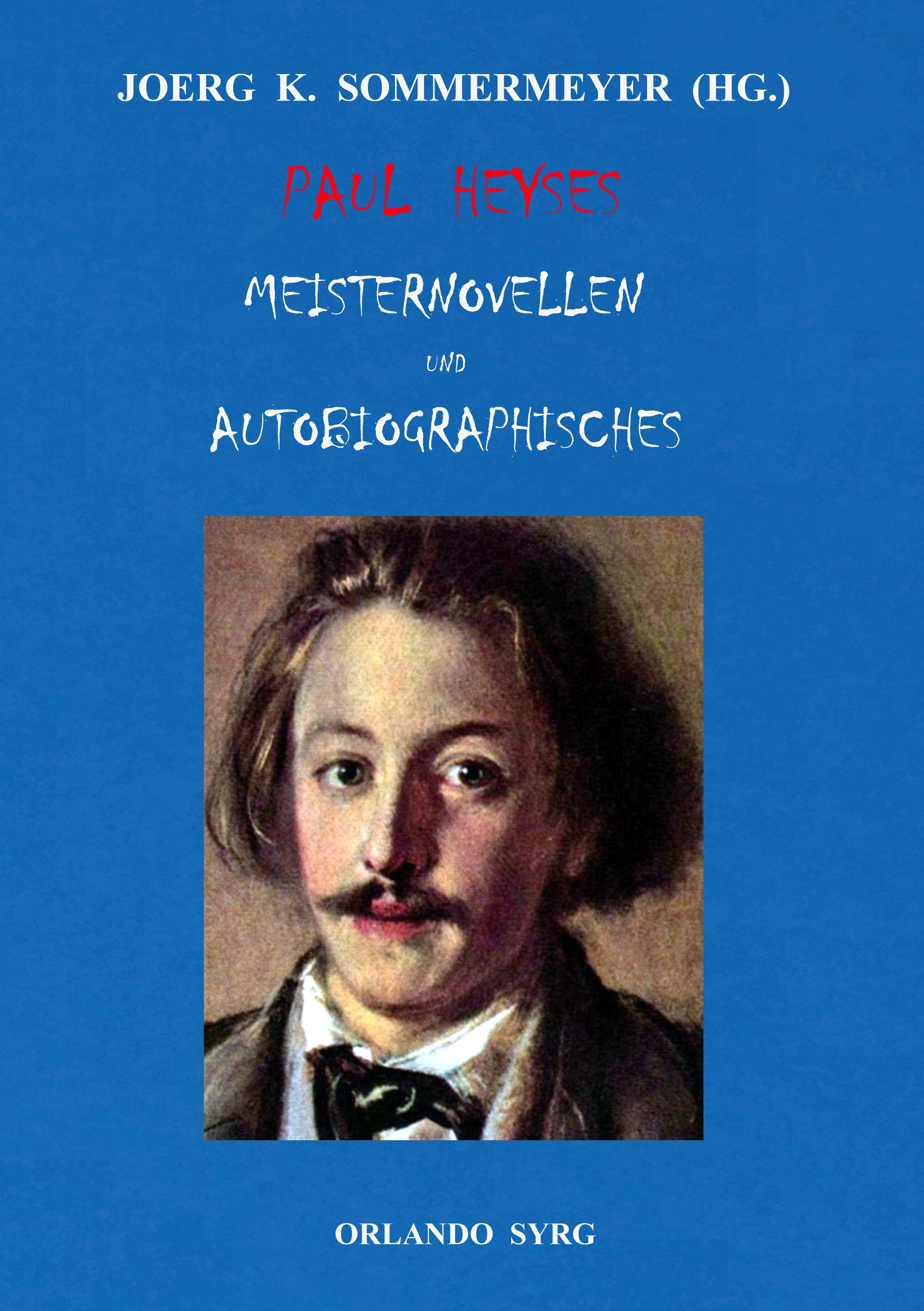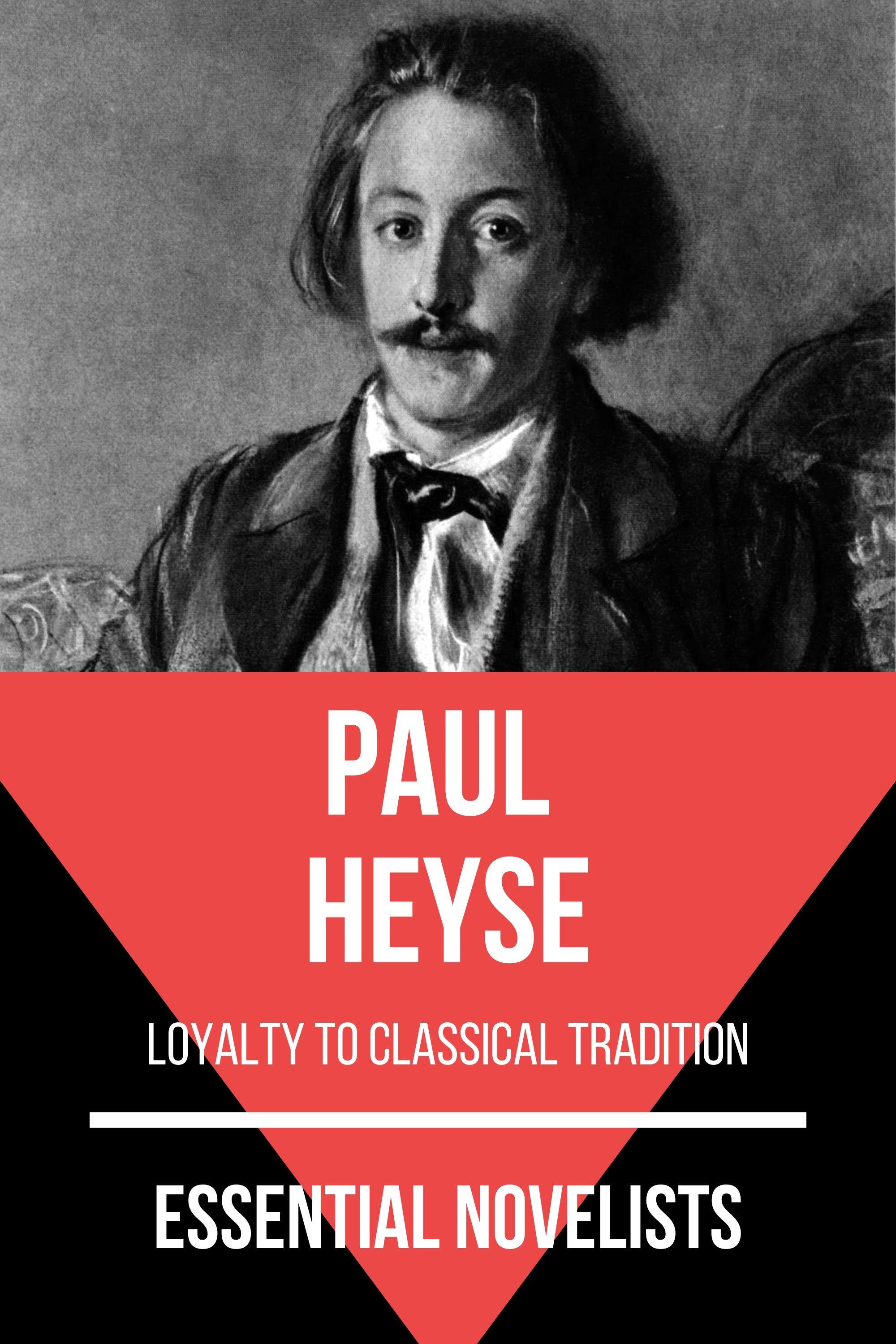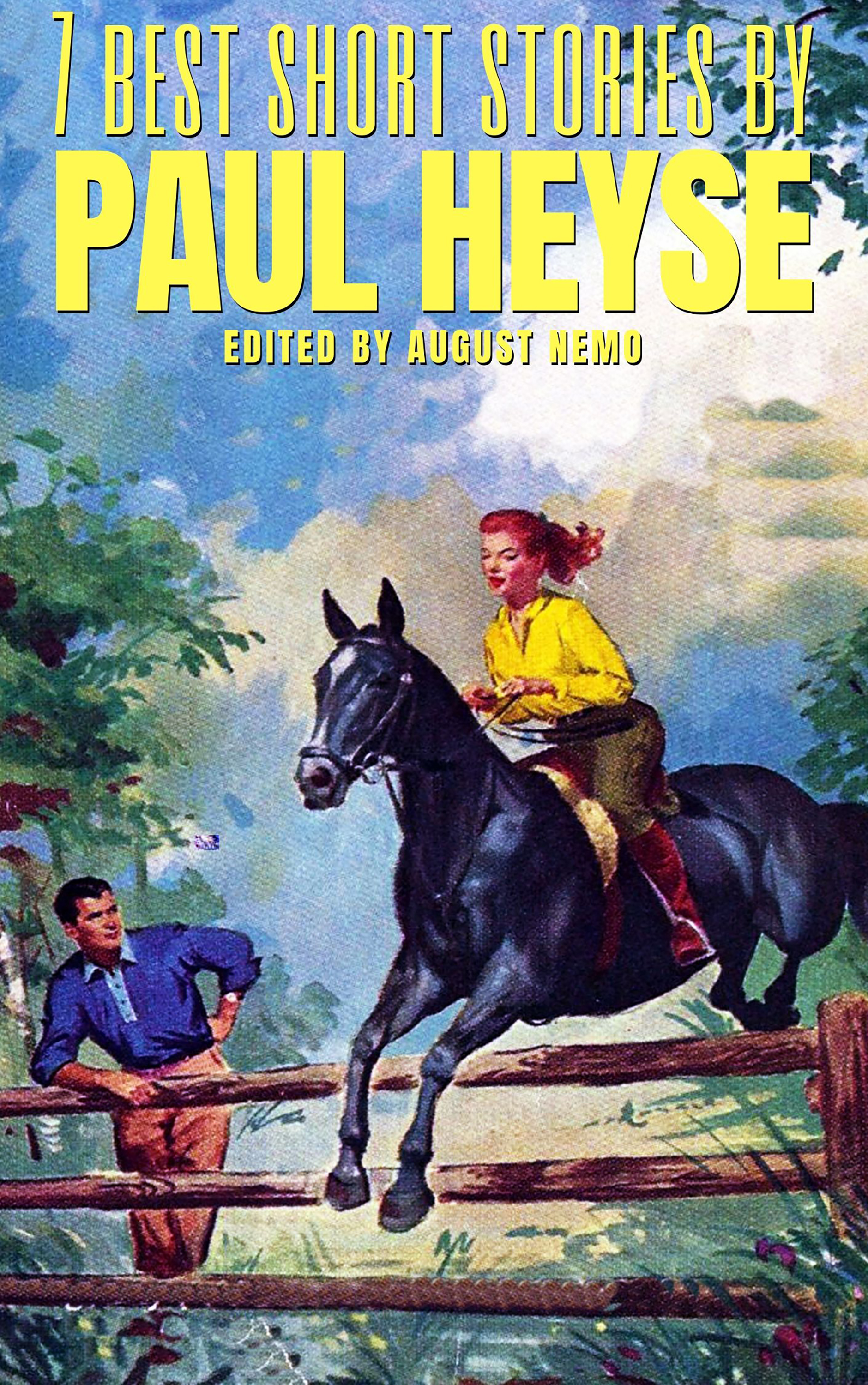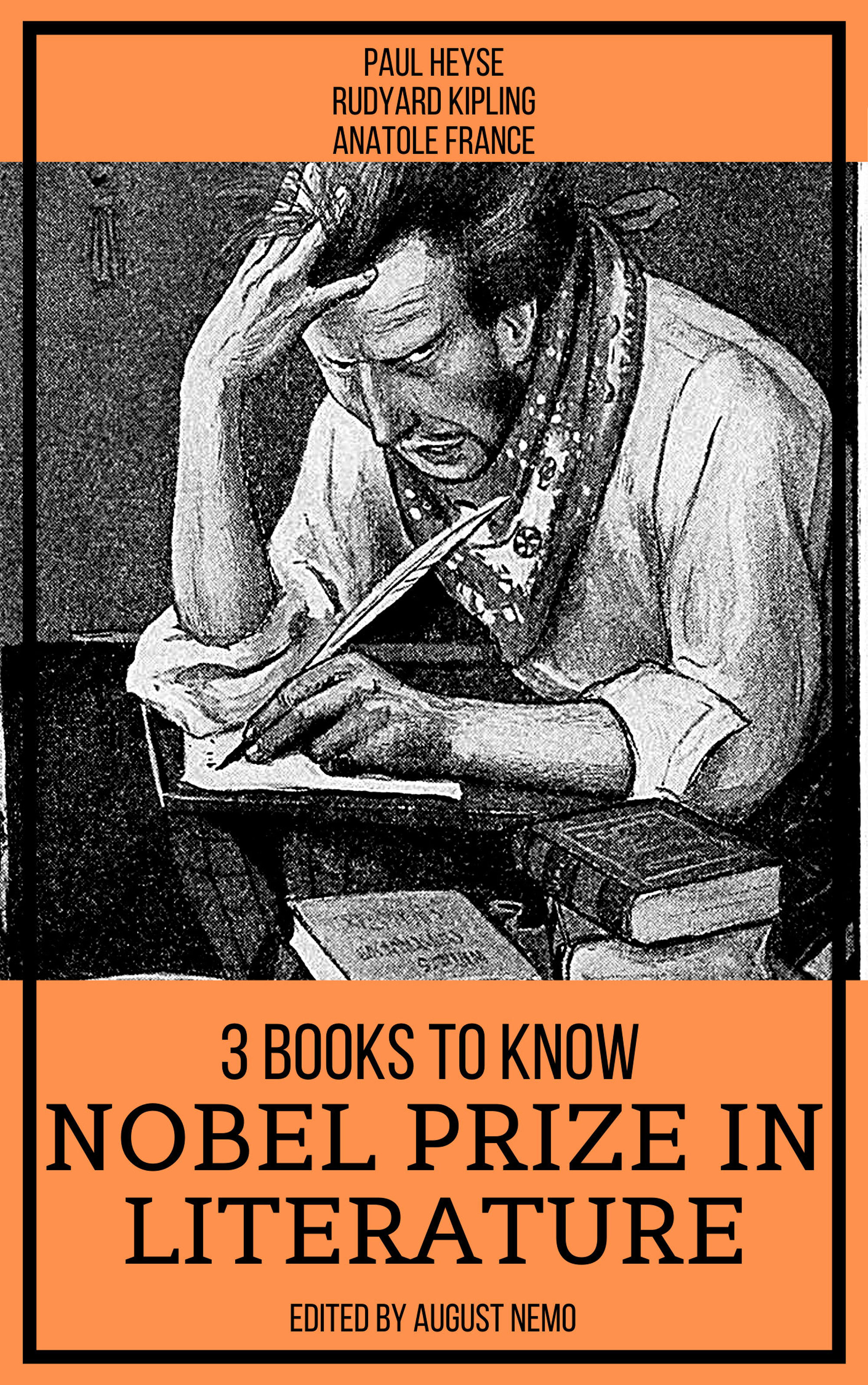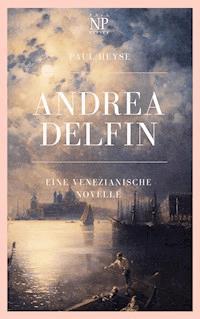
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Ein Meisterwerk des Literaturnobelpreisträgers Paul Heyse in neu bearbeiteter Fassung. Andrea Delfin kommt nach Venedig. Mit sich führt er drei Dolche, jeder trägt die Inschrift: »Tod allen Inquisitoren« eingraviert. Die Inquisitoren sind im alten Venedig die Vollzugsbeamten der Mächtigen, sie sind Ankläger, Richter und Vollstrecker in einem. Ihre Herrschaft ist berüchtigt. Andrea Delfin will den Tod der Schwester und des Bruders rächen. Der Text ist eine spannende Schilderung der Herrschaftsverhältnisse, unter denen Bespitzelung, Verrat aber auch blankes Denunziantentum und politische Ränke und Meuchelmorde an der Tagesordnung waren. Eine schreckliche Zeit, in der nur Adlige und der Klerus frei waren, alle anderen Menschen mussten damit rechnen jeden Augenblick unter behördlicher Willkür für ewig weggesperrt oder gelyncht zu werden; ein falscher Verdacht, eine getuschelte Bemerkung – ob wahr oder nicht – waren genug. »Den Schafen aber ist es gleich, Herr Delfin, ob sie geschlachtet oder vom Wolf gefressen werden …« Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Paul Heyse
Andrea Delfin
Eine venezianische Novelle
Paul Heyse
Andrea Delfin
Eine venezianische Novelle
Überarbeitung und Korrekturen: Null Papier VerlagHerausgeber: Jürgen Schulze Published by Null Papier Verlag, Deutschland Copyright © 2017 by Null Papier Verlag 1. Auflage, ISBN 978-3-954189-74-8
null-papier.de/450
Das hier veröffentlichte Werk ist eine kommentierte, überarbeitete und digitalisierte Fassung und unterliegt somit dem Urheberrecht. Verstöße werden juristisch verfolgt. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder sonstige Verwertung ohne Genehmigung des Verlages ist ausdrücklich untersagt.
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
Danke
Danke, dass Sie dieses E-Book aus meinem Verlag erworben haben.
Sollten Sie Fehler finden oder Anregungen haben, so melden Sie sich bitte bei mir.
Ihr Jürgen Schulze, Verleger, [email protected]
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
1
In jener Gasse Venedigs, die den freundlichen Namen Bella Cortesia trägt, stand um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein einfaches, einstöckiges Bürgerhaus, über dessen niedrigem Portal, von zwei gewundenen hölzernen Säulen und barockem Gesims eingerahmt, ein Madonnenbild in der Nische thronte und ein ewiges Lämpchen bescheiden hinter rotem Glas hervorschimmerte. Trat man in den unteren Flur, so stand man am Fuße einer breiten, steilen Treppe, die ohne Windung zu den oberen Zimmern hinaufführte. Auch hier brannte Tag und Nacht eine Lampe, die an blanken Kettchen von der Decke herabhing, da in das Innere nur Tageslicht eindrang, wenn einmal die Haustür geöffnet wurde. Aber trotz dieser ewigen Dämmerung war die Treppe der Lieblingsaufenthalt von Frau Giovanna Danieli, der Besitzerin des Hauses, die seit dem Tode ihres Mannes mit ihrer einzigen Tochter Marietta das ererbte Häuschen bewohnte und einige überflüssige Zimmer an ruhige Leute vermietete. Sie behauptete, die Tränen, die sie um ihren lieben Mann geweint, hätten ihre Augen zu sehr geschwächt, um das Sonnenlicht noch zu vertragen. Die Nachbarn aber sagten ihr nach, dass sie nur darum von Morgen bis Abend auf dem oberen Treppenabsatz ihr Wesen treibe, um mit jedem, der aus- und einginge, anzubinden und ihn nicht vorüberzulassen, ehe er ihrer Neugier und Gesprächigkeit den Zoll entrichtet habe. Um die Zeit, wo wir sie kennen lernen, konnte dieser Grund sie schwerlich bewegen, den harten Sitz auf der Treppenstufe einem bequemen Sessel vorzuziehen. Es war im August des Jahres 1762. Schon seit einem halben Jahr standen die Zimmer, die sie vermietete, leer, und mit ihren Nachbarn verkehrte sie wenig. Dazu ging es schon auf die Nacht, und ein Besuch um diese Zeit war ganz ungewöhnlich. Dennoch saß die kleine Frau beharrlich auf ihrem Posten und sah nachdenklich in den leeren Flur hinab. Sie hatte ihr Kind zu Bett geschickt und ein paar Kürbisse neben sich gelegt, um sie noch vor Schlafengehen auszukernen. Aber allerlei Gedanken und Betrachtungen waren ihr dazwischen gekommen. Ihre Hände ruhten im Schoß, ihr Kopf lehnte am Geländer, es war nicht das erste Mal, dass sie in dieser Stellung eingeschlafen war.
Sie war auch heute nahe daran, als drei langsame, aber nachdrückliche Schläge an die Haustür sie plötzlich aufschreckten. »Misericordia!«,1 sagte die Frau, indem sie aufstand, aber unbewegliche stehen blieb, »was ist das? Hab’ ich geträumt? Kann er es wirklich sein?«
Sie horchte. Die Schläge mit dem Klopfer wiederholten sich. »Nein«, sagte sie, »Orso ist es nicht. Das klang anders. Auch die Sbirren2 sind es nicht. Lass sehen, was der Himmel schickt.« – Damit stieg sie schwerfällig hinunter und fragte durch die Tür, wer Einlass begehre.
Eine Stimme antwortete, es stehe ein Fremder draußen, der hier eine Wohnung suche. Das Haus sei ihm gut empfohlen; er hoffe, lange zu bleiben und die Wirtin wohl zufrieden zu stellen. Das alles wurde höflich und in gutem Venezianisch vorgetragen, so dass Frau Giovanna, trotz der späten Zeit, sich nicht bedachte, die Tür zu öffnen. Der Anblick ihres Gastes rechtfertigte ihr Vertrauen. Er trug, soviel sie in der Dämmerung sehen konnte, die anständige schwarze Kleidung des niederen Bürgerstandes, einen ledernen Mantelsack unter dem Arm, den Hut bescheiden in der Hand. Nur sein Gesicht befremdete die Frau. Es war nicht jung, nicht alt, der Bart noch dunkelbraun, die Stirn faltenlos, die Augen feurig, dagegen der Ausdruck des Mundes und die Art zu sprechen müde und überlebt, und das kurz geschorene Haar in seltsamem Gegensatz zu den noch jugendlichen Zügen völlig ergraut.
»Gute Frau«, sagte er, »ich habe Euch schon im Schlafe gestört, und sogar vielleicht vergebens. Denn, um es gleich zu sagen, wenn Ihr kein Zimmer habt, das auf einen Kanal hinausgeht, bin ich nicht Euer Mieter. Ich komme von Brescia, mein Arzt hat mir die feuchte Luft Venedigs empfohlen für meine schwache Brust; ich soll überm Wasser wohnen.«
»Nun Gott sei Dank!«, sagte die Witwe, »so kommt doch einmal einer, der unserem Kanal Ehre antut. Ich hatte einen Spanier vorigen Sommer, der auszog, weil er sagte, das Wasser habe einen Geruch, als wären Ratten und Melonen darin gekocht worden! Und Euch ist es empfohlen worden? Wir sagen wohl hier in Venedig:
Wasser vom Kanal. Kuriert radikal.
Aber es hat einen eigenen Sinn, Herr, einen bösen Sinn, wenn man bedenkt, wie manches Mal auf Befehl der Oberen eine Gondel mit Dreien auf die Lagunen hinausfuhr und mit Zweien wiederkam. Davon nichts mehr, Herr – Gott behüt’ uns alle! Aber habt Ihr Euren Pass in Ordnung? Ich könnt’ Euch sonst nicht aufnehmen.«
»Ich hab’ ihn schon drei Mal präsentiert, gute Frau, in Mestre, bei der Wachtgondel draußen und am Traghetto. Mein Name ist Andrea Delfin, mein Stand rechtskundiger Schreiber bei den Notaren, als welcher ich in Brescia fungiert habe. Ich bin ein ruhiger Mensch und habe nie mit der Polizei gern zu schaffen gehabt.«
»Um so besser«, sagte die Frau, indem sie jetzt ihrem Gaste voran die Treppe wieder hinaufstieg. »Besser bewahrt als beklagt, ein Aug’ auf die Katze, das andere auf die Pfanne, und es ist nützlicher, Furcht zu haben als Schaden. O, über die Zeiten, in denen wir leben, Herr Andrea! Man soll nicht drüber nachdenken. Denken verkürzt das Leben, aber Kummer schließt das Herz auf. Da seht, und sie öffnete ein großes Zimmer, ist es nicht hübsch hier, nicht wohnlich? Dort das Bett, mit meinen eigenen Händen hab’ ich’s genäht, als ich jung war, aber am Morgen kennt man nicht den Tag. Und da ist das Fenster nach dem Kanal, der nicht breit ist, wie Ihr seht, aber desto tiefer, und das andere Fenster dort nach der kleinen Gasse, das Ihr zuhalten müsst, denn die Fledermäuse werden immer dreister. Seht da überm Kanal, fast mit der Hand abzureichen, der Palast der Gräfin Amidei, die blond ist wie das Gold und durch ebenso viel Hände geht. Aber hier steh’ ich und schwatze, und Ihr habt noch weder Licht noch Wasser und werdet hungrig sein.«
Der Fremde hatte gleich beim Eintreten das Zimmer mit raschem Blick gemustert, war von Fenster zu Fenster gegangen und warf jetzt seinen Mantelsack auf einen Sessel. »Es ist alles in der besten Ordnung«, sagte er. »Über den Preis werden wir uns wohl einigen. Bringt mir nur einen Bissen und, wenn Ihr ihn habt, einen Tropfen Wein. Dann will ich schlafen.«
Es war etwas seltsam Gebieterisches in seiner Gebärde, so milde der Ton seiner Worte klang. Eilig gehorchte die Frau und ließ ihn auf kurze Zeit allein. Nun trat er sofort wieder ans Fenster, bog sich hinaus und sah den sehr engen Kanal hinab, der durch kein Zittern seiner schwarzen Flut verriet, dass er teilhabe an dem Leben des großen Meeres, dem Wellenschlag der alten Adria. Der Palast gegenüber stieg in schwerer Masse vor ihm auf, alle Fenster waren dunkel, da die Vorderseite nicht dem Kanal zugekehrt war; nur eine schmale Tür öffnete sich unten, dicht über dem Wasserspiegel, und eine schwarze Gondel lag angekettet vor der Schwelle.
Das alles schien den Wünschen des neuen Ankömmlings durchaus zu entsprechen, nicht minder auch, dass man ihm durch das andere Fenster, das nach der Sackgasse ging, nicht ins Zimmer sehen konnte. Denn drüben lief eine fensterlose Wand ohne andere Unterbrechung als einige Vorsprünge, Risse und Kellerlöcher hin, und nur den Katzen, Mardern und Nachtvögeln konnte dieser düstere Winkel angenehm und wohnlich erscheinen.
Ein Lichtstrahl aus dem Flur drang ins Gemach, die Tür öffnete sich, und mit der Kerze in der Hand trat die kleine Witwe wieder ein, hinter ihr die Tochter, die in der Eile noch einmal hatte aufstehen müssen, um beim Empfang des Gastes zu helfen. Die Gestalt des Mädchens war fast noch kleiner als die der Mutter, erschien aber doch durch die höchste Zierlichkeit und kaum gereifte Schlankheit aller Formen größer und wie auf den Fußspitzen schwebend, während man auch im Gesicht dieselbe Ähnlichkeit und denselben Unterschied, der auf Rechnung der Jahre kam, auf den ersten Blick erkannte. Nur der Ausdruck in beiden Gesichtern schien niemals einander ähnlich werden zu können. Es war zwischen den dichten Brauen der Frau Giovanna ein Zug von Spannung und kummervollem Harren, der auch mit den Erfahrungen des Alters auf Mariettas klarer Stirn nie dauernd eine Stätte finden konnte. Diese Augen mussten immer lachen, dieser Mund immer ein wenig geöffnet sein, um jeden Scherz unverzüglich hinauszulassen. Es war unendlich drollig zu sehen, wie jetzt in diesem Gesichtchen Verschlagenheit, Überraschung, Neugier und Mutwille miteinander kämpften. Sie bog beim Eintreten den Kopf, dessen lose Flechten mit einem schmalen Tuch umwunden waren, seitwärts, um den neuen Hausgenossen zu sehen. Auch seine ernste Miene und sein graues Haar stimmten ihre Munterkeit nicht herab. Mutter, flüsterte sie, indem sie einen großen Teller mit Schinken, Brot und frischen Feigen und eine halb volle Flasche Wein auf den Tisch stellte, er hat ein kurioses Gesicht, wie ein neues Haus im Winter, wenn der Schnee aufs Dach gefallen ist.
»Schweig, du schlimme Hexe!«, sagte die Mutter rasch. »Weiße Haare sind falsche Zeugen. Er ist krank, musst du wissen, und du solltest Respekt haben, denn Krankheiten kommen zu Pferde und gehen zu Fuß, und Gott behüte dich und mich, denn die Kranken essen wenig, aber die Krankheit frisst alles. Hole nur ein wenig Wasser, soviel wir noch haben. Morgen müssen wir früh auf und neues kaufen. Sieh, er sitzt da, als ob er schliefe. Er ist müde von der Reise, und du bist müde vom Stillsitzen. So ist die Welt verschieden.«
Während dieser halblauten Reden hatte der Fremde am Fenster gesessen und den Kopf in die Hand gestützt. Auch als er jetzt aufsah, schien er die Gegenwart des zierlichen Mädchens, das ihm eine Verbeugung machte, kaum zu bemerken.
»Kommt und esst etwas, Herr Andrea«, sagte die Witwe. »Wer nicht zu Nacht isst, hungert im Traum. Seht, die Feigen sind frisch, und der Schinken zart, und dies ist Zyperwein, wie ihn der Doge nicht besser trinkt. Sein Kellermeister hat ihn uns selbst verkauft, eine alte Bekanntschaft noch von meinem Mann her. Ihr seid gereist, Herr. Ist er Euch nicht einmal begegnet, mein Orso, Orso Danieli?«
»Gute Frau«, sagte der Fremde, indem er einige Tropfen Wein ins Glas goss und eine der Feigen aufbrach, »ich bin nie über Brescia hinausgekommen und kenne keinen dieses Namens.«
Marietta verließ das Zimmer, und man hörte sie, während sie die Treppe hinunterflog, ein Liedchen mit heller Stimme vor sich hin singen.
»Hört Ihr das Kind?«, fragte Frau Giovanna. »Man hielte sie nicht für meine Tochter, obwohl auch eine schwarze Henne ein weißes Ei legt. Immer singen und springen, als wären wir hier nicht in Venedig, wo es gut ist, dass die Fische stumm sind, weil sie sonst reden würden, was einem das Haar sträubte. Aber so war ihr Vater auch, Orso Danieli, der erste Arbeiter auf Murano, wo sie die bunten Gläser machen, wie nirgend auf der Welt. Ein fröhlich Herz macht rote Wangen, das war sein Spruch. Und darum sagte er eines Tages zu mir, ›Giovannina‹, sagte er, ›ich halt’ es hier nicht aus, die Luft schnürt mir die Kehle zu, gestern erst ist wieder einer erdrosselt und mit dem Fuß an den Galgen gehenkt worden, weil er freie Reden geführt hat gegen die Inquisitoren3 und den Rat der Zehn4. Man weiß, wo man geboren wird, aber nicht, wo man stirbt, und mancher denkt auf dem Pferde zu sitzen und sitzt auf der Erde. Also, Giovannina‹, sagte er, ›ich will nach Frankreich, Kunst bringt Gunst, und der Heller läuft dem Batzen nach. Meine Sache verstehe ich, und wenn ich’s draußen zu was gebracht habe, kommst du nach mit unserem Kind.‹ – Das war damals acht Jahre alt, Herr Andrea. Es lachte, als es der Vater zuletzt küsste; da lachte er auch. Ich aber weinte, da musste er wohl mitweinen, obwohl er ganz lustig wegfuhr in der Gondel, ich hört’ ihn noch pfeifen, als er schon um die Ecke war. So ging es ein Jahr. Und was geschah? Die Signoria ließ nach ihm fragen; es dürfe keiner von Murano sein Gewerk ins Ausland tragen, damit sie es dort ihm nicht absähen; ich sollt’ ihm schreiben, dass er wiederkäme, bei Todesstrafe. Über den Brief lachte er; aber den Herren vom Tribunal war’s nicht spaßhaft. Eines Morgens, da wir noch zu Bett waren, wurde ich abgeholt, das Kind mit mir, und hinaufgeschleppt unter die Bleidächer, und musste ihm wieder schreiben, wo ich wäre, ich und unser Kind, und dass ich da bleiben würde, bis er selber mich abforderte in Venedig. Nicht lange, so hatte ich seine Antwort, das Lachen sei ihm vergangen, er wandere dem Brief auf den Fersen nach. Nun, ich hoffte täglich, dass er es wahrmachen werde. Aber Wochen und Monde vergingen, und mir ward immer weher ums Herz und kränker im Haupt, denn da droben ist die Hölle, Herr Andrea, nur dass ich das Kind hatte, das nichts von dem Jammer begriff, außer dass es schlecht aß und über Tag heiß hatte; aber dennoch sang es, um mich lustig zu machen, dass mich’s vollends angriff, die Tränen zu verhalten. Erst im dritten Monat wurden wir herausgeholt, es hieß, der Glasbläser Orso Danieli sei in Mailand am Fieber gestorben, und wir könnten nach Hause gehen. Ich habe es auch von anderen gehört – aber wer das glaubt, kennt die Signoria nicht. Gestorben? Stirbt man auch, wenn man Frau und Kind unter den Bleidächern sitzen hat und sie herausholen soll?«
»Und was meint Ihr, dass aus Eurem Mann geworden sei?«, fragte der Fremde.
Sie sah mit einem Blick ihm ins Gesicht, der ihn daran gemahnte, dass die arme Frau lange Wochen unter den Bleidächern gelebt hatte. »Es ist nicht richtig«, sagte sie. »Mancher lebt und kommt doch nicht wieder, und mancher ist tot und kommt doch wieder. Aber davon wollen wir schweigen. Ja, wenn ich es Euch sagte, wer steht mir dafür, dass Ihr nicht hingeht und es vor dem Tribunal ausplaudert? Ihr seht aus wie ein Galantuomo; aber wer ist noch rechtschaffen heutzutage? Von tausend einer, von hundert keiner. Nichts für ungut, Herr Andrea, aber Ihr wisst wohl, wie es in Venedig heißt:
Mit Lug und Listen kommt man aus, Mit List und Lügen hält man haus.«
Es entstand eine Pause. Der Fremde hatte längst den Teller weggeschoben und der Witwe gespannt zugehört.
»Ich verdenke es Euch nicht«, sagte er, »dass Ihr mir Eure Geheimnisse nicht anvertrauen wollt. Sie gehen mich auch nichts an, und zu helfen wüsst’ ich Euch ohnedies nicht. Aber wie kommt es, Frau, dass Ihr dieses Tribunal, unter dem Ihr so viel gelitten, dennoch Euch gefallen lasset, Ihr und alles Volk in Venedig? Denn ich weiß zwar wenig, wie es hier aussieht – ich habe mich nie in politische Fragen vertieft – aber so viel habe ich doch gehört, dass erst im vorigen Jahr hier ein Tumult war, um das heimliche Tribunal abzuschaffen, dass einer vom Adel selbst dagegen auftrat und der Große Rat eine Kommission wählte, die Sache zu bedenken, und alles in Bewegung geriet für und wider. Ich hörte davon sogar in meiner Schreibstube zu Brescia. Und als endlich alles beim alten blieb und die Macht des heimlichen Gerichts fester gegründet stand als je, warum zündete da das Volk Freudenfeuer an auf den Plätzen und verhöhnte die vom Adel, die gegen das Tribunal gestimmt hatten und nun seine Rache fürchten mussten? Warum war niemand, der es hinderte, dass die Inquisitoren ihren kühnen Feind nach Verona verbannten? Und wer weiß, ob sie ihn dort am Leben lassen, oder ob die Dolche schon geschliffen sind, die ihn für immer stumm machen sollen? Ich – wie gesagt – weiß nur wenig hiervon; ich kenne auch jenen Mann nicht, und es ist mir alles sehr gleichgültig, was hier geschieht, denn ich bin krank und werde es in dieser bunten Welt ohnehin nicht mehr lange treiben. Aber es wundert mich doch, dieses wankelmütige Volk zu sehen, das heute diese drei Männer seine Tyrannen nennt und morgen frohlockt, wenn die untergehen, welche der Tyrannei ein Ende machen wollten.«