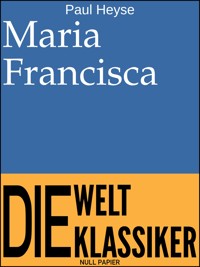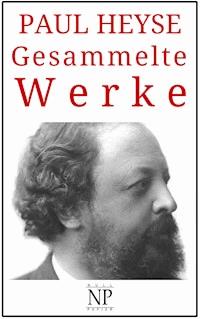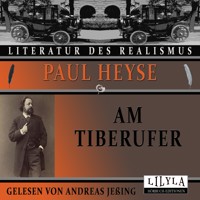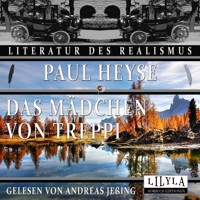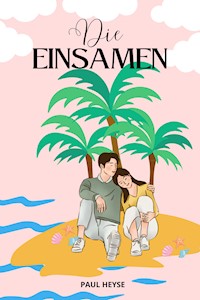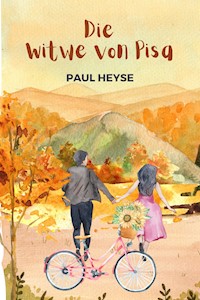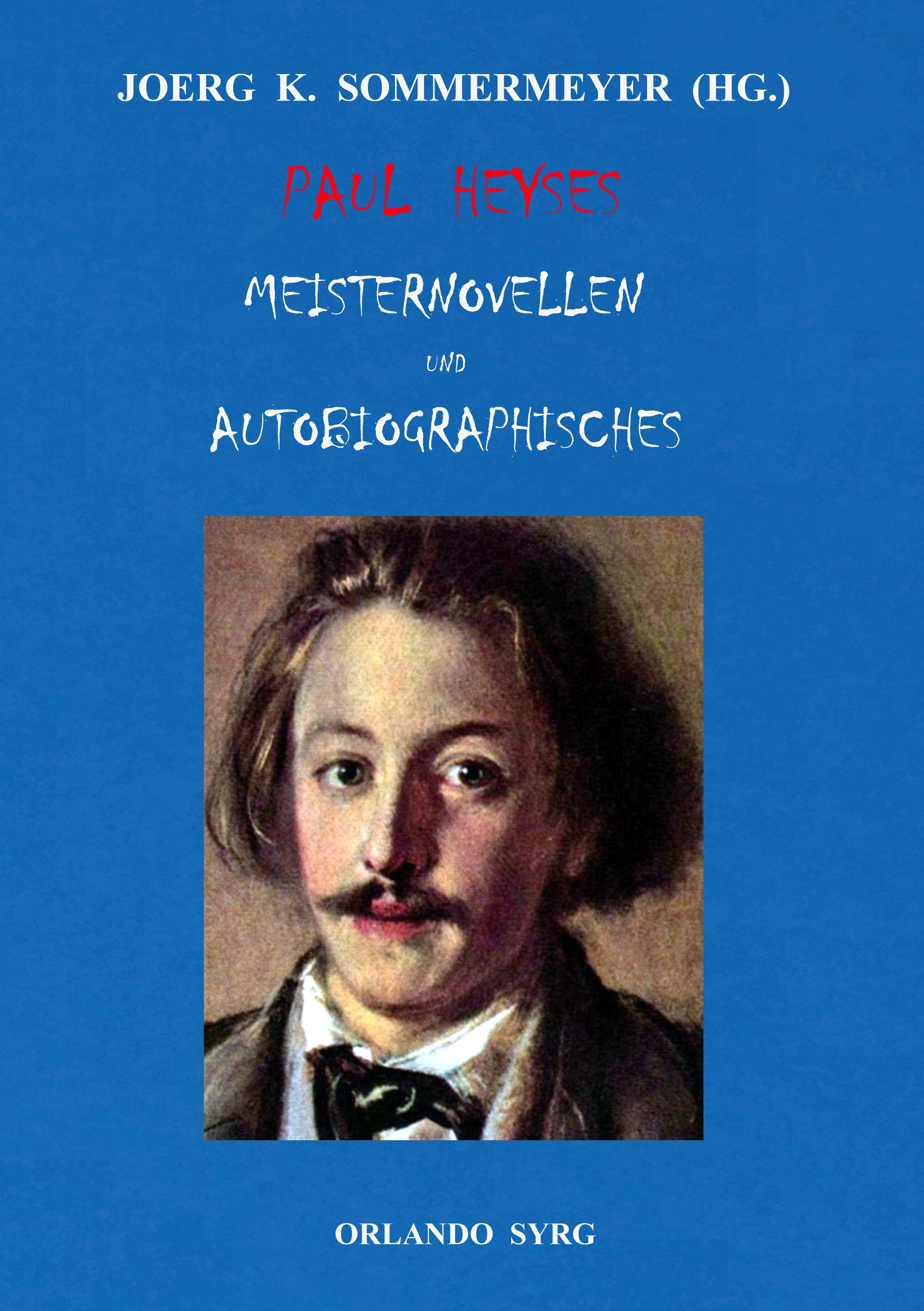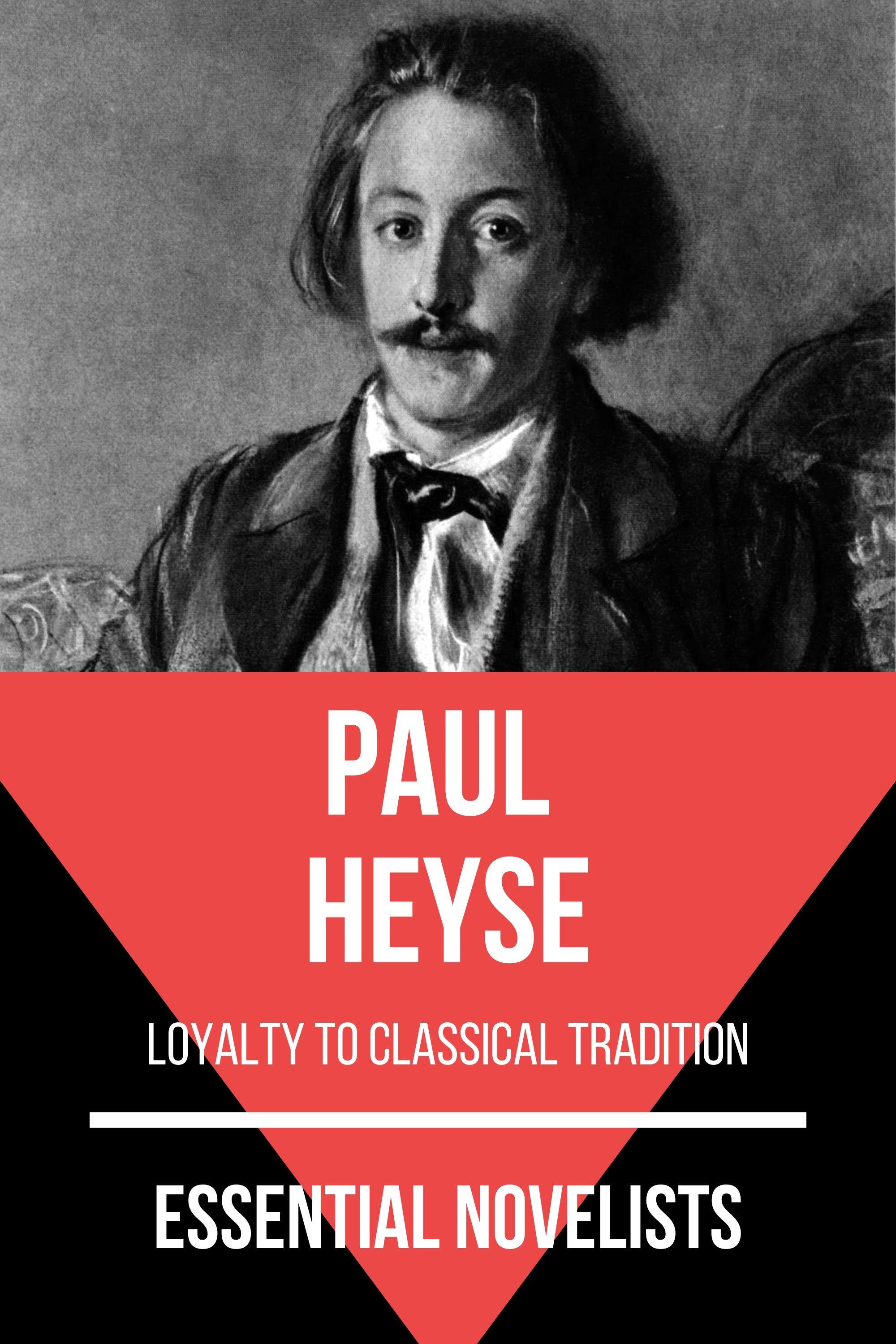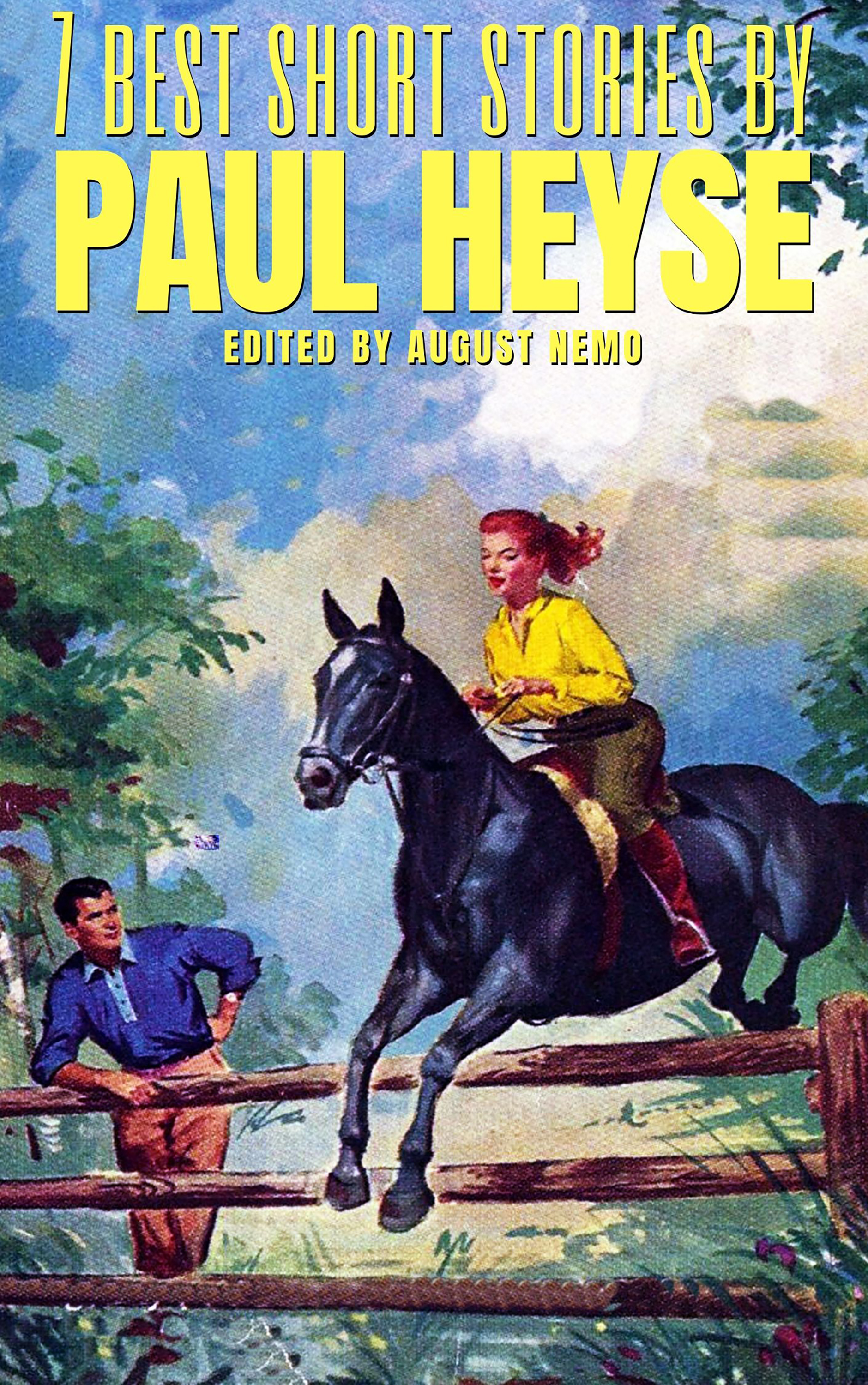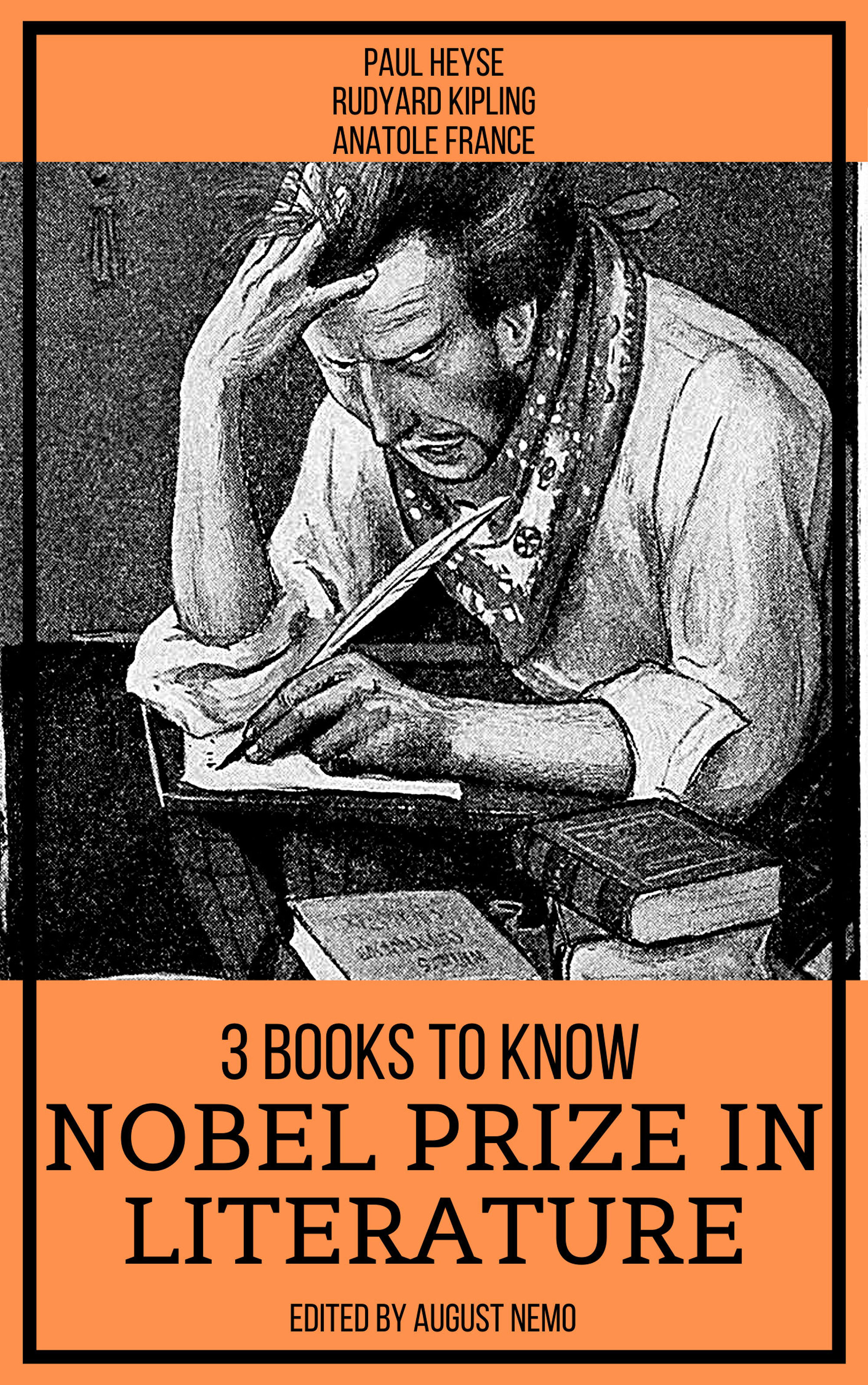Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Anfang und Ende
Novelle
Paul Heyse
Anfang und Ende
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-10-5
null-papier.de/newsletter
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Anfang und Ende
(1857)
In der tiefen Fensternische des lichterhellen Saals brannte nur eine einzelne Kerze auf silbernem Leuchter, den eine geflügelte Figur mit beiden Armen emporhielt. Der bescheidene Glanz wurde noch gedämpft durch schattige Gewächse mit breiten Blättern und den letzten Blüten des Jahres, und eine schlanke Palme überwölbte zierlich mit ihren leichten Zweigen den Eingang in die dämmrige Laube. Zwei Sessel standen darin traulich einander gegenüber. Aber der eine war leer. In dem andern ruhte eine schlanke Frauengestalt, das Haupt auf die Hand gestützt, die Augen geschlossen. Wer sie im Verdacht hatte, dass sie sich aus der muntern Gesellschaft in dies grüne Versteck zurückgezogen habe, um nur desto mehr bemerkt und aufgesucht zu werden, tat ihr Unrecht. Sie dachte durchaus nicht daran, wie zart das Helldunkel der Palme über ihre schöne Stirne fiel, wie weich und mondscheinhaft der Schein der Kerze in den Ringen ihres schwarzen Haares spielte. Noch auch benutzte sie, während am andern Ende des Saals eine sanfte Mädchenstimme zum Klaviere sang, die verstohlene Einsamkeit dazu, Gedanken nachzuhängen, wie sie wohl in der Sommerblüte des Lebens hinter geschlossenen Augenlidern ihr Wesen treiben. Denn, um es kurz zu sagen: die Musik, der sie Anfangs mit halbem Ohr gefolgt war, hatte sie endlich wie ein müdes Kind in Schlaf versenkt.
Auch erwachte sie nicht, als das Lied zu Ende war, die alten Herrn ihr aufmunterndes Bravo riefen, der Stuhl am Klavier gerückt wurde und die unterbrochenen Gespräche mit neuer Lebhaftigkeit durch den Saal schwirrten. Niemand kam, sie zu stören. Denn sie war fremd in diesem Kreise, und überdies lag ein Zug von gehaltenem Ernst auf ihrem Gesicht, der neuen Bekanntschaften nicht gerade entgegenkam. Es war ihr Schicksal, für stolz zu gelten, und sie wusste es. Dass sie nichts tat, den irrigen Glauben zu zerstören, entsprang mehr aus Bequemlichkeit, als aus Geringschätzung.
Eine bekannte Stimme, die ihren Namen nannte, drang durch ihren Schlaf. Als sie verwirrt die Augen aufschlug, stand der Hausherr vor ihr, einen Fremden an der Hand haltend, dessen hohe Stirn an die Palmenzweige stieß. Erlauben Sie mir, Ihre Meditation zu stören, Frau Eugenie? sagte der Wirt lächelnd. Ich bringe Ihnen meinen Freund und Vetter Valentin, der seit einigen Stunden unser Gast und erst seit einigen Wochen wieder im deutschen Vaterlande ist. Nun aber werden wir ihn festhalten, denk’ ich, und wer könnte uns besser dabei unterstützen, als die deutschen Frauen? –
Er hatte längst wieder den Rücken gewandt, und die Beiden verharrten noch ohne ein Wort der Begrüßung einander gegenüber. Die Augen des Mannes waren auf die rote Rose im Haar der schönen Frau gesenkt, und nur das Schwanken des Palmenzweiges ihm zu Häupten verriet, dass Blut in seinen Adern klopfte. Eugeniens Gesicht sah ernsthaft zu ihm auf, wie man einem Rätsel nachsinnt. Oder hatte der Schlaf seinen Schleier noch nicht ganz von ihren Augen genommen? Wenn dies Begegnen nur ein Traum war, so träumte sie ihn freilich nicht zum ersten Mal. Aber haben Träume die Macht, bekannte Züge zu verwandeln, wie es die Jahre tun, Locken zu kürzen und jene Falten in die Stirn zu graben, welche sie dort über den starken Brauen des Mannes im ersten Aufblick erkannt hatte?
Je länger er sie auf seine Anrede warten ließ, desto röter glühten ihr die Wangen. Ein paarmal öffnete sie die Lippen, schwieg aber und senkte die Augen. Ihr Fächer glitt auf den Teppich nieder. Er ließ ihn liegen.
Frau Eugenie, sagte er endlich, – erlauben Sie auch mir, Sie so zu nennen. Ich trete eben erst ins Haus und habe es wahrlich versäumt, meinen Gastfreund nach dem Namen Ihres Gemahls zu fragen. Wie wunderbar trifft man sich im Leben wieder! Ich muss über meine Ahnungslosigkeit staunen, dass mir dies Wiedersehen durch kein Vorzeichen des Himmels oder der Erde angekündigt worden ist.
Eine besondere Veranlassung hat mich hieher geführt, erwiderte sie rasch. Ich will meinen Sohn in eine Schule bringen, und man sagte mir, dass er in dieser Stadt am besten aufgehoben sein würde. Die vorige Nacht habe ich im Postwagen völlig ohne Schlaf zugebracht, und ich darf Ihnen wohl gestehen, dass eben, als Sie kamen, die schwache Natur gegen alle Schicklichkeit das Versäumte nachzuholen im Begriff war. Ich sage es Ihnen, weil es einen alten Freund befremden muss, so zerstreut und wenig herzlich begrüßt worden zu sein.
Sie bot ihm jetzt die Hand. Ich danke Ihnen, versetzte er, und sein Wesen hellte sich auf, ich danke Ihnen, dass sie mir mein geringes Anrecht auf Ihre Freundschaft bewahrt haben. Fahren Sie nun fort, mich auf dem alten Fuß zu behandeln, und genießen Sie weiter die Ruhe, die ich Ihnen leider gestört habe. Ich werde sorgen, dass Niemand wieder in diese Laube eindringe, und, wenn Sie es wünschen, selbst am Eingang bei der Palme Wache stehen.
Sie lachte. Nein, sprach sie, so ist es nicht gemeint. Nur für das Gespräch mit wildfremden Menschen bin ich zu müde. Wenn Sie mit meinem guten Willen vorlieb nehmen wollen, so setzen Sie sich zu mir und erzählen mir, wie es Ihnen geht und ergangen ist.
Sie werden am besten selbst urteilen, wie es mir ergangen sein muss, wenn ich Ihnen im tiefsten Geheimnis vertraue, wie es mir in diesem Augenblicke geht. Mein Freund hat mich zu sich eingeladen, um mich auf irgend eine Art zu verheiraten. Was sagen Sie dazu? Er hält es für seine Pflicht. Wie weit muss es mit einem Menschen gekommen sein, dessen Freunde es für ihre Pflicht halten, ihn unschädlich zu machen!
Sie erschrecken mich, erwiderte sie lächelnd. Als ich Sie kannte, waren Sie, wenn auch immerhin nicht ganz ungefährlich, doch weit davon entfernt, so viel Unheil anzustiften, dass man im Interesse der öffentlichen Sicherheit nötig gehabt hätte, Sie in Fesseln zu legen.
Sie spotten, Frau Eugenie. O diese Ihre Kunst, wie wohlbekannt ist sie mir! Aber diesmal treffen mich Ihre Pfeile nicht. Für Niemand fürchtet mein edler Vetter Unheil von mir, als für mich selbst. Er ist des Glaubens, wenn ich fortführe, auf dem alten Raubschloss, das ich mir gekauft, einsam zu hausen, Grillen zu fangen und Hasen zu jagen und der Landwirtschaft meiner Bauern mit Rezepten aufzuhelfen, von denen ich selbst nichts verstehe, so würde das Restchen gesunder Vernunft, das er so gütig ist bei mir vorauszusetzen, eines schönen Tages in Rauch aufgegangen sein. Sie sehen, er denkt mich homöopathisch zu behandeln, eine Torheit durch die andere zu heilen. Vielleicht hat er Recht, und wenn man bewiesen hat, dass man selbst nicht im Stande ist, sein Leben vernünftig einzurichten, muss man ja wohl dankbar stillhalten, wenn sich ein guter Freund die Mühe gibt. Zuweilen denke ich freilich, dass es zu spät sein möchte.
Zu spät? Ich kann nachrechnen. Vierzehn Jahre ist es, dass wir uns nicht gesehen. Wenn Sie sich damals nicht jünger machten, als Sie waren, so halten Sie jetzt kaum an den Jahren, die man die besten nennt.