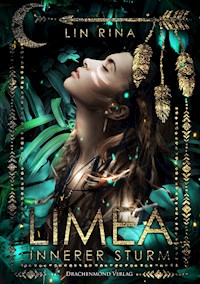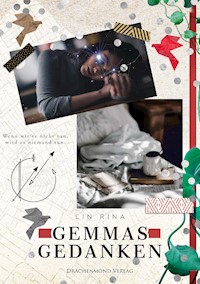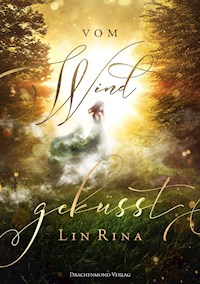Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
England 1890. Kleider, Bälle und die Suche nach dem perfekten Ehemann. Das ist es, was sich Animants Mutter für ihre Tochter wünscht. Doch Ani hat anderes im Sinn. Sie lebt in einer Welt aus Büchern, und bemüht sich der Realität mit Scharfsinn und einer gehörigen Portion Sarkasmus aus dem Weg zu gehen. Bis diese an ihre Tür klopft und ihr ein Angebot macht, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Ein Monat in London, eine riesige, vollautomatische Suchmaschine, die Umstände der weniger Privilegierten und eine Arbeitsstelle in einer Bibliothek. Und natürlich Gefühle, die sie bis dahin nur aus Büchern kannte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 908
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Animant Crumbs Staubchronik
Lin Rina
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Viktoria Kravtschenko
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock Titelschrift, Widmung und Initialen: Lin Rina
ISBN 978-3-95991-392-8
Alle Rechte vorbehalten
Für Dora
Weil durch deine Adern
Wörter und Träume fließen
Inhalt
Prolog
1. Das Erste oder das, in dem mein Onkel zu Besuch kam.
2. Das Zweite oder das, in dem mein Lesesessel nach London zog.
3. Das Dritte oder das, in dem ich mein Herz verlieren würde.
4. Das Vierte oder das, in dem ich lernte, Mr Reed zu hassen.
5. Das Fünfte oder das, in dem ich blieb.
6. Das Sechste oder das, in dem ich eine Gleichgesinnte fand.
7. Das Siebte oder das, in dem ich in die Welt der Maschine eintauchte.
8. Das Achte oder das, in dem ich eine tollkühne Tat plante.
9. Das Neunte oder das, in dem die Willkür Bücher zerstörte.
10. Das Zehnte oder das, in dem ich die Fronten klärte.
11. Das Elfte oder das, in dem mein Herz hüpfte.
12. Das Zwölfte oder das, in dem ich etwas über das Fliegen lernte.
13. Das Dreizehnte oder das, in dem mein altes Leben mich einholte.
14. Das Vierzehnte oder das, in dem Henry mit mir ein Geheimnis teilte.
15. Das Fünfzehnte oder das, in dem mir ein überaus peinliches Missgeschick passierte.
16. Das Sechzehnte oder das, in dem ich Mr Reed verteidigte.
17. Das Siebzehnte oder das, in dem ich zu einer guten Tat gezwungen wurde.
18. Das Achtzehnte oder das, in dem ich unerwartet ein Kompliment bekam.
19. Das Neunzehnte oder das, in dem Selbstständigkeit schwieriger war als erwartet.
20. Das Zwanzigste oder das, in dem ich der Vorfreude erlag.
21. Das Einundzwanzigste oder das, in dem die Lichter erstrahlten.
22. Das Zweiundzwanzigste oder das, in dem die Lichter schmolzen.
23. Das Dreiundzwanzigste oder das, in dem die Lichter tanzten.
24. Das Vierundzwanzigste oder das, in dem meine Mutter mich nicht verstand.
25. Das Fünfundzwanzigste oder das, in dem ich nicht essen konnte.
26. Das Sechsundzwanzigste oder das, in dem ich mich sorgte.
27. Das Siebenundzwanzigste oder das, in dem wir Tee tranken.
28. Das Achtundzwanzigste oder das, in dem ich es anging, Geheimnisse zu lüften.
29. Das Neunundzwanzigste oder das, in dem wir frühstückten.
30. Das Dreißigste oder das, in dem ich aus Wut handelte.
31. Das Einunddreißigste oder das, in dem ich zu viel fragte.
32. Das Zweiunddreißigste oder das, in dem ich einem Spaß erlag.
33. Das Dreiunddreißigste oder das, in dem ich Mr Reeds Geheimnis aufdeckte.
34. Das Vierunddreißigste oder das, in dem ich Rachel traf.
35. Das Fünfunddreißigste oder das, in dem ich kaum Luft bekam.
36. Das Sechsunddreißigste oder das, in dem meine Mutter lachte.
37. Das Siebenunddreißigste oder das, in dem ich nichts mehr zu lesen hatte.
38. Das Achtunddreißigste oder das, in dem wir gemeinsam schwiegen.
39. Das Neununddreißigste oder das, in dem ich Angst hatte.
40. Das Vierzigste oder das, in dem mich braune Augen ansahen.
41. Das Einundvierzigste oder das, in dem Elisa mich ausführte.
42. Das Zweiundvierzigste oder das, in dem ich in einem Schrank saß.
43. Das Dreiundvierzigste oder das, in dem mein Plan aufging.
44. Das Vierundvierzigste oder das, in dem ich als Einzige ruhig blieb.
45. Das Fünfundvierzigste oder das, in dem etwas nicht stimmte.
46. Das Letzte oder das, in dem ich ging.
47. Das wirklich Letzte oder das, in dem sich alles fügte.
Danksagung
Prolog
Ich lehnte an einer Marmorsäule und verfluchte innerlich meine Mutter, während ich nett lächelte und mir wünschte, dass auch nur ein Wort aus dem Mund meines Gegenübers sinnvoll erscheinen würde.
»Doch der Eisbär sagte: ›Ich bin der Baron von Münchhausen!‹ Und dann biss er dem Pinguin den Kopf ab«, erzählte er gerade und ich hatte leider noch nicht genügend Punsch getrunken, um auch nur vorzugeben, dass sein Witz lustig gewesen wäre.
Er hatte ein recht ansehnliches Gesicht, aber seine Aufmachung war lächerlich. Was auch immer die Mode gerade diktierte, Männer sollten keine fliederfarbenen Westen tragen. Das war einfach nur grotesk albern.
»Sie lachen gar nicht«, stellte er mit seinem messerscharfen Verstand fest und ich hätte gerne über so viel Gedankenlosigkeit geseufzt. Doch es ging nicht, dafür fehlte mir einfach die Luft.
Mein Korsett war so eng, dass ich kaum atmen konnte und ich schwören könnte, dass mir langsam die Beine einschliefen, weil nicht genug Platz für Blutzirkulation blieb.
Mary-Ann hatte mich so zusammengeschnürt, damit ich in das hellblaue Monster von einem Ausgehkleid passte, das Mutter mir extra aus London hatte kommen lassen, um die dörflichen adligen Junggesellen mit meinem Anblick zu beglücken. Mutter sagte, es sei zur Zeit Mode in London, so eng geschnürt zu sein, und alle jungen Dinger machten das heutzutage. Doch für mich war das unerträglich und ich bildete mir ein, an Sauerstoffmangel verenden zu müssen, wenn ich meinen Platz in der Nähe des geöffneten Fensters verlassen sollte.
Ich fand es völlig unsinnig, den Körper einem Kleidungsstück anzupassen, anstatt das Kleidungsstück dem Körper.
Doch was wusste ich schon? Ich war ja nur ein faules, nichtsnutziges Ding, das es nötig hatte, die jungen Männer mit hellblauen Taft zu bezaubern, damit sie über meinen missratenen Charakter hinwegsehen konnten.
Der junge Mann beäugte mich immer noch erwartungsvoll.
»Die Geschichte ist abwegig«, begann ich und wusste genau, dass ich im Begriff war, das zu tun, was meine Mutter mir immer predigte, nicht zu tun: Ich würde ihn schulmeistern. Und junge Männer schätzten es gar nicht, wenn die Frau, die sie davon überzeugen wollten, dass sie die begehrenswerteste Partie im Saal waren, es besser wusste als sie selbst.
»Mal davon abgesehen, dass Tiere nicht sprechen können, was entschuldigt ist, da es sich ja angeblich um einen Witz handelt, kann ich nicht glauben, dass ein Eisbär so etwas tun könnte«, führte ich aus und wurde prompt unterbrochen.
»Nun ja, ich glaube schon, dass ein Eisbär stark genug wäre, einem Pinguin den Kopf abzubeißen. Das ist doch schließlich ein Raubtier«, redete der junge Mann, von dem ich dachte, dass er Hilton oder Milton hieß, leicht pikiert auf mich ein und stemmte die Hände in die Seiten, um seine Unsicherheit zu überspielen.
»Ja«, antwortete ich. »Aber ich glaube nicht, dass er dazu fähig ist, von der nördlichen auf die südliche Erdhalbkugel zu spazieren, nur um sich mit einem Pinguin um ein kugelrundes Ei zu streiten.«
Milton, oder auch Hilton, sah mich recht dümmlich an und wurde dann zu unser beider Glück von einem Bekannten begrüßt. Er stellte uns flüchtig einander vor, entschuldigte sich dann förmlich und ging.
Armer Tölpel.
Ich blieb allein zurück und konnte die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf hören, die mich anklagte, dass ich so für immer allein bleiben und vor Einsamkeit an Schwermut erkranken würde.
Dabei war ich überhaupt nicht allein. Sie ließ mich endlose, langweilige Stunden auf Gesellschaften und Bällen verbringen, auf denen ich nur stumpfsinnige Gespräche führte. Meist mit Menschen, die sich für gebildet hielten, weil sie mal ein Buch von außen angesehen hatten und sich doch nur über die Peinlichkeiten anderer amüsierten. Und das, obwohl ich stattdessen zu Hause in meinem alten Sessel sitzen und den Gedanken brillanter Köpfe folgen könnte. Die Männer meines Lebens waren bereits bei mir und ich genoss jeden Moment mit ihnen. Ich löste an ihrer Seite Kriminalfälle mithilfe der Technik, Fingerabdrücke zu vergleichen, die bei jedem Menschen so einzigartig waren wie Schneeflocken. Ich nahm Städte ein, indem ich aus Holz ein Pferd baute und mich darin versteckte. Ich folgte literarischen Diskursen, geschichtlichen Nacherzählungen, studierte den Menschen, seinen Geist und die Seele. Ich reiste in achtzig Tagen um die Welt, lernte, wie man Flugzeuge baute, eine Melodie ersann, einen Krieg anzettelte.
Doch meine Mutter hielt es für Blödsinn. Sticken, das sei eine Tätigkeit, die für eine junge Frau meines Standes angebracht war.
Ich seufzte in mich hinein.
Wer hatte sich das bloß ausgedacht?
Das Erste oder das, in dem mein Onkel zu Besuch kam.
Sie hat ihn blamiert, Charles! Schamlos öffnet sie den Mund und wirft mit altklugen Sätzen um sich«, jammerte meine Mutter meinem Vater vor und ich verdrehte die Augen. Sie musste auch immer alles so sehr dramatisieren.
»Jedes Mal, wenn ein junger Mann sie anspricht, macht sie alles kaputt. Wieso kann sie nicht wie alle anderen Mädchen sein, die einfach still sind?«, polterte sie weiter und ich konnte mir genau vorstellen, wie sie im Zimmer auf und ab lief, die eine Hand auf die Brust gelegt und mit der anderen sich Luft zufächelnd. »Julia Goodman, das ist ein stilles Mädchen und sie war schon mit siebzehn verlobt. Oder die älteste von den Bordley-Schwestern. Sie hat gewusst, in welchem Momenten es gut war zu schweigen, und sie war mit achtzehn sogar schon verheiratet!« Sie holte tief Luft. Zwar hörte ich es nicht, aber ich wusste es auch so.
Mein Vater dagegen, der wohl entweder am Kaminsims lehnte oder seine Schreibtischkante unter dem Gesäß hatte, hielt dann immer die Luft an und fragte sich genau wie ich, warum sie ständig von stillen Mädchen redete, aber niemals selbst still war.
»Aber deine missratene Tochter sitzt den ganzen Tag auf dem Dachboden in einem alten Sessel und verschlingt Bücher, anstatt zu lernen, wie man sich richtig zu verhalten hat!«, keifte sie nun und ich konnte förmlich vor mir sehen, wie sich eine steile Falte zwischen den Augenbrauen meines Vaters bildete.
»Ani weiß, wie man sich richtig zu verhalten hat, Darling!«, verteidigte er mich und ich lächelte.
Mein rechtes Bein wurde langsam taub und ich versuchte mich anders hinzusetzen, ohne das Ohr vom Lüftungsgitter des Kamins zu nehmen, das von der Küche durch Vaters Arbeitszimmer bis hinauf zum Dachboden reichte.
»Und warum tut sie’s dann nicht?«, rief meine Mutter aus und ich seufzte leise, weil ich genau wusste, was jetzt folgte. »Sie ist schon neunzehn, Charles! Neunzehn! Langsam habe ich den Eindruck, dass sie überhaupt kein richtiges Leben führen möchte. Immer nur Bücher, Bücher, Bücher. Und in ein paar Jahren wird sie eine alte Jungfer sein, die keiner mehr haben will, weil sie ihre blühenden Jahre auf einem alten, dreckigen Dachboden verplempert hat!« Meine Mutter begann zu schluchzen und mein Vater murmelte ein paar tröstende Worte.
Ich nahm den Kopf wieder hoch und ließ meinen Nacken knacken. Meine Mutter machte sich einfach nur unnötig Sorgen über Dinge, die mir völlig nebensächlich erschienen. Sie glaubte, dass heiraten und einen eigenen Haushalt zu führen das größte Glück einer jungen Frau sein müsste.
Doch meins war es eben nicht. Sollte ich doch ohne Mann enden, was machte das schon? Ich wurde vielleicht nicht reich, hätte keine eigene Kutsche und konnte mir nicht jedes halbe Jahr eine neue Garderobe zulegen, aber die öffentliche Bibliothek war kostenfrei und dort würde ich bestimmt glücklicher werden als mit einem stumpfsinnigen Mann in einem viel zu noblen Haus.
Ich klopfte mir den Staub vom Rock, zog meine Bluse zurecht und strich mir eine Haarsträhne aus der Stirn, die sich aus meiner Frisur gelöst hatte.
Fast sehnsüchtig sah ich zu meinem alten Sessel, dessen dunkelgrüner Samt an den Armlehnen etwas abgewetzt war und den meine Mutter schon vor Jahren aussortiert hatte, weil er ihr zu schäbig erschien.
Doch für mich war er ein Stück guter Erinnerungen und gehörte in mein Leben, genauso wie es die Bücher taten.
Am liebsten hätte ich mich wieder in seine ausgeleierten Sitzfedern gekuschelt, das Buch aufgeschlagen, das ich vorhin begonnen hatte, und einfach vergessen, dass dort draußen eine Welt mit Gesellschaften und heiratsvermittelnden Müttern existierte.
Aber Mary-Ann würde gleich zum Mittagessen klingeln und dann hatte ich unten zu sein.
Ich seufzte laut, klemmte mir einen schmalen Roman unter den Arm, raffte meine Röcke und kletterte die steilen Stufen nach unten in den ersten Stock.
Unser Haus war größer, als es sein müsste. Fand ich zumindest. Ich schätzte kleine Räume und Wände, die mir Sicherheit boten. Meine Mutter hingegen wollte alles weit haben und mochte es gar nicht, wenn irgendein Möbelstück an der falschen Stelle stand und so den Raum kleiner erscheinen ließ.
Ich schlich mich gerade lautlos am Arbeitszimmer meines Vaters vorbei, damit ich die beiden nicht störte und auch nicht von ihnen gehört wurde, als sich die Tür genau in diesem Moment öffnete.
»Ani!«, sprach Vater mich überrascht an und Mutter schob sich hastig an ihm vorbei, um sich zu mir auf den Flur zu drängen. Sie hakte sich bei mir unter, ein verschwörerisches Lächeln auf den Lippen, und ich war verwirrt über den plötzlichen Sinneswandel. Hatte sie nicht gerade noch geschluchzt und sich über mich geärgert?
»Du wirst nicht erraten, wer heute Morgen hier war, um vorzusprechen. Er gab vor, für deinen Vater etwas abgeben zu müssen, aber ich bin mir sicher, er war wegen dir hier«, säuselte meine Mutter und ich wusste ganz genau, wen sie meinte. George Michels. Mutters neuester Auserwählter, um mich erfolglos zu verkuppeln.
»Oh, wer kann das nur gewesen sein? Doch nicht etwa Mr Michels!«, rief ich übertrieben begeistert und Mutters Grinsen fiel in sich zusammen. Wenn sie in den Jahren mit mir als Tochter etwas gelernt hatte, dann war es, Ironie zu durchschauen.
»Animant! Ob du es glauben willst oder nicht, dieser Mann könnte deiner sein und du würdest ein gutes Leben in Wohlstand führen«, begann sie und ihre Augenbrauen zogen sich missbilligend zusammen.
Ich musste mich zusammenreißen, um nicht laut zu lachen, und biss mir auf die Unterlippe. Mr Michels war zwar ein netter Kerl, aber so geistreich wie ein Stück Brot und dabei auch noch außerordentlich tollpatschig, sodass er regelmäßig über seine eigenen Füße zu fallen pflegte.
»Er bohrt in der Nase, wenn er glaubt, dass niemand hinsieht«, sagte ich, während wir die ersten Stufen ins Erdgeschoss nach unten nahmen. Und das hatte ich nicht erfunden.
»Animant!«, empörte Mutter sich und hinter uns begann Vater zu prusten, nahm sich aber sofort zusammen, als Mutter auch ihm einen scharfen Blick zuwarf.
»Er sieht gut aus und er hat dreitausend Pfund im Jahr. Ihr solltet nicht so gehässig sein«, warf sie uns vor, entzog mir ihren Arm und ging die letzten Stufen allein, ehe sie im Salon verschwand. Die Spitze ihres Unterrocks raschelte übertrieben und unterstützte ihren wütenden Abgang, der uns zeigen sollte, wie unverständig wir in ihren Augen doch waren.
Ich zuckte nur mit den Schultern und Vater begann zu grinsen. Denn obwohl er nicht der Meinung war, dass es sich für eine junge Dame geziemte, allein zu bleiben, musste er sich hin und wieder doch über die fruchtlosen Versuche meiner Mutter amüsieren, die mit aller Macht versuchte, mich dazu zu bringen, der Männerwelt zugetan zu sein.
Er war davon überzeugt, dass es mich eines Tages genauso treffen würde wie alle anderen Mädchen in meinem Alter auch und dass mein Herz sich für einen der jungen Männer erwärmte, die meine Gesellschaft suchten.
Mir fehle bisher nur der Anreiz, hatte er einmal gegenüber meiner Mutter erwähnt und ich hatte oben am Ofenrohr nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich konnte mir nicht vorstellen, was für ein Anreiz das sein sollte.
Geld war es nicht. Natürlich hatte ich nie erleben müssen, wie es war, wahrlich arm zu sein, aber selbst ohne Mann würde meine Erbschaft mich gut bis ins hohe Alter bringen. Vorausgesetzt, mich würde nicht schon vorher eine Lungenentzündung dahinraffen.
Sozialer Stand war es auch nicht. Ich machte mir nichts aus öffentlichen Veranstaltungen, Gesellschaften, Bällen und schon gar nicht aus dem edlen Getue des niederen Adels. Ich hatte kein Interesse an Titeln oder Ränkespielen der gehobenen Gesellschaft und fühlte mich dabei auch völlig fehl am Platz.
Das Einzige, was blieb und von dem ich sagen musste, dass es mir ein Rätsel war, war die Liebe. Ich hatte von ihr gelesen, war in Gedichten und Erzählungen den blumigen Ausschweifungen und pochenden Herzen gefolgt und hatte sie doch nicht begriffen. Wie war es möglich, dass man einen Menschen finden konnte, der ein Seelenverwandter war? Es gab Millionen Menschen auf diesem Planeten, wie hoch konnte da die Wahrscheinlichkeit sein, der Person zu begegnen, die für einen bestimmt war?
Mutter behauptete, dass man mit jedem Mann glücklich werden konnte, wenn man das nur wirklich wollte. Doch anscheinend wollte ich nicht wirklich, denn bisher hatte ich mir bei keinem ihrer Auserwählten vorstellen können, auch nur länger als eine Stunde so zu tun, als ob sie interessant wären.
Aber lag das wirklich an mir, oder vielleicht doch an den Männern, die mir bisher begegnet waren?
Stumm setzte ich mich zu meiner Mutter in den Salon und entschied, dass diese Art von Gedankenspiel mich nicht weiterbrachte und auch völlig unsinnig war.
Ich schlug den schmalen Roman auf, den ich für nur drei Penny im Buchladen in der Gardner Street erstanden hatte. Für seinen Preis war er recht umfangreich und erzählte die Geschichte von Jackson Throug während seiner Reise nach Indien und zurück. Ich war gerade an der Stelle, an der er genug Geld für die Überfahrt zusammengekratzt hatte und ein kleines Handelsschiff bestieg, dessen Captain mir doch sehr suspekt vorkam.
»Animant«, sprach Mutter mich an und ich blinzelte mich aus der Geschichte in die Wirklichkeit zurück. »Ich kann es einfach nicht verstehen. Was willst du denn?«, wollte sie von mir wissen und ich hob skeptisch die Augenbrauen.
»Ich will in Ruhe lesen, Mutter«, antwortete ich ihr, obwohl ich wusste, dass das nicht die Antwort auf ihre Frage war. Ihre Frage hatte sich auf meine Zukunft bezogen, auf den Typ Mann, den ich bevorzugen würde, und die Tätigkeit, die ich für mich ersann. Doch ich war es leid, diese Diskussion mit ihr zu führen, und wich ihrer Fragerei meistens aus, indem ich sie absichtlich missverstand.
Sie seufzte wieder laut auf und ich sah, wie ihre Stirn sich langsam rötlich färbte, während sie ihre Wut und Verzweiflung über mich zu unterdrücken versuchte. »Aber was ist mit morgen oder übermorgen?«, versuchte sie mich aus der Reserve zu locken. »Was ist nächstes Jahr oder in zwei Jahren?« Ihre Stimme klang noch sehr gefasst, aber trotzdem etwas gepresst. Ein bisschen tat sie mir leid, weil sie sich solche Mühe gab und mich doch nie verstehen würde.
»Keine Sorge, Mutter«, begann ich lieblich und wandte meine Augen wieder dem Buch zu, dessen papierner Einband sich glatt und kühl an meinen Fingern anfühlte. »Mir werden die Bücher schon nicht ausgehen«, sagte ich beschwichtigend und wartete auf den Seufzer, der unweigerlich folgen musste.
Er war lauter als erwartet und wurde noch nicht mal von Mary-Ann übertönt, die zum Essen läutete.
Das Essen begann still. Vater sprach das Tischgebet und häufte sich dann den Teller mit Kartoffeln und Kürbisgemüse voll. Mutter schmollte, aß demonstrativ wenig, um zu betonen, wie sehr ihre Nerven unter meinem Betragen litten und ich las ein wenig über die miserablen Zustände der Kajüte, in der Jackson Throug die nächsten Wochen zu verbringen hatte.
»Musst du denn sogar beim Essen lesen?«, tadelte mich Mutter streng und ich klappte das Buch sofort zu.
»Verzeih, Mutter. Ich hab mich durch meine Neugierde auf den Verlauf der Handlung hinreißen lassen«, behauptete ich und streckte den Rücken durch. Ich hatte sie heute genug gereizt, da war ein wenig Demut vor ihren Augen sicher nicht unangebracht.
Sie grummelte nur, schob dann den Teller von sich, als wäre schon der Anblick von Essen zu viel, und ich seufzte lautlos, während ich mir ein Stück Lamm in den Mund schob.
Es war so ein Moment, in dem die Welt im Ticken einer Uhr zu versinken drohte und jeder Kopf im Zimmer sich überlegte, was er sagen konnte, um der drückenden Stille ein Ende zu setzen.
Und dann erlöste uns die Türglocke.
»Wer kann das nur sein?«, rief Mutter sofort, die Miene erhellt, und hob den Kopf, um durch die halb geschlossene Tür in den Flur zu spähen. »Erwartest du jemanden?«, wandte sie sich dann an Vater und gab es auf, sich den Hals zu verrenken, da sie von ihrem Platz aus sowieso niemals bis zur Tür hätte sehen können.
»Nicht dass ich wüsste«, gab Vater zurück, nachdem er geschluckt hatte, und wischte sich mit einer Servierte das Öl vom Schnauzbart.
Als hätte jemand eine Kerze entzündet, fingen Mutters Augen plötzlich an zu leuchten und ihr Blick wanderte zu mir. »Und du?«, erkundigte sie sich im erwartungsvollen Ton und ich rollte nur mit den Augen.
»Mutter!«, ermahnte ich sie. »Vielleicht ist es ein Brief oder Mr Smith, weil Dolly sich schon wieder die Fessel verstaucht hat«, begann ich das Licht in ihren Augen durch belanglose Vermutungen zu löschen und Mutter zog beleidigt eine Schnute.
»Das wäre aber sehr ungünstig. Ich hatte einen Ausflug an die Seen geplant und ich brauche Dolly vorne an meinem Einspanner, weil ihr Fell so schön zu meinem Nachmittagskleid passt«, fing sie sofort an, obwohl ich nur wild spekuliert hatte. Draußen im Flur wurde Mary-Anns Stimme lauter.
»Sir, der Mantel. Ich bitte Sie, die Herrschaften …«, versuchte sie auf jemanden einzureden und hatte offenbar wenig Erfolg. Denn nur einen Moment später wurde die Tür schon schwungvoll aufgerissen und ein großer, bäriger Mann mit nassem Ulster und einem Zylinder auf dem Kopf stürmte ins Zimmer. Sein blau karierter Flanellschal flatterte im Windzug der Tür und er breitete die Arme aus.
»Überraschung!«, rief er mit seiner angenehmen Stimme und ich sprang so hastig auf, dass hinter mir beinahe der Stuhl umfiel.
»Onkel Alfred!«, quiekte ich recht undamenhaft und war drauf und dran, mich wie ein kleines Kind in seine Arme zu werfen. Da drängte sich Mary-Ann hinter ihm durch die Tür und stellte sich mir so ungeschickt in den Weg, dass der Moment der spontanen Reaktion verstrich und ich mir bewusst wurde, dass ich kein Kind mehr war und dass Mutter mich umbringen würde, wenn Regenflecken auf die Seide meiner Bluse kamen.
»Alfred!«, rief auch Vater. »Welch angenehme Überraschung. Was führt dich hier raus zu uns?«
Onkel Alfred zog sich den Schal vom Hals und reichte ihn der wartenden Mary-Ann. »Ach, nur ein paar Besorgungen. Nichts wirklich Wichtiges«, erklärte er und knöpfte den schweren Mantel auf, der mir zeigte, dass es in London kälter war als hier bei uns auf dem Land.
Wir wohnten natürlich nicht wirklich auf dem Land. Doch wenn man unsere kleine Stadt mit einer wie London verglich, dann konnte man es schon als recht ländliche Gegend bezeichnen.
Onkel Alfred reichte den Mantel der armen Mary-Ann, die unter der schieren Masse an Stoff beinahe unterging und sich vorsichtig rückwärts aus dem Zimmer schob.
»Setz dich. Iss was. Mary-Ann wird dir ein Gedeck bringen«, bot Mutter ihm an und lächelte, obwohl wir alle sehen konnten, dass sie verstimmt war. Was nicht an Onkel Alfred lag, sondern nur an ihren zu hohen Erwartungen an einen Besuch, der am besten nicht zur Familie gehörte und im heiratsfähigen Alter war.
Doch Onkel Alfred war viel zu gut gelaunt, um die verkniffenen Falten in ihren Mundwinkeln zu sehen, und zog sich den Stuhl neben meinem Vater raus. Als er sein massiges Gewicht auf das filigrane Mahagonimöbelstück fallen ließ, knarrte es gefährlich und Mutter krallte ihre Finger unauffällig in ihrem Schoß zusammen. Still schien sie zu beten, dass das Gewicht meines Onkels ihren geliebten Stühlen nichts anhaben würde.
Man konnte nicht behaupten, dass Onkel Alfred wirklich dick war. Doch er war groß, genau wie Vater auch, und hatte von Natur aus das breite Kreuz eines Hafenarbeiters. Dann kamen da noch ein paar Wohlstandspfunde dazu und schon hatte man einen Mann von gewaltiger Statur. Vater wirkte dagegen eher schmal. Ihm war es beschert, nach seiner Mutter zu kommen, während sein Bruder die Eigenschaften ihres Vaters geerbt hatte.
Und ich liebte Onkel Alfred. Er war witzig und geistreich, weltgewandt und würde sich fantastisch in einem Roman machen. Als Kind hatte ich mit großen Augen an seinen Lippen gehangen und jedes Wort, jede Geschichte in mich aufgesaugt. Er hatte von fremden Ländern geredet, von Städten und Bauten, von Menschen und Kulturen. All das, von dem ich nur träumen und lesen konnte.
Mittlerweile war zwar auch er sesshaft geworden, hatte sich eine Frau gesucht und bestritt einen hohen Posten im Personalwesen der Royal University of London, doch an Scharfsinn und Witz hatte er nicht eingebüßt.
»Animant«, sprach er mich an, nachdem er mit meiner Mutter die üblichen Nichtigkeiten über das Befinden und die Familie ausgetauscht und Mary-Ann ihm ein Gedeck gebracht hatte. »Und, Mädchen, was liest du zurzeit?«, wollte er wissen und bediente sich aus den Schüsseln mit Gemüse, Fleisch und Kartoffeln.
Ich ließ ein schüchternes Lächeln sehen. Alle Welt wusste, dass ich gerne las, dass ich eigentlich nichts anderes tat, doch die wenigsten fragten mich nach meiner aktuellen Lektüre. Selbst mein Vater hatte irgendwann aufgegeben, mich nach den Titeln zu fragen, die so schnell wechselten wie die Tageszeiten.
»Einen Diskurs über moderne Mathematik und ihren Einfluss auf unsere Sicht der physikalischen Gesetze, einen Bericht über die Gründung der Börse in Amerika 1792 und einen Roman über Jackson Throug’s Reise nach Indien«, zählte ich die Titel auf und Onkel Alfred brach in schallendes Gelächter aus.
Vater lachte mit, einfach weil es ihm guttat, die ausgelassene Stimmung seines Bruders zu teilen, und Mutter sah mich an, als ob ich gerade behauptet hätte, die Cholera heilen zu können. Ich lächelte nur eisern weiter, wusste nicht, was es zu bedeuten hatte; fühlte mich fremd bei dem Gedanken, nicht diejenige zu sein, die den Weitblick über die Situation hatte, und zog unauffällig das Buch neben meinem Teller vom Tischrand und auf meinen Schoß, damit meine Finger sich daran klammern konnten.
»Du bist wirklich unglaublich, Ani«, prustete mein Onkel und ich nahm an, dass es sich dabei um ein Kompliment handelte. »Ich kenne nur wenige Leute, die so viel lesen wie du«, fügte er hinzu und diesmal konnte ich den anerkennenden Ton deutlich heraushören. Verlegen zuckte ich mit den Schultern, weil ich mit der unerwarteten Ehre nicht umgehen konnte, und war bemüht, mich zusammenzunehmen, damit mir die Röte nicht ins Gesicht stieg.
»Mich wundert, dass du überhaupt Menschen kennst, die so viel lesen«, warf meine Mutter ruppig ein, der nicht mal im Traum einfallen würde, mich dafür auch noch zu loben. Hätte sie es mal gemacht, vielleicht hätte ich mich dann dazu erbarmt, netter zu ihren auserwählten Schwiegersöhnen zu sein.
»Oh, da gab es einen Mann in Neuseeland, der hat einfach alles gelesen, was er zwischen die Finger bekommen hat, und als es nicht genug war, hat er selbst angefangen zu schreiben«, begann Onkel Alfred ausschweifend zu erzählen und schob sich eine Gabel voll Essen in den Mund. »Und dann gibt es in London diesen Bibliothekar, der …«, nuschelte er zwischen Fleisch und Kartoffeln und seine Augen, die erst so glänzend und in Erzähllaune geleuchtet hatten, verdunkelten sich schlagartig und wurden durch seine buschigen Brauen überschattet. »Oh, dieser Kerl!«, knurrte er verbissen und seine Zähne zermahlten das Fleisch mit einem Knirschen. Doch er atmete tief durch, schüttelte seine plötzliche Wut wieder ab und versuchte sich an einem neutralen Gesichtsausdruck.
»Ist alles in Ordnung?«, erkundigte Vater sich, während er sein drittes Stück Fleisch zerteilte und Onkel Alfred verkniffen nickte.
»Ach«, wehrte er ab und drei Augenpaare sahen ihn erwartungsvoll an. Er hatte unsere Neugierde geweckt. Er sah von Vater zu Mutter und zu mir und dann wieder zurück. »Es sind nur ein paar Personalprobleme«, erklärte er trocken und seine großen Hände schlossen sich fester um das Besteck. »Die mich allerdings in den Wahnsinn treiben!«, fügte er recht energisch hinzu und ich machte mir ein wenig Sorgen. Mein Onkel war für gewöhnlich ein heiterer Geselle, Sorgen standen ihm nicht.
»Iss, Animant«, ermahnte Mutter mich flüsternd und ich ließ die Finger vom Buch auf meinem Schoß und nahm das Besteck zur Hand, ohne den Blick von meinem Onkel abzuwenden.
»Macht er dir Ärger?«, wollte Vater gerade wissen und Onkel Alfred schnaubte, begann allerdings wieder zu essen, was schon mal ein gutes Zeichen war.
»Ärger ist das falsche Wort, Charles«, erwiderte er zwischen zwei Bissen und wedelte mit der Gabel in der Luft herum. »Ein kleinkarierter Bürokratenarsch ist er, dieser Bibliothekar!«, schimpfte er los und meine Mutter zuckte bei der derben Wortwahl zusammen, was mich zum Grinsen brachte und auch Onkel Alfreds Gesicht hellte sich immer weiter auf. »Ihr müsstet ihn sehen«, meinte er und das Lachen kehrte in seine Stimme zurück. »Mit seiner albernen Lesebrille, den gebügelten Hemden und dem Stock im Hintern. Er ist der Bibliothekar der Royal University Library und er hat so viel zu tun, dass er einen Assistenten benötigt. Doch alle Literatur-Absolventen, die sich zu diesem Job bereit erklären, kündigen manchmal schon nach wenigen Tagen oder werden von ihm zum Teufel gejagt. Niemand wird seinen Ansprüchen gerecht, keiner kann seinen Anforderungen genügen und ich bin bald so weit, irgendwen doppelt zu bezahlen, nur damit er den Job behält.«
»Ist er denn sehr herrisch?«, erkundigte sich Mutter vorsichtig und mein Onkel lachte auf.
»Nein, nur verschroben und zu allem bereit. Wenn ich nicht wüsste, dass die Haushälterin im Personaltrakt ständig über seine Unordnung fluchen würde, hätte ich behauptet, er schläft sogar zwischen seinen Büchern.« Onkel Alfred wischte mit einer Kartoffel das Öl aus dem Kürbisgemüse auf und schob sie sich dann in den Mund. Öl tropfte in seinen Bart und er sah aus wie ein wilder Straßenarbeiter.
Ich versuchte nicht daran zu denken, wie es in meinem Zimmer aussah, und nahm ein wenig Kürbis auf die Gabel. All die Bücher, die schon aus meinen Regalen quollen und sich unter meinem Bett stapelten. Wenn man es genau nahm, schlief ich schon seit Langem zwischen meinen Büchern.
Doch es ging hier ja nicht um mich. Schließlich war ich eine junge Frau mit Wissensdurst und kein kauziger, verstaubter, alter Bibliothekar.
»Wenn mir nicht die Universitätsleitung im Nacken sitzen würde, wäre das auch alles nicht der Rede wert. Wir würden uns in Ruhe zusammensetzen und ich würde dem Jungspund die Leviten lesen«, sagte mein Onkel belustigt und ich stolperte über das Wort Jungspund, weil es sich nicht mit dem Bild in meinem Kopf vereinen ließ, das ich mir von dem Bibliothekar gemacht hatte. In meiner Vorstellung waren Bibliothekare alt und nicht jung.
»Wie kann ich dir helfen?«, bot Vater an, so wie er nun mal war, denn seine Hilfsbereitschaft zählte zu seinen größten Stärken. Wenn es allerdings nach meiner Mutter ging, würde man es als Schwäche betrachten, denn seine Hilfsdienste ließen ihn oft lange ausgehen und meine Mutter langweilte sich dann zu Tode oder begann, ihre Träume über meine baldige Hochzeit bis ins kleinste Detail weiter auszuspinnen, um sich den Tag zu versüßen.
»Macht euch in dieser Sache bloß keine Gedanken«, erwiderte Onkel Alfred. »Ich werde schon jemanden finden, der genauso in Bücher verliebt ist wie dieser verrückte Bibliothekar«, rief er lachend und wischte sich mit einer Serviette den Bart sauber.
»Animant zum Beispiel«, zischte Mutter mir zu und ich tat, als ob ich es nicht gehört hätte, weil sie mir damit nur einen Seitenhieb verpassen wollte.
Doch Vater hatte es ganz genau gehört. Er holte tief Luft, seine Augen weiteten sich, als ihm eine Idee kam, und dann wandte er sich an seinen Bruder. »Wieso eigentlich nicht?«, fragte er und Onkel Alfred sah ihn zweifelnd an, in der Erwartung, dass Vater einen Scherz mit ihm machte.
Aber es war kein Scherz. Nichts in seinem Gesicht wies darauf hin, dass Vater es nicht völlig ernst meinte und die Idee zweifelsohne auch noch gut fand. Mir blieb für einen Moment das Herz stehen, weil ich so erschrocken darüber war, und ich biss aus Versehen auf ein Pfefferkorn, das sich im Gemüse versteckt hatte. Alles in meinem Mund zog sich zusammen und ich war bemüht, äußerlich die Fassung zu bewahren.
»Sie hat zwar nicht studiert, aber mit Büchern kennt sie sich allemal aus«, begann Vater seine Idee zu formulieren und Mutter schnitt ihm sofort das Wort ab.
»Bist du verrückt geworden? Sie ist eine junge Dame höherer Gesellschaft und du schlägst vor, dass sie arbeiten geht?«, keifte sie los und die Empörung trieb ihr die Röte auf die Stirn. »Das wäre ein Skandal!«
»Wäre es nicht, Darling«, versuchte Vater sie zu beschwichtigen. »Sie würde mal rauskommen und wäre gezwungen, ihren schlauen Kopf auch zu benutzen.«
»Aber sie müsste allein nach London«, redete Mutter bereits weiter und nun war es Onkel Alfred, der sie unterbrach.
»Sie wäre doch nicht allein, Charlotte«, widersprach er ihr und zog ein skeptisches Gesicht. »Sie würde bei Lillian und mir wohnen.«
Vater wandte seinem Bruder erstaunt den Blick zu. »Du unterstützt meine Idee?«, fragte er überrascht und mir schwirrte langsam der Kopf.
War gerade ernsthaft im Gespräch, mich nach London zu schicken, damit ich dort in einer Bibliothek arbeitete? Und war mir das überhaupt recht?
Der Gedanke, den Tag mit stupiden Arbeiten zu verbringen, anstatt einfach bequem in meinem Sessel zu sitzen und zu lesen, war mir nicht unbedingt willkommen. Aber wenn es bedeuten würde, nach London zu gehen, Neues zu lernen und wenigstens für eine gewisse Zeit der Hochzeitsplanung meiner Mutter zu entkommen, klang der Vorschlag tatsächlich verlockend.
»Deine Tochter ist schlau und sie lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Sie wäre die perfekte Alternative zu meiner bisherigen Strategie. Und wenn es doch nichts werden sollte, dann hab ich diesen Besserwisser von einem Bibliothekar wenigstens ein bisschen geärgert«, senkte Onkel Alfred verschwörerisch die Stimme und Vater lachte.
»Niemand wird hier geärgert! Schon gar nicht ich!«, ging Mutter sofort wieder dazwischen. »Sie wird hierbleiben! Bei ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen. Sie ist doch kein Versuchsobjekt, das ihr nach London zerren und zum Arbeiten zwingen könnt, nur um zu sehen, was daraus werden könnte!« Ihre Hände waren zu Fäusten geballt und ich wartete nur darauf, dass sie damit auf den Tisch schlug wie ein Auktionator mit seinem Hämmerchen.
Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft. Animant Crumb, für dreitausend Pfund im Jahr an den jungen Herrn mit dem blonden Schnauzer und der hässlichen fliederfarbenen Weste.
Ich blinzelte meine unsinnigen Gedanken weg, die mir eine unangenehme Gänsehaut bescherten, und ließ das Besteck wieder auf meinen Teller sinken.
Ganz sicher würde ich nicht hier herumsitzen und darauf warten, dass Mutter mich so weit zermürbte, dass ich irgendwann ihrem Drängen nachgab und einen Mann heiratete, den ich nicht wollte, nur damit sie Ruhe gab. Diese Vorstellung behagte mir gar nicht, und ich wäre sogar bereit, ein wenig zu arbeiten, nur um ihr für eine Weile zu entkommen.
»Es muss ja nicht für lange sein«, behauptete Onkel Alfred und verzog grimmig den Mund über die Starrköpfigkeit seiner Schwägerin. »Ein Monat wäre schon ziemlich lang bei diesem Mann.«
»Nein!«, rief Mutter und stand demonstrativ von ihrem Stuhl auf, der quietschend über die Bodenvertäfelung kratzte. »Sie wird nicht nach London fahren! Und das ist mein letztes Wort!«
Das Zweite oder das, in dem mein Lesesessel nach London zog.
Ich saß in der Kutsche nach London und klammerte mich an meine Handschuhe, die ich zwischen den Fingern hielt und immer wieder über das glatte Leder strich, um mich selbst zu beruhigen. Draußen zog die Landschaft vorbei, gelbe Stoppelfelder, bunte Bäume, die bereits begannen, ihre Blätter zu verlieren. Draußen bot sich mir eine traumhafte Spätherbstlandschaft, die ich leider in diesem Moment nicht so richtig schätzen konnte.
Ich war auf dem Weg nach London. Kaum zu fassen. Mutter war dagegen gewesen, hatte gezetert und geschimpft, bis Vater sie beiseitenahm und anschließend mit ihr und Onkel Alfred im Salon verschwunden war.
Nur einen winzigen Moment hatte ich es dann noch auf meinem Stuhl im Esszimmer ausgehalten, bis ich aufgesprungen und ihnen hinterhergeeilt war, um an der geschlossenen Tür zu lauschen.
»Stell dir vor, welche Möglichkeiten sich dort auftun könnten. Wie viele Menschen ihr dort begegnen werden«, sagte Vater und Mutter fiel ihm ins Wort.
»Aber Charles«, begann sie weinerlich und ich wusste, welchen Blick sie jetzt aufgesetzt hatte. Diesen flehenden, von schräg unten, mit dem sie Vater immer weichkochte.
Doch diesmal schien er sich davon nicht einwickeln zu lassen. »Charlotte, Gesellschaften mit den Großen Londons, vielleicht sogar Bälle am Königshof. Junge Männer mit Rang und Namen, Grips und Witz. Einen Monat, Darling, und ihr wird der Kopf schwirren von all den nennenswerten Verehrern, zwischen denen sie sich entscheiden muss!«
Ich schnappte erschrocken nach Luft. War dieser Vorschlag wirklich von meinem Vater gekommen? Wann hatte er sich in dieser Angelegenheit denn so sehr auf die Seite meiner Mutter geschlagen? Ich wusste nicht, ob ich empört oder geschockt sein sollte.
Auch Mutter schien es die Sprache verschlagen zu haben, denn es kam kein Ton von ihr.
»Ihr müsst es ja auch niemandem sagen. Wir behaupten einfach, ich nehme sie als Gesellschaft für Lillian mit. Damit sie nicht den ganzen Tag allein ist, wenn ich die nächsten Wochen so viel zu tun habe. Wer würde es schon hinterfragen, wenn Animant ihren Onkel in London besuchen käme«, gab Onkel Alfred zu bedenken. »Und dann gibt es ja auch immer noch Henry. Er wird sich freuen, seine Schwester zu sehen.«
Ich hörte Mutter seufzen. Es war ein ergebenes Seufzen, eines, das mir sagte, dass Vater und Onkel Alfred gewonnen hatten und sie mir erlauben würde, nach London zu fahren. »Einen Monat!«, erwiderte sie streng. »Und das auch nur, wenn sie es einen Monat aushält. Was ich schwer bezweifle.«
Ich nahm das Ohr von der Tür, trat einige Schritte zurück und setzte mich vorsichtig auf die unteren Stufen der Treppe.
Denn jetzt war es an der Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich wollte. Wollte ich nach London und die Assistentin eines verschrobenen Bibliothekars werden? War die Aussicht auf ein wenig Freiheit genug, um mich aus meiner täglichen Routine zu reißen und in eine andere Stadt zu fahren?
Die Gesellschaften würden mich ganz sicher nicht reizen und auch die Erwähnung der vielen Gesprächspartner, die ich abzuwimmeln hätte, stimmte mich nicht gerade euphorisch.
Doch andersherum gab mir der Gedanke, abzulehnen und hierzubleiben, einen Stich, der direkt auf meinen Stolz abzielte. Mutter hatte behauptet, ich würde es keinen Monat dort aushalten. Sie hielt mich für naiv und unerfahren, weil ich mich bisher nie beweisen musste und weil alle in mir noch das arme, weiche Kind sahen. Wenn ich ablehnte, würde ich ihnen recht geben und das könnte mein Stolz nicht ertragen.
Also hatte ich zusagen müssen und den verkniffenen Gesichtsausdruck meiner Mutter genossen, die insgeheim gehofft hatte, dass ich mich gegen London und für ihre Gesellschaft entscheiden würde. Doch darauf konnte sie lange hoffen.
Es dauerte zwei Tage, bis ich alles gepackt hatte und Mutter mit meiner Kleiderauswahl ebenfalls zufrieden war. Onkel Alfred blieb und bewohnte unser Gästezimmer, war tagsüber aber die ganze Zeit mit Vater unterwegs, sodass sich keine Gelegenheit bot, ihn über London und die Bibliothek auszufragen.
Über uns rumpelte es und Onkel Alfred schreckte aus seinem Halbschlaf auf. »Was war das?«, wollte er schlaftrunken wissen und ich kniff die Lippen nervös zu einem schmalen Strich zusammen.
»Sicher nur mein Sessel«, gab ich zurück und Onkel Alfred schüttelte den Kopf, während er sich an seinem Bart kratzte.
»Wieso musstest du das alte Ding auch mitschleppen?«, meinte er, doch ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
»Er gehört nun mal zu mir. Und ich wäre doch auch sicher eine Schande für all meine Vorfahren, wenn ich nicht auch ein bisschen exzentrisch wäre«, warf ich selbstsicher ein und Onkel Alfred lachte laut.
»Da hast du recht, Ani! Wie so oft«, grölte er und ich lächelte.
Die Familie Crumb hatte schon eine Menge Exzentriker hervorgebracht und wenn ich mir die Stammbäume anderer Familien besah, waren es auffällig viele. Meine Großtante Rose hatte eine Vorliebe für übergroße Hüte, mein Cousin dritten Grades war ein Mann mit dem Talent, Geschichten zu erzählen, ohne jemals das Ende zu verraten, und mein Großvater hatte immer behauptet, seine eigene Mutter wäre Admiral bei der Marine gewesen.
Im Gegensatz dazu war es ja fast schon harmlos, dass ich mit einem Sessel verreiste.
Wir machten zwei Pausen auf unserer Reise. Einmal, um in einem wunderschönen kleinen Gasthaus zu Mittag zu essen und einmal für den Fünfuhrtee.
Onkel Alfred erzählte viel über seine letzte Reise nach Europa, über Lillians Begeisterung für deutsches Brot und dass es eine ganz tolle Zeit in London werden würde.
Doch egal, wie geschickt ich es anstellte, das Thema auf die Bibliothek, meinen neuen Job oder diesen ominösen Bibliothekar zu lenken, Onkel Alfred schaffte es immer irgendwie, sich wieder herauszuwinden, und nach dem achten Versuch gab ich schließlich auf.
Er wollte mir offensichtlich nichts darüber erzählen und das machte mich nervös und neugierig zugleich. Doch er versprach, sich gleich morgen früh darum zu kümmern, dass alles offiziell in die Wege geleitet wurde. Und damit würde ich mich wohl zufriedengeben müssen. Vorerst.
Wir erreichten London kurz nach Sonnenuntergang und ich konnte nur wenig erkennen auf den dunklen Straßen, die nur selten von einer Laterne beleuchtet wurden, da die Laternenanzünder ihre Runden wohl noch nicht beendet hatten. Erst als wir ins Zentrum fuhren und dem Gelände der Universität näher kamen, wurden die Straßen breiter und heller und ich konnte die düsteren hohen Häuser bewundern, die sich so eng aneinanderschmiegten, als ob sich so die Kälte besser aushalten ließ.
Natürlich war ich nicht das erste Mal in London, aber das erste Mal ohne meine Eltern, und obwohl die Luft nicht so frisch war wie bei uns auf dem Land, roch sie für mich nach Freiheit und unendlich vielen neuen Möglichkeiten.
Tante Lillian empfing uns an der Tür, als wir mit steifen Gelenken aus der Kutsche kletterten, und lachte überrascht, als sie mich erblickte.
»Animant!«, rief sie freudig und schloss mich in ihre Arme, als ich die drei Stufen zur Haustür hinaufgestiegen war und zu ihr in den warmen Flur trat.
In London war es wirklich bitterkalt, sodass man den Eindruck hatte, der Winter wäre hier schon sehr viel näher als bei uns.
»Wie kommen wir zu der Ehre?«, wollte sie wissen und ihre schmalen Augen wurden von Lachfältchen umzogen. Sie hielt mich eine Armlänge von sich und musterte mich eingehend.
»Onkel Alfred möchte mich als Bibliothekarsassistentin auf Probe einstellen«, antwortete ich frei heraus und ihre Augen wurden erst groß, dann zornig.
»Du willst sie diesem Scheusal zum Fraß vorwerfen?«, rief sie empört, als ihr Mann durch die Tür kam, und stemmte ihre dünnen Ärmchen in die schmale Taille.
»Mach dir mal keine Sorgen, Liebling. Die kleine Ani wird ihn in der Luft zerfetzen«, behauptete er gelassen, knöpfte den Mantel auf und schälte sich aus dem dicken Kleidungsstück.
»Duuu …«, begann Tante Lillian schimpfend und mit gerecktem Finger, schüttelte aber dann den Kopf und seufzte nur leise. »Ach, komm her, mein Abenteurer!« Ihre Stimme wurde milde und sie ging zu ihm, um sich von seinen bärigen Armen umschließen zu lassen.
Die beiden waren ein sehr ungleiches Paar und doch wie füreinander geschaffen. Er war groß und stämmig, sie klein und zierlich. Seine Haare waren dunkel, seine Haut gebräunt, während sie leuchtete wie ein Engel mit hellblondem Haar und einer Haut so weiß wie Marmor.
Nur ihr Humor war der gleiche und das war wohl auch der Grund, warum sie sich so gut verstanden.
Ich knöpfte meinen Mantel auf und reichte ihn an einen stillen älteren Herrn, der mir den Arm hinhielt, damit ich das Kleidungsstück ablegen konnte. Ich nickte ihm höflich zu, er nickte zurück und dann richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf meine Tante.
»Das Essen wartet, Alfred«, sagte sie gerade und hob dann vielsagend die Augenbrauen. »Und ein Gast, der darauf besteht, noch heute eine Unterredung mit dir zu führen«, fügte sie hinzu und hatte dabei ein Lächeln im Mundwinkel.
»Ein Gast, oho«, machte Onkel Alfred und Tante Lillian knuffte ihn verspielt in die Seite.
»Habt ihr beiden denn Hunger?«, wandte sich meine Tante jetzt auch an mich.
Jetzt, wo wir endlich da waren, spürte ich die Müdigkeit in meinem Körper und das Loch in meinem Magen. Außerdem würde ich zu einem guten Essen nie Neinsagen.
Das Esszimmer war kleiner als unseres. Eigentlich waren hier alle Räume kleiner als bei uns, was nicht am fehlenden Reichtum meines Onkels, sondern an dem mangelnden Platz in den Londoner Straßen lag.
Meine Tante ging voraus, ich folgte und mein Onkel wechselte noch ein paar Worte mit seinem Butler, der sich um unser Gepäck kümmern sollte.
Ich war so hungrig, dass ich nicht mal den Drang verspürte, mich vor dem Essen umzuziehen und auch meine Tante schien darin kein Problem zu sehen. Bei ihr und meinem Onkel ging es so viel ungezwungener zu als bei meinen Eltern zu Hause. Mutter hätte mich sofort die Treppen hochgejagt und mich in einen netten Fummel gesteckt, wenn auch nur die geringste Hoffnung bestand, dass der besagte Besuch männlich, jung und ledig sein könnte.
Und das war er tatsächlich. Unerwartet stand ich einem Paar hellbrauner Honigaugen gegenüber und musste sogleich aufpassen, dass mich das ausladende Kleid meiner Tante nicht in die Arme des dazugehörigen Mannes schubste. Ich kam allerdings trotzdem ins Straucheln und hielt mich an einem Tischchen fest, um mein Gleichgewicht wiederzuerlangen.
»Verzeihen Sie«, stammelte ich, ohne die Hand des Mannes in Anspruch zu nehmen, die er mir bereitwillig entgegenstreckte, um mich wenn nötig aufzufangen.
»Schon gut«, antwortete er mir mit leiser, aber fester Stimme und ich starrte ihn an wie ein verschrecktes Kaninchen.
Der Mann vor mir war jung, vielleicht Mitte zwanzig, sein Haar dunkelblond und etwa mittellang, sodass es ihm ein verwegenes Aussehen verlieh. Seine Gesichtszüge waren ebenmäßig, der Kiefer kantig, die Lippen auffällig, ohne dass ich wirklich sagen konnte weshalb.
Die schweren Schritte meines Onkels auf dem Parkett rissen mich aus der Betrachtung des Fremden und holten mich in die Wirklichkeit zurück. Ich schaffte es, in meinem Kopf ein für mich überraschendes abschließendes Urteil über das Aussehen meines Gegenübers zu fällen: Er sah viel zu gut aus, um mich nicht wenigstens ein bisschen zu beeindrucken.
»Winston!«, rief mein Onkel, als er den jungen Mann erblickte, und grinste breit. »Mein Freund, ich dachte, du wärst schon auf halbem Weg nach Glasgow.«
Auch der Angesprochene lächelte und trat vor, um meinem Onkel die Hand zu schütteln. »Erst morgen in der Früh, Alfred. Deshalb nehme ich auch die Unhöflichkeit in Kauf, dich um diese Stunde noch zu stören.«
»Ach wo«, wehrte Onkel Alfred ab, und dann schien ihm plötzlich wieder einzufallen, dass ich nach wie vor neben den beiden Männern an der Wand eingezwängt stand.
»Oh, natürlich«, begann mein Onkel und trat ein Stück zur Seite, damit ich mit meinem Rock mehr Platz zum Stehen hatte. »Ani, darf ich bekannt machen? Dieser junge Mann ist Winston Boyle, der neue Rechtsbeistand meiner Abteilung«, stellte er mir Mr Boyle vor, der höflich den Kopf neigte, ein verschmitztes Lächeln im Mundwinkel. »Winston, das ist meine Nichte Animant Crumb. Ich habe sie nach London mitgebracht, damit sie sich als Bibliothekarsassistentin versuchen kann.«
Mr Boyle fiel bei diesen Worten das Lächeln aus dem Gesicht und er zog überrascht die Augenbrauen hoch. »Wie? In dieser Bibliothek? Bei Mr Reed?«, wollte er entgeistert wissen und so langsam war ich bereit, mir doch ein wenig Sorgen zu machen.
»Wie fürchterlich muss dieser Mann denn sein, dass alle so entsetzt reagieren, wenn das Thema auf ihn kommt?«, fragte ich in einem leichten Ton und lächelte sanft, um meine Gefühle nicht zu offenbaren. Wenn ich die ganze Sache nicht mit Humor nahm, würde ich am Ende vielleicht wirklich Angst bekommen und ich war fest entschlossen, mich nicht so leicht einschüchtern zu lassen. Mutter würde es nur zu gern sehen, wie ich alles hinschmiss und nach Hause zurückgekrochen kam. Aber diesen Gefallen würde ich ihr garantiert nicht tun.
»Er ist nicht fürchterlich«, beeilte Mr Boyle mich zu beruhigen und als er mein Lächeln sah, kehrte auch sein eigenes zurück. »Nur … kompliziert.«
Ich hob eine Augenbraue, legte den Kopf leicht schräg und beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, den gut aussehenden Mr Boyle auszuquetschen. Wenn schon niemand anderes bereit war, meine Fragen zu beantworten, dann musste eben er herhalten.
»Setzt euch doch erst mal und esst«, unterbrach Tante Lillian meine Gedanken mit weicher Stimme und streckte die Hand nach mir aus, damit ich mich auf ihre Seite des Tisches setzte. »Dabei könnt ihr immer noch reden.«
Ich lächelte ihr zu, obwohl ich innerlich seufzte, raffte meine Röcke und manövrierte mich zwischen Onkel Alfred und Mr Boyle hindurch, die mir bereitwillig den Weg frei machten.
Meine Mutter hätte mich wohl niemals unterbrochen, wenn ich gerade mit einem netten jungen Mann geplaudert hätte. Aber so war das Leben nun mal, man konnte an jeder Situation etwas beanstanden.
Wir setzten uns, Onkel Alfred sprach das Tischgebet und eine beleibte Frau mit Spitzenhäubchen trug eine Terrine mit dickem Eintopf herein, aus der sie uns einem nach dem anderen ausschöpfte.
Ich hatte gerade den Löffel aufgenommen, da richtete ich das Wort auch schon wieder an Mr Boyle. »Mr Boyle«, sagte ich mit leiser Stimme, hoch erhobenem Kopf, das Kinn hielt ich jedoch ein wenig gesenkt, genau so, wie meine Mutter mir immer einredete, wie man mit jungen Männern zu reden hätte. »Geh ich recht in der Annahme, dass Sie diesen Mr Reed persönlich kennen?«, fragte ich sehr direkt und Mr Boyle nickte, während er kaute.
»Das tun Sie, Miss Crumb«, erwiderte er charmant und seine ungewöhnlichen Lippen verzogen sich zu einem leichten Schmunzeln. »Wenn man so viel Zeit wie ich in dieser Bibliothek zugebracht hat, kann man gar nicht anders, als diesem Herrn persönlich zu begegnen.«
Ich rutschte mit dem Po ein Stück weiter auf die Stuhlkante, um aufmerksamer zuzuhören und mein Interesse an diesem Thema zu unterstreichen. »Mein Onkel hat mich dazu überredet, mein Glück in der arbeitenden Schicht zu versuchen, bisher allerdings alles verschwiegen, was mir in diesem Bezug wichtig erscheint. Sie werden mir wohl verzeihen müssen, dass ich meine Neugierde so offen zur Schau trage«, erzählte ich und Mr Boyle lachte, ein Lachen, das mich anstecke.
Er stützte die Unterarme auf der Tischkante ab und beugte sich mir ebenfalls entgegen. »Ich werde Ihnen mit Freuden alle Fragen beantworten, die ich imstande bin aufzuklären«, versicherte er mir verschwörerisch und hob dann den Blick zu Onkel Alfred, als wäre ihm eingefallen, dass es sich nicht gehörte, Versprechungen in Aussicht zu stellen, die man vielleicht nicht einhalten konnte. »Wenn es Ihrem Onkel denn genehm ist«, fügte er schnell hinzu und seine Stimme bekam einen nüchternen Ton.
Onkel Alfred seufzte laut und schob sich noch einen Löffel voll Eintopf in den Mund, was seine Antwort verzögerte und mich noch mehr auf die Folter spannte. »Redet nur«, sagte er schließlich schroff. »Soll mir recht sein. Dann muss ich schon nicht über diesen Mann sprechen. Das ist nicht gut für mein Herz, wisst ihr«, behauptete er und ich konnte ihm nicht so recht glauben, weil Tante Lillian in diesem Moment ebenfalls zu grinsen anfing und sich nur mühsam das Lachen verkneifen konnte.
Doch es konnte mir ja auch egal sein, welche Gründe Onkel Alfred wirklich hatte, solange er mir erlaubte, meine Neugierde anderweitig zu stillen.
Mr Boyles Honigaugen wandten sich erwartungsvoll an mich und mir fiel es schwer, auf die Schnelle bei all den vielen Fragen zu entscheiden, welche ich als Erstes stellen wollte.
»Mein Onkel deutete an, dass sich kein Assistent für diesen Mr Reed finden lasse. Woran kann das Ihrer Meinung nach liegen?«, begann ich klein, erinnerte mich selbst daran, dass ich ja mal hungrig gewesen war, und tauchte meinen Löffel in den heißen Eintopf, der nach Kartoffeln, Hühnchen und diversen Gewürzen duftete.
»Puh, das ist wohl auch schon der Kern der Sache«, meinte Mr Boyle und ließ seinen Löffel auf halbem Weg in der Luft verweilen, während er die Stirn krauszog, um seine Gedanken anzustrengen. »Ich würde behaupten, es liegt an den Erwartungen, die er an die Leute stellt und die niemand erfüllen kann.«
»Und die wären?«, schob ich gleich hinterher, als Mr Boyle sich den Löffel zum Mund führte.
»Er nimmt sich nicht die Zeit, die Leute richtig einzulernen. Er hat gern seine Ruhe, verschwindet manchmal am Nachmittag einfach, ohne zu sagen wohin, und erwartet, dass man mit den gestellten Aufgaben fertig wird, ohne von ihm eine Anleitung zu bekommen. Ich würde behaupten, er ist ein schlechter Lehrer, der aber trotzdem Perfektion als Ergebnis erwartet«, führte er aus und da fiel ihm noch etwas ein. »Oh!«, machte er und sein Mund verzog sich zu einem kleinen Lächeln. »Und er schätzt es gar nicht, wenn man seine Arbeit nicht ernst nimmt. Ein Mensch, der Vergnügen der Arbeit voranstellt, hat bei ihm nicht die geringste Chance.«
Das waren eine Menge Eigenschaften, die auf einen sehr verschrobenen, steifen Mann hinwiesen, mit dem ich meine liebe Mühe haben würde. Falls ich die Gelegenheit bekam, lang genug zu bleiben, um mich überhaupt darauf einzulassen.
So wie es bei Mr Boyle klang, würde ich in die Bibliothek hineinkommen, einen Fehler machen und schon wieder rausgeworfen werden. Ich hatte noch nie in einer Bibliothek gearbeitet.
Was dachte ich da? Ich hatte überhaupt noch nie gearbeitet! Ich hatte keine Ausbildung, kein Literaturstudium, keinerlei Erfahrungen als Assistent eines Bibliothekars.
Aber ich hatte Stärken, die von Vorteil sein würden. Ich kannte mich in Bibliotheken aus. Zwar nicht speziell in dieser, aber ich hatte schon viele gesehen und das System war immer ähnlich. Ich konnte schnell lesen, war logisch veranlagt und hatte einen Hang zur Sorgfalt.
Und vor allem war ich dickköpfig.
Wenn es sein musste, dann würde sich dieser Mr Reed die Zähne an mir ausbeißen. Sollte sich herausstellen, dass es nur die trotzige Reaktion einer Tochter auf die Worte ihrer Mutter war, würde ich trotzdem niemals aufgeben!
Dieser Entschluss stärkte mir den Rücken, gab mir Aufwind, auch wenn Mr Boyles Worte mich eigentlich hätten entmutigen müssen.
»Woher wissen Sie von dem Vergnügensverbot?«, fragte ich nach.
»Es ist kein Verbot, Miss Crumb. Es wird nur nicht gern von ihm gesehen, wenn sie Bälle und Gesellschaften der Arbeit vorziehen und unausgeschlafen am Morgen antreten«, verdeutlichte er und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er irgendwie zu glauben schien, dass ich so eine Person sein könnte, die Bälle liebte und den Morgen verschlief.
»Und um auf Ihre Frage zu antworten. Einige meiner engeren Bekannten haben sich bereits in die Knechtschaft dieses Mannes begeben und sind allesamt geflohen«, sagte er und lachte, weil er darin einen Witz fand, den ich nicht entdecken konnte. »Aber zu Mr Reeds Verteidigung muss ich sagen, dass diese besagten Bekannten faule Taugenichtse sind und es eigentlich nicht anders verdient haben.«
Da war er also, der Witz, und ich lächelte elegant, genau wie Mr Boyle es auch tat.
Ich hatte gedacht, dass die Antworten auf meine Fragen Licht in die Dunkelheit bringen würden. Doch eigentlich warfen sie nur neue Schatten an die Wände, die ich noch weniger deuten konnte als die vorherige Dunkelheit.
Es ergab sich einfach kein vollständiges Bild und meine Neugierde wurde nur weiter angestachelt.
»Aber um dem verschrienen Mr Reed nicht unrecht zu tun, bin ich gewillt, Ihnen auch ein paar seiner positiven Eigenschaften aufzuzählen«, gab Mr Boyle fast gnädig von sich und Onkel Alfred schnaubte in sich hinein. Er schien da wohl anderer Meinung zu sein, sodass ich mir verhalten die Hand vor den Mund legte, damit er mein Lachen nicht sah.
Doch Mr Boyle entging es nicht und seine Augen glitzerten in einer so angenehmen Weise, dass ich mir nicht erklären konnte, woher all die Sympathien kamen, die ich für ihn hegte, obwohl ich ihn so wenig kannte.
Vielleicht lag es an seinem hübschen Gesicht oder seiner stilvollen Kleidung. Doch das hatten schon andere vor ihm gehabt und ich hatte ihnen auch nichts abgewinnen können.
Ich belächelte mich selbst und gab der Möglichkeit Raum, dass es an der Tatsache lag, dass er bisher noch nichts gesagt hatte, was auf Stumpfsinn hinweisen könnte.
Mr Boyle nahm noch einen Löffel Eintopf zu sich und führte seine Anschauungen weiter aus. »Mr Reed ist weltoffen und unkonventionell, soweit man das als Stärken auslegen möchte. Er ist wissbegierig, hat zu beinahe jedem Thema eine Meinung oder zumindest ein Buch, auf das er verweisen könnte, und sein Sinn für Fortschritt ist mir sehr genehm.«
Ich nickte leicht und schwieg, hing meinen Gedanken nach, versuchte das Bild weiter zusammenzusetzen.
»Bin ich Ihnen denn eine Hilfe, Miss Crumb?«, fragte Mr Boyle plötzlich ein wenig verunsichert und ich hob meine Augen wieder zu ihm, bemüht, das Lächeln zurück auf meine Lippen zu zaubern.
»Aber natürlich, Mr Boyle. Sie helfen mir sogar in großem Maße. Doch ich muss zugeben, dass ich aus alldem nicht schlau werde.«
»Da werden Sie wohl warten müssen, bis Sie ihm begegnen«, lachte Mr Boyle und seine Stimme hatte eine Art Zuversicht, die mich davon überzeugte, dass es eine interessante Begegnung werden würde.
Nach dem Essen zogen sich Onkel Alfred und Mr Boyle ins Arbeitszimmer zurück und redeten über irgendwelche Verträge. Allerdings konnte ich nicht viel in Erfahrung bringen, da Tante Lillian mich beinahe beim Lauschen erwischt hätte und ich mich daraufhin mit ihr im Wohnzimmer vor den Kamin setzte. Sie ließ mich von meinen Eltern berichten, von der Reise, und erzählte mir dann von all den aufregenden Sachen, die sie mit mir in London unternehmen wollte.
Ich wies sie nicht darauf hin, dass ich morgen eine Arbeit antrat und daher wahrscheinlich nicht so viel Zeit für ausschweifende Unternehmungen haben würde. Stattdessen lächelte ich nur und ließ ihr die Freude, mir Londons Attraktionen aufzuzählen. Und als sich die Herren wieder zu uns gesellten, war es bereits spät geworden und es war absehbar, dass Mr Boyle uns bald verlassen würde.
»Wie lang werden Sie denn voraussichtlich in London verweilen, Miss Crumb?«, fragte er mich und ich fühlte mich ein wenig geschmeichelt von all der Aufmerksamkeit, die er mir entgegenbrachte.
Er hatte sich nah neben das Sofa gestellt, auf dem ich saß, und sein Blick lag auf mir. Amüsiert und ernst zugleich.
Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Seine Blicke verwirrten mich, denn ich fühlte mich besonders gut und gleichzeitig unwohl bei dem Gedanken, dass er mit seiner Frage darauf abzielte, mich wiederzusehen.
»Oh, das weiß ich noch nicht«, gab ich uneindeutig zurück und dachte daran, dass meine Mutter darauf bestanden hatte, dass ich nicht länger als einen Monat blieb. Aber wer konnte das schon so genau vorhersagen?
Onkel Alfred schmunzelte. »Keine Angst, du wirst sie schon wiedersehen«, meinte er mit seiner brummenden Stimme und der Unterton darin gefiel mir gar nicht. Es klang so nach verkuppeln.
Tante Lillian war da auch nicht besser. »In sechs Tagen findet eine Soiree bei den Kents statt«, warf sie ein, erhob sich vom Sessel mir gegenüber und lächelte Mr Boyle an. Er erwiderte das Lächeln, während sein Blick immer wieder zu mir wanderte. Er schien eine Art Bestätigung von mir zu erwarten, die ich ihm aber nicht geben konnte, da ich seine Absichten nicht so recht zu deuten wusste.
»Animant wird uns sicher dorthin begleiten«, versprach Tante Lillian also an meiner statt und auch sie sah mich erwartungsvoll an.
Unsicher stützte ich meine Hand auf der Armlehne des Sofas ab und drückte mich auf die Füße hoch. Wenn alle im Raum standen, wäre es unhöflich gewesen, einfach sitzen zu bleiben.
Meine Gefühle waren noch durcheinander, während der Teil meines Kopfes, der rein analytisch dachte, eine Ungereimtheit in den Worten meiner Tante fand.
»Moment. In sechs Tagen? Sagte Onkel nicht, dass Sie nach Glasgow reisen würden? Welche Kutsche der Welt schafft es denn in sechs Tagen nach Schottland und wieder zurück?«, platzte es lauter aus mir heraus, als ich beabsichtigt hatte, und trotz der Unhöflichkeit, die ich damit an den Tag legte, begann Mr Boyle zu lachen.