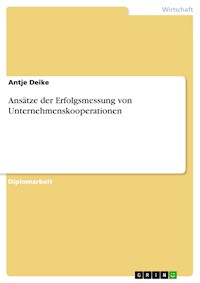
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 2,0, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Sprache: Deutsch, Abstract: Kennzeichnend für das heutige Wirtschaftssystem ist ein Überangebot an Unternehmen, die auf Erträge abzielen, indem sie menschliche Bedürfnisse befriedigen. Somit treten sie verstärkt in Wettbewerb, wobei ein höherer Zielerreichungsgrad des einen, einen geringeren des anderen bedingt und so um jede gute Wettbewerbsposition gekämpft wird. Kooperationen bieten einen Weg. Partner in Kooperationen können gegenüber Einzelunternehmen flexibler sein und so mit höherer Wahrscheinlichkeit eine gute Wettbewerbsposition erreichen. Folglich besitzen Unternehmenskooperationen als Koordinationsformen zwischen Markt und Hierarchie seit vielen Jahren eine hohe Bedeutung. So stellt sich auch die Frage nach Ihrem Erfolg. Ziel dieses Buch ist es, verschiedene theoretische Ansätze der Erfolgsmessung von Unternehmenskooperationen kritisch zu diskutieren. Die Kooperationsform, Strategische Allianz, wird vordergründig betrachtet. Dabei wird die Frage beantwortet: Welche Modifikationen an traditionellen Erfolgsmessungsverfahren vorgenommen werden müssen, um den spezifischen Charakteristika einer Strategischen Allianz gerecht zu werden und handhabbare, effiziente Verfahren zu schaffen, die Teilbeiträge zur Beurteilung des Kooperationserfolgs leisten? Zunächst wird eine Spezifizierung der Eigenarten der Allianz vorgenommen. Ein Augenmerk liegt besonders auf relevanten Aspekte für die Erfolgsmessung. Dazu gehören mögliche Ausprägungsformen, die verfolgten spezifischen Zielsetzungen sowie das Verständnis von Erfolg und seinen unterschiedlichen Bestimmungsperspektiven. Die Perspektive einer Partnerunternehmung auf ihren eigenen Kooperationserfolg wird dann eingenommen. Aus den besprochenen Eigenschaften ergeben sich dann sehr spezielle Anforderungen an ein Erfolgsmessungssystem, die im Verlauf des Buches detailliert dargestellt werden. Daraus resultiert die Forderung nach einer gewissen Anpassungsarbeit existierender, klassischer, auf den Alleingang einer Unternehmung ausgerichteter Instrumente zur Erfolgsmessung. Die nötigen Anpassungen der herkömmlichen Verfahren zur Erfolgsmessung werden diskutiert und versucht abschließend die Möglichkeit eines Gesamtsystem zu evaluieren, indem jedes der einzelnen Verfahren, gemessen an seiner Eignung, zu einem Teil einfließen kann. Rechtliche Aspekte und Fragen der Institutionalisierung werden an dieser Stelle vernachlässigt. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst, verbleibende Probleme angeschnitten und ein Ausblick gegeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Page 3
II
3.2EINFLUSSFAKTORENAUF DIEAUSGESTALTUNGDERVERFAHRENZURERFOLGSMESSUNG 253.2.1 STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 25 3.2.2 ZIELEUND INHALTLICHEBEGRENZUNG 26 3.2.3 ZEITHORIZONT 26 3.2.4 ORGANISATIONSFORMUNDAUTONOMIEDERPARTNER 27 3.2.5 VERTEILTE LEISTUNGSERSTELLUNG 28 3.3ANFORDERUNGSKATALOGANERFOLGSMESSUNGSMETHODEN 29
4MÖGLICHE VERFAHREN ZUR ERFOLGSMESSUNG FÜR DIE STRATEGISCHE ALLIANZ 2
EIN ÜBERBLICK 24.1 4.2EINDIMENSIONALE METHODEN 34.2.1 KALKULATIONIMSINNEEINER PERIODENBEZOGENENERGEBNISRECHNUNG 3 4.2.1.1 Vorgehensweise 3 4.2.1.2 Kritische Würdigung 7 4.2.2 WERTSTEIGERUNGSANALYSE 9 4.2.2.1 Vorgehensweise 9 4.2.2.2 Kritische Würdigung 12 4.2.3 AKTIVITÄTSBASIERTE ERFOLGSMESSUNG 13 4.2.3.1 Vorgehensweise 13 4.2.3.2 Kritische Würdigung 16MEHRDIMENSIONALE METHODEN 174.3 4.3.1 NUTZWERTANALYSE 17 4.3.1.1 Vorgehensweise 17 4.3.1.2 Kritische Würdigung 19 4.3.2 BALANCED SCORECARD 20 4.3.2.1 Vorgehensweise 20 4.3.2.2 Kritische Würdigung 21 4.4GESAMTSYSTEMZURERFOLGSMESSUNGEINERSTRATEGISCHEN ALLIANZ 21
5FAZIT & AUSBLICK 23
Page 4
Abbildungsverzeichnis
ABBILDUNG 1 - KOOPERATIONSFORMENAUF DEMMARKT-HIERARCHIE-KONTINUUM ............... 7 ABBILDUNG 2 - SACHZIELEEINERSTRATEGISCHEN ALLIANZ................................................. 16 ABBILDUNG 3 - ANFORDERUNGSKATALOG ........................................................................... 31 ABBILDUNG 4 - WERTSTEIGERUNGSMECHANIK STRATEGISCHER ALLIANZEN......................... 12 ABBILDUNG 5 - GRUNDPRINZIPDERAKTIVITÄTSBASIERTEN ERFOLGSMESSUNG.................... 14 ABBILDUNG 6 - BERECHNUNGDESNUTZWERTES................................................................. 19
Abkürzungsverzeichnis
bzw. beziehungsweise DBR Deckungsbeitragsrechnung d.h. das heißt EKR Einzelkostenrechnung etc. et cetera f. folgend ff. fortfolgend KAKR Kooperationsaktivitätskostenrechnung PKR Prozesskostenrechnung S. Seite SGE Strategische Geschäftseinheit u.a. unter anderem vgl. vergleiche UKV Umsatzkostenverfahren vs. versus z.B. zum Beispiel
Page 5
1Einleitung - Kooperationen in der Wirtschaftspraxis
Das oberste Ziel jeder wirtschaftlichen Tätigkeit besteht in der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Hierzu erfüllen Unternehmen des Wirtschaftssystems eine, von außen oder sich selbst gestellte, Aufgabe. Ein Unternehmen stellt dabei „ein wirtschaftlich-rechtlich organisiertes Gebilde [dar], in dem auf nachhaltig ertragbringende Leistung gezielt wird“2. Aufgrund der Komplexität der zu erfüllenden Gesamtaufgabe bedarf es zumeist einer Unterteilung in einzelne Teilaufgaben, die nach ökonomischen Gesichtspunkten auf verschiedene Organisationseinheiten zu übertragen sind.3Mögliche außerhalb liegende Einheiten können andere Unternehmen sein, die als Partner zur Aufgabenerfüllung in Betracht kommen. Regelmäßig ist die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen vorerst durch reine Leistungs-Austauschbeziehungen auf Basis marktlicher Transaktionen gekennzeichnet. Mit Hilfe gemeinschaftlichen Handelns können diese, auf einer zweiten Stufe, jederzeit zu freiwilligen Zweckbeziehungen ausgebaut werden, die die Effizienz der wirtschaftlichen Tätigkeiten steigern und die bessere Erreichung der Aufgabe möglich machen sollen.4So treten Kooperationen oder Unternehmensverbindungen auf den Plan, die verstärkt als Varianten zur Aufgabenerfüllung herangezogen werden. Kennzeichnend für das heutige Wirtschaftssystem ist nun weiterhin ein Überangebot an Unternehmen, die auf Erträge abzielen, indem sie menschliche Bedürfnisse befriedigen. Somit treten sie verstärkt in Wettbewerb, wobei ein höherer Zielerreichungsgrad des einen, einen geringeren des anderen bedingt und so um jede gute Wettbewerbsposition gekämpft wird. „Kooperationen bieten sich [nun] jedem Unternehmen als möglichen Weg zur Erreichung bzw. Erhaltung von Wettbewerbsvorteilen an“5, um diese Positionen einzunehmen. Partner in Kooperationen, die sich gegenseitig ergänzen, können gegenüber Einzelunternehmen flexibler sein6und so mit höherer Wahrscheinlichkeit eine gute Wettbewerbsposition erhalten. „Folglich besitzen Unternehmenskooperationen als
1Ohmae, K., Logik, 1994, S. 74.
2Gabler Wirtschaftslexikon, Band 4, 2000, S. 3181.
3Vgl. Grochla, E., Betriebsverbindungen, 1969, S. 16.
4Vgl. Grochla, E., a.a.O., S. 31.
5Drews, H., Kooperationscontrolling, 2001, S. 1.
6Vgl. Morschett, D., Formen, 2003, S. 391.
Page 2
Koordinationsformen zwischen Markt und Hierarchie seit vielen Jahren eine hohe Bedeutung in der Wirtschaftspraxis“.7Sie stellen kein vollkommen neues Phänomen dar, sind vielmehr ein seit geraumer Zeit eingesetztes Mittel,8doch in näherer Vergangenheit und Gegenwart sind Wachstumssprünge bei Kooperationsaktivitäten zu beobachten.9Das Verdrängungsdenken den Konkurrenten gegenüber, weicht zunehmend einem Kooperationsdruck. Wettbewerb soll dabei nicht beseitigt werden, aber Unternehmen versuchen verstärkt nur dort zu konkurrieren, wo sie einen Wettbewerbsvorteil vorzuweisen haben.10
„Bündnisse sind eben ein fester Bestandteil des Repertoires jedes guten Strategen. Und in der heutigen Zeit einer wachsenden Wettbewerbsintensität gilt dies auch für Unternehmungen.“11
Dabei wurde eine neue Form der Kooperation, die „Strategische Allianz“, begründet. Herkömmliche Methoden der Auslandsorganisation (globale, transnationale,
multinationale Organisationen) reichen häufig nicht mehr aus, um international wettbewerbsfähig zur bleiben und so hat die „Strategische Allianz“ an Bedeutung gewonnen. Sie dient der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsposition. Diese Tendenz begründet Ohmae folgendermaßen: Eine „Strategische Allianz“ ist das beste Mittel um mit dem Zwang der Globalisierung umzugehen.12
„Der Erfolg der Allianz ist [nun jedoch] in gleichem Maße unsicher wie im Falle des alleinigen Engagements. Die Allianz garantiert nicht den Erfolg unternehmerischen Handelns.“13Doch trotz der großen Bedeutung der Erfolgsmessung jeder unternehmerischen Aktivität, bewerten Unternehmen zur Zeit den Erfolg ihrer kooperativen Beziehungen nur unzureichend.14Ursachen hierfür sind vielschichtig, lassen sich beispielhaft auf fehlende Erfahrungen, das komplexe Bewertungssystem aufgrund der Zusammenarbeit mehrerer Akteure oder fehlende Managementstrukturen zurückführen.
7Drews, H., Kooperationscontrolling, 2001, S. 1.
8Vgl. Grochla, E., Betriebsverbindungen, 1969, S. 8.
9Vgl. Doz, Y., Relevanz, 1992, S. 50.
10Vgl. Bleeke, J./Ernst, D., Killer, 1994, S. 15.
11Ohmae, K., Logik, 1994, S. 54.
12Vgl. Ohmae, K.,a.a.O., S. 78.
13Gahl, A., Spannungsfeld, 1990, S. 39.
14Vgl. Merkle, M., Bewertung, 1999, S. 1.
Page 3
Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, verschiedene theoretische Ansätze der Erfolgsmessung von Unternehmenskooperationen kritisch zu diskutieren, um einen Beitrag zur Bewältigung der beschriebenen Thematik zu leisten. Wobei eine Eingrenzung auf eine spezifische Kooperationsform, die „Strategische Allianz“, vorgenommen wird. So steht dann die Frage im Mittelpunkt: Welche Modifikationen an traditionellen Erfolgsmessungsverfahren vorgenommen werden müssen, um den spezifischen Charakteristika einer „Strategischen Allianz“ gerecht zu werden und handhabbare, effiziente Verfahren zu schaffen, die Teilbeiträge zur Beurteilung des Kooperationserfolgs leisten? Die Möglichkeit eines Gesamtsystems wird in Betracht gezogen.
Notwendig ist dabei zunächst eine Spezifizierung der Eigenarten der Allianz. Ein Augenmerk soll dabei auf besonders relevante Aspekte für die Erfolgsmessung gelegt werden. Dazu gehören mögliche Ausprägungsformen, die verfolgten spezifischen Zielsetzungen sowie das Verständnis von Erfolg und seinen unterschiedlichen Bestimmungsperspektiven. Wobei dann eine Perspektive, die einer Partnerunternehmung auf ihren eigenen Kooperationserfolg, eingenommen wird. Aus den Eigenschaften ergeben sich dann sehr spezielle Anforderungen an ein Erfolgsmessungssystem, die im Verlauf des Kapitels 3 detailliert dargestellt werden. Daraus resultiert die Forderung nach einer gewissen Anpassungsarbeit existierender, klassischer, auf den Alleingang einer Unternehmung ausgerichteter, Instrumente zur Erfolgsmessung. Kapitel 4 beschäftigt sich so mit nötigen Anpassungen der herkömmlichen Verfahren zur Erfolgsmessung und versucht abschließend die Möglichkeit eines Gesamtsystem zu diskutieren, indem jedes der einzelnen Verfahren, gemessen an seiner Eignung, zu einem Teil einfließen kann. Rechtliche Aspekte und Fragen der Institutionalisierung werden an dieser Stelle vernachlässigt. Abschließend werden Ergebnisse zusammengefasst, verbleibende Probleme angeschnitten und ein Ausblick gegeben.
Page 4





























