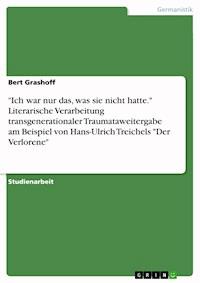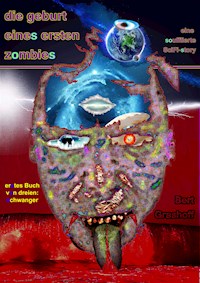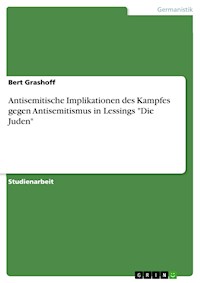
Antisemitische Implikationen des Kampfes gegen Antisemitismus in Lessings "Die Juden" E-Book
Bert Grashoff
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 1,0, Universität Bremen, Veranstaltung: Lessing als Dramatiker, Literaturkritiker und Aufklärer, Sprache: Deutsch, Abstract: Gotthold Ephraim Lessing veröffentlichte bereits 1749 das ernste Lustspiel Die Juden. 30 Jahre vor Nathan, der Weise stellte er einen edelmütigen Juden in das Zentrum eines Stückes, um die antisemitischen Ressentiments seiner Zeit auf subtile Weise zu bekämpfen, um für Toleranz und Vorurteilsfreiheit zu werben. Es ist das erste Stück der europäischen Aufklärung mit einer positiven Judenfigur überhaupt und kaum ein Aufklärer war so ambitioniert im Kampf gegen Antisemitismus wie Lessing. Der Veröffentlichung des Stücks folgten Diskussionen des gebildeten Publikums über den Wahrheitsgehalt der tief in den christlichen Traditionen verwurzelten antisemitischen Ressentiments, die selbst weitgehend von antisemitschen Reflexen bestimmt waren. Lessing verteidigte sein Stück argumentativ. Die 2004 von Bert Grashoff verfasste Hausarbeit befasst sich damit, inwiefern Lessings Versuche der Dekonstruktion der antisemitischen Ressentiments in Die Juden und auch seine Argumente in der anschließenden Diskussion hilflos bleiben und an den judenfeindlichen Vorurteilsstrukturen abperlen. Er bedient sich dabei unter anderem eines in den 1970ern entwickelten und weithin rezipierten Theorieansatzes von Moishe Postone, der den Hass aufs Abstrakte ins Zentrum des modernen, aus dem christlichen Antijudaismus entlassenen Antisemitismus stellt. Ebenso reflektiert er in der Interpretation des Lessing-Stücks auf das von Adorno und Horkheimer in den 1940ern eingeführte Konzept der pathischen Projektion und auf neuere Diskussionen um die Jahrtausendwende zur antisemitischen Figur des Kronzeugen-Juden. Die Hausarbeit stellt eine kritische Würdigung der Leistung Lessings dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Universität Bremen Fachbereich 10 Studiengang Germanistik Sommersemester 2004
Titel des Seminars: Lessing als Dramatiker, Literaturkritiker und Aufklärer
Hausarbeit zum Thema:
Antisemitische Implikationen des Kampfes gegen Antisemitismus
in Lessings „Die Juden“
Name der/s Studierenden: Bert Grashoff
Haupt- und Nebenfächer: Philosophie (HF), Germanistik NF), Soziologie (NF) Grundstudium, 4. Semester
Page 3
Bert Grashoff: Antisemitische Implikationen des Kampfes gegen Antisemitismus in Lessings „Die Juden“
Die Handlung des Stückes
Gotthold Ephraim Lessings 1749 geschriebenes und 1754 publiziertes und uraufgeführtes ‚ernstes Lustspiel’Die Judenstellt eine Kritik allgemeiner Vorurteile dar. Es behandelt den christlichen Judenhass und führt dessen antisemitische Stereotypen vor. Die dramaturgische Pointe verwehrt dem Publikum die Erfüllung des „Gesetzes des Lustspiels“, nämlich die Heirat der Liebenden - und problematisiert so auf emotionale Weise die kulturelle Separation zwischen Christen und Juden.
In nachholender Erzählung erfahren wir, dass ein Landbaron von zwei als Juden verkleideten Straßenräubern nachts überfallen wurde. Ein zufällig vorbeikommender REISENDER und sein Diener vertrieben mutig die Angreifer und wurden vom BARON aus Dankbarkeit für einige Zeit auf dessen Gut eingeladen. Dort befinden sich auch die Räuber: Vogt und Schulze des BARONS - mit deren zynischem Dialog über ihren misslungenen Mordversuch das Stück einsetzt. In Dialogen mit dem REISENDEN formulieren sowohl der Vogt, der den Verdacht von sich ablenken will, als auch der BARON, der die Banditen wirklich für Juden hält, diverse antisemitische Klischees. Der REISENDE distanziert sich stets von diesen Klischees und erweist sich insgesamt mehrmals als toleranter Menschenfreund. Die Tochter des BARONS verliebt sich in den REISENDEN, und nachdem der REISENDE durch einige Verwicklungen und glückliche Zufälle hindurch aufdecken kann, wer die Banditen gewesen sind, bietet der BARON dem REISENDEN die Hand seiner Tochter an. Der REISENDE entdeckt sich nun zum Erstaunen aller als Jude, weshalb die Heirat selbstverständlich ausfallen muss.1
These
InDie Judenbetritt die erste positive Judengestalt des deutschen Theaters die Bühne. Lessing war damit unter anderem auch in der Problematisierung des Antisemitismus seiner Zeit voraus. Primär findet die Denunziation des Antisemitismus hierbei in der Form der Denunziation des generalisierenden Vorurteils gegen eine spezifische soziale Gruppe statt: in ähnlicher Weise könnten statt der Juden etwa auch Personen anderer diskriminierter Religionen oder anderer „Rassen“ vor dem „allgemeinen Urteil“ in Schutz genommen werden. Die markanteste Stelle für diese Strategie Lessings im Stück ist der Ausspruch des REISENDEN:
1Heiraten zwischen Christen und Juden waren nicht erlaubt und konnten nur praktiziert werden, sofern der Jude bzw. die Jüdin vorher zum Christentum konvertierte.