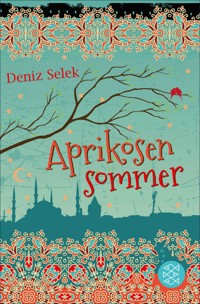
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die berührende Suche eines Mädchens nach ihrem Vater, nach der eigenen Identität und die Geschichte einer ersten Liebe Eve fliegt mit ihrer Mutter nach Istanbul, um ihren Vater ausfindig zu machen. Fünfzehn Jahre lang hat ihre Mutter alle Fragen nach ihm abgeblockt. Als er dann tatsächlich vor Eve steht, hat sie das Gefühl, endlich den fehlenden Teil ihrer Identität gefunden zu haben. Und dann ist da auch noch ihr Dolmetscher Sinan, in den sie sich Hals über Kopf verliebt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Deniz Selek
Aprikosensommer
Biografie
Deniz Selek wurde in Hannover geboren und verbrachte ihre Kindheit in Istanbul. Schon früh begann sie Geschichten zu schreiben, die sie selbst illustrierte. Sie studierte Germanistik, Pädagogik und Innenarchitektur, verkaufte neben Schuhen auch eigene Kunstwerke, arbeitete als Texterin, Redakteurin und Illustratorin, bis sie sich ganz dem Schreiben von Büchern widmete. Deniz Selek lebt mit ihrer Familie in Berlin.
Bei Fischer sind von ihr bisher erschienen: ›Zimtküsse‹, ›Heartbreak-Family – Als meine heimliche Liebe bei uns einzog‹ und ›Heartbreak-Family – Als ein anderer mir den Kopf verdrehte‹.
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: Frauke Schneider
Coverabbildung: diniane, shutterstock; Frauke Schneider
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0101-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Das Ende
Das Glück
Die Bekanntschaft
Die Geschichte
Die Hoffnung
Der Traum
Der Zettel
Die Brücke
Der Auftritt
Die Suche
Die Schwester
Das Komplott
Die Stadt
Das Hotel
Der Dolmetscher
Das Herz
Die Familie
Der Streit
Die Versöhnung
Der Anfang
Glossar
Für die kluge und starke Anastasia,
weil ich weiß, dass du es schaffst!
Das Ende
»Nicht dein Ernst, oder?« Mein eben noch freudiges Lächeln zerplatzte wie ein Ballon beim Nadelstich.
Und heraus regnete Asche, winzige graue Staubpartikel tanzten vor mir im Sonnenlicht.
Wir standen allein auf dem Flur vor seiner Klasse, und Matteo registrierte jede Regung in meinem Gesicht, jedes Zucken, jedes Heben und Senken. Alles. Jeder Muskel, jeder Nerv, jeder Millimeter Gefühl war sichtbar unter meiner zerrissenen Fassade. Er wurde rot, drehte den Kopf weg und sah aus dem offenen Fenster nach unten in den Schulhof, von dem der Pausenlärm zu uns heraufschallte.
So sehr mich das Geschrei der jüngeren Schüler sonst nervte, in diesem Moment war ich froh darüber, weil es mein inneres Schreien übertönte.
Matteo antwortete nicht. Er sah nach draußen, die Hände so tief in den Taschen vergraben, dass er seine Hose damit noch weiter runterschob und seine Beine lächerlich kurz wirkten. Er wollte gehen, wollte dieses unangenehme Gespräch beenden, so wie er uns gerade beendet hatte. Er wollte weg von mir. Schluss.
»Hau ab«, sagte ich. »Verpiss dich, du Arsch.«
Ich musste das sagen, ich musste ihn beleidigen, weil ich geheult hätte, wenn ich es anders gesagt hätte. Weil ich auch geheult hätte, wenn ich nichts gesagt hätte. Und ich wollte nicht heulen. Jedenfalls nicht vor ihm. Wahrscheinlich sah er trotzdem das Wasser in meinen Augen.
»Okay«, sagte er und wandte sich zum Gehen, obwohl er in zehn Minuten in diesem Klassenraum wieder Unterricht hatte und ich diejenige war, die gehen musste. Ich hatte in der nächsten Stunde Werken, das in einem anderen Gebäude der Schule stattfand.
Es ist vorbei, dachte ich, das war’s. Mein Herz zog sich zusammen, tuckerte und stach und schickte dabei zehnmal die gleiche Frage an meinen Bauch. Ist es wirklich vorbei? Mein Bauch zierte und wand sich und antwortete doch zehnmal mit dem gleichen flauen Ja.
Bewegungslos klebte ich im Flur vor dem Klassenraum des Typs, der bis vor einer Minute mein Freund gewesen war. Ich konnte ihm nur hinterherstarren wie ein hypnotisiertes Karnickel, bis er endlich um die Ecke bog. Matteo Veronne und Evelyn Morgenstern.
Es waren einmal ein Junge und ein Mädchen mit den schönsten ausgefallenen Namen, wie es sie kein zweites Mal gab auf der Welt. Und das Schicksal wollte es, dass sich genau diese beiden am coolsten Ort und in der coolsten Schule aller Zeiten begegneten. Freie Waldorfschule Berlin-Mitte.
Beim ersten Anblick verliebten sie sich unsterblich ineinander und wussten, dass sie füreinander bestimmt waren. Sie wussten, dass sie für immer zusammen sein würden. Zumindest sie wusste das. Na ja, sie hatte es geglaubt, okay, gehofft.
Meine Hand zitterte, als ich die Tasche nahm, und meine Knie wabbelten, als ich die ersten Schritte nach dem Verlassenwerden machte. Noch nie hatte mich ein Junge verlassen; konnte auch nicht, weil Matteo mein erster Freund gewesen war. Ich wankte in die entgegengesetzte Richtung, weg von ihm, obwohl sich alles in mir dagegen wehrte, obwohl ich mich wie abgeschnitten fühlte und es so weh tat. Trotzdem wusste ich, dass es richtig war, denn wo es weh tut, da geht’s lang. Hatte mir mein Onkel mal gesagt. Damals verstand ich den Satz nicht, heute ahnte ich, was er gemeint haben könnte.
Das Treppenhaus blockierte Hakan aus der Elften, eine Klasse über uns, mit seinen Leuten. Sie hatten sich so auf die oberen Stufen gesetzt, dass man im Slalom um sie herumtrippeln musste. Ich stieg über sie hinweg und traute mich nicht, laut zu schimpfen, weil sie ständig Sprüche abfeuerten. Wenn man sie ignorierte, ging es vielleicht. Heute jedoch nicht. Heute war mein Glückstag, ein Highlight jagte das nächste. Ich wusste, dass Hakan auf mich stand, das machte es nicht besser.
»Ey, Eva«, rief er, kaum dass ich mich an ihm vorbeigequetscht hatte. »Wo is Adam?«
Alle lachten, und ich versuchte noch schneller wegzukommen. »Hat disch verlassen im Paradies?«
Fast wäre ich gestolpert. Ich drehte mich zu Hakan um und bedauerte sehr, dass Blicke nicht töten können. Leider, leider nicht. Er hielt meinem Blick stand und lachte. Lachte mich einfach aus. Ich hasste ihn und konnte nichts erwidern. Der einzige Trost, der mir blieb, war, dass er nicht wusste, wie recht er hatte.
»Vallah«, grinste er anzüglich. »Is egal, Mann. Nimmst du Cengiz.« Bei der Erwähnung des Namens zuckte ich zusammen. Wieder lachten alle, nur Cengiz drehte sich verschämt weg. Ich übersprang die letzte Stufe und lief davon. Trotzdem holte mich Hakans Stimme ein.
»Ey, Eva«, rief er. »Cengiz liebt disch voll. Escht jetz!«
Wie hatte es dieser Trottel eigentlich bis in die Oberstufe geschafft? Ich trat gegen die Glastür, die sich scheppernd öffnete, und wich geblendet zurück.
Der Frühling war in diesem Jahr zu einer Zeit ausgebrochen, die bei mir noch Winter hieß und damit sehr viel besser zu meiner Stimmung gepasst hätte. Graue Wolken, Regen und ein eisiger Wind wären mir jetzt recht gewesen, vielleicht noch ein paar Graupel dazu, gern auch Hagel. Doch die Sonne feuerte so viel Licht und Wärme in den Schulhof, als hätte sie vergessen, dass sie noch gar nicht dran war.
Der sonst stetig rauschende Verkehr schien seine Lautstärke zugunsten des Vogelgezwitschers gedrosselt zu haben. Sie sangen fröhlich, Bäume, Sträucher und Hecken trieben aus, und Finn und Rosa standen eng umschlungen neben der Mensa und knutschten, bis sich einer am anderen verschluckte. Ekelhaft. Jetzt fehlten nur noch flatterhübsche Schmetterlinge, ein putziges Eichhörnchen oder … Krokusse! Entschlossen stampfte ich über das Beet neben mir und machte eine Gruppe von fünf lila Blüten platt. Und hätte fast geheult, weil sie dann flach und abgeknickt dalagen wie Tote. Es half auch nichts, dass ich mich sofort bückte, um sie wieder aufzurichten. Als Blumenmörderin fühlte ich mich noch elender.
Am liebsten hätte ich Werken geschwänzt, doch das hatte ich in der Woche zuvor schon getan und für die Entschuldigung die Unterschrift meiner Mutter gefälscht. Das war rausgekommen und hatte mir eine Menge Ärger eingebracht. Also musste ich hin.
Ich ging langsamer, als ich ein paar aus meiner Klasse vor dem Werkraum sah. Unter ihnen meine Freundin Henny, die sich wieder herausgeputzt hatte wie eine Indianerin, nur in blond. In ihren langen Haaren hingen kleine Muscheln, und um ihre Stirn lag ein buntes Flechtband mit Federn an den Enden. Sie wedelte mit den Armen, die von zahllosen Reifen, Bändern und Perlenschnüren umschlungen waren. An drei Fingern prangten Türkisringe, und auch ihren Hals zierte ein Lederband mit einem großen Stein. Obwohl ich ihre Aufmachung gewöhnt war, fragte ich mich, ob ihr das ganze Gedöns nicht irgendwann mal zu schwer wurde.
Je näher ich kam, umso weniger wedelte sie. Wahrscheinlich eilte mir schon eine derart penetrante Er-hat-Schluss-gemacht-Wolke voraus, dass sie riechen konnte, was los war. Wie Hundekacke am Schuh, die man erst nur als Ahnung wahrnimmt und damit über flauschigen Teppich latscht.
»Was ist passiert?« Henny bohrte ihre grauen Augen in meine. Eigentlich war sie viel zu schön für eine beste Freundin. Wenn man auch nur ein Fünkchen Interesse an Jungs hatte, sollte man sich von ihr fernhalten. Erst recht, wenn man selbst in der mittleren Kategorie unterwegs war. Aber Henny war nicht nur schön, sondern auch noch lieb dazu. Eine verheerende Mischung. Mehr als je zuvor wünschte ich, sie nicht so gern zu haben und mit einer Hässlichen befreundet zu sein. Einer richtig Hässlichen. Damit wäre es mir viel besser gegangen, obwohl Henny mit Matteo gar nichts zu tun hatte. Die mochten sich nicht mal. Es war nur dieses miese Gefühl, dass er mich möglicherweise nicht verlassen hätte, wenn ich auch so schön gewesen wäre wie sie. Dann hätte er über das andere vielleicht hinwegsehen können. So was tat man doch bei schönen Menschen, da sah man über ein paar kleine Macken hinweg, die fielen einfach nicht so ins Gewicht. Henny wurde nie verlassen. Natürlich nicht. Wenn ich ein Junge gewesen wäre, hätte ich das sicher auch nicht gemacht.
Neugierig beäugten mich jetzt auch Marlene, Clara und Natalie, die bei ihr standen. Auch sie wollten wissen, was los war.
»Nix«, murmelte ich und sah an ihnen vorbei, sie würden es ohnehin bald erfahren. Herr Zorn drängte sich mit hocherhobenem Schlüssel zwischen uns durch bis zur Tür. »Leute«, stöhnte er. »Nun macht doch mal Platz!«
Henny zog mich an einen Tisch am Ende des Raums, während die anderen ihre Schnitzarbeiten und Werkzeuge aus den Regalen nahmen. »Was ist denn mit dir?«, flüsterte sie und schob die Strähne mit den Muscheln hinter ihre Schulter, doch sie rutschte nach vorn und schaukelte hin und her. »Eve, jetzt sag schon!«
Schlaff sank ich auf den Stuhl, beugte mich über den Tisch und vergrub das Gesicht in den Armen. Meine Stimme war in der grauen Asche erstickt. Ich konnte nicht sprechen.
»Hallo, das gilt auch für euch da hinten!« Herr Zorn winkte uns heran. »Wir wollen heute zur Abwechslung mal was schaffen.«
»Äh, Entschuldigung«, sagte Henny. »Was, bitte?«
»Ihr sollt eure Sachen holen«, wiederholte er. »Und zu uns an den Mitteltisch kommen.«
In der folgenden Viertelstunde, in der uns Herr Zorn das Einspannen des Holzes und den richtigen Umgang mit den Messern zeigte, warf Henny mir ständig fragende Blicke zu. Auch Marlene und Natalie sahen zu mir rüber. Was hätte ich jetzt darum gegeben, nicht hier sein zu müssen! Nachdem Herr Zorn fertig war und wir mit dem Schnitzen begannen, passierte es. Eine Sekunde passte ich nicht auf, schnitt mit dem Messer nicht von mir weg, sondern rutschte in einer verqueren Bewegung über meine linke Hand. Weil es so sauscharf war, spürte ich gar keinen Schmerz, nur ein seltsames Kribbeln im Zeigefinger.
Ungläubig sah ich auf das Blut, das aus der Wunde sprudelte und schnell eine leuchtende Pfütze auf dem Holzboden bildete. Ein Tropfen pitschte genau in die Fuge zwischen zwei Dielen und verteilte sich kurz, aber linear nach rechts und links, bevor es versickerte. Die Farbe sieht ja echt super aus, dachte ich noch, als plötzlich jemand schrie. Ich taumelte, mein Herz klopfte schneller und härter, ich begann zu schwitzen. »Kann mal einer das Fenster aufmachen«, wollte ich sagen, »es ist so warm hier«, doch es kam nur ein Lallen heraus. Das merkte ich sogar noch.
Dann lag ich auf etwas Hartem, jemand fummelte an meiner Hand herum, und viele Stimmen vermischten sich zu einem zähen grauen Teig aus panischen Geräuschen, die ich mit meinen Gedanken ruhigkneten wollte. Davon wurde mir schlecht.
»Du hättest mir glauben sollen«, sagte mein Magen und bäumte sich auf. »Ich habe dir gesagt, es ist vorbei.«
Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Tisch und hatte einen kalten nassen Lappen auf der Stirn. Es war still. Herr Zorn, Frau Miedlich, die Schulärztin, und Henny standen neben mir. Sonst war niemand da. Ich versuchte mich aufzurichten, doch Frau Miedlich ließ mich liegenbleiben. »Der Notarzt ist schon unterwegs, Evelyn«, sagte sie. »Und deine Mutter auch, du musst ins Krankenhaus.«
»Aber warum?«, fragte ich verwirrt und sah zwischen den dreien hin und her. »Was ist eigentlich passiert?«
»Du hast dich geschnitten.« Henny drehte den Lappen auf meiner Stirn um, so dass es wieder kalt wurde. »Schlimm.«
Da wusste ich es wieder. Das Messer. Ich hatte es nicht so benutzt, wie Herr Zorn gesagt hatte. Es hatte mir alles zu lange gedauert, ich wollte schnell fertig werden und gehen. Deshalb hatte ich das Holz gar nicht erst in den Schraubstock gespannt, sondern einfach drauflosgeschnitzt, ohne nachzudenken. Ich betrachtete meine linke Hand, die von Herrn Zorn aufrecht gehalten wurde und in einen dicken Verband gewickelt war. Er schien nicht nur besorgt, sondern zutiefst erschrocken, dabei konnte er gar nichts dafür.
Der Sekundenzeiger der Uhr, die über der Tür hing, drehte leise klackend seine Runden. Keiner sagte etwas. Auch ich nicht. Mich wunderte, dass ich immer noch keine Schmerzen hatte. Mein Finger fühlte sich nur taub an.
Dann hörten wir die Sirene, zuerst noch aus der Ferne, dann immer näher, lauter und lauter, und mein Herz fing wieder an zu flattern, heftiger als zuvor, weil ich wusste, dass er meinetwegen kam. Ich hatte noch nie in einem Rettungswagen gelegen. Kurz darauf vernahmen wir eilige Schritte und Stimmen im Flur, und ich zitterte vor Aufregung und Angst.
Im nächsten Augenblick flog die Tür auf, gefolgt von der Sekretärin hasteten zwei Sanitäter mit einer Bahre und meine Mutter auf mich zu. An ihrem bleichen, angstvollen Gesicht konnte ich ablesen, dass sie versuchte, die Situation so schnell wie möglich zu erfassen. Ich auf dem Tisch, zwei Lehrer und Henny um mich herum, Hand und Finger noch dran.
»Wie fühlst du dich?« Meine Mutter war zuerst bei mir, beugte sich über mich und strich mir über die Wange. Es war merkwürdig, ich hatte die ganze Zeit nicht geweint, sogar als Matteo mir gesagt hatte, dass er nicht mehr mit mir zusammen sein wollte, hatte ich die Kurve noch gekriegt, doch wenn Kinder in kritischen Momenten ihre Mutter sehen, auch wenn sie schon fünfzehn sind, legt sich automatisch ein Schalter um, und sie weinen. Jedenfalls bei mir.
»Mama«, sagte ich mühsam gepresst und merkte sofort, dass die Tränen mit einer Wucht herausdrängten, dass ich gar nicht erst den Versuch machte, sie daran zu hindern.
Herr Zorn, Frau Miedlich und Henny traten zurück, und meine Mutter zog mich sanft und wunderbar fest in ihre Arme. Die Sanitäter sahen wohl, dass die Lage nicht lebensgefährlich war, und warteten kurz. Ich schämte mich ein bisschen, nicht so sehr wegen des Weinens, sondern eher, weil meine Wimperntusche ihre helle Jacke vollschmierte. Doch meine Mutter beachtete das gar nicht. »Hast du große Schmerzen?«
»Nein«, schniefte ich. »Irgendwie nicht.«
»Wir gucken mal, ja?«, sagte einer der Männer, der an meine Seite getreten war. Vorsichtig wickelte er den provisorischen Verband ab. An den Gesichtern der Umstehenden konnte ich sehen, dass es nicht gut aussah. Ich drehte den Kopf weg.
»Da muss ein Profi ran«, nickte der Sanitäter, schlang die Bandage wieder um meine Hand und wandte sich an meine Mutter. »Wir bringen sie zur Handchirurgie in die Münzstraße, da ist Ihre Tochter besser aufgehoben als im Krankenhaus. Das sind Spezialisten, die kriegen das wieder hin.« Er lächelte mir aufmunternd zu. »Das wird schon, mach dir keine Sorgen.« Ich wusste gar nicht, ob ich mir Sorgen machte, ich war viel zu durcheinander, um mir Sorgen zu machen.
»In Ordnung.« Meine Mutter nahm ihre Tasche vom Stuhl.
»Clemens, ruf bei Doktor Hunte an«, sagte der Sanitäter zu seinem Begleiter. »Die sollen sich bereitmachen, wir sind in fünf Minuten da.«
»Alles klar«, sagte der andere und verschwand auf dem Flur. Während er telefonierte, hob mich der erste Sanitäter vom Tisch, als würde ich nichts wiegen, und legte mich auf die Bahre.
»Ich kann laufen«, sagte ich und versuchte mich aufzurichten.
»Schön liegenbleiben«, antwortete er. »Sonst klappst du noch zusammen.« Meine Mutter nickte, und der andere Sanitäter kam wieder herein. »Kann losgehen«, sagte er, und ich dachte, wie angenehm es war, wenn in so einer Situation nicht viele Worte gemacht wurden. Henny stand wie ein Häufchen Elend neben mir.
»Ich komme mit raus.«
»Ja«, lächelte ich mühsam.
»Alles Gute!«, sagte Frau Miedlich, als die beiden Männer die Bahre anhoben und mich hinaustrugen. »Und rufen Sie uns nachher an, Frau Morgenstern?«
»Natürlich«, sagte meine Mutter. »Danke!«
Es war ein ätzendes Gefühl, durch die halbe Schule getragen und von allen Seiten angestarrt zu werden. Sämtliche Schüler hatten sich auf den Gängen versammelt, um nichts von der Sensation zu verpassen. Sie tuschelten, grinsten und zeigten mit dem Finger auf mich. Natürlich hatten alle den Rettungswagen gesehen und gehört, der noch immer mit blinkendem Signalhorn dastand. Am liebsten wäre ich aufgestanden und allein gelaufen, ich hätte das locker geschafft.
Auf dem Schulhof stand Hakan mit seinen Freunden, und ich schloss sofort die Augen, weil ein Spruch von ihm das Letzte war, was ich jetzt vertragen konnte. Ich wollte weder etwas von ihm hören, noch an Cengiz denken. Doch es kam nichts. Trotzdem machte ich die Augen erst wieder auf, als die Tür des Rettungswagens geöffnet und ich hineingeschoben wurde. Henny blieb draußen stehen, zwirbelte hektisch an ihrer Muschelhaarsträhne und wischte mit der anderen Hand unter ihrem Auge entlang. »Ruf an, wenn du kannst, okay?«
»Das macht sie«, hörte ich meine Mutter antworten, die auch draußen stand. »Eve«, rief sie in den Wagen. »Ich fahre hinter euch her, ja? Bis gleich!«
Der erste Sanitäter sprach kurz mit ihr und schloss dann die Wagentür. Der andere ließ die Bahre einrasten. Zum ersten Mal mit Tatütata ins Krankenhaus. Nie hätte ich gedacht, dass mir dieser Kindheitswunsch mal erfüllt wird. Als kleines Mädchen waren mir natürlich weder die Gründe noch die Folgen dieses Transportes klar, ich fand es einfach cool, dass es einen Höllenkrach machte und die anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Jetzt hätte ich alles darum gegeben, bei meiner Mutter im Auto sitzen zu dürfen, statt in diesem nach Medikamenten und Desinfektionsmitteln riechenden Gefährt zu liegen und von einem fremden Mann bewacht zu werden. Mit dem Motor sprang auch die Sirene wieder an, und der Wagen fuhr los. Nachdem er die enge Straße vor unserer Schule passiert hatte, drückte der Fahrer richtig auf die Tube und raste die Weinmeister runter. Zum Glück war die Münzstraße so nah, dass es keine zwei Minuten dauerte, gleich hatte ich es geschafft. Und dann ging es wirklich schnell. Die Sirene verstummte, die Tür öffnete sich, und ich durfte mich ganz vorsichtig aufrichten. Ein paar Passanten sahen neugierig zu uns rüber. Meine Mutter musste im gleichen Tempo hinterhergebraust sein, denn sie war ebenfalls schon da. Weil die Bahre nicht in den Fahrstuhl passte, stützten mich beide Sanitäter, bis wir vier in der Praxis waren. Erst noch ziemlich wackelig, wurde ich mit jedem Schritt sicherer. Und wenn mich der fette Verband nicht ständig daran erinnert hätte, dass sich darunter eine Baustelle verbarg, hätte ich gesagt, dass für mich das Schlimmste an diesem Tag Matteo gewesen war.
Das Glück
Wir wurden sofort in den Operationsraum geführt, ich legte mich auf eine Liege mit angehobenem Kopfteil, und die Sanitäter verabschiedeten sich, indem sie mir gute Besserung wünschten. Hier wurde mir erst richtig mulmig, mit dem ganzen Operationsbesteck neben mir auf dem Tisch, von dem ich genau wusste, dass es für mich zurechtgelegt worden war. Spritzen, Schere, Pinzetten, Nadeln, Fäden, Wattetupfer und ein Teil, das wie eine Mischung aus einer Klammer und einer Zange aussah, Hilfe!
Die Sprechstundenhilfe, die bereits auf uns gewartet hatte, brach den oberen Teil einer Glasampulle ab und träufelte mir Scheiß-Egal-Tropfen auf die Zunge. Sie nannte die wirklich so. Doktor Hunte kam herein; er war ein netter älterer Arzt, begrüßte meine Mutter und mich und öffnete den Verband. Jetzt sah ich den Schnitt zum ersten Mal. Er verlief V-förmig über das Mittelgelenk des linken Zeigefingers und sah eigentlich recht harmlos aus.
Als der Arzt sagte: »Na, dann wollen wir uns deine Schnitzarbeit mal genauer ansehen«, begann es weh zu tun.
Das war jedoch nichts gegen die zwei Spritzen, die er dann vor und hinter den Finger in die Hand setzte. Er hatte mir zuvor eine Art Knebel in den Mund gesteckt und gesagt: »So, jetzt mal kurz hier draufbeißen, das tut weh.« Schon beim ersten Stich blieb mir die Luft weg, mein Herz knallte gegen meine Rippen, und ich dachte, gleich springe ich unter die Decke oder trete den netten Doktor irgendwohin. Ich hatte das Gefühl, dass die Nadel auf der anderen Seite wieder rauskam, einmal komplett durch, solche Schmerzen waren das. Meine aufgerissenen Augen spiegelten sich im Gesicht meiner Mutter, Tränen liefen ihr übers kalkweiße Gesicht, sie zitterte genauso wie ich und quetschte meine heile Hand so sehr, dass auch diese weh tat. Nachdem ich das überstanden hatte, war mir wirklich alles scheißegal. Sogar Matteo.
Ich schloss die Augen und sackte in einen leichten Dämmerzustand, der vom Gespräch meiner Mutter mit dem Arzt begleitet wurde. Während er meinen Finger wieder zusammenflickte, erklärte er ihr, was geschehen war. Ich hatte ganze Arbeit geleistet und nicht nur die Sehne, sondern auch gleich noch den Nerv durchgeschnitten und dabei Glück im Unglück gehabt. Höchstwahrscheinlich würde ich zwar eine anständige Narbe, aber keinen steifen, tauben Zeigefinger zurückbehalten. Das bekam ich trotz meiner Dösigkeit noch mit.
»So, Miss Morgenstern«, schmunzelte der Arzt, als er den letzten Faden verknotete. »Jetzt erkennen dich deine Eltern immer wieder, falls du mal verlorengehst!«
Mein Vater würde mich auch mit zehn solcher Narben nicht erkennen, dachte ich. Das sagte ich natürlich nicht, guckte nur streng zu meiner Mutter rüber, die mich ignorierte und sehr interessiert daran schien, wie der Arzt einen neuen Verband anlegte.
»Danke Ihnen«, lächelte sie und gab ihm die Hand. »Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe!«
»Keine Ursache«, sagte er. »Macht mir immer noch Spaß.«
»Spaß?«, fragte meine Mutter erstaunt.
»Ja, sicher!« Er zwinkerte mir zu. »Gerade diese kniffligen Fälle, die dann doch noch gut ausgehen, finde ich am besten!«
Er klopfte mir auf die Schulter. »Gute Besserung, Mädchen! Und schnitz nächstes Mal lieber am Holz rum, ja? Das hält mehr aus.«
»Okay«, grinste ich und stellte fest, dass sich ein bisschen Stolz in die ganze Sache mischte. Auch wenn es nicht schön war und verdammt weh tat, war es schon irgendwie was Besonderes. Vielleicht gerade, weil es gefährlich und knapp gewesen war. Blutig, gruselig und extrem aufsehenerregend.
Die Fingerspitze fühlte sich immer noch taub an, doch der Arzt hatte gesagt, dass sich das wieder normalisieren würde. Ins Krankenhaus brauchte ich natürlich nicht mehr, obwohl ich langsam gehen musste, am Arm meiner Mutter, um den Kreislauf nicht zu sehr zu belasten.
Als wir zum Auto kamen, löste meine Mutter seufzend das Ticket von der Windschutzscheibe; sie hatte in der Eile im Halteverbot geparkt und einen Notfall-Zettel aufs Armaturenbrett gelegt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum der Wagen nicht abgeschleppt worden war. Glück gehabt! Sie nahm ein Paket vom Beifahrersitz und legte es auf die Rückbank.
»Was ist das?«
»Ein Lichtwecker«, sagte meine Mutter. »Ich will mich mal sanfter wecken lassen, dieses Geschrille macht mich verrückt, wenn ich im Tiefschlaf bin. Hier kann ich sogar einen Vogelgezwitscherton einstellen.«
Ich wusste, was sie meinte. Wenn ich den Wecker in meinem Handy stellte, fuhr ich auch jedesmal erschrocken hoch, obwohl ich es auf der leisesten Stufe hatte.
Der Mittagsstau, die vielen Baustellen und der weite Weg nach Lichterfelde, wo wir seit einem halben Jahr wohnten, walzte die Rückfahrt zu einer Ewigkeit aus. Mit der S-Bahn oder dem Zug ging es viel schneller. Während wir meterweise nach Hause rollten, folgte ich jedem Dunkelhaarigen aus dem Autofenster. Ich erzählte jedem Einzelnen, was geschehen war, weil ich es so gern Matteo erzählen wollte. Er nahm mich in den Arm, küsste mich, tröstete mich, lächelte. Matteo.
Für einen Moment überlegte ich, ihn einfach anzurufen und es ihm wirklich zu erzählen, so, als wäre nichts gewesen. Die Trennung einfach zu übergehen, schon allein deshalb, weil es ja nicht meine Trennung war, sondern seine.
Ich sei zu anhänglich, hatte er gesagt, ich hätte ihn zu sehr eingeengt, zu sehr geklammert und so. Was mich daran am meisten ankotzte, war, dass er recht hatte. Ich wusste das selber, ich konnte es bloß nicht ändern. Jedes Mal, wenn er zurückwich und mal etwas allein unternahm oder auch nur zu Hause war, musste ich mich bei ihm melden. Klar, dass ich ihm damit auf die Nerven ging. Meine Mutter sah mich an, und ich hatte das Gefühl, sie wüsste, woran ich dachte. War natürlich Quatsch.
»Na, Schnecke«, sagte sie. »Tut’s weh?«
Tatsächlich ließ die Betäubung langsam nach, und mein Finger begann unangenehm zu pochen.
»Geht so«, sagte ich. »Ein wenig schon.«
»Wie ist das eigentlich passiert?«
»Ich hatte keinen Bock auf Werken«, sagte ich. »Und dann hat das alles auch noch so lange gedauert. Da habe ich’s eben beschleunigt.«
»Aber doch nicht mit so einem scharfen Ding!« Meine Mutter schüttelte sich. »Mensch, Eve!«
»Ich hab nur eine Sekunde nicht aufgepasst. Kann doch passieren.«
Sie sagte nichts mehr. Eine Stunde später parkten wir am Jenbacher Weg, meine Mutter hängte meine Tasche über ihre eigene und schloss das Gartentor auf. Auch nach fast sechs Monaten wunderte ich mich noch, dass ich ihr tatsächlich in die Pampa gefolgt war. Trotz des Laptops und des neuen Handys, womit sie mich eiskalt geködert hatte. Jahre hatte das gedauert, und ich war nur schwach geworden, weil Henny und einige andere seit dem Urknall ein iPhone hatten und ich auf dem Steinzeithandy meiner Mutter ohne Internet und alles regelmäßig die Motten kriegte.
Aber es nützte nichts, das Gefühl gekauft und betrogen worden zu sein, hielt sich hartnäckig. Schon allein deshalb, weil ich jeden Tag zweimal an den Hackeschen Höfen vorbeimusste. Einmal auf dem Weg zur Schule und einmal auf dem Weg nach Hause. Da hatten wir gewohnt. Ja, genau in den Hackeschen Höfen! Hof IV, der mit dem Brunnen und dem schiefen Baum in der Mitte, linkes Haus, erster Stock mit Balkon. Zwei Minuten Fußweg von meiner Schule entfernt und maximal fünfzehn von meinen Freundinnen. Henny war diejenige, die am weitesten weg wohnte. Zu Clara und Marlene konnte ich auch zu Fuß gehen.
Ein Grund für den Umzug war, dass die Zeitung, bei der meine Mutter arbeitete, innerhalb kurzer Zeit einige wichtige Werbekunden verloren und ihre Stelle gekürzt hatte. Ihr Gehalt natürlich auch, und weil die Wohnung einen Haufen Geld kostete und wir sie ursprünglich nur als schicke Zwischenlösung gemietet hatten, bis sich was Günstigeres fand, war das Ende meines Traumzimmers sowieso absehbar gewesen. Fast drei Jahre hatte ich es dann doch gehabt, denn meine Mutter redete zwar ständig von einer neuen Wohnung, suchte aber nicht. Ich denke, sie fand es auch einfach sehr cool, da zu wohnen, wo täglich Tausende Touristen durchschlenderten, und irgendwie bekam sie es hin, auch wenn wir uns in den drei Jahren nur einen Kurzurlaub an die Ostsee leisten konnten.
Der andere Grund war die ausgeprägte Landliebe meiner Mutter, die ihr leider erst bewusst wurde, als ich es mir in Mitte schon so richtig gemütlich gemacht hatte.
Vielleicht wäre ich gar nicht so sehr gegen das Umziehen gewesen, wenn sie nicht immer mit ihren Kühen und Pferden angekommen wäre. Sie wollte Felder, Wiesen und Rinder, Vogeltirili und so. Ich nicht. Ich wollte Mitte oder Prenzlauer Berg, schon weil Matteo da wohnte, aber das wollte meine Mutter wegen der vielen Spießer nicht. Mir war da noch nie einer begegnet, und ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, was sie meinte. Egal, Prenzlberg schied leider genauso aus wie Mitte.
Aber hier war nach dreißig Metern Schluss mit Berlin. Wirklich! Da, wo die Mauer mal gestanden hatte, also direkt hinterm Mauerweg, ging Brandenburg los. Und keine hundert Meter weiter standen die Galloways. Zottelfellige braune Kühe, die Gras rupfend über die Wiese pflügten oder zwischen ihren überlangen Ponyfrisuren hervorlugten, während sich ihr Kiefer ständig auf und ab bewegte. Manchmal hoben sie auch nur den pinseligen Schwanz und flatschten was ins Grüne.
Na ja, zumindest musste ich nicht auch noch die Schule wechseln, das Schulgeld übernahmen nämlich meine Großeltern, sonst wäre ich komplett durchgedreht. Und die Fahrzeit hätte ich auch auf mich genommen, wenn ich die doppelte Strecke hätte fahren müssen. Selbst die dreifache. Einen Vorteil hatte die Sache allerdings doch. Während ich morgens aus der Lichterfelder Todeszone in mein richtiges Leben fuhr, konnte ich Hausaufgaben machen. Wenn ich fertig war und aufschaute, waren plötzlich andere Menschen um mich herum, jüngere, lautere und buntere. Und spätestens wenn die S-Bahn-Musikanten zustiegen und uns mit Ziehharmonika, Gitarre oder einem Ghettoblaster und Gesang unterhielten, war ich wieder in meinem Berlin. Krassere Gegensätze gab es sicher in keiner anderen Stadt. Hier Gartenzwerge im Vorgarten, da Cro im Café, hier Geranien in Plastiktöpfen, da Filmteams in Action, hier wachsame Nachbarn, die niemals zwischen eins und drei Rasen mähten, da südamerikanische Straßenkünstler, die um diese Tageszeit zum ersten Mal die Augen aufmachten. Das Einzige, was die Stadtteile gemeinsam hatten, waren die Hundehaufen.
»Willst du morgen eigentlich in die Schule?« Umständlich hantierte meine Mutter am Briefkasten, weil die Tageszeitung im Schlitz festklemmte und ihr zig Umschläge entgegenkamen.
»Ich glaube schon«, sagte ich. »Schreiben kann ich ja.«
Sie stellte meine Tasche in den Flur. »Ich fahre noch schnell einkaufen. Hast du einen besonderen Wunsch, zur Feier des Tages?«
»Chips«, grinste ich. »Aber extrascharf bitte!«














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














