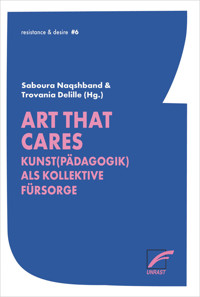
Art that Cares E-Book
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Zeiten globaler Krisen und zunehmender Spaltungen sind wir gefragt, Sehgewohnheiten und Blicke zu überprüfen und diese, wenn nötig, zu ›verlernen‹. Koloniale Rückstände in Bildung, Politik, Kultur und Gesellschaft lassen sich auch mit einer neuen Sicht auf Theorie, Praxis und Vermittlung von Kunst aufarbeiten. Die Kunst ermöglicht es, in eine authentische Kommunikation miteinander zu treten, uns selbst zu begegnen, (weiter) zu bilden und uns darüber hinaus unserer Umwelt mitzuteilen. Ästhetische Bildungsprozesse bergen das Potenzial innezuhalten, starre Positionen in Bewegung zu bringen, neue Denkräume zu öffnen und Neues wachsen zu lassen. Aufbauend auf diesem Verständnis von Kunst und Kunstvermittlung untersucht der sechste Band der Reihe ›resistance & desire‹ ästhetische Zugänge im Bildungskontext, den die Autor*innen als ein Netz der Fürsorge für sich Selbst und für Andere begreifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Band 6 der Reihe ›resistance & desire‹,
herausgegeben vom bildungsLab*
Das bildungsLab* setzt sich zusammen aus migrantischen Akademikerinnen* und Akademikerinnen* of Color, die im pädagogisch-kulturellen Raum tätig sind. Sie vermitteln und produzieren Theorie, diskutieren pädagogische und künstlerische Vorstellungen, Konzepte und Paradigmen. Sie kommentieren, intervenieren und publizieren im Feld der rassismus- und hegemoniekritischen Bildung und Vermittlung.
Saboura Naqshband & Trovania Delille (Hg.)
Art that Cares.
Kunst(pädagogik) als kollektive Fürsorge
resistance & desire #6
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Saboura Naqshband, Trovania Delille (Hg.):
Art that Cares
1. Auflage, Januar 2025
eBook UNRAST Verlag, Juni 2025
ISBN 978-3-95405-216-5
© UNRAST Verlag, Münster 2025
Fuggerstraße 13 a, 48165 Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, der Übersetzung sowie der Nutzung des Werkes für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Tasnim Baghdadi, Zürich
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
Vorwort
Andréa Hygino, Victoria Tarak & Fallon Tiffany CabralI. Mixing eggs with Mango and Chili
Andréa HyginoJogo/Roda 1Spicy Words
Andréa HyginoJogo/Roda 1Spicy Words (Deutsch)
Victoria TarakThe two bellies (ß) of the spicy s as notions my Double Consciousness / Die zwei Bäuche (ß) des scharfen S als Ausdruck meines doppelten Bewusstseins
Fallon Tiffany CabralThe Spicy S – Scharf wie die frischen grünen Chilis im Essen meiner Mutter
Konversation über das Verhältnis von Kunst und Care mit Fallon Tiffany Cabral, Andréa Hygino & Victoria TarakJogo/Roda 2
Victoria TarakJogo/Roda 3To dig a w(hole) is messy
Fallon Tiffany CabralMango Season –
Jamila Al-YousefII. »Was können wir teilen? Wie können wir heilen?«
Leila HaghighatIII. Fürsorge
Saboura NaqshbandIV. Kinder sabotieren Grenzen
Anmerkungen
Vorwort
In diesem sechsten Band von resistance & desire des bildungsLab*, einem Kollektiv migrantischer Akademiker*innen und Akademiker*innen of Color, die im pädagogisch-kulturellen Raum tätig sind – widmen sich die Autor*innen der Verbindung von postkolonialer Bildung, Care-Feminismus und kunstpädagogischen Praktiken. Wie hängen all diese zusammen? Warum ist die Care-Perspektive wichtig für postkoloniale Kunst und ästhetische Bildung? Wie kann ein ›sorgender Blick‹ erlernt werden durch die Kunst, wie kann dadurch eine sozial gerechtere Gesellschaft imaginiert werden? Welche Rolle spielen diese Imaginationsräume in einem Europa, das sich hartnäckig weigert sich mit dem kolonialen Erbe und dessen postkolonialen Folgen für die sich so diverse postmigrantische Gesellschaft überhaupt auseinanderzusetzen, diese überhaupt anzuerkennen?
Die Frage, was Kunst ist und sein kann, ist keine neue. Die Art und Weise, wie Kunst hergestellt, praktiziert und produziert wird, ist gleichsam eine Frage nach dem Politischen und Sozialen. Denn was als Kunst definiert und wie sie vermittelt wird, spiegelt wider, wie es um das berühmte ›Wir‹ in unserer Gesellschaft bestellt ist. Wie es in Zeiten globaler Krisen und zunehmender Spaltungen weiterhin bestehen und mit Bedeutung gefüllt werden kann. In einer gleichzeitig global und digital zusammenwachsenden, aber auch ökonomisch-politisch auseinander klaffenden Welt, sind wir gefragt Sehgewohnheiten und Blicke zu überprüfen, und diese gegebenenfalls zu »Verlernen«, wie die postkoloniale Denkerin Gayatri Spivak (2012) es formuliert. Eine neue Imagination der Theorie, Praxis und Vermittlung von Kunst hilft uns dabei, koloniale Rückstände in der Bildung, in Politik, Kultur und Gesellschaft aufzuarbeiten. Für ein authentisches ›Wir‹ braucht es dieses Hinsehen, Spüren und Zulassen ›anderer‹ bzw. ›verdeckter‹ Erzählungen, Narrative und Emotionen. Die Kunst hilft uns dabei, in eine solche authentische Kommunikation miteinander zu treten, uns selbst zu begegnen, (weiter) zu bilden und uns darüber hinaus unserer Umwelt mitzuteilen. Ästhetische Bildungsprozesse bergen also das Potential zu pausieren, starre Positionen in Bewegung zu bringen, neue Denkräume zu öffnen und Neues wachsen zu lassen.
Aufbauend auf diesem Verständnis von Kunst und Kunstvermittlung untersuchen die Autor*innen dieses Bandes, ästhetische Zugänge im Bildungskontext als ein Netz der Fürsorge für sich Selbst und für Andere. Denn durch das Erschaffen neuer Worte und Blicke, sowie einander zugewandten künstlerischen Praktiken können wir Welten ermöglichen, in denen alle ihren – auch sehr eigenen – Platz finden.
I. Mixing eggs with Mango and Chili[1]
Andréa Hygino, Victoria Tarak & Fallon Tiffany Cabral
Auf Einladung von Fallon beschreibt die folgende mehrteilige Collage eine vielstimmige Wissensproduktion zwischen Andréa, Fallon und mir sowie den in uns nachhallenden Stimmen unserer Familien, Wahlverwandten, Freund*innen, Kolleg*innen und tías, die uns in diesem Leben begleiten und unser Denken prägen. Entlehnt aus der Bewegungskultur des Capoeira bildet unser Beitrag drei Runden einer in den Raum des Textes übersetzten »Roda de Capoeira«. Die roda beschreibt, eine Kreisformation in der das kollektive Geschehen der Capoeira praktiziert wird. In ihrem Text »Pretagogias[2]. Der Stuhl, der Aufstand, die Ginga[3]« denkt Andréa über die Anordnungen des lernenden Körpers nach und wie die Kreisformation, einen, in den Lernprozess einbindenden Ausgangspunkt bilden kann, um jenseits westlicher Konzepte eine Schwarze Pädagogik zu formulieren. Wiederkehrender Moment in der künstlerischen Arbeit Andréas ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Schule und damit in Verbindung stehenden Erfahrungen strukturellen Rassismus und Klassismus. Aus einer afrobrasilianischen und contrakolonialen Position heraus betrachtet sie die mikropolitischen Gesten, die den weiterhin von kolonialen Bedingungen besetzten Raum der Bildung prägen. Die Begegnung zwischen Fallon, Andréa und mir bündelt sich in ihrer Ausstellung Klassenzimmer (Sala de Classe) im Kunstverein Bielefeld, die von Katharina Klang und mir kuratiert wurde, und einen Begegnungsraum formulieren möchte, um über gegenwärtige Verantwortlichkeiten kolonialer Spuren und Kontinuitäten nachzudenken. In diesem Zuge trafen wir auf die Arbeit von Fallon und ihr mutiges und behutsames Einfangen von dem was zwischen den Zeilen informeller (familien)räume liegt und welche politische Kraft von der Auseinandersetzung mit Essen aus einer rassismuskritischen und diasporischen Perspektive ausgeht. Letzteres verband sich in unseren Gesprächen mit dem Denken über die widerständige Dimension des Kauens, Verdauens und Essens in Andréas künstlerischer Arbeit und zuletzt meiner kuratorischen Praxis, die das Spinnen von Netzen beschäftigt, um Situationen zu schaffen in denen wir voneinander lernen können. In drei Runden befassen sich unsere Spiele der Roda de Capoeira mit linguistisch-widerständigen Fabulationen zum Spicy S, einer Konversation über das Verhältnis von Kunst und Care sowie Gedichten über Löcher aus denen heraus wir sprechen.
Jogo/Roda 1[4]Spicy Words[5]
Andréa Hygino
Esse ensaio começa no primeiro encontro entre Victoria, Fallon e eu, durante um almoço em Berlim. Almoço que se estendeu até o café da tarde, e daí para o chat do Signal, para as chamadas do google meet, e agora para as páginas desta publicação. Como aquela primeira conversa ao redor da mesa, desejamos manter aqui algo do fluxo de ideias, do movimento circular, ou mesmo espiral do nosso encontro. Na ocasião, partilhávamos os interesses comuns entre meu primeiro projeto de exposição na Alemanha, curado pela Victoria e a relação com os estudos sobre comida e decolonialidade de Fallon. Havia entre nós três um interesse comum: a boca.
Fallon nos contava sobre seu ensaio »You become, what you eat« no livro Biting Back, que Victoria já havia lido previamente, mas que eu não pude fazê-lo por conta da barreira linguística, já que não falo/leio em alemão. Ouvia a narrativa pela boca da própria escritora, com sua entonação, hesitações e afetos. Ela dizia de sua infância e das pimentas frescas que sua mãe, Clemy, insistia em colocar na comida misturadas ao molho de tomate, mesmo com os pedidos de Fallon para que não o fizesse. Analisando retrospectivamente, Fallon comparava o próprio comportamento na infância/adolescência ao de uma mini-colonizadora, querendo evitar tudo que não fosse comida alemã ou europeia em sua casa, enquanto reconhecia na insistência de sua mãe em utilizar as tais pimentas, algo da sutil e poderosa desobediência de quem se recusa a apagar o gosto da herança culinária indiana e, de dentro da cozinha, entre panelas e receitas de comida europeia, infiltra o sabor ardente de seu tempero favorito, indispensável para uma boa comida.
Depois de ler tantas autoras feministas e contracoloniais na universidade, Fallon reconheceu o sabor dessas teorias na vida familiar, na comida de sua mãe. Mais que isso, era literalmente alimentada pela prática desobediente da culinária com sotaque indiano em sua casa. Enquanto ouvia as histórias que me contava, fui eu também surpreendida pelo ardor da comida apimentada que escolhi no cardápio do restaurante. De início tentei disfarçar minha pouca tolerância com a pimenta. No meio daquela conversa toda, me parecia um tanto inapropriado dizer à Fallon e Victoria que não estava aguentando o molho picante espalhado sobre o arroz e os ovos. Mas não teve outro jeito, depois das primeiras garfadas, disse a elas que não conseguiria comer tudo. As duas, gentilmente, me recomendaram comer a parte sem o molho e foi o que fiz.
Achei toda a situação irônica, mas também muito pertinente. O ardor daquele prato no restaurante me fez entender e, mais ainda, experienciar intimamente a precisão do feito da Sra. Clemy, que transmitia seu saber para a filha alemã de modo não verbal, não pronunciado. Aprendizado digestivo. Saber-sabor: em português essas duas palavras vem da mesma raiz e nessa ocasião entendi melhor a correlação linguística.
Mas pimenta também é desafio ao paladar dos menos tolerantes. Não é algo que se camufla entre outros ingredientes, não passa despercebida no meio do cardápio. Em alguns restaurantes, o menu até mesmo adverte o teor da especiaria nos pratos, pra que não encontre de surpresa um paladar despreparado. Alguns rótulos de molho de pimenta contêm informações sobre a potência do ingrediente.
Lembro que na minha infância era comum os adultos dizerem em tom de ameaça «vou colocar pimenta na sua boca” quando presenciavam uma criança falando um palavrão. Alguns de fato o faziam, mas somente a menção do castigo já era suficiente para corrigir o vocabulário interdito. Um castigo aplicado diretamente à língua – que é órgão da comunicação e da digestão. Punição à fala feita através da degustação. Um mecanismo de controle muito preciso e simples que frequentou o imaginário de tantas crianças no passado, produzindo um sabor à proibição.
Suponho que o fato de ter crescido numa cidade cuja cultura culinária não utiliza a pimenta com tanta frequência produza efeitos adversos a esse alimento, usado como castigo para criança. Mas pimenta só é um incômodo na boca de quem não pode apreciá-la. Prolongando mais um pouco essa lembrança, penso o quanto pode ser desobediente essa língua habituada a comer pimenta; que, como a mãe de Fallon, não abre mão do tal sabor acentuado nos pratos que prepara. Quem entende que pimenta não é desgosto (ou castigo), é tempero. A possibilidade de escapar do castigo, dos interditos, do controle da fala – e do pensamento –, e de fazer sobreviver culturas ancestrais, heranças culinárias diante de tantos apagamentos, é de quem está pronto para saborear e apreciar o sabor vermelho desse alimento, se deleitar nas sensações dos olhos marejados, do ardor no trato digestivo, do suor da pele e do calor da temperatura corporal.
Jogo/Roda 1[6]Spicy Words[7] (Deutsch)
Andréa Hygino
Meine Gedanken zu diesem Beitrag beginnen mit dem ersten Treffen zwischen Victoria, Fallon und mir beim Mittagessen in Berlin. Ein Mittagessen, dass zu einem Nachmittagskaffee wurde, und von dort aus weiter in einen gemeinsamen Chat und Videocall überging und nun auf die Seiten dieser Publikation fließt. Der Tisch, von dem wir aßen, wurde zum Ausgangspunkt einer kreisförmigen oder sogar spiralförmigen Bewegung, einem Ideenfluss unseres Austausches. Wir trafen uns, um über die Verbindung von Essen und Dekolonialität zu sprechen. Dabei teilten wir ein gemeinsames Interesse: den Mund.
Fallon erzählte uns von ihrem Essay You become what you eat. Vom Begehren ›weiß‹ zu werden. Victoria hatte es bereits gelesen und da ich kein Deutsch spreche/lese, kannte ich es noch nicht vollständig. Demnach hörte ich die Erzählung aus dem Mund der Autorin selbst, ihre Intonation, ihr Zögern und ihre Sensibilitäten. Sie erzählte von ihrer Kindheit und den frischen Chilischoten, die ihre Mutter Maria unbedingt in die Tomatensoße (Maggi Fix Bolognese) geben wollte, obwohl Fallon sie darum gebeten hatte, es nicht zu tun. Rückblickend verglich Fallon ihr eigenes Verhalten als Kind und Jugendliche mit dem eines Mini-colonizers, der zu Hause alles vermeiden wollte, was nicht deutsch oder europäisch war. Später erkannte sie in der Zugabe der Chilischote ein Beharren ihrer Mutter, dass von dem subtilen und kraftvollen Ungehorsam einer Person sprach, die sich weigert, den Geschmack ihres indischen kulinarischen Erbes auszulöschen und sich zwischen den Töpfen und Rezepten der europäischen Küche dazu entschloss den feurigen Geschmack ihres Lieblingsgewürzes – laut Clemy, ein Gewürz, das für gutes Essen unverzichtbar ist – in die Mahlzeit ihrer Tochter einzuschleusen.
Nachdem sie an der Universität so viele feministische und contrakoloniale Autor*innen gelesen hatte, erkannte Fallon den Geschmack dieser Theorien in ihrem Familienleben, in der Küche ihrer Mutter. Mehr noch, sie wurde buchstäblich befeuert durch die widerständige Praxis der indisch akzentuierten Küche in ihrem Haus. Während ich ihren Erzählungen lauschte, wurde auch ich von einer Schärfe überrascht, die sich in dem von mir zuvor bestellten Gericht befand. Zunächst versuchte ich, meine geringe Toleranz gegenüber Chili zu verbergen. Bei all dem Sprechen über Schärfe erschien es mir ein wenig passend, Fallon und Victoria zu sagen, dass ich die pikante Soße, die auf dem Reis und den Eiern verteilt war, nicht vertragen würde. Aber mir blieb nichts anderes übrig; nach den ersten paar Bissen sagte ich ihnen, dass ich nicht alles essen könnte. Die beiden schlugen mir vor, den Teil ohne Soße zu essen, und das tat ich dann auch.
Ich empfand die ganze Situation ironisch, aber auch sehr treffend. Das Erleben der Hitze meines Gerichts machte die Brisanz von Mama Marias Handlung, die ihr Wissen auf nonverbale, unausgesprochene Weise an ihre deutsche Tochter weitergab, besonders deutlich. Verdauungslernen. Geschmackswissen: Im Portugiesischen kommen diese beiden Wörter ›saber‹ und ›sabor‹ (portugiesisch für ›wissen‹ und ›Geschmack‹) aus der gleichen Wurzel und bei dieser Gelegenheit habe ich den sprachlichen Zusammenhang besser verstanden.





























