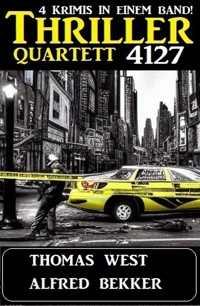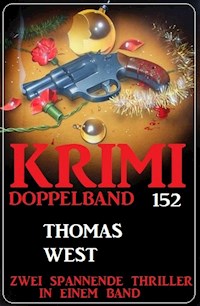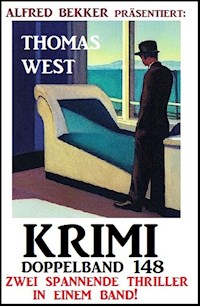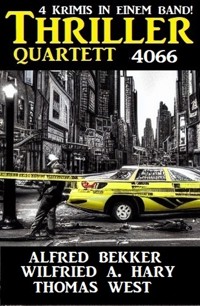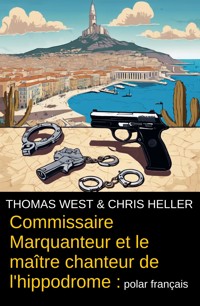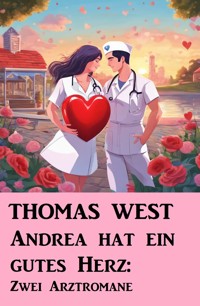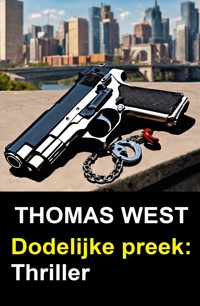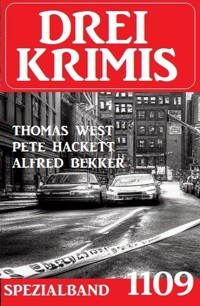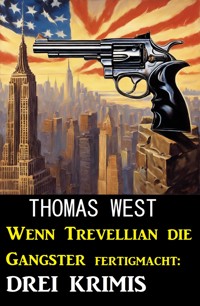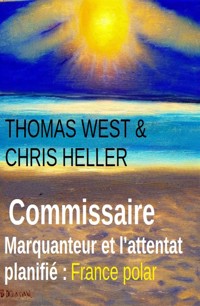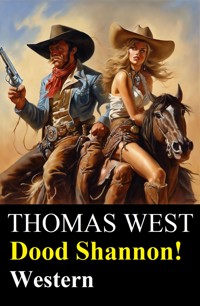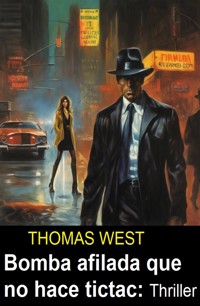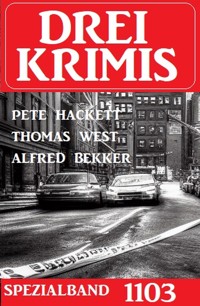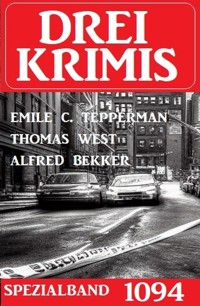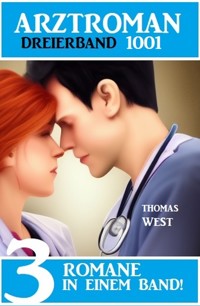
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: Ärztin mit Herz für Gangster (Thomas West) Schicksalhafte Begegnung im Krankenhaus (Thomas West) Kann sie gerettet werden? (Thomas West) Marius Ballhaus wird nach der Untersuchung im Marien-Krankenhaus mitgeteilt, dass er Leukämie hat. Das bringt ihn aus dem Gleichgewicht, und er plant seinen Tod ... Carsten trennt sich von Lara, denn diese ständigen Streitereien, ihre knallharte Kritik, das Gefühl, finanziell von ihr abhängig zu sein – er hält es nicht mehr aus ... Die Witwe Martha Steiner wird von einem Taschendieb überfallen. Er stößt sie grob, so dass sie unglücklich mit dem Kopf auf die Stoßstange eines Autos fällt ... Das Schicksal will es, dass alle drei im Marien-Krankenhaus zusammentreffen, in dem Dr. Alexandra Heinze arbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arztroman Dreierband 1001
Inhaltsverzeichnis
Arztroman Dreierband 1001
Copyright
Ärztin mit Herz für Gangster
Schicksalhafte Begegnung im Krankenhaus
Kann sie gerettet werden?
Arztroman Dreierband 1001
Dieser Band enthält folgende Romane:
Ärztin mit Herz für Gangster (Thomas West)
Schicksalhafte Begegnung im Krankenhaus (Thomas West)
Kann sie gerettet werden? (Thomas West)
Marius Ballhaus wird nach der Untersuchung im Marien-Krankenhaus mitgeteilt, dass er Leukämie hat. Das bringt ihn aus dem Gleichgewicht, und er plant seinen Tod ...
Carsten trennt sich von Lara, denn diese ständigen Streitereien, ihre knallharte Kritik, das Gefühl, finanziell von ihr abhängig zu sein – er hält es nicht mehr aus ...
Die Witwe Martha Steiner wird von einem Taschendieb überfallen. Er stößt sie grob, so dass sie unglücklich mit dem Kopf auf die Stoßstange eines Autos fällt ...
Das Schicksal will es, dass alle drei im Marien-Krankenhaus zusammentreffen, in dem Dr. Alexandra Heinze arbeitet.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Ärztin mit Herz für Gangster
Ärztin Alexandra Heinze
Arztroman von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 139 Taschenbuchseiten.
Monika sträubt sich, als ein Kumpel aus der Clique sie und ihren Freund zu einem Einbruch überreden will, und doch lassen sich die beiden breitschlagen. Aber das geht schief, und auf der Flucht werden die jungen Männer, im Rhein schwimmend, von einer Yacht angefahren. Noch hat die Polizei keine genauen Anhaltspunkte, doch das scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© Roman by Author
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Das Panorama einer Kleinstadt zog vorbei. Die Fachwerkfassaden der Häuser, die Anlegestellen der Linienschiffe, die Kirchtürme, die aus dem Altstadtkern ragten, und dahinter die bewaldeten Hügel unter dem blauen Maihimmel boten ein ideales Ansichtskartenmotiv.
Der Mann hielt das Steuer seiner kleinen Motoryacht fest und genoss den Anblick. Seit Tagen war er auf dem Rhein unterwegs. Trotz der Einsamkeit und der vielen Eindrücke, die an ihm vorübergezogen waren, kam es ihm wie gestern vor, dass er in Basel zu seiner Reise in die Nordsee aufgebrochen war.
Er lächelte zufrieden. „Etwas Besseres hättest du dir nicht antun können, Johannes“, sagte er zu sich selbst, „du musst unter einem guten Stern geboren worden sein.“ Er begann, einen alten BAB-Song zu pfeifen. Die letzten beiden Semesters seines Jurastudiums hatte er nur überstanden, weil er ständig mit der Planung dieser Bootsreise beschäftigt gewesen war.
Johannes war mittelgroß und hager. Sein dunkles Haar trug er halblang und korrekt frisiert. Seine gesamte Erscheinung hatte etwas Gepflegtes, ja Elegantes. Das sehr entspannt wirkende, schmale Gesicht war von einer tiefen Bräune überzogen. Selbst der oberflächlichste Betrachter würde beim Anblick dieses Gesichtes sofort an ein Sonnenstudio denken. Der Mann war Anfang dreißig und ganz in helles Leinen gekleidet. Johannes pflegte seine Freizeitgarderobe in einem speziellen Bioladen zu kaufen.
Der Rhein machte eine von den in dieser Region so zahlreichen Biegungen, und die Stadt verschwand hinter einem felsigen Hang. Der Motor der Yacht brummte leise. Johannes steuerte sie an den äußersten rechten Rand der Fahrrinne, weil sich der Bug eines Frachtschiffes um den Hügel schob.
Er schaute auf seine Rolex: 19.30 Uhr. Bonn würde er wohl nicht mehr vor Anbruch der Dunkelheit erreichen. Nun gut – niemand trieb ihn zur Eile, er selbst am allerwenigsten. Dann würde er eben schon in der nächsten größeren Stadt anlegen.
Er hatte seinem Vater versprochen, in Bonn einen von Bellinger aufzusuchen, einen Großcousin seines Vaters. Einer der wenigen noch lebenden Mitglieder des alten Hegauer Adelsgeschlechtes, das es bis in das Rheinland verschlagen hatte. Die meisten lebten irgendwo um den Bodensee herum. Oder, wie Johannes und sein Vater, in der Baseler Gegend.
Johannes musste grinsen, wenn er an seinen Vater dachte. Der alte von Bellinger hatte getobt wie ein HB-Männchen, als er vor drei Monaten von den Reiseplänen seines Sohnes erfahren hatte. Solange hatte Johannes sie geheim halten können. Wolf von Bellinger, sein alter Herr, hatte fest damit gerechnet, dass sein Sohn sofort nach dem Studium – das ihm sowieso schon viel zu lange gedauert hatte – in die Firmenleitung einsteigen würde. Die Baseler von Bellingers besaßen eine renommierte Immobilienfirma. Und eine außergewöhnlich profitable dazu.
Sogar von Enterbung hatte der Alte gesprochen. Aber da war er an den Richtigen geraten. Johannes war mindestens so hartnäckig wie sein Vater. Was er sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, zog er auch durch.
Das Frachtschiff war passiert, und von links schob sich eine gewaltige, gut erhaltene Festung in sein Blickfeld. Und rechts sah Johannes ein großes, verwittertes Denkmal, und dahinter die Dächer einer Stadt. Ja, hier würde er übernachten.
Langsam ließ er sein Schiff an der Uferpromenade der Stadt entlangtreiben. Parkanlagen zogen vorbei, mittelalterlich anmutende Fassaden wechselten mit der modernen Architektur großer Hotels ab, auch ein barockes Schloss tauchte auf, und er fuhr unter einer Brücke durch, über die seines Wissens die Bundesstraße führte.
Johannes war vor einigen Jahren schon einmal hier gewesen. Damals hatte ihn eine seiner Jugendlieben begleitet, eine von zahlreichen verflossenen. Er war froh, heute alleine unterwegs zu sein. Er hatte sich schon seit gut einem Jahr auf keine feste Beziehung mehr eingelassen. Und das sollte auch in den nächsten Jahren so bleiben.
Er erinnerte sich, dass er damals einen köstlichen Moselwein in einer der vielen Weinstuben der Altstadt getrunken hatte. Der Gedanke, sich in etwa zwei Stunden auf die Suche nach diesem Lokal begeben zu können, machte ihm Spaß. Und danach – nun, sicher würde es hier auch eine noble Diskothek geben, oder ein paar schöne Bars, wo man einige Menschen kennenlernen konnte. Weibliche Menschen in erster Linie, Johannes hatte da recht konkrete Vorstellungen.
Aber zunächst einmal musste er zum Yachthafen. Die Beschreibung, die ihm ein Kölner Studienkollege zugefaxt hatte, war zuverlässig, und eine halbe Stunde später konnte er anlegen. Er zog sich um, schloss das Schiff ab und vertäute es noch einmal gründlich. Dann stand Johannes von Bellinger auf dem hölzernen Landungssteg und schaute unternehmungslustig zu einem Hafenrestaurant, vor dem zwei Taxen standen.
„Dann mal los, Johannes“, sagte er laut zu sich selbst, „bin gespannt, was du alles erleben wirst.“ Wenn er auch nur einen Bruchteil davon geahnt hätte, wäre er sofort wieder in seine Yacht gestiegen und hätte zweimal hinter sich abgeschlossen.
2
„Guckt euch das an, Kinder“, Dr. Kübler sah triumphierend in die Runde um den OP-Tisch, „wie eine rote Paprikaschote glüht der Appendix hier im Fettgewebe!“
Betty zog die Darmschlingen noch ein Stück zurück und stellte sich auf die Zehenspitzen, um den entzündeten Blinddarm sehen zu können. „Noch einen Tag länger, und das Ding wäre geplatzt“, brummte Heinrich Kollmann beeindruckt.
„Einen Tag?“ Dr. Kübler zog die Nase unter seinem Mundschutz hoch. „Höchstens zwei Stunden würd’ ich dem noch geben.“ Der Chirurg beugte sich wieder über die von Haken gespreizte Operationswunde. „Jetzt brauche ich mal eine anatomische Klemme, Schwester Betty.“ Ganz kurz trafen seine funkelnden blauen Augen Bettys Blick.
„Ich reiche doch die Instrumente an!“, protestierte Marlene mit dunkler Stimme.
„Ach ja, richtig“, Kübler sah die Instrumentenschwester nicht einmal an, „also los – die anatomische Klemme.“ Die Bewegung, mit der Marlene dem Arzt die Klemme hinstreckte, war nach Bettys Geschmack eine Nuance zu heftig. Hatten die beiden Krach?
Dass Marlene und Gerd Kübler mehr als nur kollegialen Umgang pflegten, hatte sich inzwischen herumgesprochen. Und sie gaben sich auch keine Mühe, es zu verbergen. Seit über einer Woche sah man sie ständig miteinander herumschäkern. Zum Mittagessen gingen sie seit neuestem auch nur noch gemeinsam. Irgendjemand hatte sie vorgestern Abend zusammen in der Stadt getroffen. Und von Sabrina, ihrer Chefin, wusste Betty, dass sie am Morgen danach in seinem Auto auf den Parkplatz gefahren waren.
Marlene war nicht die Erste, die dem Krankenhaustratsch solche Geschichten lieferte. Geschichten, in denen Gerd Kübler die Hauptrolle spielte. Und sie wäre auch nicht die erste, die stumm den Blick senkte, wenn sie dem Arzt über den Weg lief. Mindestens fünf Frauen im Marien-Krankenhaus sprachen kein Wort mehr mit Gerd Kübler. Die meisten waren Schwestern. Ein beachtlicher Verschleiß, wenn man bedachte, dass der Chirurg erst seit einem halben Jahr hier arbeitete.
„Skalpell“, brummte Kübler, „Pinzette.“ Marlene reichte ihm schweigend die gewünschten Instrumente. Die Pinzette passte dem Chirurgen nicht. „Die doch nicht, verdammt!“, fuhr er Marlene an. „Eine chirurgische, natürlich!“
Betty sah plötzlich, dass die Hand ihrer Kollegin zitterte. Und die Augen hinter ihrer Brille – wurden sie nicht feucht? Der alte Heinrich Kollmann runzelte die Stirn. Wahrscheinlich spürte auch er die dicke Mauer zwischen Marlene und Kübler.
„So, jetzt haben wir den Übeltäter!“ Dr. Kübler hielt den entzündeten Wurmfortsatz mit der Pinzette hoch. Wieder traf sein lachender Blick Betty. Ein warmer Schauer rieselte durch ihren Bauch. Man konnte nicht sagen, dass der Mann eine Schönheit war, wirklich nicht. Nicht klein, aber auch nicht besonders groß, wirkte seine breitschultrige Gestalt fast ein wenig untersetzt. Sein aschblondes kurzes Haar, das jetzt unter der OP-Haube verborgen war, stand zu jeder Tageszeit nach allen Seiten ab. Wenn er morgens zum Dienst kam – oder um es treffender zu sagen: zum Dienst geschlendert kam, machte er regelmäßig den Eindruck eines Mannes, der allenfalls zwei Stunden geschlafen hatte. Sein rechteckiges Gesicht trug sehr ausgeprägte, männliche Züge, und ließ ihn gut und gerne drei bis vier Jahre älter wirken als er war, nämlich sechsunddreißig.
Aber seine Augen! Sie schienen unablässig zu grinsen, so dass man manchmal meinte, einen frechen Jungen vor sich zu haben. Und vor allem waren sie von einem hellen, fast wässrigen Blau, und hatten eine derart erotische Ausstrahlung, dass viele Frauen zunächst mal fasziniert waren von diesem Mann. Selbst Betty, die ihre festen Prinzipien hatte, vermied es, allzu viel Blickkontakt mit Kübler zu suchen.
„Einen kleineren Nadelhalter“, verlangte der Operateur. Er war dabei, die einzelnen Schichten der Bauchdecke zu nähen. „Und jetzt Catgut.“ Er war einer der wenigen Chirurgen, die dieses Nahtmaterial noch benutzten. „Sind Sie doch so lieb, Betty, und saugen Sie mir das Sekret noch mal ab.“ Wieder dieser funkelnde Blick. Betty wich ihm aus. Was sollte das? Wollte er Marlene eifersüchtig machen?
Später – der Patient befand sich schon im Aufwachraum, und Kübler war zum Mittagessen gegangen – sah Betty Marlene mit dem Gesicht zur Kachelwand im OP-Saal stehen. Neben ihr Heinrich Kollmann. Er hatte den Arm um ihre Schulter gelegt. Erschrocken ging Betty zu ihren beiden Kollegen. Marlene weinte. „Marlene?“ Betty berührte sie am Arm.
„Dieses Schwein“, schluchzte Marlene.
„Hat er Schluss gemacht?“
Marlene nickte. „Schön war’s – aber jetzt hab’ ich keine Lust mehr“, versuchte sie den Arzt nachzuäffen. Mit ihrer tränenerstickten Stimme misslang ihr das zwar völlig, aber Betty merkte daran, wie bitter sie war. Kollmann seufzte und ging kopfschüttelnd davon.
Betty versuchte Marlene zu trösten. Sie machte sich los und verschwand im Personalraum. Bettys Mitgefühl war nicht ganz ungetrübt. Wer sich mit Dr. Kübler einließ, war ihrer Meinung nach selbst schuld. Jeder, der Augen und Ohren im Kopf hatte, konnte wissen, dass dieser Mann ständig ein Abenteuer suchte. Für Betty war klar, dass sie ihm keinen Anlass geben würde, den Kerben auf seiner Bettkante noch eine weitere hinzuzufügen.
3
Kohlrouladen! Alexandra hätte es wissen müssen. Jeden zweiten Dienstag gab es Kohlrouladen im Ärztekasino. Ganz und gar nicht ihre Leibspeise. Aber nun war sie schon mal hier, und einen Bärenhunger hatte sie auch. Sie ließ sich nur ein kleines Exemplar auf den Teller tun und nahm dafür um so mehr Kartoffelpüree. Frau Brückmann stellte ihr augenzwinkernd ein zweites Schüsselchen Vanillepudding aufs Tablett. Mariechen kannte ihre Pappenheimer.
Alexandra lächelte dankbar und nahm an einem freien Tisch Platz. Sie war spät dran, und die meisten Kollegen hatten schon zu Mittag gegessen. Nur die Chirurgen fehlten noch. Das OP-Programm zog sich wahrscheinlich mal wieder in die Länge.
Die Notärztin ließ es sich leidlich schmecken. An der Essensausgabe sah sie jetzt einen der Chirurgen stehen – Gerd Kübler. Er scherzte mit Mariechen Brückmann. Bald kam er mit seinem Tablett auf Alexandras Tisch zu. Sein Gang war schlendernd, und er machte große Schritte. Das gab ihm etwas Gemächliches. Mit seinem typischen Siegerlächeln grüßte er an verschiedene Tische. Zwei Arztpraktikantinnen wurden mit einem Augenzwinkern bedacht. Alexandra musste grinsen. „Der Mann hält sich für unwiderstehlich“, dachte sie. Aber sie mochte ihn.
„Darf ich mich zu Ihnen setzen, Frau Heinze?“
„Nur zu, Herr Kübler“, sagte sie, „es ist genügend Platz.“ Er setzte sich.
„In den Genuss komme ich ja selten“, schmeichelte er. Auf seinem Teller lagen drei Kohlrouladen. Daneben, auf dem Tablett, standen drei Schüsselchen Vanillepudding.
„Dafür verstehen Sie es ja, sich andere Genüsse zu verschaffen.“
„Ich habe einfach einen guten Draht zu Mariechen“, lachte er, „die Beziehung zum Kasinopersonal ist wichtiger als die zum Chefarzt.“
Das war es, was Alexandra an diesem Gigolo schätzte: Sein Humor. „Ich habe nur zwei Schälchen Pudding bekommen“, beklagte sie sich scherzhaft.
„Ich bin ja auch ein Mann“, erklärte er vergnügt, „und verstehe es, mir die Damenwelt geneigt zu machen.“
Alexandra runzelte die Stirn. Kübler grinste zwar, aber sie wurde das Gefühl nicht los, dass das mehr als nur ein Scherz war. „Schon im Kindergarten soll ich angeblich alles von den Erzieherinnen bekommen haben, was ich wollte.“
„Nun, mein lieber Herr Kollege, Ihre diesbezüglichen Fähigkeiten haben sich mittlerweile herumgesprochen in diesem Haus.“
„Tatsächlich? Na, wie praktisch!“ Nicht die Spur von Verlegenheit zeigte sich auf seiner Miene.
„Und soll ich Ihnen etwas sagen?“ Alexandra hatte Lust ihn zu sticheln. „Selbst auf männlicher Seite haben Sie Ihre Bewunderer.“
„Was Sie nicht sagen!“ Er schob sich ein Stück Kohlroulade in seinen großen Mund.
„Unser allseits geschätzter Herr Oberarzt Dr. Höper soll neulich in vertrauter Runde bemerkt haben, dass selbst er noch etwas lernen könne von Ihnen.“
„Leider kann man sich seine Fans nicht aussuchen.“ Seine Stimme klang schon nicht mehr ganz so heiter.
„Und soll ich Ihnen noch etwas sagen?“ Der Schalk saß Alexandra nun im Nacken. Sie setzte das charmanteste Lächeln auf, das sie drauf hatte. „In letzter Zeit mehren sich die frechen Zungen, die Sie hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand als Weiberhelden brandmarken, stellen Sie sich das einmal vor!“
Er hörte auf zu kauen und musterte Alexandra mit leicht geneigtem Kopf. Offenbar fand er, dass sie sich bereits an der Grenze des guten Stils bewegte. „Wie schmecken Ihnen eigentlich die Kohlrouladen, Frau Heinze?“
Alexandra ging nicht darauf ein. Sie war noch nicht fertig mit ihrer gut getarnten Gardinenpredigt. „Und selbst ich, Herr Kollege, wurde schon von so einem schlechten Gedanken heimgesucht.“
„Schämen Sie sich“, sagte Kübler mit gespielter Strenge und aß weiter. „Ich schwöre Ihnen, Frau Kollegin, bei allem was mir heilig ist“, das Grinsen war auf sein Gesicht zurückgekehrt, und er sprach mit vollen Mund, „ich tue nichts, aber auch wirklich nichts, um was man mich nicht ausdrücklich bittet.“
„Ich geb’s auf.“ Alexandra wurde plötzlich ernst. „Nur eines noch: Ich finde es nicht in Ordnung, wenn ein Arzt die Unbedarftheit einer jungen Schwester, oder gar einer Schwesternschülerin ausnutzt, für die jeder Mann respektabel und moralisch unantastbar ist, wenn er einen weißen Mantel trägt.“
Darauf entgegnete er nichts mehr. Alexandra hatte den Eindruck, ihn gekränkt zu haben. Doch das war ihr egal. Sie erkundigte sich noch höflich nach seiner letzten Bergtour – Kübler war leidenschaftlicher Bergsteiger – und er gab genauso höfliche Antworten.
Auf dem Weg ins Bereitschaftszimmer dachte sie noch einmal an das Gespräch. Diese Art Männer pflegte einer Menge Frauen eine Menge Kummer zu machen. Während sie selbst ziemlich unbeschadet und leichtlebig durch den Garten der Liebe marschierten. Sie waren meistens so dickhäutig, dass wirkliche Liebe ihnen selten bis unter die Haut ging. Und wenn sie tatsächlich mal der Meinung waren, Liebeskummer zu haben, verwechselten sie das meistens mit gekränkter Eitelkeit. Das jedenfalls war Alexandras Erfahrung. „Ungerechte Welt“, seufzte sie.
In der Nähe der Patienten-Cafeteria überfiel sie plötzlich ein Heißhunger auf Schokolade. Sie zögerte ein paar Sekunden. Die Waage heute morgen hatte frohe Botschaft verkündet. Also ging sie auf den Kiosk zu.
Vor einem der Tische stand ein junges Pärchen und umarmte sich. Der junge Mann hielt einen Motorradhelm fest. Das Mädchen hatte kurze dunkle Haare und trug eine schwarze Lederjacke. Das waren sicher keine Patienten. Alexandra fiel ein, dass sie das Mädchen schon in weißer Schwesternkleidung auf der Gynäkologie gesehen hatte. Vielleicht eine Schwesternschülerin.
Die Notärztin stellte sich an den Tresen. „Guten Tag, Frau Reimers, eine Tafel Schokolade bitte.“ Fanny Reimers reichte ihr das Gewünschte. „Wie geht es Ihnen, Frau Reimers?“, erkundigte sich Alexandra, während sie nach einem Markstück suchte.
„Danke, Frau Doktor, aber Sie wissen ja“, Fanny Reimers, die mit ihrem Mann die Cafeteria und den Kiosk betrieb, winkte resigniert ab, „jede Menge Arbeit, aber wollen wir froh sein, dass wir überhaupt welche haben.“
„Da haben Sie recht …“ Der Piepser dudelte unvermittelt los. Alexandra warf einen Blick auf das Display. Die Nummer des Bereitschaftszimmers erschien darauf. „Ein Notfall, ich muss schnell los. Alexandra griff sich die Schokoladentafel, drehte sich um und spurtete los.
Sie kam nicht weit. Irgendwie stand ihr plötzlich der junge Mann mit dem Motorradhelm im Weg. Er war gerade im Begriff, sich an den Tisch zu seinem Mädchen zu setzen. Der Helm rutschte ihm aus der Armbeuge und fiel polternd auf den Tisch. Dummerweise genau auf ein volles Cola-Glas. Das stürzte um, die Cola ergoss sich über den Tisch, das Glas rollte über den Tischrand und zersprang am Boden.
„Mist, verdammter!“, schimpfte Alexandra. „Entschuldigen Sie, das tut mir leid“, wandte sie sich an die beiden jungen Leute.
„Ich mach’ das schon, Frau Doktor Heinze, gehen Sie nur zu Ihrem Notfall“, rief Frau Reimers durch das Verkaufsfenster ihres Kiosks.
Alexandra angelte einen Zehnmarkschein aus ihrem Geldbeutel. „Ich hab’s nicht kleiner und muss schleunigst weiter“, sie reichte dem Mädchen den Geldschein, „hinterlegen Sie das Restgeld einfach bei Frau Reimers.“ Ehe das Mädchen antworten konnte, verschwand Alexandra und lief in Richtung Bereitschaftsraum davon.
4
„Jetzt schieb mal die Pulle rüber!“ Die Jungens auf der Treppe vor dem großen Reiterdenkmal grölten hinauf zu dem steinernen Geländer, wo eng umschlungen ein Pärchen saß und hingebungsvoll knutschte. „Los Sascha, her mit dem Bier!“ Sascha löste sich aus der Umarmung, griff hinter sich und reichte die halbvolle Bierflasche zu seinen Kumpels hinunter.
„Sauft nicht soviel, sonst fahr’ ich mit dem Bus in die Disco“, rief das Mädchen ihnen zu und machte ein bissiges Gesicht. Es trug eine schwarze Lederjacke.
„Knutsch’ nicht soviel, du musst morgen noch mit deinen Patienten reden“, grölte einer der Angesprochenen zurück. Die anderen quittierten die Bemerkung mit lautem Gelächter.
Das Denkmal war seit über einem Jahr der Treffpunkt der Clique. Ohne sich groß verabredet zu haben, trudelte fast jeden Nachmittag ein gutes Dutzend von Ihnen hier ein. Die jungen Männer, selbst wenn sie nur ein paar Schritte weiter in der nahen Innenstadt wohnten, grundsätzlich mit ihren Mopeds.
Dort saßen sie dann, rauchten und rissen Witze, schimpften über ihre Chefs oder Berufsschullehrer, knutschten sich, langweilten sich, oder heckten irgendwelche Unternehmungen für den Abend aus. Das beschränkte sich meist auf kurze Debatten, ob man ins Industriegebiet in die Disco fuhr, oder in eine der beiden Stammkneipen der Clique. Und wenn ja, in welche. Manchmal wurden auch Feten fürs Wochenende gemanagt.
Jetzt applaudierten sie dem küssenden Pärchen. „Wenn du genauso gut küsst, wie du Vergaser reinigst und Getriebe auseinander nimmst, muss Moni ja voll gut draufkommen“, rief Patrick zur Steinbalustrade hinauf.
Der Angesprochene streichelte Monika über ihr kurzes dunkles Haar. Sascha hieß er und war achtzehn Jahre alt. Er und Patrick lernten im gleichen KFZ-Betrieb. Patrick im zweiten, Sascha im dritten Lehrjahr. Die meisten hier machten eine Ausbildung in irgendeinem Handwerksbetrieb. Einige wenige waren auch arbeitslos. Und alle waren zwischen siebzehn und neunzehn Jahre alt.
Monika Lorenz war eines der wenigen Mädchen der Clique. Die meisten hielten es nicht lange aus bei den etwas derben Kerlen. Monika aber gehörte sozusagen zu den alten Hasen, und die meisten hatten Respekt vor ihr. Außerdem war sie fest mit Sascha liiert. Seit fast drei Monaten schon.
Von der Rheinpromenade her ertönte plötzlich lautes Motorengebrüll. Alle sprangen auf. „Der Tobi kommt mit seiner Yamaha!“
Tatsächlich näherte sich ein Motorradfahrer. Hundert Meter vor dem Denkmal drehte er den Gashahn noch einmal voll auf, bremste dann vor seinen Kumpels scharf ab und demonstrierte eine gewagte Drehung auf dem sandigen Boden vor der Denkmaltreppe.
Von Weitem drohte ein älterer Herr mit der Hand, ein Tourist wohl, an dem der Motorradfahrer, Tobias, wohl etwas zu nahe vorbeigefahren war. Er schimpfte irgendetwas Unverständliches zu ihnen herüber.
„Halt bloß die Fresse, Alter, sonst hau’ ich dir eine ’rein“, brummte Tobias vor sich hin und stieg von seiner Maschine. Er war der älteste der Clique, aber nicht unbedingt der Klügste. Dafür der einzige, der schon ein Motorrad besaß. Im vergangenen Jahr hatte er seine Zimmermannslehre abgeschlossen.
Mit großem „Hallo“ begrüßten die anderen ihn. Sie stellten sich um die Yamaha, und Monika durfte sogar darauf Platz nehmen. Tobias stand stolz und mit herausgestreckter Brust neben seiner Maschine und genoss die Bewunderung der anderen. Seit er kein Moped mehr, sondern ein richtiges Motorrad fuhr – 250 Kubikzentimeter – war er in der Rangordnung der Gruppe aufgestiegen.
„Möchte wissen, wo du die Kohle herhast“, wunderte sich Patrick nicht zum ersten Mal, „ist doch schweineteuer so’n Gerät.“
„Köpfchen, Alter“, Tobias fasste sich an die Stirn.
Der Spätnachmittag verlief dann wie üblich – Witze, Sticheleien, die neuesten Heldentaten auf dem Rücken der Maschinen, und die ersten Flaschen Bier. Tobias fuhr sogar ein paar Runden durch die Stadt, um den ganz heißen Fans seiner Maschine das Fahrgefühl zu vermitteln, das er tagtäglich genoss.
Gegen acht einigte man sich auf Disco, und die ersten stoben davon. Sascha, Patrick und Monika blieben auf der Treppe sitzen. „Was is’ los?“, wollte Tobias wissen, während er sich den Nierenschutz anlegte. „Kein’ Bock auf Disco?“
„Bock schon, aber Kohle ist alle.“ Sascha zog bedauernd die Schultern hoch. „Der nächste Erste is’ erst in acht Tagen.“
Tobias stülpte sich den Helm über und schwang sich auf seine Yamaha. Er klappte das Visier hoch und grinste die anderen drei an. „Mit ’nem bisschen Köpfchen würdet ihr auch zu mehr Kohle kommen.“
„Was?“, wunderten sich die anderen. „Wie meinst du das?“
„Wie ich’s sage“, Tobias machte Anstalten, das Motorrad anzuwerfen, „ich wüsste schon, wie ich an eurer Stelle zu Geld kommen würde.“
„Wie viel Geld?“ Patrick wurde neugierig.
„Genug für einen Ofen.“ Er klopfte auf den Tank seiner Maschine, drehte das Gas auf und brauste davon. Die Zurückbleibenden sahen sich fragend an.
5
Die Frau war blond. So aufdringlich blond, wie man normalerweise nicht sein konnte. Es sei denn, man nahm gewisse Chemikalien zur Hilfe. Sie hatte eine süße Stupsnase, und zumindest an dem Ohr, das Johannes sehen konnte, trug sie einen überdimensionalen, goldenen Kreolen. Und sie schnarchte.
Johannes kniff die Augen zusammen und riss sie wieder auf. Diese Frau – wie um alles in der Welt kam sie auf sein Schiff? Er ließ sich in das Kissen des schmalen Kajütenbettes fallen. Langsam, ganz langsam tauchten die Bilder des gestrigen Abends in seinem schmerzenden Schädel auf. Er hatte die Weinstube gefunden. Genau – und dann, bei einem Bummel durch die Altstadt, hatte ihn diese Yuppie-Bar angemacht. Ach ja – dort hatte er die Leute kennengelernt, zwei Frauen und einen Mann.
Der Mann war noch recht jung gewesen, jünger als er selbst. Wie hieß er gleich? Rudi, richtig! Hatte Job in einem Autohaus. Und die eine der beiden Frauen hatte sich mit Caren vorgestellt. Caren, genau – oder Carmen? Egal, jedenfalls war sie eine Kollegin. Rudi hatte angedeutet, dass sie als Juristin beim Amtsgericht arbeitete.
Und die Blonde hier? Johannes blinzelte sie an. Sie schnarchte wie eine ganze Burschenschaft nach durchzechter Nacht. Wie hieß sie gleich? Der Name wollte ihm partout nicht einfallen. Sie waren sich in der Nobel-Disco näher gekommen, in die sie anschließend gefahren waren. Architektin war sie, das wusste Johannes noch, und dass sie ihn ständig zum Tanzen genötigt hatte, das wusste er auch noch.
Irgendwann musste der Film gerissen sein. Johannes stand vorsichtig auf und ging an den Kajütenschrank. Er löste sich eine Aspirin auf. Während die Tablette im Glas sprudelte, sah er sich um. Auf der Eckbank der Essecke, neben ihren Kleidern, lag eine kleine Handtasche. Er besaß so eine Tasche nicht, also musste sie dieser schnarchenden Frau gehören. Leise schlich er zur Essecke, kramte eine Brieftasche aus der Handtasche und zog einen Personalausweis heraus. Selbstverständlich war ihm das unangenehm. Doch noch peinlicher wäre es gewesen, sie wachzuküssen, um sich nach ihrem Namen zu erkundigen.
Carola hieß sie, Carola Wenz. Johannes las das Geburtsdatum. Sie war vier Jahre jünger als er – neunundzwanzig. Er schob den Ausweis sorgfältig zurück in die Brieftasche, legte die Tasche wieder auf den Kleiderhaufen und trank sein Aspirin. Danach legte er sich wieder neben die Dame namens Carola Wenz.
Drei Stunden später saßen sie an Deck und frühstückten. Sie sprachen nicht viel. Carola legte ihm Toast auf den Teller, Carola schenkte ihm Kaffee ein, Carola löste ihm noch eine Aspirin auf. Und bei allem lächelte sie so glücklich, als hätte sie schon jahrelang von diesem Frühstück geträumt. Johannes wusste nicht, wie ihm geschah. Ihm schwante Übles.
Irgendwann beugte sich Carola über den kleinen Campingtisch zu ihm herüber und küsste ihn auf die Nase. „Bitte sei mir nicht böse, wenn ich dir ein Frage stelle.“
„Bitte – frage was du willst“, antwortete er, „ich kann mir ja immer noch überlegen, ob ich antworte.“
„Dann sag’ mir, wie du heißt, ich habe deinen Namen vergessen.“ Johannes lachte schallend.
Nach dem Frühstück – Johannes überlegte gerade, ob er nach Bonn aufbrechen oder noch einen Tag hier bleiben sollte – schaute Carola auf ihre Uhr. „Wir sollten langsam los.“
Johannes guckte sie überrascht an. Hatte er ihr etwa im Suff versprochen, sie mit nach Bonn zu nehmen? „Wohin?“
„Na zu den Tennisplätzen!“ Sie lachte. „Wir sind doch für zwei Uhr mit Rudi und Caren zu einem Tennismatch verabredet. Hast du das vergessen?“
„Ach so“, irritiert schaute er über das Wasser, „habe ich gar nicht mitgekriegt – aber warum nicht? Brechen wir also auf.“ Niemand zwang ihn, heute noch nach Bonn zu fahren. Er konnte sich seine Route nach Belieben einteilen. Was sollte ihn daran hindern, noch vierundzwanzig Stunden dranzuhängen? Spontane Bekanntschaften mit netten Leuten – so was erlebt man nicht alle Tage.
Das Tennismatch brachte seinen vom Alkohol lädierten Kreislauf in Schwung. Carola spielte überraschend gut, Rudi war ein amüsanter Spaßvogel, und diese Caren hatte Beine, die es Johannes schwer machten, sich auf ihre Bälle zu konzentrieren. Er begann es zu bedauern, heute morgen nicht neben ihr aufgewacht zu sein. Doch offensichtlich war sie mit dem lustigen Rudi liiert. Obwohl der mindestens fünf Jahre jünger war als sie.
Carola warf ihm ständig Handküsse zu, und als sie nach dem Spiel auf die Terrasse des Clubhauses gingen, um etwas zu trinken, hakte sie sich wie selbstverständlich bei ihm unter. Die Art, wie sie ihn anschaute, war eindeutig. Die Frau hatte sich in ihn verliebt!
„O Gott, nichts wie weg hier“, dachte Johannes. Er überlegte, wie er sich aus Staub machen konnte, ohne die Regeln der Höflichkeit zu verletzen. Immerhin hatte er eine exzellente Kinderstube, und verliebte Frauen pflegen bekanntlich äußerst empfindlich zu sein. Manchmal sogar gefährlich.
Er dichtete an einer Ausrede, und für einen Moment sah es so aus, als könnte er sein Schicksal noch wenden, doch dann verkündete Rudi bestens gelaunt: „Und heute Abend seid ihr meine Gäste – wir müssen unsere Bekanntschaft schließlich noch feiern.“ Er lud die beiden Frauen und ganz ausdrücklich auch Johannes in ein Waldrestaurant zum Wildschweinbraten ein.
„Und morgen Abend fahren wir mit dir nach Aachen in das Spiel-Kasino.“ Rudi war unwiderstehlich. Und eine verliebte Frau hatte ja auch ihre Vorzüge. Also vergaß Johannes seine Ausrede und stieß mit den anderen an. Er entschloss sich, noch einen weiteren Tag in der Stadt zu bleiben. Vielleicht auch noch zwei Tage. Etwas mehr als vierundzwanzig Stunden später sollte er diesen Entschluss bitter bereuen.
6
„Morgen Vormittag eine Röntgenkontrolle, und wenn die in Ordnung ist, kann der Gips weg.“ Assisa notierte eifrig die Anordnungen Dr. Höpers, während er und Dr. Kübler sich dem Nachbarbett zuwandten.
Ein strenges OP-Programm lag hinter ihnen, und sie waren erst nach dem Mittagessen dazu gekommen, die Visite bei den Patienten der Chirurgie zu machen. Gerd Kübler hatte nichts gegen Visiten am frühen Nachmittag. Man konnte sich ohne Zeitdruck den Patienten widmen.
Höper entfernte den großflächigen Verband vom Bauch der jungen Frau und betrachtete die Operationswunde. „Na also“, sagte er zufrieden, „das heilt ja wunderbar, Frau Overhoff.“
„Ich bin Ihnen ja so dankbar, Herr Doktor“, seufzte die blonde Frau. Sie wirkte blass und erschöpft, aber trotzdem war ihre Attraktivität nicht zu übersehen.
„Es war wirklich ein schwieriger Eingriff.“ Der Oberarzt sprach sehr freundlich und mit sanfter Stimme. Es war Gerd Kübler schon bei früheren Gelegenheiten aufgefallen, dass Höper Gefallen an der jungen Frau gefunden hatte. „Aber man tut, was man kann“, lächelte er.
Die Frau hatte allen Grund dankbar zu sein. Sie litt unter Morbus Crohn, einer entzündlichen Darmerkrankung, und war wegen einer eiternden Darmfistel operiert worden. Höper hatte das Kunststück fertig gebracht, ihr einen Anus praeter zu ersparen. Kübler hatte bei der langen und schwierigen Operation vor acht Tagen assistiert. Und wieder einmal war sein Urteil über den Oberarzt bestätigt worden: Er war der beste Chirurg, den er bisher kennengelernt hatte.
Nach der Visite gingen die beiden Männer ins Arztzimmer. „Hier ist der OP-Plan für morgen. Würden Sie ihn in den OP bringen, Herr Kübler?“
Gerd Kübler nahm den Zettel entgegen.
„Ich dachte, dass Sie die Galle und die Leistenhernie übernehmen.“ Kübler nickte. Dann studierten sie gemeinsam ein paar Röntgenbilder – ein Dickdarmtumor, den sie in der kommenden Woche gemeinsam operieren wollten.
„Und was macht Ihr Jagdglück, Herr Kollege?“, sagte Höper unvermittelt und grinste dabei über das ganze Gesicht. „Wie ich höre, bleibt es Ihnen treu.“
Gerd Kübler zog es vor, sich dumm zu stellen. „Mein Hobby ist nicht die Jagd, Herr Höper, ich bin Bergsteiger.“
Höper schlug ihm lachend auf die Schulter. Diese Vertraulichkeit war genau die Umgangsform, die Kübler nicht mochte. Jedenfalls nicht mit Höper. „Sie wissen doch genau, was ich meine, Herr Kübler. Also alle Achtung, bei der Marlene habe ich’s wochenlang vergeblich versucht.“
„Wenn man so eng zusammenarbeitet, kann es schon mal zu privaten Kontakten kommen“, sagte der Assistenzarzt kühl.
„Ja, so kann man’s auch nennen“, Höper grinste immer noch, „haben Sie schon die neue Ärztin im Praktikum wahrgenommen?“
„Ja, scheint eine intelligente Frau zu sein.“ Kübler wollte sich auf keinen Fall noch weiter in dieses anzügliche Männergespräch hineinziehen lassen.
„Ja, ja“, grinste Höper, „intelligent ist sie auch.“ Er wurde plötzlich ernst. „Ich wollte nur sagen, dass ich es für eine Geste der Kollegialität halten würde, wenn Sie mir die Dame überließen.“
Höper verließ das Arztzimmer. „Blödmann!“, zischte Kübler. Er nahm das Papier mit dem OP-Programm und ging hinüber in den OP-Trakt. In der Sterilisation traf er Betty. „Hier ist das Programm für morgen, Schwester Betty“, er lächelte sie an, „würden Sie es auf die Wandtafel schreiben?“
Betty nickte und wich seinem Blick aus. Kübler betrachtete die Schwester. Sie sah hinreißend aus. Ihre kleine Gestalt war schlank, und sie bewegte sich mit der tänzerischen Grazie eines jungen Rennpferdes. Ihr kurzes, dichtes Haar war blond mit einem Rotstich, und in ihrem schmalen, sommersprossigen Gesicht standen ein paar große, manchmal staunend in die Welt blickende Augen. Was ihn besonders faszinierte an dieser jungen Frau war ihre natürliche Ausstrahlung.
„Haben Sie heute Nachtbereitschaft, Schwester Betty?“ Sie verneinte.
„Erst morgen.“ Sie legte das letzte Paar Handschuhe in die Trommel und schloss den chromblitzenden Behälter.
„Ach, da werden wir unter Umständen miteinander das Vergnügen haben“, sagte Kübler, „morgen habe ich nämlich ebenfalls Nachtdienst.“ Sie antwortete nichts und schob die Trommel in den Sterilisator. „Ich arbeite übrigens gern mit Ihnen zusammen, Betty.“
„Danke“, sagte sie knapp und verschwand mit dem Zettel in den Aufwachraum. Kübler ging ihr nach. Während sie mit einem Edding das Programm an die Wandtafel schrieb, stand er im Türrahmen und betrachtete sie. Er merkte natürlich, dass seine Gegenwart sie nervös machte. Aber gerade das genoss er. „Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Herr Doktor Kübler?“ Sie drehte sich mit fragend hochgezogenen Augenbrauen zu ihm um. Wieder klang ihre Stimme kühl und abweisend.
„Ich frage mich, warum Sie mir die kalte Schulter zeigen, Betty.“ Schweigend schrieb sie weiter. „Ist es die Sache mit Marlene?“ Sie antwortete nicht. „Glauben Sie nicht alles, was über mich geredet wird, Betty. Wenn eine Beziehung nicht funktioniert, gehören immer zwei dazu. Das wissen Sie doch auch.“ Sie drehte sich um und musterte ihn. Ihr Gesicht wirkte nicht mehr ganz so distanziert. „Lassen Sie sich bitte nicht von der Gerüchteküche beeindrucken. Ich bin nicht ganz so übel wie mein Ruf, Betty.“
„Warum erzählen Sie mir das, Dr. Kübler?“ Er ging langsam auf sie zu und stellte sich neben sie. Seine blauen Augen bohrten sich lachend in ihren Blick. „Vielleicht lege ich Wert auf Ihr Urteil, Betty.“ Er zuckte mit den Schultern. „Ich wundere mich selbst darüber. Normalerweise ist es mir egal, was andere über mich reden. Aber Sie …“
„Ja?“
„Sie haben so etwas Besonderes an sich, Betty. Irgendwie ist es mir wichtig, dass Sie nicht schlecht von mir denken.“
Eine leichte Röte flog über ihr Gesicht. „Ich werde darüber nachdenken.“ Sie wandte sich wieder der Tafel zu. Kübler verabschiedete sich und ging zurück auf die Chirurgie. Frauen, die ihm die kalte Schulter zeigten, reizten ihn besonders. Er war entschlossen, diese Festung zu erobern.
7
Die Pizzeria war ganz im Stil südländischer Lokale eingerichtet. Exotisch geformte Weinflaschen standen in Wandnischen und auf den Holzblenden, die die einzelnen Tische voneinander trennten, hier und dort sah man Gipsbüsten römischer Jünglinge, und an den Wänden hingen Bilder mit Landschaftsmotiven von der süditalienischen Adriaküste.
„Der Zigarettenautomat hängt im Durchgang zu den Toiletten. Die beiden Spielautomaten neben dem Eingang habt ihr ja gesehen, als wir hereingekommen sind.“ Tobias sprach leise und ließ seinen unbeteiligten Blick durch das Lokal schweifen. „Wir haben auf dem Nachbargrundstück einen Dachstuhl restauriert. Vom Hof aus kommt man lässig ’rein in den Laden.“
Sascha und Patrick sahen sich an. Ihre Gesichter wirkten angespannt. In Saschas Augen flackerte Angst. „Du bist übergeschnappt, Tobi, völlig übergeschnappt“, zischte Monika.
„Klar, Frau“, seelenruhig griff Tobias nach seinem halbvollen Bierglas und leerte es auf einen Zug, „so übergeschnappt, dass ich mir eine Yamaha leisten kann.“ Er bestellte noch ein Bier. Als der Kellner sich wieder vom Tisch entfernt hatte, beugte er sich zu Monika hinüber. „Ihr habt mich gefragt, wie ich an an soviel Kohle komme, und ihr wolltet wissen, ob das auch eine Quelle für euch wäre. Ich habe euch meine Antwort gegeben. Jetzt seid ihr am Zug.“
„Ich weiß nicht.“ Sascha schaute unsicher von Patrick zu Monika. „Ehrlich gesagt, mir ist das zu heiß. Und dann: Ein Einbruch, he …“ Tobias gab ihm unter dem Tisch einen Fußtritt, weil sich der Kellner mit dem Bier näherte.
„Ein Bier, bitteschön“, fragend schaute er die anderen drei an, „trinken Sie auch noch etwas?“
„Ja, bringen Sie noch drei Bier“, sagte Tobias, ohne die Antworten seiner Kumpels abzuwarten. Der Kellner verschwand zwischen den Tischen. „Du hast Schiss, das ist alles!“, fuhr er Sascha an.
„Was heißt hier Schiss?“, druckste der herum, „aber stell’ dir doch mal vor, wenn die uns erwischen, was glaubst du …“
„Quatsch!“, unterbrach Tobias. „Du machst dir ja keine Vorstellung, wie einfach das geht. Hab’ ich auch nicht vor dem ersten Mal.“
„Du hast sowas schon öfter gemacht?“ Monika hatte nur Gerüchte gehört über dunkle Nebenjobs, denen Tobias angeblich nach Feierabend nachgehen würde. Es jetzt aus seinem eigenen Mund bestätigt zu bekommen, überraschte sie, gelinde gesagt. „Ehrlich?“ Sie kriegte den Mund kaum noch zu vor Staunen. Auf ihren sonst so schnoddrigen Gesichtszügen spiegelte sich eine Mischung aus Bewunderung und Furcht. „Aber das ist doch kriminell.“
Tobias sah sich um. Niemand achtete auf die kleine Jugendgruppe. „Kriminell?“, flüsterte er. „Was machen denn die da oben? Kassieren Schmiergelder, oder streichen dicke Ruhestandszahlungen ein, nachdem sie sich ein paar Jahre in irgend ’nem Ministerium gelangweilt haben. Ist auch nichts anderes. Was is’n heut noch kriminell? Ein Job ist das, wie viele andere auch.“
Der Kellner brachte das Bier, und Tobias wechselte das Thema. Kaltblütig schilderte er einen Boxkampf, den er in Köln gesehen hatte. Als der Kellner wieder fort war, beendete er seine Betrachtungen über Kriminalität. „Man muss gucken, dass man zu was kommt, jeder macht das auf die eine oder andere Weise. Und wer es nicht macht, ist einfach dämlich.“
Er lehnte sich zurück. Lauernd beobachtete er die anderen drei. Die sahen sich ziemlich betreten an. Patrick, der bisher geschwiegen hatte, ergriff als erster das Wort. „Hat gar nicht so unrecht, der Tobi.“ Er sagte das zu Monika und Sascha. „Warum eigentlich nicht? Und wenn er sich auskennt, kann doch gar nichts schiefgehen.“
„Ich weiß nicht.“ Sascha war förmlich anzusehen, wie er sich innerlich wand. Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her und schaute mit unruhigem Blick zu den Nachbartischen. „Ehrlich, ich weiß nicht recht.“
„Komm, Sascha, sei keine Pflaume“, sagte Patrick, „stell dir vor, du kannst dir eine Maschine leisten.“
Unsicher sah Sascha seinen Freund an. „Du würdest wirklich mitmachen?“
Gespannt verfolgte Tobias das Gespräch.
„Klar“, Patrick wirkte entschlossen, „ich würde schon mitmachen.“
„Du spinnst ja!“, fuhr Monika ihn an.
„Also gut“, sagte Sascha zögernd, „wenn du mitmachst, bin ich auch dabei.“ Monika raufte sich ihre kurzen, dunklen Haare und wurde blass. Tobias grinste befriedigt. Sie zahlten und verließen das Lokal. Monika versuchte Sascha von seinem Entschluss abzubringen. Die anderen beiden hielten dagegen. Sascha wollte sich vor seinen Kumpels keine Blöße geben. Umfallen kam für ihn deswegen nicht in Frage. Er blieb bei seiner Entscheidung: „Ich mache mit, scheiß drauf!“
Irgendwann gab Monika seufzend auf. „Komm Moni, lass uns nicht hängen.“ Tobias legte freundschaftlich den Arm um sie.
„Aber nur, weil ich Sascha nicht allein lassen will“, beteuerte sie, „und ich gehe nicht mit ’rein!“
„Ist gut“, strahlte Tobias, „einer muss sowieso Schmiere stehen, du kriegst mein zweites Handy.“
Sie gingen zu Tobias. Er bewohnte im Haus seiner Eltern eine Einliegerwohnung. Dort wollten sie in Ruhe die Einzelheiten ihres Planes durchsprechen. „Und wann steigt die Sache?“, wollte Patrick wissen.
„Morgen Nacht“, sagte Tobias.
8
Nach dem Dienst fuhr Betty mit einigen Kolleginnen in eine Kneipe am Stadtrand. Sie hatten sich zum Essen verabredet und wollten die Dienstpläne für den kommenden Monat besprechen.
Betty war nicht richtig bei der Sache. Merkwürdigerweise wanderten ihre Gedanken ständig zu Gerd Kübler. Sie ärgerte sich selbst darüber. Nach dem Essen und der Festlegung des Dienstplanes kam, was immer bei solchen Gelegenheiten kam: Krankenhaustratsch. Die Ärzte wurden durchgekaut, die neuesten Affären von allen Seiten beleuchtet, und man zog über unbeliebte Kollegen her, soweit sie nicht anwesend waren.
Betty langweilte sich. Sie bezahlte und ging als erste nach Hause. Es war noch hell, als sie ihr Zimmer im Personalwohnheim betrat. Sie fühlte sich eigenartig unruhig und beschloss, noch ein wenig an der Rheinpromenade entlang zu joggen.
Die körperliche Anstrengung tat ihr gut. Schweißmaß kehrte sie ins Personalwohnheim zurück. Auf dem Gang des Stockwerks, in dem sie wohnte, begegnete ihr ein Paar. Marlene und ein Zivi, den Betty nur vom Sehen kannte. Er arbeitete auf der Inneren. Die beiden gingen Arm in Arm an ihr vorbei. Marlene grüßte nur kurz, sie schien verlegen zu sein.
Kopfschüttelnd schloss Betty ihre Zimmertür hinter sich ab. Dass Marlene schon wieder mit einem anderen Mann angebändelt hatte! So schlimm konnte die Enttäuschung über die unglückliche Affäre mit Dr. Gerd Kübler demnach gar nicht gewesen sein. Betty wusste nicht, was sie davon halten sollte.
Nach dem Duschen saß sie auf dem Balkon und rauchte. Wieder wanderten ihre Gedanken zu Dr. Kübler. Wie nett er heute zu ihr gewesen war! Wie sagte er? Sie haben so etwas Besonderes an sich, Betty. Das hatte ihr schon lange niemand mehr gesagt. Sie sah seine blauen Augen vor sich und hörte in Gedanken seine samtene Stimme. Vielleicht war der Mann doch besser als sein Ruf.
Und eigentlich hatte er recht: Zu einer gescheiterten Beziehung gehörten immer zwei. Und wenn Marlene heute schon wieder Arm in Arm mit einem anderen Mann unterwegs war, hatte sie das Verhältnis zu dem Chirurgen wohl nicht besonders ernst genommen. Und die anderen Romanzen, die der Arzt hatte? Oder besser: Gehabt haben sollte, denn manches musste man in so einer Klinik einfach der Gerüchteküche gutschreiben. Aber selbst wenn alles stimmte, was so über Dr. Kübler erzählt wurde – vielleicht war ihm einfach noch nicht die Richtige über den Weg gelaufen. Betty hatte noch nie gehört, dass er verheiratet wäre. Er trug doch keinen Ehering, oder?
An der Ausfahrt des Parkplatzes quietschten plötzlich Bremsen. Betty schrak auf. Jetzt erst wurde ihr bewusst, wie intensiv sie an diesen Mann dachte. „Du spinnst doch!“, schimpfte sie mit sich selbst. „Bildest dir womöglich noch ein, dass er ein Auge auf dich geworfen hat!“
Sie empfand keine Spur von Müdigkeit und schaltete den Fernseher ein. Vom Bett aus schaute sie sich einen Krimi und danach noch einen Spätfilm an. Meistens schlief sie während des Fernsehens ein. Heute war nicht daran zu denken. Die halbe Nacht lag Betty schlaflos. Sie schaffte es einfach nicht, ihre aufgescheuchten Gedanken von Gerd Kübler fernzuhalten.
9
Am nächsten Morgen kam sie wie gerädert in den OP. Obwohl sie den Plan gestern eigenhändig an die Tafel geschrieben hatte, musste sie in den Aufwachraum gehen, um nachzusehen, in welchem Saal sie Dienst hatte.
Es war Saal 2. Eine entzündete Gallenblase sollte dort operiert werden. Ihr Herz machte einen Sprung, als sie den Namen des Operateurs las: Dr. Kübler. Betty sollte als Instrumentenschwester assistieren.
Die Patientin war eine noch nicht fünfzigjährige Frau. Sie war ziemlich schlank, was für Frauen, die an der Gallenblase operiert werden mussten, nicht eben typisch war. Dr. Gerd Kübler lächelte Betty freundlich an, als er aus dem Waschraum kam.
„So, dann wollen wir mal anfangen.“ Kübler warf einen fragenden Blick auf den Anästhesisten. Der nickte bestätigend. Die Patientin schlief also. „Licht bitte korrigieren“, wandte sich Kübler an Heinrich Kollmann. Betty reichte ihm zunächst das Skalpell.
Die Bauchdecke war schnell eröffnet. Eine Arztpraktikantin hielt die Haken. Kübler arbeitete flink und präzise. Betty brauchte er kaum Anweisungen zu geben, die Instrumentierung bei Gallenblasenoperationen beherrschte sie im Schlaf. Ab und zu, wenn sie ihm ein Instrument reichte, trafen sie seine blauen, lachenden Augen.
Nach zwanzig Minuten lag die Gallenblase frei. Betty sah, wie Dr. Kübler stutzte. „Herr Kollmann, das Licht etwas mehr nach links, hier auf den unteren Leberlappen.“ Kollmann korrigierte die OP-Lampe, und der Arzt beugte sich tief über die geöffnete Bauchhöhle. „Ach du Schande!“, stöhnte er plötzlich. „Sehen Sie sich das an!“
Alle, die in unmittelbarer Nähe des OP-Tisches standen, starrten mit zusammengezogenen Brauen in die OP-Wunde. Auch Betty. Dort, wo die Gallenblase hätte sein müssen, sah sie nur eine grauweiße, wuchernde Gewebemasse. Kollmann sprach es als erster aus: „Ein Tumor.“
„Gott! Die Frau ist noch keine fünfzig“, entfuhr es der Praktikantin. Sie hatte noch nie einen Tumor bei einem lebenden Menschen gesehen und war ziemlich blass geworden.
„Labor verständigen“, sagte Kübler knapp, und begann das wahrscheinlich bösartige Gewebe von seiner gesunden Umgebung zu lösen. Eine Probe wurde sofort ins Labor gebracht. Niemand um den Tisch zweifelte daran, dass die Frau Krebs hatte, aber der Befund musste durch eine Gewebeanalyse objektiviert werden.
„O je“, seufzte der Chirurg, „die ganze Bauchhöhle ist voll von Wucherungen.“ Er richtete sich auf. „Schwester Betty, würden Sie mir bitte mal den Schweiß von der Stirn wischen?“
Betty nahm ein steriles Tuch und tat ihm den Gefallen. Ihr Atem ging schneller, als sie ihn berührte. Und wieder traf sie das Funkeln seiner Augen. Ein warmer Schauer rieselte ihr durch den Bauch.
„Herr Kollmann, holen Sie doch mal den Oberarzt, der soll sich das anschauen.“ Kollmann ging in Saal 1 und kam kurz darauf mit Dr. Höper zurück. Der warf einen kritischen Blick in die offene Bauchhöhle. „Sieht ja aus wie ein Blumenkohlfeld.“ Er schüttelte resigniert den Kopf. „Schneiden Sie das Gröbste ’raus und machen Sie zu. Da ist nichts mehr zu machen.“ Er ging zurück zu seiner Operation.
Eine bedrückte Stimmung legte sich auf das Operationsteam. Nur das Nötigste wurde gesprochen. Solche schlimmen Befunde, zumal wenn sie sich so unerwartet aufdrängten, waren einfach deprimierend. Dagegen machte noch soviel Routine nicht immun.
„Arme Frau“, Heinrich Kollmann sprach aus, was alle dachten, „schläft mit einer Gallenblasenentzündung ein, und wird mit einem Krebsgeschwür wieder aufwachen.“
Später, die Patientin war bereits im Aufwachraum, bereitete Betty den Instrumententisch für die nächste Operation vor. Kübler stand neben ihr und sah zu.
„Schlimm, nicht?“ Sie nickte. „Ja, Betty, so schnell kann es gehen. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war.“ Sie sahen sich an. Betty fühlte ihren Herzschlag deutlicher, als sonst. „Sie haben Ihre Sache übrigens mal wieder hervorragend gemacht.“ Seine Augen lachten.
„Danke, Herr Dr. Kübler.“ Am Eingang zu Saal 1 sah sie Heinrich Kollmann stehen. Er musterte sie skeptisch.
10
Alexandra schloss ihren Wagen ab und machte sich auf den Weg durch den Krankenhausgarten. Es war gleich vierzehn Uhr. Die Spätschicht würde bald ihren Dienst antreten. Alexandra selbst hatte heute Nachtdienst. Aber für die Zeit des Schichtwechsels hatten sie eine kleine Besprechung anberaumt. Clemens Stellmacher und Herbert Conradi mit ihren Teams und sie wollten die Urlaubspläne für das Spätjahr durchsprechen. Friederichs und Zühlke hatten ihr Zettel in die Hand gedrückt, auf denen sie ihre eigenen Urlaubswünsche notiert hatten. Sie wussten, dass man sich auf die Notärztin verlassen konnte. Sie würde ihre Interessen vertreten.
Im Krankenhausgarten sah Alexandra eine junge Frau aus der Klinik kommen. Lederjacke, kurzes dunkles Haar. Erst als sie näher kam, erkannte sie das Mädchen, mit dessen Freund sie vorgestern in der Patientencafeteria zusammengestoßen war.
Das Mädchen winkte von Weitem. „Hallo, Frau Dr. Heinze.“
„Sie kennen meinen Namen?“
„Ja, die Frau am Kiosk hat Sie doch angesprochen,“ Sie zog eine Geldbörse aus ihrer Jackentasche. „Ich schulde Ihnen noch Geld. Ich wollt’s Ihnen persönlich geben.“
„Sie arbeiten auch hier, nicht wahr? Ich hab’ Sie neulich mal auf der Gyn gesehen.“
„Stimmt, ich will Krankenschwester werden, und bis im Herbst der neue Kurs anfängt, mache ich ein Praktikum. Ich heiße übrigens Monika, Monika Lorenz.“ Sie zählte Alexandra einige Münzen in die Hand. „War übrigens voll nett von Ihnen, uns die Cola zu ersetzen.“
„War doch selbstverständlich.“ Alexandra winkte ab. „Und was haben Sie vorher gemacht, wenn ich fragen darf.“
„Da habe ich eine Lehre als Verkäuferin gemacht“, Monikas Gesicht verfinsterte sich, „war voll Scheiße.“
„Und die Krankenpflege gefällt Ihnen besser?“
„Ja, voll geil.“ Das Mädchen ging weiter und hob die Hand. „Tschüss und vielen Dank noch mal.“ Schmunzelnd betrat Alexandra das Marien-Krankenhaus. Die etwas derbe, manchmal auf wenige, plakative Worte reduzierte Sprache der jungen Generation verblüffte sie immer wieder aufs Neue. Das Mädchen gefiel ihr. Es hatte etwas Verwegenes an sich und schien eine ehrliche Haut zu sein.
Die Besprechung verlief problemlos. Schnell war der Urlaubsplan aufgestellt. Die Wünsche ihrer beiden nicht anwesenden Sanitäter konnten ohne Weiteres berücksichtigt werden. Schon nach einer knappen Stunde verließ Alexandra das Bereitschaftszimmer. Sie war froh, denn sie wollte noch ein wenig schlafen.
An der Pforte holte sie die Post aus ihrem Fach. Als sie an der Patientencafeteria vorbeiging und den Gartenausgang ansteuerte, sah sie Gerd Kübler und Schwester Betty aus dem Aufzug kommen. Kübler tätschelte die Schulter der Schwester, bevor er sich von ihr trennte und in Richtung Ambulanz verschwand.
„Er wird sich doch nicht an Schwester Betty heranmachen“, dachte Alexandra. Sie kannte die OP-Schwester. Eine hübsche Frau, nach der sich die Männer auf der Straße umdrehten. Aber alles andere als eine Frau, die leicht zu kriegen war. Betty hatte ihre Prinzipien, das wusste man im ganzen Marien-Krankenhaus. Sie würde sich ihrer Haut schon zu wehren wissen, da war Alexandra sicher.
11
Johannes von Bellinger stand vor dem Spiegel, der über dem Waschbecken in seiner Kajüte hing. Er legte sich eine rote Fliege an. Glücklicherweise hatte er seine gute Abendgarderobe mit auf die Reise genommen. Ohne Schlips und Kragen wurde man im Kasino nicht hereingelassen.
Draußen, irgendwo auf dem Gelände des Yachthafens, hupte es laut. Johannes bückte sich durch die Kajütentür und ging an Deck. Auf dem Parkplatz neben der Straße erkannte er den großen Ford von Rudi und Carolas Fiesta. „Ich komme gleich!“ Er schlüpfte in sein weißes Jackett, schloss das Schiff ab, und machte sich auf den Weg zum Auto.
Sie begrüßten ihm mit großem Hallo. Caren und Carola küssten ihn auf die Wangen. „Heute lade ich euch zum Essen ein“, sagte Johannes, „mit leerem Magen sollte man nie eine Spielbank betreten, hat mir mein Vater eingeschärft.“
Carola überließ Johannes das Steuer. „Heute bist du mein Chauffeur.“ Sie fuhren nach Aachen. Rudi führte sie in ein griechisches Restaurant in der Innenstadt. Während des Essens beobachtete Johannes Carola. Er hatte ihr gestern angedeutet, dass er nicht daran dachte, sich fest zu binden. Ihr einziger Kommentar war ein verliebtes Lächeln. Er war nicht sicher, ob sie ihn verstanden hatte. Vielleicht musste er noch deutlicher werden.
Das Essen zog sich hin. Rudi gab einige schlüpfrige Witze zum Besten und sorgte für eine ausgelassene Stimmung. Insgeheim beglückwünschte sich Johannes dazu, seinen Aufenthalt noch einmal um einen Tag verlängert zu haben. Gegen neun Uhr stand er auf, ging zur Theke und bezahlte mit seiner Kreditkarte. Eine Stunde später bogen sie auf den Parkplatz der Aachener Spielbank ein.
Sie gingen auf das gediegene, klassizistische Gebäude zu. Eine prickelnde Spannung ergriff sie, als sie zwischen den großen Säulen des Eingangsportals hindurchschritten und das ganz in Marmor gehaltene Foyer betraten.
An der Bank kauften sie Chips. Die Frauen für einige hundert Mark, Rudi und Johannes für jeweils tausend Mark. Dann schlenderten sie durch das Kasino. Es bestand aus zwei großen Sälen, die in einem etwas muffigen Plüschstil der fünfziger Jahre ausgestattet waren. In dem einen hingen protzige Kristalllüster von der Decke, in dem anderen lange, gläserne Gehänge, die von verborgenen Strahlern erleuchtet waren. Der violette Ton der Wände tat ein Übriges, um eine gedämpfte, konzentrierte Atmosphäre zu erzeugen.
Sie schlenderten durch die Säle, blieben an dem einen oder anderen Tisch stehen und beobachteten Spieler und Croupiers. „Kommt, wir setzen uns hier dazu“, flüsterte Carmen. An dem Roulett-Tisch spielten überwiegend Männer und Frauen ihres Alters, also Ende zwanzig, Anfang dreißig. Der Croupier erinnerte Johannes an Albert Einstein – ein befrackter, älterer Herr mit einer grauen Mähne. Sie machte allerdings einen gepflegteren Eindruck als die des Physikers.
„Mindesteinsatz fünf Mark“, flüsterte Rudi, „sollten wir nicht etwas größer einsteigen?“
Carola und Carmen ignorierten seinen Einwand und setzten sich an den Tisch. Die Männer sahen ihnen eine Weile zu und gingen dann zu den Tischen, an denen Black Jack gespielt wurde. „Schau dir diese Frauen an“, grinste Rudi. Die Kartengeberinnen, alles Frauen, hatten Gesichter wie aus Stein gemeißelt. Sie verteilten die Karten mit fast unbeweglichen Oberkörpern, aber mit so flinken Händen, das man ihren Bewegungen kaum folgen konnte.
„Los, Johannes, wagen wir ein Spielchen.“ Sie setzten sich an den Tisch. Johannes verlor dreimal hintereinander jeweils fünfzig Mark. Er warf Rudi einen unwilligen Blick zu. Der hatte wenigstens einmal gewonnen. Dann setze er hundert Mark. Er bekam eine Zehn und einen König auf die Hand und forderte eine dritte Karte. Es war eine Sieben.
„Einundzwanzig!“ Triumphierend sah Johannes die Kartengeberin an. Ihre Miene blieb steinern. „So, jetzt will ich’s wissen“, flüsterte er Rudi zu. Eine warmes Prickeln füllte seinen Brustraum aus, er war plötzlich hellwach, sein Atem ging schneller – die Spielleidenschaft hatte nach ihm gegriffen. Rudi machte große Augen, als Johannes fünfhundert Mark setzte. Die erste Karte war ein schwarzen Ass. Die zweite ein rotes. Johannes strich seinen Gewinn ein. Seine Miene war schon fast so unbeweglich wie die der Kartengeberin.
Von drei weiteren Spielen gewann er zwei. Sie waren noch nicht mal eine Stunde in der Spielbank, da klimperten in Johannes’ Taschen schon Chips im Wert von fast dreitausend Mark.
„Wenn mich nicht alles täuscht, hast du eine Glückssträhne, Mann“, sagte Rudi anerkennend, als sie einen der Roulett-Tische ansteuerten.
„Dann aber schnell zum nächsten Spiel, bevor sie wieder versiegt.“ Johannes wollte sich auf den nächstbesten freien Stuhl setzen.
„Hier gilt ein Mindesteinsatz von fünfhundert Mark“, raunte Rudi ihm zu, „sollten wir es nicht erst Mal mit Hundertern probieren?“
„Dann wäre die Glücksgöttin beleidigt“, grinste Johannes, „die müsste ja den Eindruck kriegen, ich würde ihr misstrauen.“ Er nahm Platz, während Rudi abwartend hinter ihm stehen blieb. Fortuna hielt Johannes die Treue. Nach weniger als zwei Stunden war er um zwanzigtausend Mark reicher.
12
Sie mussten bis um halb zwei warten. Dann erst ging auch das letzte Licht in der Pizzeria aus.
„Also Leute – es kann losgehen.“ Tobias sah in die Gesichter der anderen drei. Sie waren blass. Keiner sagte ein Wort. Sascha und Patrick trugen Leinenbeutel mit dem Werkzeug bei sich. Aus der Brusttasche von Monikas Lederjacke ragte ein Handy. Auch Tobias hatte ein Handy dabei.
„Jetzt scheißt euch nicht in die Hosen. Verlasst euch auf mich, für mich ist das Pipifax.“ Die Prahlerei half Tobias, seine eigene Nervosität zu verbergen. „Los, Moni, auf deinen Posten!“
Das Mädchen verschwand in einem dunklen Hauseingang gegenüber der Pizzeria. Von hier aus sollte sie die Straße im Blick behalten und notfalls eine Warnung über das Handy durchgeben.
Sascha und Patrick folgten Tobias in die nächste Seitenstraße. Von dort gelangten sie über ein Hoftor in den Hinterhof des Grundstücks, das an die Pizzeria grenzte. Es war das Grundstück, auf dessen Haus Tobias’ Firma den Dachstuhl renoviert hatte.
Bald standen sie vor einer Mauer, die den Hinterhof von der Rückfront der Pizzeria trennte. Sie kletterten nacheinander darüber. Mit klopfenden Herzen und dicht an die Mauer gepresst warteten sie ein paar Minuten. Als alles ruhig blieb und nirgends ein Licht aufflammte, schlich Tobias auf die Tür zu, die vom Hof aus in die Küche des Restaurants führte. Mit einem Dietrich öffnete er sie in wenigen Sekunden. Er winkte seine beiden Kumpels heran. Leise schloss er die Tür hinter ihnen.
„Was sagt ihr jetzt? So einfach ist das.“ Er grinste. Die Gesichter der anderen beiden entspannten sich etwas. „Los jetzt, wir gehen ins Lokal.“
Sie betraten den Gastraum. Sascha ließ seine Taschenlampe aufflammen. „Spinnst du!“, fuhr Tobias ihn an und drückt Saschas Hand mit der Lampe hinunter. Er wählte die Nummer von Monikas Handy. „Hast du Licht gesehen?“ Monika verneinte. „Wir schalten noch einmal eine Lampe an, achte drauf, ob die Fenster dicht sind.“ Er ließ seine Stablampe aufflammen. „Und?“
„Am rechten Fenster sah man einen Lichtschein durch den Rollladen“, kam Monikas Flüstern aus dem Handy. Tobias zog den Vorhang zu und wiederholte den Lichttest. „Und jetzt?“
„Nichts mehr zu sehen.“
„Gut, dann fangen wir an.“ Er steckte das Handy weg und beleuchtete die beiden Spielautomaten. „Jetzt zeige ich euch erst einmal, wie man so ein Ding hier knackt.“
Sascha und Patrick stellten sich neben ihn an die Spielautomaten. Tobias reichte Sascha die Stablampe und zog einen Draht aus einer der Leinentaschen. Er schaltete den Automaten ein und fütterte ihn mit ein paar Münzen. „Ein bisschen was muss man immer investieren“, grinste er.
Während die Symbolräder rotierten, führte er den Draht vorsichtig in den Münzausgabeschlitz. Dann holte er eine Batterie mit einem Schalter aus der Tasche und schloss den Draht an. „So, jetzt tricksen wir die Elektronik aus.“ Er drückte den Schalter über der Batterie – der Automat spuckte ein Fünfmarkstück aus. Er drückte ein zweites Mal – wieder fünf Mark.
Die beiden anderen machten große Augen. „Geil!“, flüsterte Patrick. Nach zehn Minuten lag das Ausgabefach voller Münzen. Über vierhundert Mark insgesamt.
„Beim anderen probierst du es mal“, Tobias drückte Patrick den Draht in die Hand. „Woher hast du den?“, staunte Sascha.
„Beziehungen“, antwortete Tobias. „Kostet ein paar Riesen“, er zuckte mit den Schultern, „aber wer nichts investiert, verdient nichts.“
Patrick brauchte ein paar Minuten länger. Aber schließlich hatten sie auch den zweiten Apparat um seine Fünfmarkstücke erleichtert. Sie verstauten die Münzen in einer großen Geldtasche. „Jetzt suchen wir die Kasse.“ Tobias ging zur Theke und begann die einzelnen Fächer und Schubladen zu durchwühlen.
„Sollten wir nicht wieder verschwinden?“ Sascha war furchtbar nervös. „Wir haben doch schon über achthundert Mark.“
„Quatsch!“, rief Tobias. „Reiß dich zusammen, Kerl! Wir haben doch erst angefangen.“
Sie mussten lange suchen, bis sie die Kasse fanden. Sie befand sich in einem abschließbaren Schrankfach in der Küche. „Na also“, triumphierend sah Tobias seine Komplizen an, „so einfach ist das. Man darf nur nicht zu schnell aufgeben, das machen nur Amateure.“
Er stellte die Kasse vor Patrick auf einen Tisch und kramte einen Bund mit Schlüsseln verschiedener Stärken und Längen heraus. Auch ein verstellbarer Dietrich war dabei. „Versuch du mal die Kasse zu knacken.“ Er fasste Sascha am Jackenärmel. „Und ich zeig’ dir inzwischen, wie man einen Zigarettenautomaten behandelt.“
13
„Hallo, Schwester Betty!“ Es war schon nach Mitternacht. Die Rettungsleitstelle hatte einen Zugang angekündigt, einen Jungen mit akutem Blinddarm, und Betty stand in Saal 1, um den Instrumententisch für die Operation vorzubereiten. Dr. Gerd Kübler lehnte im Türrahmen zum Waschraum. „Der Blinddarm ist im Städtischen gelandet. War scheinbar sehr dringend, und die Leute wohnen direkt neben dem Städtischen.“
Betty seufzte. „Jetzt bin ich umsonst aufgestanden.“ Sie begann, die Instrumente zurück in die Trommel zu legen.
„Tut mir leid“, sagte Kübler, „ich bin vorsichtshalber noch gar nicht ins Bett gegangen und hab’ ein paar Entlassbriefe diktiert.“ Er kam auf sie zu. „Kann ich Ihnen helfen?“ Gemeinsam räumten sie auf und verdunkelten den OP-Saal. „Schade, jetzt haben wir doch nicht das Vergnügen miteinander“, bedauerte Kübler.
„Die Nacht ist noch lang, Herr Dr. Kübler“, sagte Betty, „da kann noch viel passieren.“ Sie ging ins Dienstzimmer, um die schon eingetragene Notoperation wieder aus dem Berichtsheft zu streichen. Der Arzt folgte ihr.
Er beugte sich über das Heft. „Wissen Sie eigentlich, dass Sie eine sehr interessante Handschrift haben, Betty?“
„Interessant?“ Sie sah sich ihre Notizen an. „Finden Sie?“
„Ja, immer wenn Sie den OP-Plan auf die Wandtafel schreiben, denke ich das. Ihre Schrift erkenne ich sofort.“
Betty sah den Arzt skeptisch an. „Ehrlich?“ Er nickte, und sie fühlte sich geschmeichelt. „Was ist denn daran so interessant?“
„Sie haben ein sehr klares, geradliniges Schriftbild.“ Er nahm das Heft in die Hand und setzte sich zu ihr an den Tisch. „Eine richtige Charakterschrift. Das spricht für eine ausgeprägte Persönlichkeit. Jemand, so schreibt, hat wahrscheinlich feste Grundsätze und weiß, was er will.“
Betty dachte nach. „Da ist etwas dran“, lächelte sie.
„Und dann diese feinen, kleinen Buchstaben“, fuhr Kübler fort, „das spricht für eine hohe Sensibilität.“ Kübler sah sie an. Seine blauen Augen schimmerten sanft. Betty wurde es heiß und kalt. „Aber um das zu wissen, muss man nur in Ihr Gesicht schauen, Betty. Wer ein bisschen Menschenkenntnis hat, kann in Ihren Augen lesen, dass Sie ein weiches, einfühlsames Herz haben.“
Betty wurde rot. „Sie machen mich verlegen, Dr. Kübler.“ Sie fühlte sich plötzlich sehr wohl in der Gegenwart des Arztes. „Danke.“
Eine Zeitlang saßen sie einfach nur da und schwiegen. Kübler zündete sich eine Zigarette an. „Wollen Sie auch eine?“ Betty, die vor einer Viertelstunde noch nur den Wunsch hatte, endlich ins Bett zu kommen, empfand plötzlich keine Spur von Müdigkeit mehr. Sie nahm eine Zigarette und ließ sich von ihm Feuer geben.
„Haben Sie eigentlich Familie, Dr. Kübler?“
„O je, Familie“, er lächelte etwas wehmütig. „Ich hab’s mal probiert, aber bei mir hält’s keine Frau lange aus. Ich bin seit drei Jahren geschieden. Einen Sohn habe ich. Ich glaube, ich tauge nicht für die Ehe.“ Er lehnte sich zurück und blies den Rauch an die Decke. „Ehrlich gesagt, ich habe sogar ein wenig Angst davor.“
„Vielleicht ist Ihnen nur noch nicht die Richtige begegnet.“ Kaum war ihr der Satz von den Lippen, fühlte Betty ihr Herz klopfen. „Hoffentlich bin ich jetzt nicht zu weit gegangen“, dachte sie.
Kübler lächelte. „Vielleicht haben Sie recht, Betty.“
Sie wich seinen blauen Augen aus. Die Anziehungskraft, die von diesem Mann ausging, wurde mit einem Mal so stark, dass Betty unruhig auf ihrem Stuhl hin und her rutschte. „Mach dass du aus seiner Nähe verschwindest“, rief eine Stimme in ihr. Und eine andere raunte ihr zu: „Ich würde ihm gern noch viel näher kommen.“
Kübler drückte seine Zigarette aus. „Ich werde jetzt schlafen gehen.“ Er stand auf und sah sie an. „Sie brauchen keine Angst vor mir haben, Betty, wirklich nicht. Gute Nacht.“ Dann verließ er den Raum.
Betty lauschte seinen Schritten nach. Die große Tür des OP-Traktes schloss sich mit einem leisen Klicken. Sie löschte das Licht und machte sich auf den Weg in ihr Zimmer. Ihre Knie waren weich, und sie ging wie auf Watte. In ihrem Bauch brannte ein Gefühl, das sich nicht mehr löschen ließ. „O Gott“, murmelte sie, während sie durch den Krankenhausgarten ging, „jetzt habe ich mich doch verliebt in den Mann.“
14
Der Croupier zog die Chips auf Schwarz. Es waren mindestens zehntausend Mark. „Rien ne vas plus!“, schnarrte er und setzte die Scheibe in Bewegung. Johannes von Bellinger starrte unentwegt auf das rotierende Rad, die Welt war für ihn zusammengeschrumpft auf diesen Tisch, auf das Pokergesicht des alten Herrn ihm gegenüber, auf dessen schwarze Kelle, mit der er die Chips bewegte, und auf den Spielplan mit den roten und schwarzen Feldern und den Zahlen von 0 bis 37. Alles andere war wie ausgeblendet.
Johannes hatte auf die kleinen und die geraden Zahlen gesetzt. Die Scheibe verlangsamte sich, die Kugel sprang in eines der siebenunddreißig Fächer.
Die Achtzehn gewann, die höchste der kleinen Zahlen. „Pair et manque“, schnarrte der Croupier. Caren und Carola, die hinter Johannes standen, applaudierten. Der Croupier schob ihm einen gewaltigen Haufen Chips zu.
„Gratuliere“, sagte Rudi leise, „du hast doch schon mindestens fünfundzwanzigtausend gewonnen.“
„So ungefähr“, murmelte Johannes und sortierte seine Chips, „zwei Möglichkeiten bieten sich an: Aufhören oder jetzt erst recht.“
„Was würde wohl die Glücksgöttin sagen?“, grinste Rudi.
„Tja, was würde sie wohl sagen?“ Johannes spielte weiter. Der Croupier zuckte kurz mit den Augenbrauen, als er sah, wie der junge Mann einen großen Stoß Chips auf Schwarz und auf die Null schob.
Eine Stunde verging. Es war schon nach Mitternacht. Johannes war wie im Fieber. Nur ein einziges Mal noch gewann er. Danach verlor er Spiel um Spiel. Sein Gewinn schrumpfte atemberaubend schnell auf die lächerliche Summe seines Anfangseinsatzes zusammen. Der Croupier sah ihn mit hochgezogenen, weißen Brauen an.