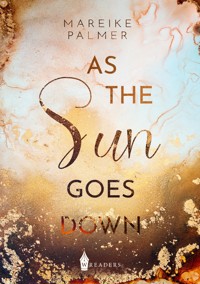
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sie ist stark geschminkt, trägt eine Perücke und ein Kostüm, sie schwebt viele Meter entfernt von mir in der Luft, aber an ihrem Lächeln würde ich sie überall wiedererkennen.« Im gleißenden Scheinwerferlicht einer Zirkusvorstellung soll sich das Schicksal von Sam und Martha entscheiden. Sie verzaubert das Publikum mit ihrem grazilen Tanz am Vertikaltuch, sein Atem stockt verräterisch. Doch eigentlich beginnt ihre Geschichte viel früher: Im Spätsommer lernen sie sich auf einem Campingplatz kennen. Zwischen Stockbrot und Waldspaziergängen verdreht Martha Sam den Kopf, nur um ihn am Tag ihrer Heimreise fallenzulassen. Sam rutscht in ein Loch aus Liebeskummer, bis sein bester Freund ihn zu einem Ausflug in den Zirkus überredet – wo er Martha wiedersieht und beginnt, um eine zweite Chance zu kämpfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bereits veröffentlichte Titel der Autorin
Mein Eskapismus (Hier findest du die Vorgeschichte von Marie)Reichtum, Sündenböcke und MakrelenTotenkälteBrandmal: Das Feuer in mirWREADERS TASCHENBUCH
Band 258
Dieser Titel ist auch als E-Book erschienen
Vollständige Taschenbuchausgabe
Copyright © 2025 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena WeinertBestellung und Vertrieb: epubli, Neopubli GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Jasmin Kreilmann
Lektorat: Svea-Magdalena Lehmann, Sina Kleber
Satz: Elci J. Sagittarius
www.wreaders.de
Für Alma.
Ohne den Platz auf deinem Sessel, ohne deine Zeit und
deinen Tee wäre dieses Buch wahrscheinlich immer noch nicht fertig.
Prologim braunen Ledersessel
26.08.2016
Wie fühlst du dich heute?«
»Eigentlich ganz gut. Ich verstehe nicht ganz, warum ich hier bin.«
»Deine Eltern haben beschlossen, dass du eine Therapie beginnst.«
Respekt. Selten schafft es jemand, mir schon nach einer Begrüßung und zwei Sätzen derart auf den Sack zu gehen, dass ich am liebsten die Augen verdrehen und ihm die Meinung geigen würde.
Doch statt meine Gedanken auszusprechen, versinke ich brav in diesem viel zu großen Sessel, der ein Gefühl von Geborgenheit bei mir auslösen soll, es aber nicht tut. Ich begehre nicht auf, sondern mache alles so, wie es von mir erwartet wird. Je schneller der Therapeut zu dem Schluss kommt, dass ich eine ganz normale Jugendliche bin, desto eher bin ich hier raus.
»Das haben meine Eltern mir schon erzählt. Aber es ist doch alles in Ordnung. Ich bin nicht schlecht in der Schule, ich habe Freunde, mit denen ich fast jeden Tag ins Freibad gehe. Wir springen vom Fünfer und auf den Sandplätzen spielen wir Volleyball … na ja, ich bin meistens der Schiedsrichter.« Der Mann verzieht keine Miene. Ich könnte mich dafür boxen, dass meine Stimme zu dünn klingt, als ich hinzufüge: »Ich bin glücklich, wirklich. Warum soll ich meine Sommerferien hier drinnen verbringen?«
Statt auf meine Frage zu antworten, streicht der Mann vor mir über seine Halbglatze und notiert sich ein paar Worte. Sofort hinterfrage ich, ob ich nicht zu viel gesagt habe.
»Vielleicht erzählst du mir erst einmal etwas über dich.«
Unbehaglich rutsche ich hin und her. Meine Oberschenkel kleben an dem hellbraunen Leder unter mir. Es ist eindeutig zu heiß für diesen kleinen Raum. Die Sonne brennt ohne Erbarmen auf die vorhanglosen Fensterscheiben und lässt mich an Ort und Stelle zerfließen. Als meine Konzentration mühsam zu meinem Gegenüber zurückkehrt, lässt mich sein grauer Blick durch die schmale Doktorenbrille dennoch frösteln.
»Ich bin Samantha Werner«, höre ich mich selbst im nächsten Moment sagen. »Ich bin siebzehn Jahre alt.«
»Das meine ich nicht. Wie du heißt, wie alt du bist, welche Blutgruppe du hast, das kann ich alles deiner Akte entnehmen. Ich meine, dass du mir etwas über dich erzählen sollst. Über deine Lieblingsfächer, über deine Hobbys und Freunde, deine Freizeit.«
Kurz kneife ich die Augen zusammen, frage mich, ob ich ihm die Freibad-Sache noch einmal erklären soll. Dann entscheide ich mich aber zu einem bewusst gelassenen Tonfall. »Klar, kein Problem.«
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Der Blick dieser grauen Augen fährt mir jedes Mal ins Mark, wenn ich ihn kreuze, also versuche ich, ihm auszuweichen. Stattdessen lasse ich meine Augen über das Hemd wandern, das dem Therapeuten über dem Bauch spannt, und über die schlichte Wand mit einem historisch anmutenden Anatomieposter hinter ihm. Letztendlich bleibt mein Blick an der kleinen Plastikpflanze auf dem Schreibtisch hängen. Sie soll eine Orchidee imitieren, scheitert dabei meiner Meinung nach aber kläglich. »Ich liebe Biologie, nach dem Abi bewerbe ich mich gleich für ein Studium. Ich verbringe gern Zeit draußen, dann zeichne ich Pflanzen und genieße die frische Luft im Wald. Und ich esse gern, wie unschwer zu erkennen ist.«
Mit einem vielsagenden Grinsen lege ich mir die Hand auf den Bauch und versuche dabei, das ungute Gefühl wegzudrücken. Da kommt mir der Gedanke, dass meine Eltern bestimmt glauben, dass ich essgestört bin, weil ich in letzter Zeit so viel zugenommen habe. Sofort muss ich laut auflachen.
»Bin ich hier, weil ich in letzter Zeit so viel futtere? Da brauchen meine alten Herrschaften sich aber keine Sorgen zu machen, wenn ich will, trainiere ich das alles wieder ab.«
Damit kann ich dem steifen Gesicht doch tatsächlich ein Lächeln entlocken. »Ich glaube nicht, dass es darum geht. Du verbindest deine Mahlzeiten offensichtlich mit etwas Positivem. Es hört sich nicht an, als hättest du ein ungesundes Verhältnis zu Nahrungsmitteln.«
»Na, dann sehen Sie ja selbst, dass alles in Ordnung ist.«
Gerade glaube ich, die Kurve gekratzt zu haben und in meinen restlichen Sommer entlassen zu werden, da stellt er aus dem Nichts die nächste seltsame Frage: »Wie würdest du dich selbst beschreiben?«
»Wahrscheinlich als kleiner verfressener Besserwisser. Also das Beste, was meinen Eltern passieren konnte.«
Diesmal lächelt er nicht. »Und wie sieht es in der Schule aus? Bist du mit deinem Freundeskreis zufrieden?«
»Klar, die Jungs sind super. Wir zocken nach dem Unterricht ganz gern und spielen im Sommer immer Volleyball im Freibad, wie ich ja schon gesagt habe.«
Der Mann zieht seine linke Augenbraue in die Höhe. »Du hast nur Jungen als Freunde?«
»Ich denke nicht, dass etwas falsch daran ist.«
»Natürlich nicht. Aber wie sieht es dann mit einem Freund aus?«
Schweigen. So langsam bekomme ich einen Riecher dafür, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickelt. Angespannt überlege ich, was ich antworten kann, während sich die Halbmonde meiner Fingernägel schmerzhaft in meinen Handteller bohren.
Die Halbglatze kommt mir zuvor: »Traust du dich nicht, einen Jungen anzusprechen, weil du kurze Haare hast und ein wenig im Übergewicht liegst?«
Ein Schauer des Unbehagens kriecht meinen Nacken herauf und ich muss meine Kinnlade ermahnen, an Ort und Stelle zu bleiben. Am liebsten würde ich diesem Typen ins Gesicht sagen, dass meine Persönlichkeit und mein Selbstbewusstsein nichts mit meinem Körper zu tun haben. Stattdessen mime ich die Vorsichtige, auch wenn es in mir zu brodeln beginnt: »Nein. Ich spreche keinen Jungen an, weil ich eine Freundin habe.«
Die unangenehme Spannung in der Luft verstärkt sich zu einem elektrisierenden Knistern. »Eine Freundin also. Deine Eltern hatten mich bereits über deinen bisexuellen Onkel und deine gute Bindung zu ihm aufgeklärt.« Der Mann sortiert seine Blätter auf dem Tisch, schließt meine Akte. »Ich schätze, da muss ich dich zu einem Kollegen überweisen.«
Mein Blick folgt dem ersten Instinkt zur Tür und in meinem Kopf ploppt das Bild von einem Beutetier auf, das dem Jäger in die Augen sieht, wohl wissend, dass es in der Falle sitzt. Das ungute Gefühl wächst zu einem Luftballon an Emotionen in meinem Bauch heran, der mit jedem Moment mehr zu platzen droht. Ich atme einmal kurz durch, dann frage ich möglichst kontrolliert: »Und wo genau besteht da jetzt Therapiebedarf?«
»Du brauchst keine Angst zu haben, Samantha. Ich merke doch an deiner Reaktion, dass du weißt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Aber wir kriegen das wieder hin. Du bist noch jung, du kannst noch geheilt werden. Wir können ihn dir noch austreiben.«
Mein Mund trocknet aus und das Brodeln in mir verwandelt sich für einen kurzen Moment in Angst, die mir den Atem raubt. In mir kämpfen so viele Emotionen um die Oberhand, dass meine Lungen rebellieren. Ich will diesem Glatzkopf den Schädel zerdeppern, will ihn anschreien und ihm auf sein gottverdammtes Butterbrot schmieren, dass mit seiner Denkweise etwas nicht in Ordnung ist. Gleichzeitig verspüre ich die seltene Hoffnung, dass es da doch jemanden geben muss, der mich vor diesem Monster und seinem Kollegen beschützt. Dass ich nicht allein vor dieser riesigen Wand stehe, die droht, auf mich zu fallen und mich zu zerquetschen.
Ich glaube, der Luftballon ist geplatzt. An meinen zuckenden Muskeln spüre ich, dass tausend Emotionen die Schranke in meinem Hals überbrückt haben und hochkochen. Irgendwie schaffe ich es noch, eine letzte Frage auszustoßen: »Austreiben? Wen denn?«
»Satan natürlich. Den Teufel höchstpersönlich.«
1Drei Wörter und ein Gedicht
26.08.2019
Der Trubel um mich herum berauscht meine Sinne und ich zücke mein Smartphone, um mit den letzten Prozenten Akku den Moment einzufangen. Ein Marktschreier, der seine Pflaumen bewirbt. Ein Tuchhändler, der eine heruntergefallene Rolle aufhebt. Eine sechsköpfige Familie, die sich an mir vorbeidrängt, und der Duft nach gebrannten Mandeln im Sommer. Das Gurgeln der Kelle, mit der eine alte Dame mit rotem Kopftuch ein paar Gurken aus der Brühe im Fass schöpft.
Und dann ist da diese eine Frau.
Ich kenne sie gerade mal seit drei Tagen. Ich weiß wenig über sie, aber ich mag es viel zu gern, wie sie jeden Morgen ihre Nase grinsend in die Sonne streckt, wie sie gestern ausgelassen ein Büschel mit Sauerampfer und Klee für unseren Kräuterquark gepflückt hat. Ihr Lachen ist es, und die Art und Weise, wie die Lachfältchen ihr Gesicht strahlen lassen. Dieses Lachen und diese verdammten Fältchen gehen mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich lebe wie in einer Blase, die von Glücksgefühlen und dem Geschrei der Händler belebt wird. Eine berauschende Kuppel über mir, gefüllt mit Mandelduft, mit Sommersonne, die mir auf der Nase kitzelt, und all den anderen unbeschreiblichen Gefühlen, die meine Handykamera nicht einfangen kann.
Als ich mich den anderen im Camp angeschlossen habe, hätte ich nicht gedacht, dass mich ein Haufen so unterschiedlicher Charakterköpfe so glücklich machen könnte. Ich bin lediglich hier, weil mein Therapeut es mir geraten hat.
›Vielleicht kannst du dann unter dieses düstere halbe Jahr einen Schlussstrich ziehen. Jeder von ihnen hat selbst einen schweren Rucksack zu tragen, ihr könnt alle ein wenig Raum für Gedanken und neue Bekanntschaften gebrauchen. Du könntest einfach eine gute Zeit haben. Zwei Wochen lang zelten, am Lagerfeuer sitzen, Stockbrot backen, Nachtwanderungen auf die Beine stellen und im nächsten Teich baden. Einfach wieder ein Kind sein, ein ganz normales Kind in einem ganz normalen Feriencamp.‹
Es funktioniert. Tag drei und in meinem Kopf sind keine Sorgen, nur der Markt und die Frau und die zuckersüße Pflaume, die mich der Händler probieren lässt.
Ich habe das Gefühl, all diesen Charakterköpfen im Camp so nahezustehen, dabei kenne ich sie kaum. Am ersten Abend haben wir nicht einmal versucht, uns über Krankheiten oder Leidenswege auszutauschen. In einer Sache sind wir uns alle einig: Dass dies Themen sind, die wir zumindest die ersten Tage ausblenden wollen. Stattdessen haben wir uns einander vorgestellt, wie Kinder in einem Camp es eben tun. Mit ein paar passenden Adjektiven zu unseren Namen und einem Wollknäuel, das über die Lichtung geworfen wurde. So wurde ich der sachkundige, stolze und startklare Sam. Die anderen beiden Männer sind der fragile, famose, fehlerhafte Finn und der hemmungslose und hastige Henry, dessen Persönlichkeit das Wort haarsträubend besser beschrieben hätte.
Henry reißt mich aus den Gedanken an unser Kennenlernen, indem er mir auf die Schulter tippt. Überrumpelt sehe ich sein breites, freches Grinsen, bevor mein Blick seiner Hand folgt, die sich in eine ebenfalls haarsträubende Stoffrolle krallt. Kribbelbunt, dicker Faden, etwas grob gewebt. Auf eine seltsame Weise passt der Stoff zu ihm.
Ich wende mich schon ab, da bekomme ich aus dem Augenwinkel noch mit, wie Finn sich schattenhaft neben Henry und die Stoffrolle stellt. Auf Henrys Frage zu seiner Meinung antwortet Finn nur mit einem Schulterzucken. Wenn etwas aus seinem Mund kommt, und das kommt höchstens zweimal pro Stunde vor, dann ist es immer etwas Positives. Ich schätze, dem kribbelbunten Fetzen kann er einfach nichts abgewinnen.
Während Henry sich überschwänglich bei Finn unterhakt und ihn zu einem Olivenstand weiterzieht, stehe ich immer noch da, ganz in meiner Blase versunken, die eine Hand in der Jackentasche. Ich beobachte. Das hat mich das Biologiestudium gelehrt. Dem Aufmerksamkeit zu schenken, was gemeinhin als Kleinigkeit abgetan wird. Ich betrachte eine Wespe, wie sie erst über einem Stück Streuselkuchen sirrt, um dann zu landen und sich mit ihren Beißwerkzeugen durch die Streusel hinunter bis auf die süße Füllung des Kuchens zu arbeiten. Mit einem dicken Brocken Beute hebt das kleine Stechmonster schwerfällig ab. Ich verfolge die plumpe Flugkurve bis zu einer lockigen Haarsträhne, die der Wind sich zu eigen macht.
»Ist dir kalt?« Ihre Worte reißen mich aus meiner Konzentration. Erst jetzt erkenne ich sie. Wie schnell man doch den Blick für das große Ganze verliert.
Ich bin überrascht, dass sie mich anspricht. In der Vorstellungsrunde hat sie scharf kritisiert, dass es viel zu wenige positive Adjektive mit M gibt. Deswegen ist sie einfach nur Martha. Seitdem haben wir nicht miteinander gesprochen, weshalb es mich umso mehr überrascht, dass Martha jetzt vor mir steht und mich aufmerksam mit ihren dunkelbraunen Augen betrachtet. Auf ihrer Haut schimmert der goldene Glanz der Nachmittagssonne.
»Eigentlich nicht.«
»Warum bist du dann hier festgefroren?«
»Ich bin zu überwältigt.«
»Davon, dass ich dich angesprochen habe?«
»Auch. Das hast du bisher nicht gemacht.«
Ein Lächeln, ich habe ihr Lächeln herbeigerufen, das mir schon seit drei Tagen nicht mehr aus dem Kopf geht. Ein warmes Gefühl der Freude breitet sich in mir aus.
»Weil es keinen Anlass dazu gab. Aber jetzt stehst du hier und machst den Anschein, abgeholt werden zu wollen.«
Ich spiegele ihr Lächeln, vielleicht nicht ganz so sanft und herzlich wie sie, doch ich gebe mir die größte Mühe. »Und wo gehst du mit mir hin, jetzt, wo du mich abgeholt hast?«
»Ich bin keine Frau, die große Worte braucht.«
Während ich noch darüber nachdenke, hakt sie sich bei mir unter und gibt mir zu verstehen, in welche Richtung sie möchte. Ich folge ihr blindlings durch eine Straße voller Marktschreier, die ich nur gedämpft mitbekomme, so sehr bin ich in ihren stillen Bann gezogen.
Sie fasziniert mich. Es ist kein Gefühl der Verliebtheit, das mich durchströmt. Das würde ich wiedererkennen, ohne Frage. Es ist einfach nur Faszination, mit der sie mich einen Meter um den anderen durch die enge Gasse zieht. Auf unserem ganzen Weg tauschen wir kein weiteres Wort. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Wenn ich in Zukunft auf diesen Moment zurückblicken werde, werde ich mit einem Schmunzeln denken, dass der Sam auf dem Markt sich noch an die Ruhe gewöhnen wird und auch daran, Marthas stille Sprache zu verstehen.
Sie zieht so sehr meine Aufmerksamkeit auf sich, dass ich ganz aus meiner Beobachterrolle falle. Zu viele meiner Sinne sind an der blanken Faszination festgenagelt. Die anliegenden Häuser, die Balkone mit den Gitterstreben und herabhängenden Pflanzen, die vielen Stände mit den Kürbissen und Birnen, die unregelmäßige Pflasterstraße unter unseren Füßen, all das wirkt noch viel magischer auf mich, jetzt, wo ich meinen Moment mit ihr teilen kann.
Ich bekomme fast gar nicht mit, wie wir den Markt verlassen und unseren Schlendergang unter einer Reihe perfekt angepflanzter Bäume fortsetzen, bis der Trubel in meinem Kopf von einem befreienden Gefühl abgelöst wird.
So sehr ich die Enge und die Vertrautheit genieße, umso mehr liebe ich die Freiheit. Meine Lungen saugen die Luft tief in sich hinein, bringen mir eine Erlösung, nach der ich nicht einmal gesucht habe. Ich nehme einen Atemzug, ich nehme einen zweiten, dann macht sie Anstalten, sich langsam von mir zu lösen.
Mit Bedauern sehe ich ihrer Wärme hinterher, wie sie sich unter einem Geländer hinwegduckt, von dem der blaue Lack blättert. Ehe ich mich versehe, sitzt sie auf dem oberen Ende der Betonwand, die den Kanal in Schach hält, und stützt sich lässig mit den Händen hinter ihrem Rücken ab. Es ist ein schönes Bild, das ich einige Augenblicke auf mich wirken lasse, bevor ich ihr folge.
Ihre Augen sind geschlossen, doch ihr Gesicht ist der Sonne zugewandt. Immer, wenn ich an sie denke, sehe ich sie genau so vor meinen Augen: Frei, genießerisch, die Augen gegen die Sonne leicht zusammengekniffen.
Normalerweise habe ich oft an einer Situation etwas auszusetzen. Ich verbessere gern Menschen, wenn sie etwas wissenschaftlich Inkorrektes sagen. Und ich gebe gern meinen Senf dazu, auch wenn es vielleicht nicht immer erwünscht ist. Komisch. Jetzt habe ich ausnahmsweise mal nicht das Gefühl, die Menschen um mich herum zu schlaueren Wesen zu machen zu müssen. Die Schweigsamkeit färbt ab.
»Von Glanz, Farben und Geborgenheit:
So scheint der Glanz auf dein Gesicht,
so spürst du Wärme vom haltenden Geist.
Genießt du der Klänge Farben nicht,
dann will ich dennoch, dass du weißt:
Du bist geborgen.«
»Von wem ist das?«, frage ich.
Statt einer Antwort deutet sie nur in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ich belasse es dabei, auch wenn die Neugier in mir schreit, noch einmal nachzufragen. Doch ich schlage die Begierde breit und konzentriere mich wieder auf mein Umfeld. Auf den Kanal und den Himmel, den ein paar hellgraue Schäfchenwolken zieren.
So lasse ich einige Minuten vergehen, ehe ich mich ihr zuwende. Eine leichte Brise spielt mit ihren schwarzen Locken, ihre schönen Augen sind auf etwas tief unter uns gerichtet. Ich folge ihrem Blick. Sie fixiert einen Punkt im still dahinfließenden Wasser zu unseren Füßen und sieht so lange hinunter auf den Kanal, dass ich fast dem Glauben verfalle, dass sie da unten mehr als die braune Brühe erkennt. Fiebrig denke ich darüber nach, was sie dort erblickt haben könnte. Vielleicht einen Fisch oder einen Einkaufswagen, den Jugendliche in ihrem Übermut von der Kante gestoßen haben. Doch so sehr ich meine sonst so scharfen Augen bemühe, sie möchten nicht das erfassen, was die schöne Frau neben mir unter der beinahe glatten Oberfläche sieht.
Es dauert seine Zeit, bis bei mir der Groschen fällt. Sie schaut nicht das Wasser an, jedenfalls nicht direkt. Stattdessen betrachtet sie unser Spiegelbild. Mehr noch, mich sieht sie dort unten an. Sieht, wie ich sie seit Minuten anstarre und zu begreifen versuche, was meinen Augen entgeht. Meine Wangen werden rot.
Ich atme zischend aus und stütze meine Hände zu beiden Seiten auf dem Beton neben mir ab, neige mich ein Stückchen vor und unserem Ebenbild im Wasser entgegen. »Was gibt es da zu starren?«
Ihr Spiegelbild grinst. »Dieselbe Frage könnte ich dir stellen.«
»Warum lässt du mich dann zuerst fragen? Wolltest du mich auflaufen lassen?«
Mit einem nachdenklichen Blick wiegt sie den Kopf von der einen Seite auf die andere. »Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich das Spiel genossen. Dass wir uns gegenseitig ansehen und du es nur noch nicht weißt.«
Mir stellt sich die Frage, was für ein Spiel das sein soll. Aber ich weigere mich, die Worte über meine Lippen kommen zu lassen. Vielleicht bin ich zu starrköpfig, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst zu ihr sagen könnte. Statt eine Antwort zu geben, ziehe ich die leicht modrige Kanalluft tief in meine Lungen ein und richte meinen Blick gen Himmel. Würde ich sie jetzt weiter anstarren, würde sie nur ihr Spiel gewinnen. Nicht, dass ich es ihr nicht gönnen würde. Vielleicht brauche ich einfach etwas Zeit, bevor ich mich auf eine weitere Konversation mit ihr einlassen kann. Das alles kam so plötzlich. Dass wir hier sitzen und dass sie überhaupt mit mir redet, dass sie selbst die Initiative ergriffen hat.
Die Zeit, die uns noch bleibt, bevor wir mit den anderen den Rückweg zum Camp antreten, verbringen wir in unseren Gedankenwelten. Meine Glieder sind schon ganz steif, als sie aufsteht und mir die Hand reicht. Ich lasse mir von ihr aufhelfen und für einen Augenblick ist sie mir körperlich so nah, dass sie Teil meiner Blase wird. Ihr Geruch erinnert mich an Zedernholz. Sofort verbinde ich ihn mit ihrem Namen: Martha, die nach Zedernholz duftet.
Auf dem Weg zu den anderen verstehe ich das Gedicht von Glanz, Farben und Geborgenheit. Die schönen Worte stammen von einem Platz mit zwei Kissen auf dem Pflasterboden, noch vor den ersten Ständen des kleinen Markts. Auf dem einen Kissen sitzt ein junger Mann mit einem schwarzen Bart und einer Hornbrille mit quadratischen Gläsern. Vor ihm, auf dem anderen Kissen, steht eine große Schreibmaschine, so alt, dass sie sicher mindestens einen Weltkrieg überlebt hat. Vorhin sind wir einfach an der Stelle vorbeigegangen. Ich war so abgelenkt von Martha, dass ich den Künstler gar nicht bemerkt habe, bei dem sie schon gewesen sein muss, bevor sie mich angesprochen hat. Das Duo auf den Kissen passt so gut zur Stimmung dieses engen Gässchens, zu den Mandarinenständen und dem Mandelduft, zu dem wespenumschwirrten Pflaumenkuchen und den grob gewebten Stoffrollen.
Erst als wir an dem jungen Mann vorbeilaufen, erkenne ich die Schrift auf dem Pappschild, das von vorn an seine Schreibmaschine angelehnt ist: Gib mir drei Wörter, dann schenke ich dir ein Gedicht.
Glanz, Farben und Geborgenheit. Ihre drei Wörter.
2Die unendliche Tiefe eines Teichs
Als ich zurück in unser Zelt komme, erschlägt mich der Anblick von Henrys Schlafecke. Seine Luftmatratze ist unter einem Haufen von Klamotten, Snacks und Kissen begraben. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, frage ich mich, wie er darunter schlafen kann und wann erste wilde Tiere vom Duft der verstreuten Süßigkeiten angelockt werden.
Während ich noch mit mir selbst Wetten abschließe, wann wir einen erbitterten Krieg gegen die Ameisen führen werden, kommt der Urheber allen Chaos in unser Zelt und setzt sich auf seinen Haufen. Folgendermaßen beweist Henry, dass er gleichzeitig sprechen und sich gezuckerte Gummibärchen in den Mund stopfen kann: »Kommst du mit zum Teich, Bruder?«
Ich verdrehe die Augen, weil er mich immerzu Bruder nennt. Manchmal glaube ich, kein Satz von ihm kann anders beginnen oder enden. »Wann geht ihr los?«
»Wir dachten, vielleicht so in ’ner halben Stunde. Wenn alle ein bisschen gechillt haben.«
Mit einem Schulterzucken nehme ich es hin und mache mich daran, das Zelt zu verlassen. Henry zu sagen, dass sein Gebrauch von Jugendsprache übertrieben ist, zieht nicht. Als hätte ich das nicht bereits am Tag unserer Ankunft versucht. Ich genieße meine halbe Stunde lieber im Wald, mit einem Bleistift und einem Zeichenblock, als mit Henry im stickigen Zelt festzuhängen.
Für einen Moment lasse ich mir von der Sonne das Gesicht wärmen. Ich stehe einfach so da, wie heute Vormittag auf dem Markt, aber anscheinend wirkt es dieses Mal nicht so, als müsste ich abgeholt werden. Sekundenlang genieße ich die prickelnde Wärme und das Zwitschern einer Amsel, die rechts von mir im Baum sitzt. So stehe ich die Tage hier immer mal und reflektiere. Ich zähle die Situationen, in denen ich ein kleiner Besserwisser war und ordne sie in folgende Kategorien: 1. Absolut berechtigt. 2. Vielleicht blöd rübergekommen. 3. Wurde eines Besseren belehrt. Heute gab es nicht allzu viele davon, höchstens beim Frühstück, als ich Henry gesagt habe, dass es viel sinnvoller ist, zuerst seinen Apfel zu schneiden und danach sein Brot mit demselben Messer zu bestreichen, weil ansonsten an seinem Apfel Brotaufstrich klebt. Diesen Moment ordne ich ohne zu zögern in die erste Kategorie ein: Absolut berechtigt.
Niemand kommt, um meine Idylle zu unterbrechen. Ich glaube, innerlich hoffe ich, dass Martha mich wieder anspricht. Ich lasse bestimmt noch eine Minute vergehen und gebe mir dabei große Mühe auszusehen, als würde ich gern wieder abgeholt werden. Aber wahrscheinlich sitzt Martha gerade in ihrem Zelt und bekommt gar nichts von meinen kläglichen Versuchen mit.
Resigniert schwinge ich meinen Zeichenblock und setze mich in Bewegung in Richtung Wald. Von unserer kleinen Camping-Lichtung sind es nur ein paar Meter bis an den Waldrand, nur ein paar Schritte, bis ich von der Kühle unter dem dichten Blätterdach und dem spärlichen Unterholz verschluckt werde. Meine nackten Füße rascheln durch das halb zersetzte Laub des letzten Herbstes und lassen einen wohligen Moschusduft aufsteigen. Ich bin so daran gewöhnt, im Wald barfuß zu laufen, dass ich die vielen kleinen Steinchen schon fast nicht mehr spüre. So fühle ich mich dem Leben näher, der Schönheit, den Farben.
Ich entdecke eine zweite Analogie zu heute Vormittag: Auch hier fühle ich mich erlöst und weiß nicht einmal, was mich davor bedrückt hat. Ein Gefühl der Freiheit breitet sich in meiner Brust aus, während meine Lungen sich mit der frischen Luft der letzten Sommertage füllen. Eigentlich mag ich es, mitten im Geschehen zu stehen, mit meinen Freunden picknicken zu gehen und ausgelassen in den Abend zu feiern. Aber es gibt auch Momente wie diesen, wo ich es schätze, allein zu sein. Hier stehe ich, nur mit mir selbst, und doch bin ich nicht einsam. Ich bin mir selbst genug.
Wenn ich mit Block und Stift in einen Wald gehe, weiß ich am Anfang nie, wonach ich suche. Ich schlendere einfach, und irgendwann sticht mir das perfekte Motiv ins Auge. Etwas, das einfach gezeichnet werden muss. Dann komme ich nicht drumherum, mich auf eine breite Wurzel oder einen Stein zu setzen und den Stift zu zücken. So sind Bilder von ganzen Feldern aus Maiglöckchen im Frühjahr, von seltenen Schlüsselblumen, Baumpilzen, einem Mistkäfer und seiner Kugel und von einem Buntspecht entstanden. Immer nur mit Bleistift, immer mit ungefähr einer halben Stunde Zeitaufwand.
So sticht mir auch jetzt das Motiv, das gezeichnet werden möchte, einfach so ins Gesicht. Ein kleiner Steinpilz in einem flachen Moosbett. Ich erkenne ihn an der dunkelbraunen Kappe mit dem dünnen weißen Rand, dem Schwämmchen darunter und dem dicken Stamm, fast so breit wie die Kappe selbst.
Ganz selbstverständlich setze ich mich daneben und beginne, erste Umrisse zu skizzieren. Erst das Moosbett, dann die Kappe und den Stamm, bevor Details folgen. Eine unebene Stelle, an der sich wohl eine Schnecke sattgefressen hat, hier und da ein paar Unregelmäßigkeiten. Der Pilz ist nicht perfekt, und genauso wenig ist es meine Zeichuung. Trotzdem ziehen mich die dünnen Striche in meinem Zeichenblock in ihren Bann. Das Zeichnen hilft mir, dem Beobachter in mir gerecht zu werden. Fokussiert an einer Kleinigkeit zu arbeiten und trotzdem nicht das Gesamtbild zu vergessen. Ich gebe mir nur eine halbe Stunde, damit ich mich nicht zwischen der Bleistiftmine und dem Papier verliere, und zwinge mich so, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. In ein paar Jahren will ich die Zeichnung immer noch von der eines Rotfuß- oder Gallenröhrlings, eines Birkenpilzes und einer Marone unterscheiden können.
Meine Striche sind schnell und geübt. Manchmal denke ich über meine Motive nach, während ich sie zeichne. Der Gedanke der Vergänglichkeit ist dabei am lautesten. Ich zeichne immer Motive, die morgen schon nicht mehr sein könnten. Ich habe nur diese eine Chance, sie in ihrer aktuellen Form darzustellen. Es ist wie ein Foto, das ich schieße, nur wesentlich intensiver. Wenn ich ein Tier zeichne, habe ich das Gefühl, einen Teil des kleinen Lebens einzunehmen. Vielleicht sieht mich das Tier nicht einmal, und doch halte ich seine Existenz zwischen zwei Seiten Papier fest.
Während ich diesen Steinpilz zeichne, spricht mein innerer Biologe zu mir, sagt, dass wir Ende August haben. Das ist etwas früh für Steinpilze, seien sie noch so klein und zierlich. Ständig fühle ich mich mit den Themen meines Studiums konfrontiert, was Fluch und Segen zugleich ist. Ich liebe die Natur und das Wissen, das heimlich in ihr schlummert. Aber je mehr ich davon in meinen Kopf lasse, desto mehr wird Tag für Tag der Besserwisser getriggert. So schön der Gedanke auch ist, mich mit den heilenden Wirkungen und Toxinen mancher Pflanzen zu befassen, Pilze nach ihrer Essbarkeit zu bestimmen und seltenen Schnegeln auf die Schliche zu kommen, so furchtbar finde ich die Tatsache, all das Wissen in meinem Kopf zu speichern, es aber nicht rauslassen zu können. Denn wenn ich über meine Schulzeit und die bisherigen Semester etwas gelernt habe, dann, dass die wenigsten Menschen sich so sehr für Biologie begeistern können, wie ich es tue. Und wenn ich bei diesen Leuten den Besserwisser raushängen lasse, werde ich als Nerd abgestempelt. Deshalb habe ich angefangen, solche Momente zu reflektieren und in mein Schema einzutragen.
Sobald ich die Komposition der einzelnen Bildelemente habe, sind die Schattierungen an der Reihe. Meine Gedanken über den Besserwisser in mir und die Faszination der Vergänglichkeit meiner Motive nehmen mich mit auf ihre Reise und auch ich vergesse die Zeit, während meine Finger einfach weiterzeichnen und mein Kopf in ein weiches Federbett aus Gedanken fällt, das mich mit Wohlbefinden erfüllt. Erst als die Zeichnung fertig in meinen Händen liegt, wache ich aus meiner Trance auf. Für einen Moment fährt hastige Kälte in meine Glieder, während ich rasch versuche, meinen Blick zu klären und auf die Uhr an meinem Handgelenk zu schauen. Erleichterung durchströmt mich, als ich sehe, dass ich noch genug Zeit habe, um zum Lager zurückzukehren und meine Badehose von der Wäscheleine zu pflücken, die wir zwischen den Zelten gespannt haben. Das ist eine weitere Tatsache, die mich so sehr am Zeichnen fasziniert: Man bekommt nicht mit, wie die Zeit verfliegt und etliche Minuten später sitzt man da, hält ein kleines Kunstwerk in den Händen und fragt sich, wer es zu Papier gebracht hat.
Dass wir zum Teich aufbrechen, hat anscheinend schnell die Runde gemacht. Keine fünf Minuten nach meiner Rückkehr ins Lager versammeln wir uns auf der Lichtung. Henry steht nur in Unterhose und mit einem breiten Grinsen im Gesicht bereit. Ich habe die vage Vorahnung, dass er baden wird, wie Gott ihn geschaffen hat.
Der Weg zum Teich ist nicht weit. Er führt über einen kleinen Pfad durch ein dichtes Brombeergestrüpp. Die menschenmagnetische, musikalische Maria bleibt kurz mit ihrem gelben Rock hängen und quiekt belustigt auf. Ich gebe Henry eine Sekunde, bis er sich in die Brust wirft und zu ihrer Rettung eilt. Er tut mir den Gefallen, befreit sie mit seinem fetten Grinsen auf den Backen, das nur noch breiter wird, als sie seinen Mut, dem Brombeergestrüpp die Stirn zu bieten, mit einem spielerischen Küsschen auf die Wange quittiert. Wir alle wissen, dass Maria viel zu alt für Henry wäre und mit ihrer überschwänglichen Art schnell übertreibt, doch wir können über die skurrile Situation nur lachen. Selbst Marias zurückhaltende Freundin Marie steht mit verschränkten Armen da und schüttelt grinsend den Kopf.
Während ich kühle Erde zwischen meinen Zehen spüre, nehme ich diesen Duft nach Zedernholz wahr. Martha läuft direkt vor mir, schaltet meine Sinne aus und lässt meinen Kopf verstummen. Normalerweise würde ich jetzt die raschelnden Bäume wahrnehmen, vielleicht ein Eichhörnchen, das die Rinde hinaufflitzt. Ich würde dem Geruch nach frischen Speisepilzen nachgehen oder dem Plätschern eines kleinen Rinnsals zwischen klobigen Steinen. Doch bis wir am See ankommen, ist da nur Zedernholz. Herb, wohltuend, vielleicht mit einer süßlichen Note verfeinert.
Der Teich liegt direkt zwischen den Bäumen, so nah, dass die Wurzeln in den See hineinragen. Das Wasser sieht keinen Sonnenstrahl, über der Oberfläche spannt sich ein Dach aus tiefgrünen Blätterkronen und verbirgt den Teich wie unter einer Kuppel. Unter der obersten Schicht wird das Wasser schwarz. Ich knie mich ans Ufer und schöpfe eine Hand. Es ist eiskalt und klar. Ich kann keine umherschwirrenden Mikropartikel erkennen, keine Verunreinigung. Kaum lasse ich es durch meine Finger rinnen, schließt es sich wieder der tiefen Schwärze im Teich an. Bei genauerem Hinsehen erkenne ich, dass nur der Boden von dem kleinen Gewässer dunkel ist und es dadurch wie ein schwarzes Loch im Waldboden wirken lässt.
Mit einem unterdrückten Aufschrei zucke ich zusammen, als ich eine kalte Dusche von vorn bekomme. Die tropfnassen Haare ins Gesicht geklatscht, muss ich mir das Wasser aus den Augen blinzeln, ehe ich Ausschau nach dem Übeltäter halten kann. Mein Anblick bringt Maria zum Kichern und in meinem Kopf manifestiere ich zwei Hauptverdächtige: Zum einen Maria, die wie ein quirliges Kind an Finns langem und viel zu warmem Pullover zupft. Zum anderen Henry, der hinter mir höhnisch lacht. Augenverdrehend falle ich in das Lachen ein.
Im nächsten Moment sehe ich sie: ein breites Grinsen im Gesicht, die Haare hochgesteckt. Der neonfarbene Badeanzug passt so überhaupt nicht in die Idylle des kleinen Teichs. Vielleicht kann ich deshalb nicht die Augen von ihr abwenden, wie sie in eleganten Schritten um das kleine Gewässer schwebt, die Augen auf den morastigen Boden gerichtet. Ich will Martha nicht beobachten, will ihr nicht schon wieder das Gefühl geben, angestarrt zu werden. Aber mein Blick ist an ihr oder ihrem neonorangenen Badeanzug festgetackert.
Ich muss mich losreißen. Muss einen anderen Punkt finden, den meine Augen fixieren können. Hastig suche ich nach etwas, woran sie sich festhalten können, und finden schließlich den höhnenden Henry, ein weiteres Wort, das ihn sehr gut beschreibt. Tatsächlich zieht er komplett blank. Ein Grinsen schleicht sich auf meine Lippen und kurz denke ich, wie vorhersehbar seine Aktion war. Wie ein junger Gott breitet er die Arme aus, präsentiert uns seinen Allerwertesten und schreitet erhobenen Hauptes in das Wasser, das mir gerade noch eiskalt zwischen den Fingern zerronnen ist. Aber Henry zieht seine Nummer ohne zu zucken durch und genießt Marias anerkennendes Pfeifen und Finns Prusten, als er sich an seiner Wasserflasche verschluckt. Hastig schlägt er sich eine Faust auf die Brust und löst in mir eine nagende Sorge um ihn aus, die mich erstarren lässt, bis er wieder freier zu atmen beginnt.
Während ich mir Sorgen um Finn gemacht habe, hat sich der Rest der Truppe hinter Henrys Rücken in die Badesachen geworfen. Nur Martha steht in ihrem auffälligen Badeanzug vor ihm und hat volle Sicht auf Henrys entblößte Vorderseite, was sie allerdings nicht weiter zu interessieren scheint. Henry Schultern sacken nach unten. Wahrscheinlich hat er mit einem belustigten Blitzen in ihren Augen, einem empörten Aufschrei oder einfach mit irgendeiner Reaktion ihrerseits gerechnet, doch Martha hebt nicht einmal eine Augenbraue.
Ich bin der Einzige, der sich angesichts der lockenden Erfrischung noch für die Wasserqualität interessiert. Die anderen stürmen den Teich, spritzen sich gegenseitig nass und schreien belustigt auf, als Henry mit seinen zu Schaufeln geformten Händen eine Welle in Marias Richtung schickt, der sie nicht ausweichen kann. Mit erhobenen Händen steht sie da, den Mund in einer Mischung aus Überraschung und Belustigung weit geöffnet, ihre Brust hebt und senkt sich rasch. Während sie sich das Wasser aus den Augen blinzelt, sehe ich einen Funken in ihnen aufblitzen, der mit jedem Schlag ihrer Wimpern stärker von kindlichen Rachegefühlen genährt wird.
Während Henry und Maria sich im nächsten Moment eine erbitterte Wasserschlacht leisten, in die unweigerlich auch Finn und Marie mit hineingezogen werden, halte ich inne. Am liebsten würde ich jetzt Proben aus dem Teich nehmen oder mich mit meinem Zeichenblock hinsetzen und die Szene für die Ewigkeit festhalten. Das habe ich früher oft gemacht, wenn ich mit meinen Jungs ins Freibad gegangen bin. Ich habe danebengesessen und den Schiedsrichter gespielt, habe Bilder von Sommertagen gezeichnet oder vom Biologiestudium geträumt. Die anderen haben nie hinterfragt, warum ich ihnen nicht gefolgt bin, mich nicht mit ausgezogen habe und in den Tag gestürmt bin. Vielleicht haben sie geahnt, dass ich mich dabei nicht wohlfühlen würde. Oder sie haben gesehen, dass mein Körper anders ist als ihrer. Ich konnte dieses ewige Vergleichen zwischen Jugendlichen nicht ab, ständig die Fragen, wer den Längsten hat und wer im Gym am besten pumpt. Was das angeht, bin ich damals nie ganz angekommen. Und auch wenn ich heute anders über meinen Körper denke, hängen mir die heißen Tage vor vielen Sommern noch immer nach.
Ich bemühe mich, die Gedanken an mein früheres Selbstbild nicht zuzulassen und mir zu sagen, dass ich genug bin. Verdränge diese nagende Kälte und konzentriere mich wieder darauf, die anderen zu beobachten, wie ich es immer tue, nur dass mein Fokus jetzt woanders liegt. Ich sehe nicht mehr, was sie machen. Ich sehe, wie sie es tun. Es kommt mir vor, als würden sie alle sich in Zeitlupe bewegen. Niemand achtet auf die Körper der anderen. Auf Henrys entblößten Intimbereich oder auf Finns schlaffe Haut, die an den Rippen herabhängt. Niemand macht unangebrachte Kommentare, mehr noch: niemand scheint an den eigenen Körper überhaupt zu denken.
Bevor ich mich der Ausgelassenheit der anderen anschließe, mache ich etwas, was mir früher geholfen hat, wenn ich unsicher war. Ich versuche zu erraten, was die größten Unsicherheiten der Menschen vor meinen Augen sind. Vielleicht denkt Maria, dass ihre Brüste zu groß sind oder ihr Hals zu kurz ist. Vielleicht hält sich Finn für zu dünn, zu dick oder zu blass. Vielleicht hätte Marie gern weniger Haare an den Unterarmen und weniger kantige Gesichtszüge. Die Wahrheit ist: Ich weiß es nicht. Und genauso wenig wissen die anderen über meine größte Unsicherheit.
Mein Gedankenspiel schenkt mir Kraft und lässt mein Blut warm und ermutigend durch meinen Kopf rauschen. Der Tag riecht zu verlockend nach Sommer, nach schallendem Gelächter und dem Hochgefühl von neuen Freundschaften, als dass ich ein weiteres Mal danebenstehen und beobachten möchte. Ich weiß nicht, welcher Teil von meinem Gehirn sich entscheidet, mir die Kleider vom Leib zu reißen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es sich richtig anfühlt.
Für ein paar Momente bin ich wieder dieses Kind im Ferienlager. Ich stürme mit den anderen ins Wasser, wir bespritzen uns gegenseitig, bilden Teams und schlagen Schlachten. Plötzlich ist es egal, dass etwas weniger Gewicht meiner Gesundheit ganz guttun würde. Ich fühle mich einfach wohl zwischen den anderen, ich bin Teil der Gruppe. Als wären wir schon lange Freunde und würden uns nicht erst seit ein paar Tagen kennen. Das Gefühl des warmen Rauschens in meinem Kopf breitet sich über meinen Hals und meine Glieder bis tief in meinen Bauch aus, wo es zu einem leichten Kribbeln wird. Kein Verliebtheits-Kribbeln, eher ein Glücklich-Kribbeln, das mit ziehenden Schmerzen in den Wangen einhergeht. Diese kleinen Krämpfe, die nur entstehen, wenn man zu viel gelächelt hat.
Nachdem wir Henry und Maria, die beide maßlos übertreiben, jubelnd den Sieg in Sachen Wasserschlacht überlassen haben, legen wir uns als tote Männer und Frauen auf die Wasseroberfläche. Eigentlich ist es egal, dass Henry und Maria übertrieben haben. Es ist so egal wie mein Gewicht und die Narben, die ich flüchtig auf Maries Armen gesehen habe. Letztendlich beobachten wir doch alle mit unterschiedlichen Augenpaaren das Blatt, das sich hoch über uns vom Baum löst und langsam, mit hin und her gleitenden Bewegungen, auf uns zu segelt.
Der Wind trägt neben dem Blatt auch den seichten Duft nach Zedernholz zu mir und hält mir vor Augen, dass es da jemanden gibt, der sich aus der Wasserschlacht herausgehalten hat. Der Gedanke bringt mich aus dem Gleichgewicht, mein Rumpf sinkt nach unten und ich muss kurz nach Luft schnappen, als die klirrende Kälte des Wassers meinen Bauch berührt.
Um mich abzulenken, lasse ich meinen Blick über das Ufer gleiten. Die dicken Baumstämme stehen nah am Wasser und strecken durstig ihre Wurzeln in meine Richtung aus. Zwischen ihnen haben sich Brombeerbüsche angesiedelt, beim genaueren Hinsehen sehe ich sogar einen Pfad, der über Jahre von Tierhufen gestampft wurde. Zwischen zwei nah aneinander stehenden Bäumen sitzt Martha in ihrem knallorangenen Badeanzug. Die Beine hat sie untergeschlagen, die Augen geschlossen. Ihre Gesichtszüge sind ganz entspannt, es sieht beinahe aus, als würde sie meditieren.
Vorsichtig, um die anderen nicht zu stören, lasse ich mich tiefer ins Wasser gleiten und halte unmittelbar auf sie zu.
»Warum legst du dich nicht wie die anderen aufs Wasser?«
Ich bin überrascht, dass sie mich bemerkt hat, wo ihre Augen doch zu sind. Irgendwie weiß ich, dass sie mich erkannt hat, auch wenn ich noch kein Wort gesagt habe. Dabei bleibe ich, ich schweige.
»Bei euch sieht das so einfach aus. Als sei die Oberfläche ein gemütliches Kissen und würde nicht nachgeben.«
»Warum kommst du nicht zu uns und legst dich mit aufs Kissen? Ich bin sicher, dass du es auch kannst. Du musst nur …«
»… ganz tief die Luft einsaugen und den Bauchnabel über Wasser drücken. Ich war auch mal in einem Schwimmkurs.«
Ihre Worte sind schärfer als sonst und klatschen wie eine Ohrfeige auf meine Wange. Ich frage mich, ob ich wieder zu sehr den Besserwisser gespielt habe. Muss man einer erwachsenen Frau wirklich erklären, wie man sich über Wasser hält? Schnell ordne ich die Situation unter ›2. Vielleicht blöd rübergekommen‹ ein und versuche instinktiv, mich mit einem verschmitzten Lächeln zu retten, das sie allerdings nicht sehen kann, weil ihre Augen noch immer geschlossen sind.
»Warum kommst du dann nicht mit rein?«
»Ich genieße lieber das Ufer und die Ruhe.«
»Ich dachte, du wartest vielleicht darauf, abgeholt zu werden.«
Langsam öffnet sie ihre Augen und ich werde unwillkürlich an die Schwärze des Teichs erinnert. Ihre Gesichtszüge sind noch immer entspannt, beinahe lächelt sie.
»Du hast Angst vor Wasser«, stelle ich fest.
»Ich habe keine Angst vor Wasser, ich habe Angst vor dem, was unter der Oberfläche lauert.«
Mit einem verlegenen Lachen drehe ich mich um die eigene Achse, wirbele damit Wellen auf, die sich kreisförmig um mich herum ausbreiten. »Das ist ein kleiner Teich. Siehst du? Ich kann stehen.« Demonstrativ hebe ich die Arme und gehe ein Stückchen tiefer hinein. Martha muss nicht wissen, dass nicht einmal ich in der Mitte stehen kann.
»Es geht nicht um die Größe oder die Tiefe eines Gewässers.«
»Dass du vor großen Fischen und Meerestieren Angst hast, kann ich ja nachvollziehen. Aber das hier ist ein kleiner Teich, was soll hier schon groß sein?«
Sie rutscht noch ein Stück näher ans Ufer und lässt ihre Hand durch das Wasser gleiten. Nur eine Sekunde, dann zieht sie sie heraus, als hätte sie einen Stromschlag bekommen.
»Ich habe nicht von schrecklichen Monstern oder Seeungeheuern geredet. Es geht um das, was unter mir ist.«
Ich vermute, dass sie nicht näher darauf eingehen wird, deshalb belasse ich es dabei. Zu dankbar bin ich für jedes Wort, das sie an mich richtet.
Und dann schenkt sie mir sogar noch ein paar mehr Worte: »Es geht um die Dunkelheit, die irgendwo dort unten lauert.«
3Ein Abend mit Krümeltee
Wir schweigen gemeinsam. Ich sitze neben ihr und spüre die Tropfen auf meiner Haut unangenehm stechen. Ich wollte mich noch nicht abtrocknen, wollte den Moment nicht zerstören, also unterdrücke ich das Zittern, das sich anbahnt, als der Wind die Luft auffrischen lässt. Zu sehr möchte ich diesen Moment mit Martha genießen, wie wir am Ufer sitzen und den anderen beim Treiben auf dem dunklen Wasser zusehen.
Finn ist der erste, der so sehr zittert, dass er aus dem Teich muss. Mit aufeinander klappernden Zähnen wickelt er sich in sein weißes Handtuch ein. Ich rechne fest damit, dass er sich zu uns setzt, wie immer den stillen Zuhörer spielt und vor sich hin zittert. Stattdessen überrascht er mich mit einer kleinen, schüchternen Tanzeinlage durch das umliegende Unterholz. Seine Beine sind so dünn, sein ganzer Körper so fragil, sein Auftreten so leicht, dass man ihn mit einem Reh verwechseln könnte. Ich sehe ihm sicher eine Minute zu, bis ich meine, anmutige Ballettschritte zu erkennen. Die Beine zu eleganten Posen verdreht, die Füße grazil gestreckt, nur seine Arme umklammern das Handtuch, das um seinen dünnen Körper gewickelt ist. Ich stelle ihn mir im Bühnenlicht eines alten Operngebäudes vor, wie seine Silhouetten und Spitzentänze von einer Hundertschaft bestaunt werden. Auch Martha tippt mich sanft am Arm an und weist auf Finns kleine Show. Ihre leichte Berührung fühlt sich warm und irgendwie vertraut an, als würden ihre zierlichen Fingerspitzen ständig meine Unterarme berühren, die am Anfang des Sommers mal zu viel Sonne abbekommen haben und jetzt dunkler sind als die Haut an meinem restlichen Körper.
Auch als die anderen aus dem Wasser steigen, sieht niemand Finn und seine Tanzeinlage komisch an. Nicht einmal Henry reißt unangebrachte Witze, flüchtet sich nur schnell zu seinem Handtuch und wickelt es sich ungeschickt um die Hüften. Es existiert keine Peinlichkeit, als er sich mit einigen holprigen Schritten den Weg durch die Brombeerbüsche zu Finn bahnt und in den Tanz einsteigt, auf seine eigene, unbeholfene Weise. Henrys Bewegungen kommen nicht im Ansatz an die Anmut heran, die Finn ausstrahlt, aber er gibt sein Bestes. Um sein Gleichgewicht kämpfend hebt er ein Bein, streckt es in eine Richtung und wechselt dann mit einem kleinen Hopser zum anderen Bein, dabei hält er die Hände in die Hüften gestützt und lässt einen übertriebenen Stolz durch seine Mimik ziehen, der mir ein schräges Lächeln entlockt. Finn hingegen scheint ihn gar nicht richtig wahrzunehmen, tanzt sich nur weiter warm, obwohl er nicht mehr zittert.
Wir sehen noch kurz dem ungewöhnlichen Duo zu, ehe wir beginnen, unsere zitternden Körper mit den steifgetrockneten Frotteehandtüchern abzureiben. Es fühlt sich an, als würde das Material mir die erste Hautschicht abschilfern und rot brennend zurücklassen, aber ich mache trotzdem weiter. Ich bin dankbar um die Wärme, die die Reibung auf meiner Haut erzeugt, bevor ich gänsehäutig in mein Shirt und meinen grünen Strickpulli schlüpfe. Gerade richte ich mich auf und streiche über den wollig-weichen Stoff, da klingt die Stimme meiner Mutter für einen kurzen Moment in meinen Ohren: ›Warum hast du dich nicht direkt umgezogen? Du wirst noch eine Blasenentzündung bekommen.‹
Jetzt, wo ich Biologie studiere, habe ich endlich die Mittel, ihr zu widersprechen. Kälte begünstigt vielleicht eine Blasenentzündung, ausgelöst wird sie aber von einem Bakterium. Ich gebe zu, im Recht zu sein löst ein seltsames Gefühl der Zufriedenheit in mir aus. In diesen Momenten kribbelt eine Stelle an meinem Hinterkopf und lässt meinen Nacken prickeln, als würden tausend Ameisen auf meiner Haut Finns Ballettschritte tanzen.
Wenn meine Mutter hier wäre, würde ich ihr die Sache mit dem Bakterium wahrscheinlich auf die Nase binden. Und wahrscheinlich wäre das eine der Situationen, die ich unter ›2. Vielleicht blöd rübergekommen‹ listen müsste, wenn meine Mutter nicht meine Mutter wäre. Aber weil diese Frau meine Mutter ist, gehört der Moment definitiv zu ›1. Absolut berechtigt‹.
Kopfschüttelnd versuche ich, den Gedanken an meine Eltern loszuwerden. Martha trägt mittlerweile wieder ihr schwarzes Top und reibt sich die Arme, obwohl sie gar nicht mit im Wasser war. Der Wind hat Kühle mit sich gebracht, die die Härchen auf ihren Unterarmen aufrecht stehen lässt. Für einen Moment überlege ich, ob ich ihr meinen Pulli anbieten soll, dann entscheide ich mich, sie lieber abzulenken. Mit dem Kinn weise ich auf Finn, Henry und ihr kleines Tänzchen. »Warum machst du nicht mit?«
Sie lacht. »Würdest du das von mir erwarten?«
Ihr Lachen ist so schön. So frei.
»Nein, aber von Finn habe ich es auch nicht erwartet.«
»Tja, ich schätze, dass dich nicht jeder Mensch überraschen kann.« Herausfordernd funkelt sie mich an. »Und warum machst du nicht mit?«
»Hast du jemanden mit meiner Figur schon einmal Ballett tanzen gesehen?«
»Es muss ja kein Ballett sein, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Schau dir an, wie unterschiedlich Finn und Henry tanzen, dann hast du keine Ausrede mehr.«
Mein Auge zuckt. Was erwartet sie? Dass ich mich Finn und Henry anschließe und mich warmtanze? Oder soll ich lieber standhaft bleiben? Ihr vielleicht von einer anderen meiner Stärken erzählen?
Ich hole tief Luft, um nicht direkt antworten zu müssen. Nach meiner letzten Beziehung dachte ich, dass ich schon irgendwie ein Frauen-Versteher bin. Ich habe Amelie damals ihre Lieblings-Gummibärchen gekauft, wenn es ihr nicht gut ging. Stunde um Stunde habe ich ihr den Rücken gestreichelt, nur um strahlende Blicke aus ihren warmen Augen zu bekommen. Ich habe ihr immer zugehört, war in den Freundschafts-Gossip ihrer Clique involviert und habe nur ihr zuliebe ab und an eine Skincare-Routine über mich ergehen lassen. Aber Martha ist ganz anders als Amelie. Sie löst so viele Fragen aus, gepaart mit dem drängenden Wunsch, hinter ihre glatte Stirn blicken zu können.
Langgezogen stoße ich den angehaltenen Atem wieder aus. Die Luft brennt in meiner Kehle und ich antworte das, was sich in meinem Kopf richtig anhört: »Na ja, ich habe mich schon angezogen. Und irgendwie ist das gerade ein Ding zwischen Henry und Finn.«
Es fühlt sich wie eine lahme Ausrede an, und in dem enttäuschten Blitzen in ihren dunklen Augen erkenne ich, dass sie es genauso aufnimmt. Für den Bruchteil einer Sekunde legt sich ein unbehagliches Schweigen über uns. In möchte etwas sagen, irgendetwas, bevor das angespannte Gefühl bei Martha ankommt. In meinem Kopf rattert es, aber bevor ich zum Zug kommen kann, verziehen sich ihre Lippen zu einem schelmischen Grinsen.
»Und bevor Henry dazugekommen ist, war es nur das Ding von Finn. Wenn du dich anschließt, ist es ein Ding zwischen euch Dreien.«
Der Knoten in meinen Gedanken wird noch unübersichtlicher, wird von diesem verdammten Lächeln in einen dichten Nebel gehüllt. Ich muss meine Augen an etwas anderes tackern, kann nicht auf diese Wangen sehen, weil der Nebel in meinem Kopf sonst nur noch dichter wabert. Rasch sucht mein Blick sich einen belanglosen Brombeerbusch. Doch aus dem Augenwinkel sehe ich noch immer, wie sie mich von unten anlächelt, und muss alles in mir zusammennehmen, um nicht dem Drängen nachzugeben, mich ihr wieder zuzuwenden.
Es dauert seine Zeit, bis der Nebel etwas lichter wird und ich ihr antworten kann. »Dasselbe könnte ich dir sagen. Aber statt weiter darüber zu diskutieren, könntest du mir lieber erzählen, was du in deiner Freizeit machst, wenn du nicht gerade versuchst, mich zum Tanzen zu motivieren.«
Sie zieht eine Augenbraue in die Höhe, wiegt den Kopf hin und her. Und ich bin immer noch nicht imstande, wieder in diese tiefen, dunklen Augen zu sehen. »Bis vor ein paar Jahren war ich in einem Verein.«
Pause.
Oh nein, ich werde dir nicht alles aus der Nase ziehen, denke ich und realisiere zu spät, was sie hier gerade macht. Sie provoziert, dass ich in ihrem Gesicht nach einer Regung suche. Sofort verdichtet sich der Nebel in meinem Kopf wieder und in meinem Unterbauch breitet sich ein dumpf kribbelndes Gefühl aus, das ich mit aller Macht an Ort und Stelle zu halten versuche.
Zehn Sekunden, zwanzig Sekunden.
»So läuft das Spiel nicht«, sagt sie schließlich so leise, dass ich mich vorneigen muss, um sie zu verstehen. Ihre Stimme ist mit derselben Energie geladen, die auch das Blitzen in ihren Augen befeuert, und die es immer härter für mich macht, dieses Gefühl in seinem Käfig aus Vernunft wegzusperren.
Ein nervöses Lachen verlässt meine Lippen, als ich mich auf ihr Spiel einlasse. »Denkst du, dass ich dich jetzt frage, in welchem Verein?«
Sie sieht mich nur weiter unverwandt an und bringt meine Haut damit zum Brennen. Ein Teil von mir weiß, dass dieses Duell zwischen unseren Blicken nur enden wird, wenn ich nachgebe. Aber irgendwie mag ich diese Provokation, auch wenn sie mir weiche Knie beschert.
Ich genieße den Moment exakt so lange, wie ich es mir zutraue, bevor das Gefühl in meinem Unterbauch droht, zu einer Flutwelle heranzuwachsen und meinen Körper zu überspülen. Dann versuche ich kläglich, eine einzelne Augenbraue in die Höhe zu ziehen, um ihre düsteren Augen von meinen abzulenken, und gebe nach. »Wie du willst. Erzähl mir mehr über den Verein.«
Wieder dieses schelmische Grinsen. »Das war eine Aufforderung, keine Frage.« Pause. Dann ein Lachen, das das Knistern aus der Luft nimmt und mich endlich durchatmen lässt. »Ich war in einem Verein für Synchronschwimmer.«
Mein Blick gleitet bewundernd ihren Körper hinunter. Martha ist so eine zierliche Frau, ich kann mir spielend leicht vorstellen, wie sie ohne großen Widerstand durch klares Wasser schwebt und dabei kunstvolle Figuren präsentiert. Dann kommt mir ein Gedanke. Mein Blick springt von ihr zu dem kleinen Teich neben uns, wieder zu ihr, wieder zum Teich.
»Das ist nicht dein Ernst«, platzt es aus mir heraus. »Du erzählst mir etwas von unendlich tiefen Teichen und bist in deiner Freizeit Synchronschwimmerin? Wo passt das zusammen?«
»Ich habe dir doch gesagt, dass es die Dunkelheit ist. Nicht das Wasser.«
Mit noch immer verengten Augen vervollständige ich ihren Gedanken. »Und ein Schwimmbecken ist immer gut ausgeleuchtet.« Sie neigt den Kopf, wie um zu nicken. »Wenn ich dich also nachts mit in ein Freibad nehmen würde, würdest du nicht ins Wasser steigen. Tagsüber aber schon.«
»Im Grunde schon, ja. Wobei ein Freibad noch einmal etwas anderes ist als ein offenes Gewässer. Im Freibad wäre mir in der Nacht mulmig zumute, aber im Grunde wüsste ich ja, dass da nichts ist.«
Gerade lege ich in Gedanken eine Liste mit Dingen an, die wir zusammen unternehmen müssen, und setze ›Nachts in ein Schwimmbad einbrechen‹ darauf, als Maria sich neben uns fallen lässt und den letzten Funken Spannung vertreibt.
»So, ihr zwei Täubchen.« Wenn sie nicht so direkt wäre, würde ihr Grinsen ihren Gedanken verraten. »Abflug, es geht zurück ins Camp. Henry hat es endlich geschafft, seine Unterhose wieder anzuziehen.«
Die Sonne ist im Begriff, hinter den Bäumen zu verschwinden, und es wird so kühl auf der Lichtung, dass wir beschließen, uns ins Frauenzelt zurückzuziehen. Erst protestiert Maria, immerhin könnten wir uns ja auch ins Männerzelt setzen. Als sie aber Henrys Stapel sieht, ändert sie ihre Meinung und schließt sich der lachenden Truppe im Frauenzelt an.
Rasant gerate ich in eine Art Tunnel, lasse mich von den anderen mitreißen. Von ihrem Lachen, von den Witzen, die durch den Raum geworfen werden, und wieder spüre ich diese Glücklich-Kribbeln tief in meinem Bauch. Viele Jahre später werde ich so den Sommer beschreiben, als ich 20 war: Kribbelig und berauscht, obwohl wir nichts getrunken oder geraucht haben. Der Sommer, als ich 19 war, war ein ganz anderer. Da habe ich mit meinen ersten Unifreunden kühles Dosenbier auf der Wiese zwischen der naturwissenschaftlichen und der technischen Fakultät getrunken und neue Musikrichtungen ausprobiert. Der Sommer, als ich 18 war, war laut und von der Freiheit nach dem Abitur, von Zukunftsträumen und dem Bimmeln von Fahrgeschäften auf dem Jahrmarkt erfüllt. Und dann gibt es da den Sommer, als ich 17 war. Der riecht in der ersten Hälfte nach einer Mischung aus Sonnencreme, dem Schweiß meiner Jungs und gechlortem Freibadwasser. Über die zweite Hälfte legt sich eine bleierne Düsternis, die ich an manchen Tagen nur schwer durchdringen kann. Dieser Sommer ist der Grund, warum ich überhaupt erst in Therapie gekommen und letztendlich in diesem Camp gelandet bin.





























