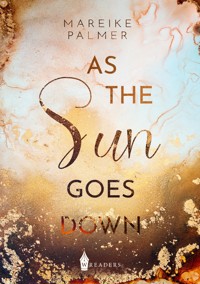Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich bin ihm verfallen. Dem Wahn. Dem Mörder. Dem Bösen in mir. Ich habe den Tod gesehen. Zischende Kugeln. Blut im Sand. Und Fliegen, immer diese verdammten Fliegen. Sie sieht das Monster in mir. Ich bin das Monster. Ich bin nicht das Monster. Ich bin das Monster. Und wie ich das Monster bin. »Brandmal – Das Feuer in mir« ist Mareike Palmers vierte Publikation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltswarnung
Mord, auch an Hamstern
Explizite Folter
Psychologische Konditionierung eines Kindes
Psychische Erkrankungen
Semi-Consensual Elemente
Hebephilie
Über die Autorin
Mareike Palmer ist eine junge Autorin und Studentin aus Deutschland. 2015 trat sie unter einem Pseudonym einer Online-Community bei und veröffentlichte erstmals ihre Texte im Netz. 2021 erschien ihr erster Roman beim Wreaders-Verlag. »Brandmal – Das Feuer in mir« ist ihre vierte Publikation.
Inhalt
Prolog im Sand 8
Nach dem Sand die Heimkehr 12
Alltag, dieser verdammte 24
Kennenlernen 40
Dagmar, Dagmars Flamme und ein Gespräch 44
An dem Tag 52
Das Streichholzmädchen 60
Gräber in der Totenstille 73
Der Tag danach und der danach 80
Ein Geständnis zum Abitur 85
Quadratschädel und Pferdeschwanz 96
Ein Gentleman, eine Lady, ein Gast 105
Nur etwas anders als sonst 114
Gin, zu viel Gin 119
Nennen wir es 124
Trauerfeier 124
Ein Sommerabend in Amsterdam 132
Der denkbar furchtbarste Totenschmaus 136
Wen ich nicht vermissen kann 140
Brennspiritus und Jacuzzi 145
Apathische Kinder und Wandtattoos 152
Noch ein bisschen Apathie 156
Wie ich ermordet worden bin 159
Wieder auf Anfang 171
All die Grausamkeiten 175
Vom Stehlen einer Person 180
Vom Stehlen einer Persönlichkeit 185
Mama 189
Die Tiefkühltruhe und die Angstpflanze 193
Die Fee unter der Truhe 198
Die Fabrik 201
Danach 204
WREADERS E-BOOK
Band 221
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book-Ausgabe
Copyright © 2023 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Druck: epubli – Neopubli GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Emily Bähr
Lektorat: Silja Alexandra Sporbeck, Annina Anderhalden
Satz: Annina Anderhalden
www.wreaders.de
ISBN: 978-3-96733-431-9
Für Marie, den kleinen Kiri und für all das, was uns verbindet.
0
Prolog im Sand
Roxane Rosalie Roth
In meinem ersten Leben bin ich ein Soldat gewesen. Keiner dieser Kriegshelden oder Kämpferherzen, keiner, der für die Schlacht gebrannt hat. Eher einer der schwächeren Art, der die Angst deutlich im Bauch spürte und nicht imstande war, sie zu unterdrücken. Ein Weichei, wenn man es auf ein Wort herunterbricht. Ein Angsthase, der sich vor dem Krieg fürchtet, vor Mördern und dem Tod. Vor dem Kugelhagel, in dem er in einem belanglosen Gefecht um ein paar Meter Boden sein Leben verlor. Und vor den Verbrechen, die er selbst begangen hat, wohl wissend, einem anderen Mann Leid anzutun.
Dabei hatte der Soldat, der ich sicher einmal gewesen bin, keine Angst vor dem Fliegen, geschweige denn vorm Abstürzen, keine Angst vor Spinnen oder engen Räumen. Keine Angst vor Krankheiten oder vor Einsamkeit, vor der Lüge. Da war nur diese grenzenlose Furcht vor dem, was nach dem Krieg, nach der Kugel kommt.
In meinem zweiten Leben hat man mich dann mit dem anderen Geschlecht gesegnet. Und kaum habe ich gelernt, eine Frau zu sein, wie eine Lady zu handeln und mich dementsprechend zu bewegen und auszudrücken, bin ich wieder ein Soldat geworden. Dieses Mal freiwillig und ganz zum Missfallen meiner Familie und meines Verlobten. Vielleicht, um dem Weichei von früher zu beweisen, dass doch noch etwas aus dieser Seele geworden ist. Vielleicht aber auch, um meine Angst vor dem Tod zu besiegen.
Wenn man sich auf der Straße einmal umsieht, wird einem auffallen, dass der Tod ziemlich allgegenwärtig ist. Ein überfahrener Igel, ein Großmütterchen hinter Gardinen aus dem letzten Jahrhundert, ein ertrunkenes Kind im Nachbarpool. Uns alle erwischt es früher oder später. Kein Grund, ängstlich zu werden. Kein Grund, fliehen zu wollen. Eher ein Spiel, in dem man nur ein Leben hat, ehe der Monitor schwarz wird und die Seele, die Spielfigur, zurück ins Hauptmenü geschleudert wird.
Als ich jedoch in diesem Moment vor Anna knie, die Hände neben mir auf dem Boden, den Kopf gesenkt, die Augen auf das Loch gerichtet, das die Kugel in ihrer Schläfe hinterlassen hat, glaube ich zu wissen, wie es dem Soldaten aus meinem ersten Leben ergangen ist.
Wir sitzen irgendwo im Hinterland der Sahelzone. Ein Krieg um Boden, der es eigentlich längst nicht mehr wert ist. Egal in welche Richtung man sich dreht, sieht man nur Sand, vielleicht ein paar gröbere Kiesel, das Skelett einer Pflanze, die vergeblich auf die nächste Regenzeit gewartet hat. An manchen Stellen, wo der Boden noch etwas dichter ist, prägen tiefe Risse das Relief. Wenn die sich nach einem Sandsturm mit feinen Körnern füllen, muss man aufpassen, dass man nicht versehentlich mit dem Fuß in eine der größeren Spalten rutscht und feststeckt. Wenn die Kugeln den Sand um einen herum aufspritzen lassen und man nicht ausweichen kann, ist das sonst das sichere Verhängnis. Das könnte Anna passiert sein, vielleicht hatte sie aber auch einfach nur Pech.
So hocke ich da, das G36 über der Schulter, der Sand knirscht unter meinen Stiefeln. Aus der Wunde in Annas Kopf fließt konstant dunkelrotes Blut. Es verklumpt in ihren staubigen Haaren und nimmt in den wenigen Augenblicken, die ich neben ihr knie, immer dunklere Farbtöne an. Keine Minute später kreisen die ersten Fliegen. Kleine Biester, auf die der Geruch des Todes eine magisch anziehende Wirkung besitzt.
Sie ist die einzige Soldatin in meinem Auslandseinsatz gewesen, die ich beim Namen gekannt, die einzige, für die ich mich ansatzweise interessiert habe. Weil wir aus ähnlichen Verhältnissen kommen, uns beide just von heute auf morgen zum Dienst gemeldet haben. Wenn man unsere restlichen Kameraden fragt, weshalb sie hier sind, bekommt man Antworten, die folgendermaßen klingen: Grenzerfahrung. Unfähigkeit, mit sich selbst etwas Anderweitiges anzufangen. Ein Studium, an das man ohne den Wehrdienst niemals gekommen wäre.
Ich würde meine eigene Unerschrockenheit und die Flucht aus der kleinen Stadt, in der ich mit Adam wohne, vor das Loch schieben, das diese Frage in die Luft reißt. Ich musste einfach weg, raus aus diesem verdammten Alltag. Jetzt bin ich hier und stelle einige interessante Dinge über mich fest: Ich habe kein Problem mit Leichen und Verwesung. Schließlich habe ich auch kein Problem mit der toten Anna und den Fliegen, die über uns kreisen, während ich neben ihr hocke und ihrer Seele eine gute Reise zurück ins Hauptmenü wünsche. Ich habe auch kein Problem damit, mich über längere Zeit nicht zu waschen. Irgendwann stinken alle unter der brennenden Sonne so sehr, dass es keinen Unterschied mehr macht. Nicht einmal der Gedanke an mein eigenes Ableben schockiert mich noch. Ich könnte morgen mit Anna zusammen in einer Holzkiste zurück in das Kaff meiner Eltern geschickt werden. Dann müsste ich mir jetzt niemanden suchen, mit dem ich ab heute meinen Schlafplatz teile, um in der Nacht nicht zu frieren.
Ich trauere nicht lange um meine ehemalige Kameradin und das Leben, das mit dem Blut aus der Schusswunde in ihrem Kopf fließt. Denn ich weiß, dass sie nur kurz gelitten hat. Ein Umstand, den sich fast jeder für seinen eigenen Tod wünscht. Fast bin ich neidisch auf sie und ihren perfekten Abgang. Dazu kommt, dass ich weiß, dass nach ihrem freiwilligen Dienst beim Militär nichts auf sie gewartet hätte. Keine Familie. Kein Freund, keine Freundin. Nur ein Hamster, den sie sich selbst überlassen hat und der mit Sicherheit irgendwann in den letzten Monaten verdurstet ist. Über dem auch die Fliegen gekreist sind, auf der Suche nach einer geräumigen Kinderstube für ihren Nachwuchs.
So hat sie es mir immer in der Nacht unter der aufgespannten Plane erzählt. Niemand. Nur dieser namenlose Hamster. Ich habe nie nachgefragt, was mit ihrer Familie passiert ist. Warum sie zu Hause keine Freunde hatte. Und wenn ich ehrlich bin, bemitleide ich mich im Nachhinein deswegen nicht. Ich bin kein so sentimentaler, so sozialer Mensch, dass ich in der Nacht nicht schlafen könnte, wenn ich nicht alles über die zweite Person unter der Plane wissen würde. Wir haben Distanz bewahrt, immer.
Eine Zeit lang bin ich auch dem Gedanken verfallen, niemand würde auf mich warten. In dieser großen weiten Welt, in diesem Land, dem ich mit meinem Leben diene.
Aber ich habe einen Verlobten, der früher mal mein bester Freund gewesen ist.
Ich habe Eltern, die mich lieben, auch wenn sie mit meiner Entscheidung, zum Militär zu gehen, nicht wirklich einverstanden sind.
Ich habe eine ältere Schwester, zu der ich zwar kaum noch Kontakt habe, aber wenigstens haben wir uns nicht zerstritten. Ich habe eine Zwillingsschwester, auch wenn unser Verhältnis mittlerweile abgekühlt ist.
Ich habe so etwas wie eine beste Freundin, eine Dänin, Dagmar. Ich habe Nachbarn, mit denen ich ganz gut auskomme.
Und ich habe Max.
Trotzdem habe ich mich hierfür entschieden. Das Leben ist mir wohl etwas über den Kopf gewachsen.
Mittlerweile bin ich die kleine Soldatin, die beinahe jeden Tag mit einem G36 und einer Tagesration auf dem Buckel auf das Feld geschickt wird, der jede Sekunde eine Kugel den Schädel zerdeppern könnte, die sich bewusst in diese Lage gebracht hat. Die damals nicht lange nachgedacht hat, ehe sie sich für eine Grundausbildung und einen anschließenden Auslandseinsatz verpflichtet hat.
Irgendwer muss den Job ja machen, oder? Irgendwer auf dieser Welt muss immer Krieg führen, bewaffnete Konflikte, wie wir es nennen. Wir können es einfach nicht lassen.
1
Nach dem Sand die Heimkehr
Roxane Rosalie Roth
Zu Hause. Diese Worte fühlen sich in meinem Kopf seltsam an. Ich bin im Sand zu Hause, zwischen fliegenden Geschossen und dem drückenden Geruch nach frischem Blut. Nicht in der abgestandenen Luft dieser geräumigen Erdgeschosswohnung direkt neben der Promenade. Ich bin es gewohnt, Dreck zu fressen, zischende Projektile statt zwitschernde Vögelchen zu vernehmen. Was tue ich in dieser Idylle? Was mache ich hier nur?
Alles ist noch genau so, wie ich es zurückgelassen habe. Der Rotweinfleck auf dem altmodischen Teppich, aus reinem Übermut entstanden. Der abblätternde Lack auf der Innenseite unserer Badtür. Ansonsten ist es nahezu peinlich sauber. Hier knirscht niemandem beim Essen der Sand zwischen den Zähnen.
Mein Verlobter ist überall. Er will mich umsorgen, mich wie ein Kind behandeln, das gerade vom Spielplatz nach Hause gekommen ist. Seine Worte schwirren um meinen Kopf, prasseln auf mich ein, doch ich ziehe mein Schweigen hinter mir her, lasse mich von der Stille ins Bad begleiten.
Die Stille in mir ist neu, früher war ich irgendwie aufgeweckter. Sie ist vor vier Tagen entstanden, als die Truppenärztin mich einberufen und zurück in meine Heimatstadt geschickt hat. Es ist eine Stille, die von Trauer zeugt. Nicht für Anna, für sie habe ich eine Minute geschwiegen, doch das Schweigen war nicht von Dauer. Es ist etwas anderes. Ich habe Heimweh. Ich habe Heimweh und ich will nach Hause. Ich lasse mir die Tränen wie ein Kind über die Wangen laufen.
Ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause.
Ich vermisse das G36 wie einen Bruder, den Sand wie eine weiche Wolke aus Bettwäsche. Ich vermisse die Hitze, die mir jeden Tropfen Wasser aus dem Körper saugt.
Einige Minuten stehe ich einfach so da, ehe ich es schaffe, die Einheitskleidung des Militärs nach und nach abzulegen. Mit jedem Kleidungsstück, das auf dem Boden landet, fühle ich mich etwas mehr verlassen, bis ich beinahe nackt bin. Nur die dicke Schmutzschicht birgt mich noch. Ich muss dem Drang widerstehen, Deckung zu suchen, denn ich bin ungeschützt. Eine Gefahr für die Truppe.
Erst heute fällt mir auf, wie groß unser Bad ist. Es bietet keinerlei Deckung, was ein Fünkchen Panik in mir aufkeimen lässt. Was mache ich, wenn ein Feind in der Badewanne liegt, ein Gewehrlauf aus dem Schränkchen neben dem Spiegel ragt? Was tue ich, sollte mich ein Scharfschütze durch das Fenster über mehrere Kilometer hinweg anvisieren?
Ich muss mich ablenken, am besten sofort. Muss von diesem aufdringlichen Gedanken wegkommen, der mich verfolgt wie ein Aasgeier ein schwaches Tier, das bald sterben und eine Futterquelle bieten wird.
Ich weiß, was eine gute Ablenkung wäre. Aber es wäre eine Überwindung, der ich in den Bädern in den Kasernen, in denen ich meine Nächte nach der Sahelzone verbracht habe, schon nicht gewachsen war. Kurz wiege ich Kosten und Nutzen ab und entscheide mich dann, das erste Mal seit Monaten in einen Spiegel zu sehen. Ich muss mich regelrecht zwingen, muss mich fragen, wovor ich mich eigentlich fürchte. Wird mein Gesicht schmaler sein als davor? Sehe ich ausgemergelt, verstrubbelt, dreckig aus?
Ich darf mir nicht mehr Zeit lassen. Mein Kopf ist zu gut darin, Ausreden zu finden und unangenehme Dinge hinauszuzögern. Ich lasse meinen Blick auf mein Spiegelbild gleiten, starre mir erst selbst in die Augen, bis ich realisiere, dass ich vor dem Rest meines Körpers nicht davonlaufen kann.
Ich erkenne mich nicht. Mir steht eine Kreatur gegenüber, an der man jede Rippe zählen kann und die so flache Brüste hat, dass man sie kaum mehr als solche erkennt. In meinen gewucherten Haaren klebt so viel Staub, dass aus dem ehemals glänzenden Rostrot ein brackiges Braun geworden ist. An den Spitzen sind sie so verfilzt, dass sie aussehen wie eine klumpige Matte, auf der bequem eine ganze Familie von Mäusen hätte übernachten können.
Wie ich mich da so sehe, kommen die Erinnerungen an unser Lager wieder hoch. Sand, überall Sand, und dann waren da diese kleinen bräunlichen Lehmhütten. Eine von ihnen, das Bad für alle Geschlechter, hat derart gestunken, dass man es nur aufgesucht hat, um sich zu erleichtern. Im Grunde bestand es nur aus einem tiefen Loch im Boden, fließendes Wasser gab es selbstverständlich nicht. Meine größte Angst in diesem Bad war immer, aus Versehen in die Jauchegrube zu fallen. Noch jetzt muss ich mich bei diesem Gedanken unwillkürlich schütteln.
Angreifbarer als ich in all den letzten Monaten war, kämpfe ich mühevoll jeden Drang nieder und setze einen Fuß in die Dusche. Ich habe so lange nicht mehr unter einem Wasserstrahl gestanden, dass ich ganz vergessen habe, wie sich das kühle Nass auf meiner Haut anfühlt. In der Sahelzone ist Wasser zum Trinken da, wenn es hochkommt noch zur Zahnpflege. Den Körper mit diesem heiligen Gut zu waschen, wäre reinste Blasphemie gewesen. Und es war auch nicht notwendig. Zu unserer aller Verwunderung hörten wir nach zwei Monaten ohne Wasser und Seife auf zu stinken. Vielleicht haben wir es auch nicht mehr wahrgenommen.
So stehe ich hier, verschwende Liter um Liter damit, mir meine Schutzschicht von der Haut zu schrubben, bis ich vom Scheitel bis zur Sohle krebsrot bin. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu beobachten, wie das wertvolle Lebenselixier braun und unbrauchbar unter meinen Füßen im Abfluss verschwindet. Wie viel Durst damit doch gestillt werden könnte.
Während ich mich der Prozedur unterziehe, versuche ich, an etwas anderes zu denken. Die letzten vier Tage haben sich bemerkenswert langgezogen. Es ist beinahe so, als würde die Zeit außerhalb der Kampfzone langsamer vergehen. Erst ist Anna gestorben. Dann hat man mich, als sich die Unruhen ein wenig gelegt hatten, zur oberen Truppenärztin einberufen, die mir mitteilte, dass ich ihr in letzter Zeit aufgefallen wäre. Über die Einschätzung, dass ich Symptome einer Belastungsstörung zeige, die sich womöglich auch posttraumatisch äußern wird, bin ich durchaus beleidigt.
Ich habe die Truppenärztin auf Knien angefleht, in der Sahelzone bleiben zu dürfen. Doch der Beschluss stand bereits fest, wurde über meinen Kopf hinweg entschieden. Kaum hatte ich mich versehen, saß ich schon im Militärflugzeug zurück nach Deutschland. Dann die Tage in der Kaserne, in der ich Gespräche führen musste und befragt wurde, ehe sie mich haben gehen lassen. Selbst in der Kaserne wäre ich lieber geblieben, als zurück in dieses Kaff zu fahren.
Dann die Ankunft, von meiner Mutter so groß gefeiert, wie es eben am Bahnhof möglich war. Sie hat mich übertrieben geherzt, mich fast mit ihrer blonden Dauerwelle erstickt, die sie seit den Achtzigern nicht mehr loswird. Die Begrüßung meines Vaters fiel etwas spärlicher aus, die von meinem Verlobten enttäuschte mich jedoch regelrecht. Ein öffentlichkeitstaugliches Küsschen, das war alles, was ich von Adam Richter bekam. Dann nahm er mir mein Gepäck ab und lud mich in seinen dunkelgrünen Mini.
Und jetzt bin ich hier. Verschwende Ressourcen, die an anderer Stelle dringender gebraucht werden.
Als ich nach wenigen Augenblicken die schiere Verschwendung nicht mehr aushalte und aus der Dusche steige, ist meine Haut so gereizt, dass sie anfängt zu brennen, sobald ich mich in das Handtuch einwickle. Ich rede mir ein, dass ich mich jetzt menschlicher fühle. Dass ich davor ein Tier war, das nur auf seine Instinkte vertraut und seinen Körper vernachlässigt hat.
Ohne den Schmutz, der mich die letzten Wochen im Feld begleitet hat, fühle ich mich nicht nur verlassen, sondern auch nackt. Ich habe das letzte Bisschen, das mich an mein Zuhause im Sand erinnert hat, weggewaschen. Jetzt bin ich allein.
Nur meine Haare spielen das Spiel der Säuberung nicht mit. In mein Handtuch gewickelt muss ich mir ganze zehn Zentimeter abschneiden, um auch die letzten Verfilzungen loszuwerden. Jetzt reichen sie mir gerade noch bis zur Schulter, was mich früher vielleicht gestört hätte. Heute gibt es nichts, was mich weniger tangiert. Gleich darauf sind mit derselben großen Schere meine Nägel an der Reihe. Meine Hand zittert, ist sich solche filigranen Arbeiten nicht mehr gewohnt. Zweimal schneide ich in mein Nagelbett und sehe zu, wie ein einzelner roter Tropfen hervorquillt. Es erinnert mich an Anna und ihr Blut und ihren leeren Blick.
Keine fünf Minuten später sitze ich wieder in der Küche. Der Stuhl neben dem Esstisch ist mein Reich. Ich sehe Adam dabei zu, wie sich die Haut über seinen Muskeln spannt, während er die Tomaten wendet und vor sich hin summt, damit das Zischen des Weißweins, den er gekonnt zum Ablöschen einsetzt, nicht das einzige Geräusch ist, das mich von meinen Gedanken losreißt.
Eigentlich ist Adam Richter das Rundumpacket an Mann: Er sieht gut aus, hat Muskeln, ist mit seiner Hornbrille und seinen hellbraunen Locken aber doch kein vollständiger Stereotyp. Er behandelt mich, als wäre ich ihm das Wichtigste auf der Welt. Er kann kochen, er ist gut im Bett, er beteiligt sich im Haushalt und verdient gut. Aber er war auch mein bester Freund, bevor er mich damals geküsst hat. Und ein großer Teil von mir wünscht sich, dass aus der Sache zwischen uns niemals mehr geworden wäre.
Zu seinem Essen serviert er Weißwein. Ich möchte schon Protest einlegen und einen Gin Tonic verlangen, da steht er plötzlich dicht hinter mir, umfasst meine Taille gekonnt mit seinen warmen Händen und raunt mir mit seiner tiefen Stimme ins Ohr: »Gin Tonic gibt es später. Der Wein passt einfach so gut dazu. Tu mir doch den Gefallen.«
Ich setze ein Lächeln auf und nicke. Zwar ist Gin Tonic das Getränk, das wir seit Jahren immer gemeinsam trinken und auf das ich mich nach meiner Heimkehr am meisten gefreut habe, aber er hat recht. Und jeder Alkohol ist mir in dieser Situation ein Freund.
Während wir essen, schenkt er mir drei Mal nach, bis ich mich fühle, als hätte man meinen Kopf in weiche Watte eingepackt. In seinen Blicken, die er mir immer wieder zuwirft, liegt ein Feuer, das gut mit der Kerzenflamme auf dem Tisch mithalten kann.
Als wir fertig sind, trägt er die Teller ab und nimmt zwei Gläser, samt der Flasche Gin aus dem Schrank. Wie er da so mit dem Rücken zu mir steht, tue ich, was man als gute Verlobte tut: Ich setze ein charmantes Lächeln auf, stelle mich hinter ihn, bis mein Bademantel sein Oberteil berührt, und fahre mit den Händen von seiner Taille bis hoch zu seiner Brust.
»Hast du das auch so vermisst?« Es ist das Erste, was ich zu ihm sage, seit wir das Haus betreten haben. Meine Stimme fühlt sich rau und brüchig an, ich muss mich kurz räuspern. Dann spüre ich nahezu, wie seine Haut Funken versprüht, während er zustimmend murmelt. Seine Hand verweilt an der Flasche Gin, während meine Finger den Weg von seiner Brust zurück zu seinen Bauchmuskeln finden, die sich unter dem dünnen Shirt abzeichnen. Er ist muskulöser geworden, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Unwillkürlich stelle ich mir vor, wie er jeden Abend im Fitnessstudio verbracht hat, um in der leeren Wohnung nicht immer an seine Verlobte im Krieg denken zu müssen. Beinahe wünsche ich mir, dass ich ihn genauso vermisst hätte und nicht nur den Sex. Der körperliche Entzug hat mich in den ersten Wochen hart getroffen, danach gab es irgendwie immer andere Probleme. Aber jetzt, wo ich so hinter ihm stehe und die Ergebnisse seines Kummers unter seiner Haut spüre, drängt sich meine Lust wieder an die Oberfläche.
Ich gehe noch ein Stück näher an ihn heran, drücke ihn gegen die Küchenzeile. Früher habe ich ihn immer auf diese Weise verführt. Dann atme ich seinen vertrauten Geruch ein, unterstrichen mit dem Duft nach der Flasche Wein, die wir eben gemeinsam geleert haben.
Ich gehe auf die Zehenspitzen, hauche ihm einen Kuss in den Nacken. Meine Hände hören auf zu wandern, verweilen irgendwo zwischen Brust- und Bauchmuskeln. Er rührt sich keinen Zentimeter, umklammert die Flasche Gin, bis seine Fingerknöchel weiß werden. Es macht ihn verrückt, wenn er mich nicht berühren kann. Ich sehe es daran, wie er zu zittern beginnt, aber er macht keine Anstalten, sich umzudrehen. Ich bin verwirrt. Gerade eben kam es mir so vor, als würde er die Stimmung zwischen uns initiieren und jetzt lässt er seine Chance fallen.
Als ich wieder auf die Fersen sinke, ist der Moment vorbei. Adam braucht noch ein paar Sekunden, ehe er Gin in das zweite Glas kippt. Auf seinen Lippen zeichnet sich ein verschmitztes, kleines Lächeln ab. Leicht schüttelt er den Kopf, als hätte er es kommen sehen. Einen Augenblick lang bin ich mir sicher, dass er das Gefühl hat, dass alles wieder so ist wie früher. Wir reden zwar nicht viel, aber zwischen uns knistert es trotzdem auf eine andere, stillere Weise. Und ich möchte den Moment nicht kaputtmachen, lasse mir noch Zeit, ehe ich ihm diesen Zahn ziehe.
Das Lächeln behält er bei, während wir uns zusammen ins Wohnzimmer setzen. Nur die kleine Stehlampe neben der grünen Ledercouch erhellt den Raum, draußen ist es schon dunkel. Ich nippe an meinem Gin Tonic und bereite mich auf die Fragen vor, die er mir stellen wird.
»Es wäre dumm, dich zu fragen, wie es gewesen ist. Ich kann es mir schon denken.«
»Wieso kannst du es dir denken? Hättest du so früh etwa nicht mit mir gerechnet?«
»Ich bin froh, dass du wieder da bist. Aber es muss doch einen Grund geben.«
Seufzend nehme ich einen großen Schluck, der das halbe Glas leert. Es ist ein stiller Moment, bis ich mich aufraffe zu antworten: »Sie glauben, dass ich eine Belastungsstörung habe.«
»Warum das denn?« Seine Antwort kommt keuchend. Ich sehe dieses Mitgefühl in seinen Augen, diese große Empathie, vor der er strotzt.
»Vor ein paar Tagen war ich mit Anna im Feld. Die Sicht war schlecht, irgendwie war ziemlich viel Staub aufgewirbelt. In der Nacht davor hat ein Sandsturm getobt, dann ist es auf dem Feld immer besonders gefährlich. Wir haben uns ein Zelt geteilt, Anna und ich. Sie war die Einzige, mit der ich ab und an geredet habe.«
»Und was ist passiert?« Er kann es sich denken, fragt sicherlich nur aus Höflichkeit. Um mir die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden, wenn ich es brauche.
»Anna hat den perfekten Abgang hingelegt. Der Schuss ging direkt durch die Schläfe.«
Seine Antwort kommt zu schnell. »Das tut mir leid.«
»Muss es nicht. Sie hatte zu Hause niemanden, der auf sie gewartet hat. Und sie hat sicher nicht gelitten, war gleich weg. Zack und weg, wie man es sich vorstellt.«
»Berührt dich das denn gar nicht? Du redest so unbeschwert darüber.«
»Anscheinend dachte der Truppenarzt, dass es mich mehr mitnimmt. Vor dem Einsatz hatten wir ein Gespräch mit einem militäreigenen Psychologen. Der hat mich nach meinen größten Ängsten gefragt und ich meinte, meine größte Angst sei der Tod. Ich glaube, sie haben das Ganze fehlinterpretiert und mich für nicht mehr zurechnungsfähig gehalten.«
»Es ist trotzdem schrecklich, dass du deine Freundin hast sterben sehen.«
»Sie war nicht meine Freundin. Ich habe nur gesagt, dass man mit ihr reden konnte. Und ich habe nicht nur gesehen, wie sie gestorben ist, ich habe mit meinem G36 neben ihr gesessen.«
Darauf erwidert er erst ein paar Minuten nichts. Er muss verdauen, was ich gesagt habe. Vielleicht versucht er auch, die Bilder, die er sich unweigerlich vorstellt, zu verdrängen.
»Und … wie war es sonst so?«
»Es war unglaublich heiß. Das waren Temperaturen, die man sich als Durchschnittsdeutscher nicht vorstellen kann.«
»Was gab es zum Essen?«
»Du stellst vielleicht Fragen. Im Feld gab es Tütenfutter, in der Basis meistens Nudeln. Klingt vielleicht im ersten Moment befremdlich, aber die muss man nicht lange kochen, sie halten sich und machen schnell satt.«
Wieder eine Minute dieses unangenehmen Schweigens. Ich höre die altmodische Uhr an der Wand ticken, nehme einen Schluck, dann noch einen. Mein Gin Tonic ist fast leer, so langsam werde ich ungewöhnlich redselig.
»Warum hast du mir nie geschrieben?«
»Hast du mal versucht, mitten in der Sahelzone einen Briefkasten zu finden?«
»Komm schon Rocky, wir sind nicht mehr im Zweiten Weltkrieg. Du hättest mir eine Nachricht aufs Handy schicken können.«
»Das hatte ich nicht unbedingt dabei, wenn ich wie ein Tier durch den Sand gerobbt bin.«
»Aber du hättest mir am Abend schreiben können. Ich habe fast nie von dir gehört.«
Statt zu antworten, nehme ich einen weiteren Schluck.
»Ich verlange nicht viel, ich hätte nur gern gewusst, wie es meiner großen Liebe geht.«
Ich leere das Glas, überlege mir eine Antwort, aber statt etwas Sinnvollem fällt mir nur ein: »Machst du mir noch einen Gin Tonic?«
»Ich glaube, du hattest genug.« Seine Stimme ist vorsichtig, er geht mit mir um wie mit einem rohen Ei. Als wäre ich zerbrechlicher als damals.
»Vielleicht hast du recht.«
Ich merke, wie mir meine Zunge langsam schwer wird. Vorsichtig, weil ich meine Kräfte nicht mehr wirklich einschätzen kann, stelle ich das Glas auf dem flachen Couchtisch ab und rutsche ein Stück näher an Adam heran. Auch er stellt sein Glas beiseite.
»Eigentlich haben wir auch genug geredet.« Ich versuche, einen verführerischen Ton in meine Stimme zu legen. Und es gelingt mir gut, ich habe wohl noch viel Kontrolle, trotz einer halben Flasche Wein und eines Gin Tonics.
Langsam lasse ich meine Hand seinen Arm hinauf in seinen Nacken gleiten. Ehe ich mich versehe, spielen meine Finger mit seinen hellbraunen Locken. Seine Hände wandern auf meine Hüfte, ziehen mich sanft auf seinen Schoß. Ich gehe mit seiner Bewegung mit und verwickle ihn in einen innigen Kuss. Nach so langer Zeit fühlt es sich gut, aber auch ungewohnt an. Während seine Hände von meiner Hüfte hinab zu meinem Hintern wandern, öffnen sich seine Lippen für mich. Erst lässt er seine Zunge genüsslich an meiner Unterlippe entlangfahren, dann tastet er sich weiter vor. Er ist vorsichtig, so kenne ich ihn gar nicht.
Ein erstes Keuchen kommt über seine Lippen, als ich mit der Hand unter sein Oberteil fahre. Ich will ihn aus der Reserve locken, will, dass seine Hände fester zupacken. Dass er mich ebenfalls zum Stöhnen bringt und ich mich nicht wie das rohe Ei fühle, das er in mir sieht. Alles in mir schreit danach, dass er mich den Alltag vergessen lässt, in den mich die Truppenärztin zurückgeschickt hat. Aber Adam bleibt vorsichtig, seine Hände verweilen an ihrem Ort, die Augen hat er geschlossen und seine Zunge findet viel zu schnell den Weg zurück in seinen Mund.
Frustriert stöhne ich auf. Ich möchte die Leidenschaft zurück, das Feuer. Aber stattdessen bekomme ich nur sanfte Küsse an meiner Kieferpartie. Er berührt meine Haut kaum und kurz frage ich mich, ob er mich hungrig sehen möchte und mich so lange in den Wahnsinn treibt, bis ich ihm die Kleidung vom Leib reiße. Ich schiebe meinen Oberkörper vor und presse meine Brüste an seine Muskeln, intensiviere unseren Kuss, grabe meine kurzen Nägel ein wenig in seinen Nacken. Er soll merken, wie sehr ich seinen Körper begehre. Doch er scheint auf dem Schlauch zu stehen. Ich starte einen zweiten Versuch, ziehe ihm rasch sein Oberteil über den Kopf, drücke den Rücken durch und werfe meinen Kopf nach hinten, in der Hoffnung, dass er wie früher mit der empfindlichen Haut an meinem Hals spielt. Ich habe das Gefühl, ihm keine deutlicheren Signale mehr geben zu können, aber alles, was ich bekomme, sind ein paar sanfte Küsse auf meinem Dekolletee. Das Feuer brennt in mir, aber nicht in ihm.
Kurz glaube ich, dass ich mein Ziel doch erreicht habe, als seine Lippen den tiefen Ausschnitt meines Bademantels hinabwandern, und klopfe mir innerlich schon fast auf die Schulter, doch bevor er meinen Brüsten auch nur nahekommt, blickt er auf. In seinen Augen blitzt keine Lust, nur Unsicherheit. Mein Kopf will nicht verstehen, was da passiert ist. Vorhin in der Küche hatte er dieselbe verführerische Stimme wie früher, aber dann hat er seine erste Chance verstreichen lassen, und jetzt auch seine zweite.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch enttäuschter sein könnte. Vor meinem Einsatz wäre es nicht so gelaufen, da bin ich mir sicher. Ich versuche, mich in ihn hineinzuversetzen, aber es will nicht funktionieren. Da ist zu viel Frust, der sich in meiner Brust zu einem pulsierenden Ball angesammelt hat. Ich muss meine Lippen zusammenpressen, um nichts zu sagen.
Wir sehen einander an und schweigen. Ich merke, dass er hin und her gerissen ist. Natürlich hat er meine Zeichen gesehen und wahrscheinlich würde er mir auch gern geben, was ich will. Alles andere würde Adam Richter nicht ähnlichsehen. Aber irgendetwas scheint ihn abzuhalten.
»Was ist los?« Ich versuche, meine Stimme nicht wie ein Flehen klingen zu lassen, aber es fällt mir schwer. Der Sex mit Adam war das Einzige, worauf ich mich in diesem gottverlassenen Kaff gefreut habe und jetzt nimmt er mir auch das.
»Ich möchte dich nicht verletzen.«
Ich kann nur den Kopf schütteln, das nehme ich ihm nicht ab. Ich sage nichts und es dauert einige Atemzüge, bis er versteht, dass das nicht alles sein kann.
»Ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht genug geredet haben. Du hast nur ein paar Sätze über deine letzten Monate verloren. Es ist ja in Ordnung, wenn du nicht mehr reden möchtest, aber …«
»Aber was?« Meine Stimme ist hoch und aufgebracht. »Ist es zu viel verlangt, nach Monaten der Abstinenz begehrt werden zu wollen?«
Ich atme schnell, während er meine Hände in seine nimmt und mir einen beschwichtigenden Handkuss aufdrückt. »Nein, ist es nicht. Ich kann dir nur gerade nicht geben, was du möchtest. Ich bin zu verkopft. Und ich möchte dir wirklich keinen Vorwurf machen, aber du hättest wenigstens fragen können, was ich in den letzten Monaten gemacht habe.«
Ich verenge die Augen zu Schlitzen. »Ich kann es mir doch denken. Du hast gearbeitet, gegessen, bist ins Fitnessstudio gegangen. Am Sonntag hast du vielleicht meine Eltern besucht, um nicht selbst kochen zu müssen. Und damit ihr mir alle zusammen nachweinen könnt.«
»Rocky, ich bin dein Verlobter.« Er sagt das leise und mit gepresster Stimme, aber ich verstehe das Argument nicht. »Ich wäre einfach gern gefragt worden, wie es mir geht und was ich gemacht habe. Ich bin zum Beispiel befördert worden.«
Ich seufze, fühle mich viel zu nüchtern und sehne mich nach einem weiteren Glas Gin. Dann schwinge ich das Bein über seinen Schoß zurück auf den Boden und sitze wieder neben ihm.
»Siehst du?«, frage ich mit verschränkten Armen. »Du erzählst es mir doch sowieso. Und ich laufe dir nicht weg, du hast die nächsten Tage noch genug Zeit, mir alles zu schildern. Verstehst du mich nicht ein kleines Bisschen? Mich hat fünf Monate lang niemand angefasst, ich habe mich die ganze Zeit nach Berührungen gesehnt.«
Adam lässt die Schultern hängen und schaut resigniert auf den Couchtisch zu seinen Füßen. »Wenn du es unbedingt möchtest, kann ich bei dir Hand anlegen. Für mehr bin ich zu müde, ich habe die letzten Tage nicht viel geschlafen, weil ich die ganze Zeit nur daran denken musste, dass du bald nach Hause kommst.«
Wieder diese Worte. Nach Hause. Sie fühlen sich nicht nur in meinem Kopf komisch an, auch ausgesprochen wirken sie irgendwie fehl am Platz. Daneben drängt sich noch ein anderer Gedanke in meinen Kopf. Adam ist nie zu müde für Sex. Vor einem halben Jahr konnte ich ihn mitten in der Nacht aufwecken und innerhalb weniger Minuten verführen. Was ist seitdem nur mit ihm passiert?
Aber vielleicht ist er ja wirklich zu müde. Zumindest rede ich mir das ein und erlaube mir die kleine Hoffnung, dass unser Feuer irgendwann in den nächsten Tagen wieder zu lodern beginnt. Jedenfalls habe ich wenig Lust darauf, dass er mich jetzt anfüttert, dann aber nicht weiter geht. Ich erkämpfe mir ein Lächeln auf dem Gesicht, um unser hitziges Gespräch beizulegen. Wenn wir jetzt weiter streiten, brauche ich mir über Intimitäten in den nächsten Tagen gar keine Gedanken zu machen.
Ich bücke mich und hebe sein Shirt auf, das ich im Eifer meines Gefechts neben mir auf den Boden geworfen habe. Schweigend reiche ich es ihm und er erwidert mein schmales Lächeln. Ich sehe ihm an, dass es mindestens so erzwungen ist wie meines.
Adam füllt seine Lungen tief und geräuschvoll mit Luft, ehe er mit klarer, lauterer Stimme sagt: »Ich habe unsere Hochzeit übrigens fast fertig geplant. Soll ich dir morgen vor dem Abendessen die Pläne vorstellen?«
Der Bruch in seiner Stimmung und im Thema erwischt mich unerwartet. Ich muss schlucken, kurz die Augen schließen. Dieser ganze verdammte Abend ist ein Zeugnis dafür, wie sehr mein Leben aus den Fugen geraten ist. Erst will mein Verlobter nichts Körperliches mehr von mir, dann geht unsere Kommunikation in die Brüche. Und dann ist da noch die Hochzeit. Beim bloßen Gedanken an diesen Tag, der mich für immer zu einer Roxane Rosalie Richter machen wird, wird mir übel.
Ich will das alles nicht, ich will hier weg. Zum Sand, zur Hitze, zu meinem Gewehr. Ich könnte schreien, könnte weinen und mit meinen Nägeln das teure Ledersofa zerkratzen. Aber ich lasse mir nichts anmerken. Gestern dachte ich noch, dass ich das alles hier schon irgendwie schaffen werde. Wie ich mich doch geirrt habe.
Ich stehe auf und wische mir die schweißnassen Hände am Bademantel ab. Es ist mir noch nie so schwergefallen, das Lächeln auf meinen Lippen zu halten, als ich erwidere: »Warum nicht?«
Und wieder vermisse ich in diesem einsamen Moment mein Zuhause.
2
Alltag, dieser verdammte
Roxane Rosalie Roth
Die Geschichte von Anna ist das erste, worüber mich meine Eltern ausfragen, als ich am nächsten Tag kurz vor zwölf auf der Matte stehe. Meine Mutter vergießt eine weitere Träne, verlangt eine Schweigeminute, in der sie die Hände zusammenfaltet und für meine gefallene Kameradin betet.
»Bist du froh, wieder zu Hause zu sein?«
Der prüfende Blick meines Vaters trifft mich. Kurz wandern meine Augen zu meiner Mutter, die meinen Vater mit einem verkniffenen Gesicht ansieht. Er hat ihre Schweigeminute etwas zu früh durchbrochen, doch sie verkneift sich einen Kommentar.
»Ja, sicher.« Ich muss schlucken, mehr bringe ich nicht heraus. Mein Vater hat es schon wieder gesagt. Zu Hause. Warum geht jeder davon aus, dass das hier mein Zuhause ist?
»Das klingt aber …«
»Nein, Papa, ich bin wirklich froh, nicht mehr im Sand zu sitzen. Allmählich ist mir die Hitze zu Kopf gestiegen. Ich war fünf Monate da und es hat kein einziges Mal geregnet, weißt du?«
»Was erwartest du auch von einer Wüste?«
An das unwirsche Knurren meines Vaters schließt sich die etwas hysterische Stimme Mamas an: »Kaum ist deine Tochter wieder zu Hause, musst du mit ihr streiten. Du bist unglaublich, Richard.«
»Wir streiten nicht.«
Trotz meiner Beteuerung wirft sie meinem Vater einen strafenden, beinahe giftigen Blick zu. Am liebsten würde ich das Thema an der Stelle abreißen. Immer, wenn wir über meinen Einsatz reden, werden meine Eltern unruhig, brausen bei jeder banalen Kleinigkeit auf und gehen einander an die Gurgel. Als würden sie sich gegenseitig für meine Entscheidung die Schuld geben, dabei habe ich keinen der beiden gefragt, ehe ich mich verpflichtet habe.
Mama trägt die letzte dampfende Terrine zu Tisch, dann zieht sie sich die Schürze aus, lächelt. »Guten Appetit, greift zu.« Und während sie mir einen Kloß auf den Teller klatscht: »Hat Adam dir eigentlich schon von seinen Hochzeitsplänen erzählt?«
Wahnsinn, ich habe tatsächlich gedacht, es gibt kein anderes Thema, welches die Stimmung noch mehr drücken könnte. Anscheinend ist mein Verlobter, kaum dass er fertig geplant hatte, zu meinen Eltern gerannt und hat ihnen seine Pläne auf dem Silbertablett präsentiert. Eigentlich sollte mich das nicht wundern. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er sich sogar besser mit ihnen versteht als ich.
»Nein, aber er hat es mir für heute Abend versprochen.«
»Sicher, gestern hattet ihr anderes zu tun.«
Meine Mutter schmunzelt wie ein kleines Kind, während Papa knurrt: »Übertreibt es nur nicht, ich bin noch nicht bereit, Großvater zu werden.«
Ein kurzes, sehr unangenehmes Schweigen legt sich über den Tisch. Ich stochere mit hellrotem Kopf in meinem Kloß herum und versuche, auf andere Gedanken zu kommen. Klöße.
Klöße essen wir immer, wenn der Herbst beginnt und dann über den ganzen Winter. Es ist Sonntag, früher haben wir sie jeden Sonntag gegessen, manchmal mit Rouladen, manchmal mit einem Braten, meistens mit Rotkraut, ab und an auch mit grünen Brechbohnen. Noch so eine Tradition, die den ewigen Kreislauf markiert.
»Mal von der Familienplanung abgesehen: Wie versteht ihr euch?«
»Wie sollen wir uns schon verstehen?« Etwas freudlos lasse ich eine Mischung aus Schnauben und Kichern vernehmen. »Wir sind verlobt. Er freut sich auf die Hochzeit.«
»Ich freue mich auch auf die Hochzeit. Fast genauso sehr wie darauf, dir ein Brautkleid auszusuchen. Natürlich erst, wenn du wieder ein bisschen zugenommen hast.«
Ich blicke auf den Kloß und die Bratensauce hinunter und denke mir, dass das nicht allzu lange dauern kann. Subtil tritt eine Hand in mein Sichtfeld, die eine mit totgebratenem Fleisch beladene Zange hält. Es landet auf meinem Teller, ein fettes Stück. Ich mag kein Fett an meinem Fleisch, aber das soll meiner Mutter recht sein, solange ich schnell wieder meine ursprüngliche Form zurückerlange. Sie weiß, dass ich meinen Teller immer aufesse, zumindest in meinem Elternhaus. Wenn ich als Kind nicht aufgegessen habe, musste ich danach meistens mein Zimmer aufräumen, die Wäsche machen oder musste am Abend früher ins Bett.
Die Stimme meiner Mutter reißt mich aus meinen Gedanken. »Stimmt, ich habe ganz verdrängt, dass Adam dir noch nichts von seinen Plänen erzählt hat. Mir wurde zugesichert, dass ich dein Kleid mit aussuchen darf.«
Ich sehe schon wieder eine Freudenträne in ihrem Augenwinkel glitzern und frage mich, wie ich diese Sentimentalität all die Jahre ausgehalten habe. Kurz überlege ich vorzuschlagen, Dagmar mitzunehmen, aber das wäre sicher nichts für sie. Ich habe schon genug stereotypisches Verhalten von ihr verlangt, als ich sie danach gefragt habe, ob sie meine Trauzeugin sein möchte.
Ich seufze. »Nur du und ich, Mama.«
»Dann darfst du aber nicht kurzfristig doch noch beschließen, mit der Familienplanung zu beginnen. Eine Hochzeit ist nichts für Umstandsmode.«
Wieder spieße ich ein Stück Kloß mit einer Zinke auf, wieder läuft mein Kopf hochrot an. Mir war klar, dass sie auf dem Thema herumreiten würde, immerhin hat sie Papa damals in frühen Jahren geheiratet, weil sie mit meiner großen Schwester schwanger geworden ist. Aber für mich könnte die Kinderplanung nicht weiter hinten anstehen. Es reicht schon, dass Adam mir diesen Antrag gemacht hat, wahnsinnig herzzerreißend und kitschig. Ich weiß noch, wie ich in diesem Moment in seine Augen gesehen habe, so warm. Sie haben regelrecht Funken versprüht, die sich mit einer Gänsehaut auf meinen Armen niedergelassen haben. Ich hätte nicht nein sagen können. Einerseits, weil ich damals noch viel mehr für ihn empfunden habe. Andererseits, weil ich ihm nicht das Herz brechen möchte, damals nicht und heute nicht.
»Keine Angst, Mama. Das erste Enkelkind hast du von Dana zu erwarten.«