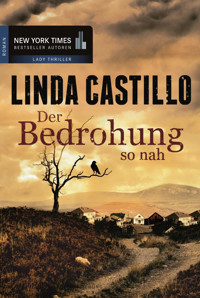9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wenn die Flammen eine schreckliche Wahrheit verbergen – der 16. Fall für Polizeichefin Kate Burkholder Mitten in der Nacht wird Polizeichefin Kate Burkholder von einem Anruf geweckt: Bei einem Feuer in einem einsamen Waldstück ist ein Mann umgekommen. Der Verstorbene, ein amischer Mann namens Milan Swanz, wurde an einen Pfahl gefesselt und lebendig verbrannt. Kate weiß nur zu gut, dass die Amischen ihre Probleme lieber ohne Einmischung der Außenwelt lösen, und zunächst will niemand mit ihr über den ermordeten Mann sprechen. Nach und nach findet sie heraus, dass Swanz vor Kurzem aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Doch was hat er getan, dass er so bestraft wurde? Und führte diese Tat auch zu seinem Tod? Während ihrer Ermittlungen taucht Kate tief in die Kultur und Geschichte der Amischen ein. Bis sie ein Geheimnis aufdeckt, das alles erschüttert, was sie über die Amischen – und damit ihre eigenen Wurzeln – zu wissen glaubt. Ein packender Thriller – und ein spannender Einblick in die europäischen Ursprünge der Amischen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Linda Castillo
Aschetod
Thriller
Über dieses Buch
Wenn die Flammen eine schreckliche Wahrheit verbergen
Mitten in der Nacht wird Polizeichefin Kate Burkholder von einem Anruf geweckt: Bei einem Feuer in einem einsamen Waldstück ist ein amischer Mann umgekommen. Der Verstorbene wurde an einen Pfahl gefesselt und lebendig verbrannt. Kate weiß nur zu gut, dass die Amischen ihre Probleme lieber ohne Einmischung der Außenwelt lösen, doch nach und nach erfährt sie, dass der Tote vor Kurzem aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Warum wurde er so bestraft? Um die Wahrheit herauszufinden, muss Kate tief in die Geschichte der Amischen eintauchen. Bis sie ein Geheimnis aufdeckt, das alles erschüttert, was sie über die Amischen – und damit ihre eigenen Wurzeln – zu wissen glaubt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wuchs in Dayton im US-Bundesstaat Ohio auf, schrieb bereits in ihrer Jugend ihren ersten Roman und arbeitete viele Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit »Die Zahlen der Toten« (2010), dem ersten Kriminalroman mit Polizeichefin Kate Burkholder. Linda Castillo kennt die Welt der Amischen seit ihrer Kindheit und ist regelmäßig zu Gast bei amischen Gemeinden. Die Autorin lebt heute mit ihrem Mann und zwei Pferden auf einer Ranch in Texas.
Helga Augustin hat in Frankfurt am Main Neue Philologie studiert. Von 1986 bis 1991 studierte sie an der City University of New York und schloss ihr Studium mit einem Magister in Liberal Studies mit dem Schwerpunkt ›Translations‹ ab. Die Übersetzerin lebt in Frankfurt am Main.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The Burning« bei Minotaur Books, ein Imprint von St. Martin's Publishing Group, New York
© 2024 Linda Castillo, published by arrangement with St. Martin’s Publishing Group. All rights reserved.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin's Publishing Group durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Redaktion: Silke Reutler
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Archangel/Abigail Miles
ISBN 978-3-10-491902-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Epilog
Dank
Dieses Buch widme ich meinen Schwestern Debbie und Kim.
Ich werde Euch immer lieben.
DER HERR PRÜFT GERECHTE UND FREVLER;
WER GEWALT LIEBT, DEN HASST ER AUS TIEFSTER SEELE.
Psalm 11,5
Prolog
So langsam dämmerte es Milan Swanz, dass er sich die falsche Nacht ausgesucht hatte, um sich zu betrinken. Nach dem langen Abend in der Bar, wo er Bier und Wild Turkey in sich hineingekippt hatte, musste er jetzt auch noch nach Hause laufen. Inzwischen war nämlich sein Saufkumpan verschwunden und damit auch seine Mitfahrgelegenheit. Als er das gemerkt hatte, war es ihm noch egal gewesen, denn da hatte er nur Augen für die Rothaarige in den engen Jeans und dem tief ausgeschnittenen Pulli gehabt, die auf den Billardtisch geklettert war, um einen komplizierten Jumpshot zu platzieren und damit das Spiel zu gewinnen. Leider war auch die Rothaarige kurz danach verschwunden, so dass er jetzt hackedicht und geil eineinhalb Meilen durch den knöcheltiefen Schnee entlang der Dogleg Road stapfen musste.
»Arrogante Schlampe«, murmelte er wütend.
Auf dem einsamen Abschnitt der Landstraße war es so dunkel, dass er Probleme hatte, den Weg auszumachen. Diese verfluchten Ohio-Winter! Als er abends um sechs Uhr in die Bar gekommen war, hatte das Thermometer angenehme zehn Grad angezeigt. Seither waren die Temperaturen gesunken und fünf Zentimeter Schnee gefallen, so dass er sich jetzt regelrecht den Arsch abfror.
Milan war gerade an der Brücke über den Little Paint Creek vorbeigekommen, als vor ihm in den kahlen, verzweigten Ästen der Bäume Scheinwerferlicht aufflackerte. Er drehte sich um, sah ein Fahrzeug näherkommen und trat zur Seite auf den Schotterstreifen, um auszuweichen. Kurz darauf knirschten Reifen auf dem Asphalt, und der Wagen blieb neben ihm stehen. Das Fenster auf der Beifahrerseite glitt herunter.
»Keine gute Nacht, um spazieren zu gehen«, hörte er eine freundliche Stimme vom Fahrersitz.
Milan blieb stehen, beugte sich vor und blickte ins Wageninnere, wobei warme Luft ihm ins Gesicht strömte. »Womit Sie absolut recht haben.«
»Wo wollen Sie hin?«
»Nach Hause.« In der Hoffnung, mitgenommen zu werden, zeigte Milan die Straße hinunter. »Anderthalb Meilen die Straße runter.«
»Ich fahre in die Richtung. Soll ich Sie mitnehmen?«
»O Mann, das wäre großartig.«
Die automatische Türverriegelung klickte, als sie sich entsperrte. »Steigen Sie ein.«
Milan klopfte sich den Schnee von den Schultern, öffnete die Tür und glitt auf den Beifahrersitz. Ein Seufzer entkam seinem Mund, als die Wärme des Innenraums ihn umhüllte und der Geruch von Leder in seine Nase stieg. »Danke, Mann.«
»Kein Problem.« Der Fahrer blickte in den Seitenspiegel, gab Gas und fuhr weiter. »Bei so einem Wetter sollte wirklich niemand draußen sein.«
»Meine Mitfahrgelegenheit ist ohne mich los.«
»Kann passieren.«
Ein angenehmer Song, den Milan nicht kannte, drang aus der Musikanlage, er lehnte sich im luxuriösen Sitz zurück, genoss die Wärme und entspannte langsam. Eines Tages würde er auch so einen Wagen besitzen. Eines Tages würde auch er mal Glück haben und –
Ein Geräusch auf der Rückbank ließ ihn aufschrecken, etwas huschte nur Zentimeter vor seinem Gesicht vorbei, legte sich auf seinen Hals. Und dann spürte er den Druck eines Riemens auf seinem Adamsapfel.
»Hey!«, stieß er kaum verständlich hervor, denn der Druck auf seinen Kehlkopf wurde stärker.
Instinktiv riss er beide Hände hoch, um den Riemen zu lockern, aber der legte sich immer fester um seinen Hals, nahm ihm die Luft und schnitt ihm die Blutzufuhr zum Gehirn ab. Er grub seine Nägel tief in sein Fleisch, ritzte sich die Haut auf, doch er konnte die Finger nicht unter den Riemen kriegen.
Panik erfasste ihn. Sein Körper zuckte, bäumte sich auf, er trat mit den Füßen um sich, drückte den Rücken in die Sitzlehne, hob ein Knie und rammte den Fuß ins Armaturenbrett, Plastik splitterte.
Aber der Riemen zog sich immer enger zu. Er konnte nicht mehr atmen, nicht mehr sprechen, er krümmte den Rücken, wand sich nach rechts und links, trat mit den Füßen, versuchte, ein Bein zu heben, um die Windschutzscheibe einzutreten, doch dafür war nicht genug Raum. Er schlug mit dem linken Arm zur Seite, um den Fahrer zu treffen, und knallte stattdessen mit dem Unterarm ans Lenkrad.
Blinde Panik überkam ihn. Er bohrte seine Finger ins Fleisch an seiner Kehle, hob den rechten Fuß, trat gegen das Handschuhfach, einmal, zweimal, hörte den Kunststoff krachen. Er riss den Mund auf, doch der Schrei erstickte, und seine Zunge hing zwischen den Zähnen heraus. Er bekam keine Luft. Keine Luft.
Das Licht flackerte und verdüsterte sich, die Musik verflüchtigte sich zu einem Rauschen, seine Hände fielen ihm in den Schoß, und seine Blase entleerte sich. Die Wärme breitete sich in seinem Schritt aus, aber das fühlte er schon nicht mehr.
Als Milan Swanz zu Bewusstsein kam, war es dunkel und kalt, und er hatte fürchterliche Kopfschmerzen. Ein eisiger Wind schnitt durch seine Jacke und seine Jeans, in seinem Hirn herrschte Chaos. Er war im Freien und fror bis auf die Knochen. Ihm fiel der Wagen ein, der ihn mitgenommen hatte, der Riemen um seinen Hals, dass jemand vom Rücksitz aus versucht hatte, ihn zu erdrosseln …
Er öffnete die Augen und blickte sich um. Eine Wand aus Bäumen umgab ihn, grauer Nachthimmel über skelettartigen Ästen. Schnee fiel wie Asche. Kein Mensch war zu sehen. Er versuchte, sich zu orientieren, aber er erkannte nichts wieder.
Wo war er?
Was zum Teufel ging hier vor?
Er stand aufrecht, aber nicht aus eigener Kraft. Alarmglocken schrillten in ihm auf, als ihm klarwurde, dass seine Hände im Rücken an etwas Festes, Raues gefesselt waren. Er versuchte, die Fesseln an seinen Handgelenken zu lockern, doch sie waren entweder aus Draht oder Kabelbinder und gaben keinen Millimeter nach. Beim Blick nach unten sah er, dass er auf einem Stapel Holzpaletten stand. Jemand hatte auch etwas, das wie Feuerholz und Reisig aussah, zu seinen Füßen aufgestapelt. »Was zum Teufel?« Seine Stimme hallte von den Bäumen wider, aber die einzige Antwort war das Rieseln des Schnees und das laute Hämmern der Angst in seiner Brust.
»Hallo«, rief er. »Wer ist da?«
Er hörte Schritte, blickte mit zusammengekniffenen Augen ins Dunkel und sah einige Meter entfernt eine Gestalt auf sich zukommen. Der Typ im Auto, wurde ihm klar.
»Alter, ich weiß verdammt nochmal nicht, was du vorhast, aber du kommst besser her und schneidest mich los.«
Der Mann blieb vor ihm stehen, wirkte gelassen, entschlossen, sein Gesichtsausdruck unberührt. In dem Moment sah Milan den Behälter in seiner Hand, und ein unangenehmes Kribbeln machte sich in seinem Bauch breit. »Was zum Teufel hast du vor?«, knurrte Milan.
Keine Antwort.
»Mach mich los!«, schrie er.
Aus dem Schatten tauchte ein zweiter Mann auf. Langer Wintermantel, Hut, Handschuhe, einen ähnlichen Behälter in der Hand. Diesmal wusste er, was drin war: Diesel. Trotz der Kälte spürte Milan, wie ihm der Schweiß den Rücken runterlief.
»Lass mich gehen, Mann.« Er hatte die Worte wie einen Befehl klingen lassen wollen, aber sie kamen wie das Quieken eines Kindes heraus. »Komm schon, Kumpel.«
Ohne ihn zu beachten, öffnete der Mann vor ihm den Behälter und goss den Inhalt auf die Holzpaletten. Sofort stieg der Gestank von Diesel auf. Einen Moment lang starrte Milan ungläubig nach unten, dann wurde jede Faser seines Körpers von Panik erfasst. Adrenalin durchflutete seine Adern wie Nitroglyzerin. Er zerrte an seinen Fesseln, versuchte, die Arme nach vorne zu reißen, aber der Draht schnitt tief ins Fleisch an seinen Handgelenken. Er krümmte und wand sich, um von dem freizukommen, an das er festgebunden war, versuchte, sich mit den Füßen abzustoßen, aber auch die waren an den Gelenken festgebunden.
Lieber Gott im Himmel, was ging hier vor?
»Was zum Teufel soll das?«, schrie er.
Keiner der beiden Männer beachtete ihn. Sie arbeiteten im Einklang, sorgfältig, ihre Mienen ruhig und unergründlich. Ein eingespieltes Team, methodisch vorgehend, konzentriert auf die Erledigung seiner Aufgabe.
Der Geruch von Diesel, vermischt mit der kalten Luft, stieg in Milans Nase. Entsetzen packte ihn, Galle füllte seinen Mund. Aus Angst, sich übergeben zu müssen, spuckte er aus.
»Seid ihr verrückt?«, schrie er. »Das könnt ihr nicht machen, lasst mich frei!«
Wieder zerrte Milan an den Fesseln, krümmte den Rücken, warf den Kopf von einer Seite auf die andere und versuchte mit der ganzen Kraft der Verzweiflung, sich aus den Fesseln zu winden, er grunzte vor Anstrengung. Noch einmal versuchte er, seine Beine zu bewegen, denn wenn er wenigstens das Holz beiseitestoßen könnte, hätte er vielleicht eine Chance …
»Hilfe! Helft mir! Irgendwer!« Seine Stimme klang wie das Heulen eines Hundes, das Grauen darin hatte nichts Menschliches mehr.
Die Männer beendeten ihre Vorbereitungen, traten ein paar Schritte zurück und stellten die Behälter auf den Boden. Wortlos neigten sie ihre Köpfe.
»Verrückte Arschlöcher!«, schrie Milan. »Warum macht ihr das?«
Der Dieselgestank hing schwer in der Luft. Milan blickte hinab auf die Paletten und Holzscheite, die um seine Füße aufgehäuft waren und sich langsam mit der Flüssigkeit vollsogen. Er wusste, was sie vorhatten. Und zum ersten Mal seit Jahren flehte er Gott um Hilfe an.
»Bitte!«, schrie er. »Helft mir doch! Hilfe! Irgendwer!«
Einer der beiden Männer trat zu ihm. Milan sah das Feuerzeug in seiner Hand. »Warte! Warte! Nicht!«
Der Zündmechanismus klickte, Panik und Grauen überwältigten ihn angesichts der kleinen Flamme. Es war, als würden Tausende Nadeln in sein Rückgrat stechen.
»Seid ihr total durchgeknallt?«, schrie er. »Hört auf! Aufhören!«
Der Mann warf das Feuerzeug, ein leises Klirren, als es auf dem Holz aufschlug. Fassungslos sah Milan zu, wie es zwischen den Scheiten verschwand. Ein Augenblick der Hoffnung, dass es nicht zünden würde, dann orangerotes Flackern und ein Zischen, als die Flammen hochschossen.
»Lieber Gott! O Gott! Nein!«
Hitze schlug gegen seine Schienbeine und kroch seine Schenkel hinauf. Der Geruch von brennendem Holz und Stoff, seine Schienbeine schmerzten, als würden Brandeisen darauf gedrückt. Die Hitze wanderte weiter an seinem Körper hoch, erfasste Genitalien und Bauch.
Er roch versengtes Haar, spürte Flammen im Gesicht, auf Lippen, Augen. Das Grauen zu wissen, was als Nächstes kommen würde. Er schrie vor Panik und Entsetzen, schluckte Funken, seine Lunge brannte, Speichel kochte in seinem Mund. Die Schmerzen waren zu groß, um sie zu ertragen.
Sein Darm entleerte sich.
Er brüllte vor Qual.
Und die Flammen verschlangen die Nacht.
1. Kapitel
Fehler waren Officer Chuck »Skid« Skidmore nicht fremd, er hatte in seinem Leben schon ein paar gemacht. Mehr als ein paar, wenn er ehrlich war. Einige hatten ihm geschadet, bei anderen war er ungeschoren davongekommen, hatte aber etwas aus ihnen gelernt. Die meisten seiner Fehler waren harmloser Natur gewesen – ein schlechtes Urteilsvermögen, mangelhafte Planung, oder er hatte sich einfach nicht genug Mühe gegeben, das Richtige zu tun.
Er stand auf der überdachten Brücke und beobachtete, wie seine Kollegin Mona Kurtz hinter seinem Streifenwagen anhielt, und dachte sich, dass das, was er vorhatte zu tun, so weit von Unschuld entfernt war, wie er es sich nur vorstellen konnte. Doch er besaß einfach nicht die nötige Selbstdisziplin, um sich zurückzuhalten.
Es war halb drei Uhr morgens, und es schneite wie verrückt. Er war seit Mitternacht im Dienst und hatte noch nicht einen einzigen Anruf entgegengenommen. Langeweile gepaart mit Lust waren eine schlechte Kombination für einen Mann, der seit fast sechs Monaten von einer Frau – einer Kollegin – besessen war.
»Schön, dich hier zu treffen«, sagte Mona, warf ihre Autotür zu und ging zu ihm.
»Das habe ich auch gerade gedacht.« Er hielt sich, so gut er konnte, zurück, lehnte weiter mit verschränkten Armen an seinem Streifenwagen, und für einen Moment genoss er einfach nur ihren Anblick. Lange Beine, das Haar ein bisschen wild. Unter dem offenen Mantel trug sie noch ihre Uniform, und er konnte die Umrisse ihrer Figur ausmachen.
»Hast du Feierabend?«, fragte er.
»Ich bin frei wie ein Vogel.«
Ohne Aufforderung oder Zögern ging sie auf ihn zu und ließ sich gegen ihn fallen. Die Berührung war wie eine Bombe, die in seiner Brust detonierte. Er schlang die Arme um sie, sog ihren Duft nach Kokosnuss und Minze ein und wollte sie nur noch mehr. Er hatte nicht die Absicht gehabt, sie zu küssen, aber im nächsten Moment war sein Mund auf ihrem.
Sie schlang ihre Arme um seinen Hals, presste sich an ihn, er spürte ihre Brüste, ihr Becken.
»Dir ist schon klar, dass das nicht gerade klug ist, oder?«, murmelte er.
»Total klar«, keuchte sie.
Er sagte etwas von Karriere und gesundem Menschenverstand, aber sie brachte ihn küssend zum Schweigen. Mit wild klopfendem Herzen drehte er sie herum, drückte sie gegen die Autotür und fuhr mit den Händen unter ihre Bluse, fummelte am BH-Verschluss. Das Blut rauschte ihm vom Kopf bis knapp unter den Gürtel seiner Hose.
»Rückbank«, stieß er aus, tastete nach dem Türgriff.
»Beeil dich.«
Er fand den Griff und öffnete die Tür, war so fixiert darauf, sie ins Auto zu bekommen, dass er den Schrei fast überhört hätte.
Mona erstarrte in seinen Armen und drehte den Kopf zur Seite, unterbrach den Kuss. »Hast du das gehört?«
»Ja.« Skid richtete sich auf, schüttelte sich innerlich. »Klang wie ein Schrei.«
Nicht bloß ein Schrei, dachte er, vielmehr die Art von Laut, bei dem einem die Nackenhaare zu Berge stehen.
»Wer ist mitten in der Nacht im Wald und schreit sich so die Lunge aus dem Hals?«, flüsterte sie.
Er löste sich von ihr, sah sich um, sein Polizisteninstinkt kehrte langsam zurück. Erst jetzt nahm er den Geruch von Rauch wahr. »Irgendwas brennt.«
Mona ließ den Blick wandern, als wollte sie sich ins Gedächtnis rufen, wo sie waren. »Ich rieche es auch.«
»Wir müssen nachsehen.«
»Ja.«
Skid zog die Mini-Maglite aus seinem Gürtel, richtete den Strahl auf den Wald. Und tatsächlich schwebten weiße Rauchschwaden zwischen den Bäumen.
»Der Wind kommt von Norden«, murmelte er.
»In der Richtung ist keine Farm, Skid«, sagte sie.
»Es ist viel zu kalt, als dass jemand zelten würde.« Den Kopf zur Seite geneigt, drückte er auf sein Ansteckmikro. »Zehn-dreiundsiebzig«, meldete er der Zentrale den Code für Feuer in der Umgebung.
Margarets Stimme kam knisternd aus dem Funkgerät. »Standort?«
»Dogleg Road«, sagte er. »Bei der Brücke über dem Little Paint Creek.«
»Soll ich die Feuerwehr schicken?«
»Ich will erst mal sehen, was da los ist, bevor wir jemanden aus dem Bett holen.«
»Verstanden.«
Sie gingen auf die andere Straßenseite, durchquerten den Straßengraben und stiegen über einen kaputten Drahtzaun. Sobald sie in den Wald traten, war es stockdunkel und roch noch stärker nach Rauch. Holzrauch vermischt mit etwas Unangenehmem. Die Ohren gespitzt, schlängelte Skid sich fünfzig Meter durch die neuangelegte Schonung, an Himbeersträuchern und totem Unterholz vorbei, aber außer den knirschenden trockenen Blättern unter ihren Stiefeln hörte er nichts.
»Feuer.« Mona zeigte geradeaus. »Da vorn rechts, zwischen den Bäumen.«
»Ich sehe es auch«, sagte er. »Sei vorsichtig.«
»Klar.«
Sie sprinteten los, versuchten, so leise wie möglich zu sein, was aber in dieser totalen Stille fast unmöglich war. Die ganze Zeit über hatte Skid die Hand an seiner Waffe.
»Polizei Painters Mill!«, rief er, als sie sich näherten. »Identifizieren Sie sich!«
Keine Antwort.
Er hörte das Feuer knistern und knallen, noch bevor sie die Lichtung erreichten. Eine Art Lagerfeuer, dachte er. Das aufgeschichtete Holz brannte lichterloh, Flammen schlugen fünf Meter in die Höhe. Keine Menschenseele weit und breit.
»Polizei!« Fünf Meter entfernt, betrat Mona die Lichtung. »Zeigen Sie sich! Sofort!«
Die einzige Antwort kam vom Knistern des Feuers.
»Wer immer hier war, scheint sich aus dem Staub gemacht zu haben«, murmelte Mona.
Skid ließ den Blick langsam über die Szene wandern, wobei ihm zunehmend unbehaglich wurde. Er hatte angenommen, dass sie auf eine improvisierte Party aufmerksam geworden waren. Dass junge Leute um ein Lagerfeuer säßen, Bier tranken oder Dope rauchten und sich die Hintern abfroren. Aber irgendetwas stimmte hier nicht. Keine Bierflaschen, kein Müll, keine Möglichkeit zu sitzen. Und nur wenige Schuhabdrücke im Schnee.
»Was zum Teufel ist das hier?«, murmelte er.
»Skid.«
Etwas in Monas Stimme ließ ihn aufhorchen. Sie stand unweit des Feuers, das Gesicht mit der Hand vor der Hitze abgeschirmt und den Kopf zur Seite geneigt, wirkte sie ausgesprochen irritiert.
»Was ist das?«, flüsterte sie.
Mitten aus dem Feuer ragte ein Pfahl, etwa zwei Meter fünfzig hoch und dick wie ein Telefonmast. Etwas seltsam Menschenähnliches hing daran.
»Ach du Scheiße«, sagte er.
»Ist das …«
»Hol den Feuerlöscher«, sagte er. »Beeil dich! Ich versuche, ihn da rauszuholen.«
Mona wirbelte herum und rannte in Richtung ihrer Wagen.
Skid wollte näher ans Feuer herangehen, aber die Hitze trieb ihn augenblicklich zurück. Unfähig, den Blick von dem menschenähnlichen Ding an dem Pfahl zu nehmen, drückte er auf sein Ansteckmikro. Er kannte ihr Zehner-Code-System wirklich gut, aber welche Nummer er für das hier nehmen sollte, wusste er beim besten Willen nicht. »Hier draußen brennt es! Ein Brandopfer. Zehn-zweiundfünfzig.« Das war der Code für die Anforderung eines Krankenwagens.
»Verstanden.« Eine besorgte Pause entstand. »Bist du in einem Gebäude?«
»Negativ. Nur … im Wald. Ruf den Chief an, Margaret«, sagte er. »Ich glaube, wir haben hier einen Mordfall.«
2. Kapitel
Das Klingeln meines Handys reißt mich aus dem Tiefschlaf. Ich wälze mich herum, taste danach und halte es mir vors Gesicht, sehe blinzelnd aufs Display. ZENTRALE. 2:47 Uhr. Ich nehme ab, knurre meinen Namen.
»Burkholder.«
»Tut mir leid, dass ich Sie geweckt habe, Chief«, ertönt die Stimme der Nachtschicht-Mitarbeiterin. »Hab gerade einen Anruf von Skid bekommen. Es gibt ein Feuer und eine Leiche draußen nahe der Dogleg Road.«
Sofort bin ich hellwach, setze mich aufrecht hin, schwinge die Beine aus dem Bett. »Ein Gebäude?«, frage ich, stehe auf und gehe zum Schrank. »Haus? Scheune?«
»Im Wald«, sagt sie. »Nahe der überdachten Brücke.«
Während ich eine Uniformbluse vom Kleiderbügel zerre, versucht mein noch nicht waches Hirn, den Sinn ihrer Worte zu verstehen. »Ein Autounfall?«
»Davon hat er nichts gesagt. Klang ziemlich aufgewühlt.«
»Sagen Sie ihm, ich bin auf dem Weg.«
Aus den Augenwinkeln nehme ich wahr, wie sich mein Mann, John Tomasetti, im Bett aufgesetzt und sich mit den Händen übers Gesicht reibt. »Alles okay, Chief?«
»Bin nicht sicher.« Ich krame meine Hose aus einer Schublade und ziehe sie an. »Es brennt im Wald nahe der Dogleg Road. Skid sagt, es gibt eine Leiche.«
»Seltsame Kombination.« Er nimmt sein Handy und checkt die Zeit. »Soll ich mitkommen?«
Tomasetti ist Agent beim Ohio Bureau of Criminal Investigation und war davor Detective der Cleveland Division of Police. Über die letzten Jahre haben wir an Dutzenden Fällen zusammengearbeitet und sind nicht nur ein ausgezeichnetes Ermittlerteam, wir kriegen auch unser Leben als Ehepaar ziemlich gut hin.
Ich nehme meinen Ausrüstungsgürtel vom Stuhl und schnalle ihn um. »Musst du nicht um sieben in Columbus sein?«
»Leider.« Seufzend steht er auf, umrundet das Bett und nimmt mich in die Arme. »Ich würde lieber mit dir abhängen.«
»Eine Leiche würde dabei wohl eher stören.«
»Kann man aber einfach loswerden.«
Wir sind jetzt seit zwei Monaten verheiratet. Eine Veränderung, die mir noch immer nicht ganz geheuer ist – und eine Freude, die zu fühlen mir beinahe Angst macht. Vielleicht, weil ich zum ersten Mal im Leben rückhaltlos glücklich bin und genieße, wie alles zusammenpasst.
Er küsst mich.
Ich erwidere seinen Kuss und entziehe mich seiner Umarmung, Sekunden bevor ich weiche Knie bekomme. »Tomasetti, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen makabren Sinn für Humor hast?«
»Das höre ich oft.«
Ich drehe mich um, ziehe die Nachttischschublade auf, nehme meine .38er heraus und stecke sie in mein Holster.
»Nimm dich in Acht da draußen, Chief«, sagt er.
»Wir sehen uns beim Abendessen«, erwidere ich.
Ich streife mit meinem Mund seinen und bin zur Tür hinaus.
Um diese Zeit schläft das ländliche Ohio tief und fest, in den abgelegenen Straßen ist es dunkel und still. Schnee wirbelt im Scheinwerferlicht des Explorers. Ich schalte das Blaulicht meines Dienstwagens ein, gebe Vollgas und ignoriere jedes Stoppschild, das mich zu bremsen versucht, und brauche für die Fahrt, die gewöhnlich eine halbe Stunde dauert, siebzehn Minuten.
Im Herzen von Amish Country liegt Painters Mill, eine hübsche Kleinstadt mit fünftausenddreihundert Einwohnern, von denen ein Drittel amisch ist. Ich bin als Amische geboren, habe die Glaubensgemeinschaft aber im Alter von achtzehn Jahren verlassen, als das Schicksal mir den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Ich lief so weit weg von Painters Mill – und meinen Wurzeln –, wie ich konnte, und landete in Columbus, wo ich, so unwahrscheinlich es damals schien, in den Polizeidienst eintrat. Ich durchlief eine harte Schule, machte dabei haufenweise Fehler und lernte, nicht amisch zu sein. Als ich schließlich Streifenpolizistin wurde und mein Leben in geordneten Bahnen verlief, hat es mich immer mehr zurück zu meinen Wurzeln gezogen. Als dann die Stelle des Polizeichefs frei wurde und der Gemeinderat mir den Job angeboten hat, habe ich zugesagt.
Seither war mein Leben hier nicht frei von Schwierigkeiten, aber ich habe nie zurückgeblickt und meine Entscheidung nie bereut. Meine Eltern sind inzwischen gestorben, aber meine Geschwister leben mit ihren Familien noch immer in der Gegend. Und sie sind noch immer amisch. Als Kinder standen wir uns sehr nahe, aber nachdem ich weggegangen war, wurde es extrem schwierig zwischen uns. Aber wir arbeiten daran, dass unser Verhältnis wieder so innig wird, wie es einmal war.
Als ich schließlich in die Dogleg Road Richtung überdachte Brücke einbiege, fallen dicke Schneeflocken vom Himmel. Ich entdecke Skids Streifenwagen, der mit blinkenden Warnlichtern am Straßenrand steht, und greife nach meinem Funkgerät. »Zehn-dreiundzwanzig«, sage ich, lasse die Zentrale im Revier wissen, dass ich am Einsatzort angekommen bin.
Monas privates Auto parkt hinter dem Streifenwagen, was mich einigermaßen überrascht. Sie ist der Neuling in unserem Revier und zugleich der erste weibliche Officer in Painters Mill. Zufällig weiß ich, dass sie bis Mitternacht gearbeitet hat. Da sie aber nach ihrer Schicht oft noch dableibt, besonders, wenn etwas Interessantes vor sich geht, mache ich mir wegen ihrer Anwesenheit keine allzu großen Gedanken.
Ich parke hinter ihrem Wagen und steige aus. Kein Mensch weit und breit. Keine anderen Fahrzeuge, kein Anzeichen eines Feuers. Nur Rauchgeruch hängt in der Luft. Ich drücke die Sprechtaste des Handfunkgeräts. »Skid, wo sind Sie?«
»Genau nördlich von meinem Wagen, Chief. Hundert Meter.«
Seine Stimme klingt angespannt. Ich knipse meine Maglite an, entdecke zwei Schuhabdrücke, folge ihnen durch den Straßengraben und steige über den Zaun, leuchte im Halbkreis um mich herum und fange an zu sprinten. Zwanzig Meter vor mir sehe ich die flackernden Lichter von Taschenlampen zwischen den Bäumen. Die ganze Zeit über versuche ich, mir ein Szenario vorzustellen, das zu dem Feuer und der Leiche geführt haben könnte. Die Gegend hier ist abgelegen und im Frühjahr oft überflutet. In der Nähe gibt es weder Farmen noch Häuser, und es führt auch keine Straße und kein Feldweg hier entlang, auf dem ein Auto fahren könnte.
Was hatte also jemand hier draußen zu suchen, und warum ist er oder sie jetzt tot?
Nach etwa hundert Metern erreiche ich eine Lichtung. Ein Stück weiter sehe ich die schwelenden Überreste eines Feuers, aus dem weißer Rauch aufsteigt. Skid und Mona stehen etwa drei Meter von dem Haufen glühender Asche entfernt. Skid hat einen Feuerlöscher in der Hand. Beide wirken sehr aufgeregt.
»Da ist jemand im Feuer!«, ruft Skid.
Ich renne los, erkenne schon bald einen verkohlten Pfahl, der mitten aus der glühenden Feuerstelle ragt. Ein ungutes Gefühl überkommt mich beim Anblick der irgendwie vage menschlichen Gestalt, die an dem Pfahl befestigt ist.
»Lebt er noch?« Meine Stimme klingt normal, als ich die beiden erreiche, aber mein Puls rast, und meine Nackenhaare sträuben sich.
Von allen meinen Officern – insgesamt fünf – ist Skid derjenige, der am ehesten dazu neigt, im unpassenden Moment einen klugscheißerischen Kommentar abzugeben. Aber heute Nacht sehe ich nur Fassungslosigkeit und Unglauben in seinem Gesicht.
»Ich kann nicht nah genug rangehen, um was zu erkennen«, sagt er. »Ist einfach zu heiß.«
»Hat es bei Ihrer Ankunft noch gebrannt?«
»Stand voll in Flammen.« Er hebt den Feuerlöscher hoch. »Chief, Mona und ich waren in der Nähe, er hat noch gelebt, wir haben einen Schrei gehört. Aber als wir ihn dann gefunden haben, hat er sich nicht mehr bewegt.«
»Wir haben das Feuer gerade erst löschen können«, sagt Mona.
Ich sehe sie an, bemerke den kleineren Feuerlöscher in ihrer Hand. »Spritzen Sie Schaum auf die glühende Asche.«
Sie tut es.
»Wir müssen ihn da rausholen.« Ich sehe Skid an. »Krankenwagen?«
»Ist unterwegs. Die Feuerwehr auch.«
In meinen Dienstjahren bei der Polizei hatte ich schon mit unterschiedlich schweren Brandverletzungen zu tun – mit Opfern von Hausbränden, Autounfällen, Verätzungen und von Rauchvergiftungen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Der Oberkörper ist in einer aufrechten Position, von der Kleidung ist nichts mehr übrig. Das sichtbare braune und schwarze Fleisch ist mit grauenhaften rostfarben Flecken übersät. Auch der Hals ist rostfarben und sieht feucht aus. Der Kopf hängt nach vorn, der untere Teil des Gesichts ist braun, die Stirn blutig und voller Blasen.
»Wir müssen ihn da rausholen«, sage ich.
»Alles klar«, sagt er.
Das Problem ist nur, dass das Opfer von glühender Asche umgeben ist. Ohne sich selbst die Füße zu verbrennen, kann man nicht rankommen.
»Mona.« Ich werfe ihr den Schlüssel von meinem Explorer zu. »Holen Sie meinen Werkzeugkasten, Wasser, Schaufel. Schnell!«
Sie fängt den Schlüssel mit einer Hand, wirbelt herum und sprintet los.
Ich lasse meinen Blick über die nähere Umgebung schweifen, suche etwas – ein Stück Holz oder einen großen flachen Stein –, auf dem wir stehen und mit dem wir die glühende Asche beiseiteschieben können, kann aber nichts dergleichen entdecken.
»Mist.« Ich gehe so nah wie möglich ran, strecke den Arm aus, aber die Hitze ist nicht auszuhalten, und ich mache einen Schritt zurück. Die Situation ist unerträglich. »Zehn-zweiundfünfzig, dringend«, fordere ich über Funk, dass sich der Krankenwagen beeilen soll. »Wir haben ein Brandopfer.«
Skid läuft auf der Lichtung umher, sucht etwas, womit wir unsere Füße schützen können, aber außer Holzabfällen gibt es hier nichts.
Ich kann nicht aufhören, das Opfer anzusehen. Es ist an einem Holzpfahl festgebunden, bewegt sich nicht, die Hände sind hinter dem Rücken mit etwas gefesselt, das dem Feuer standgehalten hat.
»Chief!«
Mona kommt aus dem Wald auf uns zu gelaufen, meinen Werkzeugkasten in der einen Hand, zwei Klappspaten in der anderen. Ich eile zu ihr, nehme ihr einen Spaten ab, klappe ihn zu voller Länge auf und renne zum schwelenden Aschehaufen, schaufele die rotglühende Glut beiseite. Skid bringt den Feuerlöscher zum Einsatz, Mona zieht eine große Flasche Wasser aus ihrer Tasche und schüttet es in die Glut, die zischend erlischt. Natürlich ist mir klar, dass es sich hier um einen Tatort handelt und wir vermutlich Beweise zerstören. Aber das ist jetzt nicht zu vermeiden, die Rettung eines Lebens hat immer Vorrang.
»Spritz auch ein bisschen Schaum auf die Asche hier!«, sage ich zu Mona. Skid ist inzwischen mit der zweiten Schaufel zugange.
Mona nimmt den kleineren Feuerlöscher und überzieht die frisch freigelegte Glut mit Schaum.
Ich schaufele noch einen Moment weiter, und als dann genug Platz ist, dass ich, ohne mich zu verbrennen, zum Opfer gelange, wage ich es. Schon beim ersten Schritt dringt die Hitze durch meine Stiefelsohlen, steigt die Waden und weiter die Beine hinauf. Ich gehe weiter.
Das Opfer ist grauenhaft entstellt. Das versengte Haar und die verbrannte Kleidung stinken so sehr, dass ich den Atem anhalte. Das Grauen von verkohltem Fleisch. Lieber Gott.
Ich recke den Hals, sehe, dass die Fesseln an den Handgelenken aus Draht sind. »Gib mir den Bolzenschneider!«
Mona reicht mir das Werkzeug, ich schiebe die Schneidefläche unter den Draht und durchtrenne ihn. Die Arme des Opfers fallen zur Seite, leblos. Auch der Torso ist mit Draht am Pfahl festgebunden, ich zerschneide ihn, der Oberkörper sackt in sich zusammen und beginnt langsam nach vorne zu kippen, ich springe hin und packe mit beiden Händen den Oberarm des Opfers. Das Fleisch zwischen meinen Schutzhandschuhen fühlt sich glitschig an, die aufkommende Übelkeit ringe ich mühsam nieder. Dann steht Skid neben mir, packt den anderen Arm, und wir ziehen das Opfer aus der glühenden Asche. Fünf Meter weit. Wir legen es mit dem Rücken auf den Boden, die Arme seitlich am Körper.
»Wasser!«, sage ich.
Mona kennt die Abläufe und hält die Flasche schon bereit. Ich gieße dem Opfer das gesamte Wasser über Kopf, Hals und Oberkörper. Es ist zu wenig, aber ich weiß, dass es keine Rolle spielt. Wir sind zu spät, um noch etwas tun zu können. Die Verbrennungen sind zu schwer.
Einen Moment lang stehen wir schweigend da, keuchen heftig. Hier im Wald ist es so still, dass ich die Schneekristalle fallen höre. Das Rascheln der trockenen Blätter. Der Wind rauscht leise in den Ästen, die Glut knistert und knackt.
Das entfernte Heulen von Sirenen durchbricht den Bann. Ich blicke das Opfer an, muss mich zusammenreißen. Von meiner Ausbildung weiß ich, dass verbrannte Kleidung, Schuhe und Gürtel ausgezogen oder weggeschnitten werden müssen. Dieser Mensch ist so sehr verbrannt, dass ich nicht erkennen kann, was Fleisch und was Kleidung ist.
Wortlos dreht Mona sich um, rennt an den Rand der Lichtung und übergibt sich. Skid wühlt in meinem Werkzeugkasten und nimmt eine Rettungsdecke heraus.
»Was zum Teufel hat sich hier abgespielt?«, sagt er, faltet die Decke auseinander und breitet sie über dem Opfer aus, lässt das Gesicht frei.
Als ich hier eingetroffen bin, war mein erster Gedanke, dass jemand versucht haben könnte, eine Leiche zu beseitigen. Nachdem ich aber die Drahtfesseln gesehen und erfahren habe, dass Mona und Skid einen Schrei gehört hatten, weiß ich, dass das nicht der Fall ist.
Mona kommt wieder zu uns. Sie ist keine Mimose, aber ihr Gesicht ist jetzt kreideweiß.
»Habt ihr irgendwen gesehen oder gehört, als ihr herkamt?«, frage ich. »Gab es Anzeichen, dass jemand hier war?«
»Ich habe niemanden gesehen«, sagt Mona. »Aber ehrlicherweise muss ich sagen, Chief, dass wir so damit beschäftigt waren, das Feuer zu löschen, da kann uns durchaus etwas entgangen sein.«
»Ich hab keine Menschenseele gesehen.« Skid schüttelt fassungslos den Kopf. »Aber der Schrei … Chief, der arme Kerl wurde an diesen verdammten Pfahl gebunden und ist bei lebendigem Leib verbrannt.«
Die Vorstellung ist so bizarr, dass sie mir nicht in den Kopf gehen will. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Den Draht, den Pfahl, das Holz, das aufgeschichtet und angezündet worden ist …
»Es hat auch nach Diesel gerochen«, sage ich.
Er nickt. »Wer immer das war, hat also einen Brandbeschleuniger benutzt.«
Ich wende mich Mona zu. »Sichern Sie den Tatort rundherum mit Absperrband, fünfzehn Meter in jede Richtung. Achten Sie auf Schuhabdrücke und alles, was nicht hierhergehört. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches sehen, kennzeichnen und sichern Sie es.«
Sie nickt und geht zu den Fahrzeugen.
»Skid, sehen Sie sich hier um, vielleicht gibt es ja Schuh- oder Reifenspuren.«
Er tippt mit dem Finger an seine Mütze. »Wird gemacht.«
Die Sirenen sind jetzt ganz in der Nähe, zwischen den Bäumen sehe ich das blaue Licht eines Feuerwehrautos oder Rettungswagens flackern. Der Strahl von Monas Taschenlampe schwenkt nach rechts und links und verschwindet dann im Wald.
Ich blicke hinab auf das Opfer, und mir wird leicht übel. »Was um Himmels willen ist mit dir passiert?«, flüstere ich.
Das Rauschen des Windes ist die einzige Antwort.
3. Kapitel
Eine Stunde später wimmelt es hier nur so von Einsatzkräften. Zuerst war der Notarzt eingetroffen und hatte das Opfer für tot erklärt. Polizisten anderer Dienststellen sicherten und sperrten den Tatort weiträumig ab, Feuerwehrleute löschten die restliche Glut. Als der Bereich schließlich freigegeben wird, kann der Leichenbeschauer mit seiner Arbeit beginnen.
Zarte Schneeflocken fallen aus dem Nachthimmel herab. Ich stehe außerhalb des Absperrbands und warte auf Doc Coblentz. Fünfzehn Meter weit weg steht der verkohlte Pfahl als makabres Zeugnis für das, was hier passiert ist. Vorhin ist es mir gelungen, den Draht, mit dem die Hand- und Fußgelenke und der Torso des Opfers festgebunden waren, in den Ascheresten zu finden und in einen Beutel zu stecken. Es sind die ersten Beweisstücke, die ich an diesem weitläufigen Tatort bergen konnte. Da er sich im Freien befindet, versprechen die Ermittlungen schwierig zu werden.
Ein paar Meter entfernt spricht ein Holmes County Sheriff’s Deputy mit einer der Rettungssanitäterinnen. Der Wind hat aufgefrischt, und ich kann sehen, dass die Sanitäterin unter ihrer Jacke zittert.
»Chief?«
Beim Blick über die Schulter sehe ich Doc Ludwig Coblentz und einen jungen MTA näherkommen. Seit ich vor ein paar Monaten das letzte Mal mit ihm zu tun hatte, scheint er ein paar Pfunde zugelegt zu haben. Der Doc trägt einen dicken Mantel mit Kapuze, die mit Kunstfell gefüttert ist, und Khakihosen, deren Saum er in die Stiefel gestopft hat. Beide Männer haben große Arztkoffer dabei.
»Hey, Doc.« Ich gehe auf ihn zu, wir schütteln uns die Hände, ohne die Handschuhe auszuziehen.
»Je älter ich werde, desto kälter werden die Winter in Ohio«, sagt Coblentz mit einem übertriebenen Frösteln.
»Ich glaube, deshalb wurden gefütterte Overalls erfunden.«
»Ich glaube, deshalb wurde Florida erfunden.«
Kurz gehen seine Mundwinkel nach oben, dann blickt er zum Opfer und dem verkohlten Pfahl. Er ist ein erfahrener Arzt und hat in seinen Jahren als Leichenbeschauer viele ungewöhnliche Tatorte gesehen. Seine Ruhe, Professionalität und Einstellung helfen ihm, die dunkleren Aspekte seiner Arbeit zu relativieren. Und doch entgeht mir nicht das Entsetzen, das über sein Gesicht huscht, die hochschießenden Augenbrauen.
»Der Anruf hatte mich zunächst verwirrt«, sagt er. »Was ich da gehört habe, hat für mich keinen Sinn ergeben.« Er seufzt. »Jetzt verstehe ich, warum das so war.«
»Manchmal ergibt es selbst dann keinen Sinn, wenn man weiß, was passiert ist.«
»Das ist wahr.«
Ich berichte ihm das wenige, was ich weiß.
»Skid und Mona haben einen Schrei gehört?«, fragt er. »Sind Sie sicher?«
Ich nicke. »Einen Schrei oder Hilferuf.«
»Wenn der Schrei also nicht vom Täter oder einem Zeugen kam, war das Opfer, kurz bevor sie es erreicht haben, noch am Leben.«
Ich sehe, wie es im Kopf des Doktors arbeitet, er verschiedene Möglichkeiten durchdenkt. »So wie der Schrei klang, glauben sie, dass er wahrscheinlich vom Opfer kam«, füge ich hinzu.
Er nickt. »Wie lange ist das her?«
Ich blicke auf meine Uhr. »Etwa eineinhalb Stunden.«
Kopfschüttelnd stellt er den Koffer ab, bückt sich, öffnet ihn und holt einzeln verpackte Schutzkittel, Handschuhe aus Nitril und Schuhhüllen heraus, jeweils zwei Paar, wovon er eins mir gibt.
»Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht?«, fragt er.
Ich nicke.
»Wir müssen uns trotzdem bemühen, den Tatort so wenig wie möglich zu kontaminieren.«
Wortlos streifen wir die Schutzkleidung über, was wegen unserer dicken Jacken und Winterstiefel nur mit ungelenken Verrenkungen geht. Als wir es geschafft haben, hebe ich das Absperrband für ihn und seinen Assistenten hoch, bücke mich zuletzt selbst drunter durch. Wir betreten den Tatort, den ich zuvor fotografiert habe, inklusive des Opfers. Dabei hat mir der Blick auf das Kamerabild meines Smartphones die nötige Distanz zu dem Anblick verschafft, der mich andernfalls enorm mitgenommen hätte. Ich habe den Zoom für Nahaufnahmen benutzt, bin aber selber nicht zu nah rangegangen. Auf dem Weg zum Opfer ist mir mulmig, was bedeutet, dass ich noch nicht wirklich bereit bin für das, was auf mich zukommt.
»Konnten Sie das Opfer identifizieren?«, fragt der Doc.
Ich schüttele den Kopf. »Zu heiß und zu viel Rauch. Wie Sie sehen, ist er ziemlich schlimm verkohlt.«
»Brandbeschleuniger?«
»Wir haben Diesel gerochen«, sage ich, wobei mir bewusst ist, dass der Geruch noch immer in der Luft liegt.
Eine der Sanitäterinnen hat die Rettungsdecke durch ein einfaches weißes Tuch ersetzt und eine wasserfeste blaue Plane darübergelegt. So soll verhindert werden, dass der leichte Schneefall das Tuch durchweicht und mögliche Beweise vernichtet.
Doc Coblentz geht in die Hocke und hebt die oberen Ecken der zwei Abdeckungen an. Obwohl ich mich auf den Anblick gefasst mache, bleibt mir einen Moment lang die Luft weg. Ich habe über die Jahre schon einige Tote gesehen, die Opfer eines Brandes waren. Letzten Sommer der Autounfall auf dem Highway. Vor ein paar Jahren der Scheunenbrand, und dann, kurz nachdem ich Chief geworden bin, der Hausbrand, bei dem ein älteres Ehepaar umkam. Jeder Tod ist verstörend, aber der Verbrennungstod ist besonders grausam.
Dieses Opfer hier ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Vor kurzem erst haben Skid und ich den Leichnam ausgestreckt auf den Rücken auf den Boden gelegt, jetzt sind die Arme und Beine schon etwas gebogen und die Knie ein Stück auseinander, vermutlich von der Muskelkontraktion. Das Fleisch ist verkohlt und löst sich, die Füße wirken geschrumpft. Der rostfarbene Oberkörper ist mit schwarzen Flocken überzogen, die entweder von verbrannter Kleidung oder verbranntem Fleisch herrühren – oder beidem. Es ist das Gesicht, das mich am meisten verstört. Die Stirn ist blutrot und sieht feucht aus. Die Haare sind weggebrannt, besonders ums Gesicht herum. Der Mund ist offen, die Zunge hängt heraus wie ein Stück verfaultes Obst. Der entsetzliche Geruch ist eine Kombination aus versengtem Haar, verbranntem Stoff und verkohltem Fleisch.
Ich drücke mir den Schal auf Mund und Nase und versuche, nicht zu atmen.
»Bevor ich die Leiche nicht auf dem Tisch habe, werde ich Ihnen kaum etwas sagen können, Kate«, beginnt er. »Aber mir ist klar, dass Sie mit den Ermittlungen anfangen müssen, deshalb tue ich mein Bestes, wobei natürlich alles vorläufig ist und sich ändern kann, aber das wissen Sie ja.«
»Ich bin dankbar für alles, was Sie mir jetzt schon sagen können.« Ich zwinge mich, den Toten wieder anzusehen. »Momentan ist es am wichtigsten, ihn zu identifizieren.«
»Dann sehen wir mal, was uns diese arme Seele hier zu sagen hat.« Mit einem entschlossenen Nicken in Richtung seines Assistenten lässt sich der Doktor auf die Knie nieder, die laut protestieren. »Man kann wohl einigermaßen sicher sagen, dass es sich um einen Mann handelt. Er hat schwere Brandverletzungen mit Verkohlungen, besonders an den unteren Extremitäten und am Torso.« Er sieht mich über seine Brille hinweg an. »Wo genau haben Sie das Opfer gefunden?«
Bei seiner Ankunft habe ich gesehen, wie sein Blick zum Pfahl gehuscht ist, und ich weiß, dass er sich die Frage selbst beantworten kann. »Er war mit Draht an dem Pfahl dort festgebunden.«
Jetzt verharrt sein Blick auf dem Pfahl, dem Aschehaufen drum herum, dem Kleinholz und den Ästen nahebei, die noch kein Feuer gefangen hatten.
»Nur damit wir alle den gleichen Wissensstand haben … Sie sagen also, das Opfer wurde an den Pfahl gebunden und verbrannt?«
»Ich glaube nicht, dass das jemand mit Sicherheit sagen kann«, erkläre ich, »aber so sieht es jedenfalls aus.«
»Guter Gott«, murmelt er und wendet sich wieder dem toten Mann zu, zieht das Tuch bis zur Mitte seiner Schenkel herunter. Ich zwinge mich, das Opfer anzusehen, diesmal mit den Augen der Polizistin, die nützliche Informationen sucht. Mein Blick fällt auf einen Fetzen Jeansstoff, der unter der Hüfte hervorschaut, eine Messinggürtelschnalle, die sich in den verkohlten und sich schälenden Torso eingebrannt hat, sowie Flocken von nicht zu bestimmendem Material.
Coblentz nimmt einen Tupfer aus seinem Koffer und zeigt damit auf einen kleinen Lappen, der ebenfalls unter der Hüfte des Toten hervorragt. »Mehr ist vom Gürtel nicht übrig geblieben«, sagt er.
»Können wir nachsehen, ob er ein Portemonnaie bei sich hatte?«, frage ich.
»Die meisten Männer haben ihr Portemonnaie in der Gesäßtasche.« Der Doc kräuselt die Brauen. »War er mit dem Rücken an den Pfahl gebunden?«
Ich nicke.
»Dann könnten wir Glück haben«, sagt er, »zumindest hinsichtlich einer Identifizierung.«
»Vielleicht hat der Pfahl die Rückseite seines Körpers geschützt.«
»Richtig.«
Das könnte die erste gute Nachricht sein, die ich seit meinem Eintreffen erhalte. »Hoffentlich ist das Portemonnaie noch unversehrt, falls er eins dabeihatte.«
»Glücklicherweise brennt Leder nicht so schnell, wie man denkt.« Er nickt dem Assistenten zu. »Wir rollen ihn auf seine rechte Seite«, sagt er. »Von uns weg. Achten Sie darauf, dass er nicht rutscht.«
Der Assistent geht mit geradem Rücken auf die Knie und legt seine Hände auf Schulter und Hüfte des Toten.
Ich trete einen Schritt zurück und sehe den beiden Männern zu, wie sie den Toten gemeinsam auf die Seite rollen. Die verkohlte Vorderseite verschwindet aus meinem Blickfeld, dafür werden versengter Jeansstoff und kleine blaue Stellen am Gesäß und der Rückseite der Oberschenkel des Opfers sichtbar.
»Extraktionszange«, sagt der Doktor.
Der Assistent dreht sich zum Koffer, nimmt eine medizinische Zange heraus und reicht sie ihm.
Coblentz drückt die Zangenspitze auf eine Stelle, an der die Jeans noch nicht ganz verbrannt ist, schiebt den Zangenkopf zwischen zwei Stoffschichten, öffnet die schmalen Zangenbacken und zieht ein angekohltes Portemonnaie heraus.
»Na also«, sagt er.
Das Portemonnaie hat ein klassisches Klappformat, so wie das von Tomasetti. »Sieht gar nicht allzu schlimm aus«, sage ich.
Der Doc wirft mir einen skeptischen Blick zu.
Ich nehme den Geldbeutel in meine behandschuhte Hand. Der Assistent hat bereits ein großes steriles Tuch aus dem Koffer genommen und breitet es auf der blauen Plane aus. Danke murmelnd, lege ich den Geldbeutel darauf und klappe ihn mit dem Zeigefinger auf. Ein halber Zentimeter des Führerscheins wird sichtbar, die Ecken sind verkohlt und geschmolzen, aber der Rest ist unbeschädigt.
»Bingo.« Vorsichtig ziehe ich die Plastikkarte an einer Ecke heraus.
»Milan Swanz«, lese ich laut vor. »Ich kenne ihn. Er ist amisch.«
Doc Coblentz sieht mich fragend an.
»Ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Hab ihn verhaftet. Zweimal.« Mein Blick wandert zur Adresse, die ich kenne. »Mist.«
Ich hole mein Handy aus der Tasche, fotografiere Vorder- und Rückseite des Führerscheins, dann nehme ich mir wieder das Portemonnaie vor. Keine Kreditkarten, was für einen Amischen nicht ungewöhnlich ist. Ein Fünfdollarschein, ein einzelner. »Wer immer ihn umgebracht hat, war nicht an seinem Bargeld interessiert«, sage ich, nehme mir aber vor zu überprüfen, ob er Kredit- oder Bankkarten hatte.
Da ich sonst nichts Interessantes mehr finde, ziehe ich einen Beweismittelbeutel hervor, lasse das Portemonnaie hineinfallen und stecke den Beutel zurück in meine Jackentasche.
Ich sehe Coblentz an. »Wir müssen trotzdem noch einen DNA-Abgleich machen, um sicherzugehen, dass das Portemonnaie von Swanz nicht einem anderen untergeschoben wurde.«
»DNA ist kein Problem«, sagt der Doc. »Zahnabgleich ebenso.«
Wir starren uns einen Moment lang an. Seine Brille ist beschlagen, seine Nasenspitze ist rot, und die Nase tropft. Unglaube und Abscheu stehen in seinem Gesicht geschrieben, aber auch eine eiserne Entschlossenheit, die ihm hilft, mit dem hier klarzukommen. Ich spüre, wie all diese Gefühle auch in mir arbeiten.
»Kann man irgendwie feststellen, ob er noch gelebt hat, als er in Brand gesetzt wurde?«, frage ich.
»Na ja, die Autopsie wird klären, ob er an den Verbrennungen oder an Ruß- oder Rauchvergiftung gestorben ist. Sobald wir ihn ins Leichenschauhaus gebracht haben, werde ich einen Test durchführen, um den Kohlenmonoxidgehalt im Blut zu bestimmen, und checken, ob sich Ruß in seinen Atemwegen befindet. Bei den meisten Fällen von Brandstiftung ist Rauchvergiftung die Todesursache, bei Selbstverbrennungen sind es die Brandwunden.«
Wir schweigen eine Weile, als wären die Gedanken, die in unseren Köpfen kreisen, zu dunkel, um ausgesprochen zu werden.
»Sonst noch etwas?«, frage ich schließlich.
»Wie Sie sich denken können, wird das vermutlich ein komplizierter und schwieriger Fall«, sagt er. »Ich werde wohl einen forensischen Pathologen zur Unterstützung hinzuziehen.«
Ich blicke hinab auf den Toten, auf die verkohlte und sich abschälende Haut, die Stellen mit dem verbrannten Jeansstoff, und mir wird übel. Milan Swanz hatte viele Probleme und hat viele Fehler in den sechsunddreißig Jahren, die er auf dieser Welt war, gemacht. Aber er war ein Mensch mit einer Frau, mit Kindern und Eltern, die ihn trotz all seiner Defizite geliebt haben.
Meine drängendste – und schwierigste – Pflicht ist es deshalb, der Familie von Milan Swanz die Nachricht von seinem Tod zu überbringen. Wenn ich das hinter mir habe, werde ich mich auf das konzentrieren, was ich am besten kann – den Mistkerl finden, der ihn getötet hat, und ihn vor Gericht bringen.
Ich fische mein Handy aus der Jackentasche, schlüpfe unter dem Absperrband durch und drücke die Kurzwahltaste fürs Revier. Meine Mitarbeiterin von der dritten Schicht in der Telefonzentrale nimmt nach dem ersten Klingeln ab.
»Hey, Chief.«
»Ich möchte, dass Sie Milan Swanz durch LEADS laufen lassen.« LEADS ist das Akronym für die Datenbank der Strafverfolgungsbehörden. »Und seine Frau, Bertha, auch.«
»Brauchen Sie die Adresse?«
»Ich weiß, wo sie wohnen.« Ich stoße einen Seufzer aus. »Ich brauche die Namen und Kontaktinformationen seiner Eltern sowie die Namen von allen Leuten, mit denen er zu tun hatte. Finden Sie heraus, ob ein Auto auf seinen Namen zugelassen ist.«
»Wird gemacht.« Ich höre das Klappern ihrer Tastatur.
»Sie sind Amische«, füge ich hinzu. »Über die Eltern wird es wohl kaum etwas geben. Rufen Sie mich an.«
Ich lege auf, entdecke Sheriff Mike Rasmussen vom Holmes County Sheriffbüro und gehe zu ihm.
Er hat mich ebenfalls gesehen und kommt mir entgegen. »Hab den Anruf erst vor einer halben Stunde gekriegt«, sagt er. »Was zum Teufel ist hier passiert?«
Wir geben uns die Hand. Über einem gefütterten Overall trägt er einen Dienstparka, der am Kragen offen ist. Ich bin ziemlich sicher, dass er unter dem Overall einen karierten Schlafanzug anhat.
Ich berichte ihm das wenige, was ich bis jetzt weiß.
Mike Rasmussen ist ein erfahrener Polizist. Genau wie ich hat er schon einiges erlebt und ist nicht leicht zu beeindrucken. Am Ende meiner Ausführungen starrt er mich ausdruckslos an, als erwarte er, dass ich in Lachen ausbreche und zugebe, dass das Ganze ein kranker Witz ist.
»Wollen Sie mich verarschen?«, sagt er. »Auf einem Scheiterhaufen verbrannt? Wie eine Hexe?«
»Wir haben ihn gerade identifiziert. Milan Swanz. Er ist von hier. Amisch.«
Er kneift die Augen zusammen. »Warum kommt mir der Name bekannt vor?«
»Weil er vorbestraft ist.«
»Weswegen?«
Ich schüttele den Kopf. »Allein in Painters Mill und ohne lange nachzudenken wegen Alkohol am Steuer, Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Trunkenheit und Ruhestörung.«
Er sieht mich fragend an. »Sie kennen ihn?«
»Nicht gut. Ich bin mit ihm zur Schule gegangen und hab ihn zweimal in den vergangenen zwei oder drei Jahren verhaftet. Er hatte kein leichtes Leben, glaube ich.«
»Irgendwelche laufenden Verfahren?«
»Keine Ahnung. Ich werde jetzt mit seiner Familie sprechen.«
»Schöne Scheiße.« Er verzieht das Gesicht. »Ist er verheiratet?«
Ich nicke. »Mit seinen Eltern werde ich wohl auch sprechen.«
»Mein Gott.« Er reibt sich mit der Hand über die Bartstoppeln. »Ich versuche immer noch, das alles hier zu begreifen.«
»Nicht ganz leicht, oder?«
Er sieht an mir vorbei hinüber zum Pfahl und schüttelt den Kopf. »Hören Sie, Kate, das hier fällt in Ihre Zuständigkeit, aber wenn Sie Unterstützung brauchen …«
»Ich nehme jeden Ihrer Officer, den Sie entbehren können. Das hier ist ein extrem grausames Verbrechen. Ich dachte, vielleicht wäre es eine gute Idee, das BCI einzuschalten und eine Task Force einzurichten.«
»Was immer Sie brauchen.« Er schenkt mir ein kleines Lächeln. »Dürfen Sie und Tomasetti denn zusammenarbeiten, wo Sie jetzt verheiratet sind?«
»Soviel ich weiß, gibt es keine Vorschrift, die dagegenspricht.« Ich zucke mit den Schultern. »Painters Mill liegt in seinem Gebiet. Wir werden sehen.«
»Hört sich gut an. Wir drei sind ein ziemlich gutes Team, finde ich.«
Ich blicke an ihm vorbei zu Mona und Skid, die sich nur wenige Meter hinter ihm unterhalten. »Als Erstes brauchen wir Scheinwerfer, um die nahe Umgebung absuchen zu können. Metalldetektoren, Hunde, das volle Programm. Später weiten wir die Suche aus. Das Ganze ist erst vor ein paar Stunden passiert. Wir haben die nähere Umgebung zwar schon abgesucht, aber im Dunkeln. Gut möglich, dass wir etwas übersehen haben. Vielleicht hat der Mörder ja was verloren oder zurückgelassen.«
»An der Straße gibt es eine geschotterte Parkbucht.« Er zeigt zu den Bäumen hinter dem Tatort. »Ich lasse einen Deputy checken, ob es dort Reifenspuren oder Schuhabdrücke gibt.«
»Gut.« Ich seufze. »Der Schnee ist nicht gerade hilfreich.«