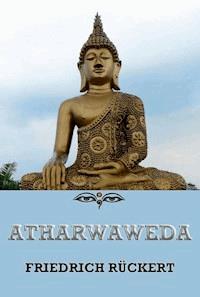
Atharwaweda E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Atharvaveda ist eine der heiligen Textsammlungen des Hinduismus. Er enthält eine Mischung von magischen Hymnen, Zauberformeln und anderem Material, das offenbar sehr unterschiedlichen Alters ist. Obwohl vieles sprachlich deutlich jünger ist als die anderen drei Veden (zumindest des Rigveda), finden sich in ihm auch sehr alte Passagen. Man schätzt, dass der Atharvaveda in der zweiten Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends kanonisiert wurde, und auch dann erst mit den anderen drei Veden auf eine Stufe gestellt wurde. Er liegt in zwei Rezensionen oder Schulen vor, der bekannteren Shaunaka-Version, und der erst in jüngster Zeit besser erforschten Paippalada-Version. Der Atharvaveda umfasst 20 Bücher in 731 Hymnen mit ungefähr 6000 Versen. Ungefähr ein Siebtel des Atharvaveda ist aus dem Rigveda entnommen. Der Atharveda ist entstanden, als die Sesshaftwerdung in der Gangesebene schon abgeschlossen war. Das Wort für Tiger kommt hier vor, im früheren Rigveda hingegen noch nicht. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Atharwaweda
In der Übersetzung von Friedrich Rückert
Inhalt:
Atharwaweda
Vorwort.
Über den Atharwaweda.
Erstes Buch
13. Im Gewitter.
14. Verwünschung zu ewiger Jungfrauschaft.
15. Zusammenströmungs-Opfer.
16. Heiliges Blei.
17. Blutstillung.
18. Gegen Leibesverunstaltungen durch Unholdinnen.
19. Gegen die Geschosse.
22. Gegen die Gelbsucht.
23. Kraut Färberich.
24. Ein anderes desgleichen.
25. Gegen das Fieber.
28. Gegen Unholde und Unholdinnen.
Zweites Buch
2. Der Gandharwa.
8. Gegen die nächtlichen Feldbeschädiger (Unholde).
14. Gegen allerlei Unholde.
15. Ermutigung.
19. An Agni.
24. Zurückweisung der Ungetüme.
25. Göttin Buntflügel.
26, a. Zur Heimkehr des Viehes.
26, b. Zusammenströmungs-Opfer.
27. Spalt-Kraut zum Gegenopfer.
28. Einweihung zu langem Leben.
30. Liebeszauber.
32. Gegen die Würmer.
36. Brautlied.
Drittes Buch
5. Das Laub-Amulett.
6. Der Ashwattha-Baum.
7. Hirschhorn gegen Auswüchse.
12. Einweihung des Hauses.
14. Kuhsegen.
15. Glück zur Handelschaft.
17. Die Ackerfurche.
18. Zauber gegen die Mitgattin.
19. Der Hauspriester für das Waffenglück seines Häuptlings.
23. Empfängnisweihe.
24. Zur Gutvermehrung.
25. Liebeszauber.
30. Häuslichen Frieden zu stiften.
Viertes Buch
3. Zauber gegen Raubtiere und Räuber.
4. Wurzel, Leibkräftiger genannt.
5. Der Liebhaber schläfert ein.
6. Zauber gegen vergiftete Pfeile.
7. Gegen giftige Nahrungsmittel.
9. Kraut Andschana.
10. Die Muschel Krishana oder Karshana.
12. Wachskraut, Wunden verwachsen zu machen.
13. Über einem Bettlägerigen.
14. Des Bockes Opfer.
16. Eine Anrufung Waruna's.
17, a. Kraut Siegreich und Konsorten.
17, b. Kraut Abwasch.
18. Gegenzauber.
20. Kraut Allsehend.
21. Ein Kuhsegen.
22. Glückwunsch dem Häuptling.
30. Göttin Herrschaft.
32. Der Gott Zorn.
35. Der heilige Reisbrei.
37. Das Kraut Bockshorn gegen Apsarasen und Gandharwen.
38, a. Die Spielglücksgöttin Apsaras.
38, b. Stallsegen.
39. Wunschmelke.
Fünftes Buch
5. Schlingpflanze Silatschi.
8. Opfer gegen den Feind.
10. Der Felsenschild.
14. Durch Zauberkraut zurückgewiesener Zauber.
15. Zauberzahlen.
16. Desgleichen.
18. Der Brachmane gegen den Kschatrija.
20. Die Kriegstrommel.
29. Agni gegen die Pishatschen.
30. Siechtum zu besprechen.
31. Hinwegräumung aller Bezauberungen.
Sechstes Buch
5. Der Hauspriester betet für den Hausherrn.
8. Liebeszauber.
9. Desgleichen.
11. Um einen Sohn zu zeugen.
12. Eine giftige Schlange zu besprechen.
13. Gebet gegen den Tod.
14. Gegen die Blähe.
15. Die Mistel (?)
17. Zur Empfängnis.
18. Benehmung der Eifersucht.
20. Das Fieber zu entlassen.
21. Haarmittel.
22. Der Regen.
24. Die Heilwasser.
25. Gegen Krämpfe?
26. Der Gott Sünde.
27. Die Unglückstaube.
28. Dieselbe Taube.
29. Dieselbe Taube mit der Eule.
30. Spruch gegen Kahlköpfigkeit.
32. Das Haus gegen bösen Besuch zu segnen.
37. Der Fluch gegen den Flucher.
38. Indra's Mutter.
39. Das Ruhmopfer.
40. Befriedung.
41. Weihe.
42. Versöhnung.
43. Auszürnekraut.
44. Kraut Hörnling.
45. Gegen böse Gedanken.
46. An den Schlaf.
47. Die drei täglichen Spenden.
50. Die Feldfruchtschädiger.
51. Abendgebet.
52. Gegen die Unsichtbaren.
53. Ein Morgensegen.
54. Für den Vorrang des Häuptlings.
55. Verehrung der sechs Jahrzeiten.
56. Die göttlichen Schlangen.
57. Rudra's Heilkraut gegen Rudra's Pfeile (Seuchen).
58. Brachmanen-Ehre.
59. Kraut Dschiwala Arundhati.
60. Hochzeitslied.
61. Die Kraft der Soma-Verehrung.
63. Lösung von Nirriti
64. Einigkeitsweihe.
65. Die Feinde handlos zu machen.
66. Desgleichen.
67. Desgleichen.
68. Die Bartscherweihe.
69. Honigwein der Wohlredenheit.
70. Die Kuh dem Kalb zugetan zu machen.
71. Das alles heiligende Feuer.
72. Segenspruch über das Männliche.
73. An die Brüder.
74. Noch eine Hausfriedenstiftung.
75. Einen Feind zu vertreiben.
76. Der Agni des Kschatrija.
77. Die gestalleten Rosse.
78. Hochzeitwunsch.
79. Gott Wolkenherr.
80. Der himmlische Hund?
81. Der Beihandige (ein geburtshelfender Gott?).
82. Indra's Treibstachel.
83. Gegen geburthemmende Mondeskräfte?
84. Von der Unterwelt losgebeten.
85. Die Auszehrung in einen Baum zu bannen.
86. Loblied auf einen Fürsten.
87. Weihe eines Fürsten.
88. König Treufest.
89. Liebeszauber.
90. Besprechen von Rudra's Pfeil
91. Die Erquickung des Pflügers
92. An das Kriegsroß.
93. Alle Todesgötter.
94. Friedenstiftung.
95. Costus speciosus, das Kraut aller Kräuter.
100. Ein Gegengift.
102. Einen Feind zum Freunde zu machen.
103. Feindliche Heere zu versöhnen.
104. Feindesheere zu binden.
105. Für den Husten.
106. Die Sommerfrische.
107. Schützende Mächte.
108. Göttin Besonnenheit.
109. Die Pippali
110. Zur Geburt des Sohnes.
111. Gemütsverstörung zu heilen.
112. (Versuchten?) Kindesmord zu sühnen.
113. Desgleichen.
114. Ein Opferversehen zu sühnen.
115. Entsündigung.
116. Ackerweihe?
117. Schuldentilgung.
118. Spielschulden.
119. Nicht-Spielschulden.
120. Zum Himmel.
121. Desgleichen.
123. Die Götter Ahnen und deren König Jama.
124. Gegen Verunreinigung durch einen Tropfen.
125. Dem Wagenbaum wird geopfert.
126. Trommelweihe.
127. Gegen Beulen, Entzündung und Geschwüre.
128. König Shakadhuma.
129. Ranke Shinshapa.
130. Der Gedenker, d.i. Liebesgott.
131. Desgleichen.
132. Desgleichen.
133. Weihe der Kriegerbinde.
134. Der Blitzstrahl.
135. Desgleichen.
136. Ein Kraut, den Haarwuchs zu befördern.
137. Desgleichen.
138. Shamja, die Unterlage des Soma-Mörsers, zur Verwünschung.
139. Pflanze Njastika.
140. Gegen Zahnweh?
141. Zur Mehrung der Kühe.
142. Gott Weizen.
Siebentes Buch.
6. Aditi.
8. Fürstenweihe.
9. Puschan (= Faunus, Pan).
10. Saraswati's Busen.
11. Indra auf dem Regenbogen?
12. Geselligkeit.
13. Bei aufgehender Sonne.
14. Der Söhner, d.i. Sonnengott.
16. An denselben.
18. Fruchtbarkeit und Opfer.
19. Ein kurzes Gebet.
20. Göttliche Genehmigung.
32. Teilnahme an den Opfergeschenken.
33. Kurzes Gebet.
34. Ein anderes.
35. Der verschließende Stein.
36. Vereinigung.
37. Des Manu (Adams) Kleid.
38. Kraut »Schau-mich-an« und »Weinen-mach«.
40. Saraswat.
41. Der göttliche Falke.
42. Soma – Rudra.
45. Eifersuchtsheilkraut.
50, a. Spielglück, Kriegsglück.
50, b. Desgleichen.
53. Neues Leben.
56. Gegen Muskito-Stich.
56, b. Gegen Skorpionstich (?)
57. Ein Rätsel.
58. Indra und Waruna zum Somatrunk geladen.
60. Der besuchende Gott grüßt das Haus.
62 und 63. Agni.
64. Der schwarze Raubvogel.
65. Baum Abwascher.
66. Verlaufenes Vieh zurück zu beten.
67. Wiederherstellung.
68. Saraswati.
70. Zerstörung des feindlichen Opfers.
72. Das Mittagsopfer.
74. Ein kurzer Liebeszauber.
75. Ein Kuhsegen.
76. Krankheit Weiberich (Krämpfe?).
78. Brachmanische Weihe des heiligen Feuers eines Kschatrija.
79. Göttin Zusammenwohnerin, d.i. Neumond.
80. Göttin Vollmond.
81. Der Mond.
83. Löser Waruna.
87. Agni ist Rudra geworden.
88. Gegen Vergiftung.
89. Entsündigung durch Wasser und Feuer.
90. Die Mannheit zu benehmen.
95 u. 96 Zwei Talismane gegen den Dieb aufgestellt.
100. Gegen böse Träume.
101. Glück im Schlaf.
102. Um zu pissen.
103. Aufforderung zu einem guten Werk.
104. Der Atharwan braucht eine Kuh.
105. An den Trotzigen.
107. Einen Stachel auszuziehn (?).
108. Wann das heilige Feuer durch die Reibhölzer erzeugt wird.
109. Die Spielgötter.
111. Das Weinfaß.
112. Die sieben heiligen Wasser.
113. Die Liane Dürsterin.
114. Sich von Verliebtheit zu lösen.
115. Einhundert Schicksalsgöttinnen.
118. Segenspruch.
Achtes Buch
1. Weihe zu neuem Leben.
1, b. Desgleichen.
2. Desgleichen.
4, b. Gegen die bösen Feinde.
5, a. Kranzgewind-Angebinde
5, b. Dasselbe oder ein Ähnliches.
6. Den Weibern die Unholde abzuwehren.
7, b. Alle Heilpflanzen.
8. Kriegszauber.
Neuntes Buch.
3. Einweihung eines (erweiterten und umgesetzten) Hauses.
Zehntes Buch.
1. Gegen Zaubergebilde und Popanze.
3, a. Bewahr-Abwehr-Kränzlein.
3, b. Ein Nachtrag dazu.
3, c. Desgleichen.
Elftes Buch.
2. Eine Verehrung Shiwas.
4. Der göttliche Hauch.
6. Statt eines: Herr, erlös uns von dem Übel!
8. Eine mythische Naturphilosophie.
9. Kriegshelfer Million-Billion.
10. Weihe zum Siege.
Zwölftes Buch.
1, a. Verehrung der Erde.
1, b. Desgleichen.
1, c. Wohlgeruch der Erde.
1, d. An die Erde.
1, e. An dieselbe.
Dreizehntes Buch.
1. Fromme Verwünschungen.
2. Sonnen-Rennbahn.
4. Indra aus Allem und Alles aus ihm.
Vierzehntes Buch.
1, a. Ablösung und Anbindung der Braut.
1, b. Desgleichen.
1, c. Guter Wunsch für die junge Frau.
1, d. Spruch des Gatten, wenn er die Gattin bei der Hand nimmt.
1, e. Desgleichen.
1, f. Wenn man der Braut das Haar zurecht macht.
1, g. Braut Sonne auf dem Wagen.
1, h. Das Hausgesinde des Bräutigams zur Ankunft der Braut.
1, i. Zum Eintritt der Braut.
2, a. Der Mann empfängt die Braut dreier Götter.
2, b. Auf der Brautfahrt.
2, c. Die junge Frau wird mit Samenkörnern bestreut.
2, d. Die Braut wird den Weibern gezeigt.
2, e. Die Braut besteigt das Bett.
2, f. Der Gandharwe wird vom Brautbette weggewiesen.
2, g. Der Brachmane bekommt die Hochzeitkleider.
2, h. Die neue Hausfrau wird mit den Kühen belehnt.
2, i. Die junge Frau wird gekämmt.
2, k. Der Gatte.
Fünfzehntes Buch
Sechzehntes Buch
Siebzehntes Buch.
1, a. Eine Anrufung Indra's.
1, b. Anrufung der Sonne, als Wischnu.
Achtzehntes Buch.
2, a. Totenopfer für langes Leben.
2, b. Beim Leichenbrand.
2, c. Zu wem der Tote gehen soll.
2, d. Nachruf dem Begrabenen.
2, e. Er wird hinausgetragen.
2, f. Ungeladne Gäste unter den Geladenen.
2, g. Bestimmung des Totenopfers eines Reichen.
2, h. Jedem sein Teil.
2, i. Desgleichen.
2, k. Himmlisches Geleite.
3, a. Die Witwe wählt die Gattenwelt.
3, b. Zur Auffahrt der Gestorbenen.
3, c. Jama, der erste der Gestorbenen.
3, d. Der Leichenbrand heilt alle Schäden.
3, e. Beliebige Gestalten der Väter.
3, f. Eine Fröschin kühlt den Leichenbrand.
4, a. Drei Opferpfannen mit einem vierten Pfännchen im Leichenbrand.
4, b. Die drei Leichenfeuer als Rosse.
4, c. Die Leichenmahlzeit befördert die Verstorbenen zum Himmel.
4, d. Kuh und Kalb des Gestorbenen.
4, e. Das Totenopfer gibt dem Geschiedenen seinen geistigen Leib.
Neunzehntes Buch.
2. Heilwasser.
3. Agni Weltlebensfeuer.
9. Stillung.
15. Fahrlosigkeit in Indra's Schutz.
26. Geweihtes Gold.
28, a. Das verderbliche Darbhakraut.
28, b. Nachtrag.
47. An die Nacht.
50. Desgleichen.
56. An den Schlaf.
60. Allheil.
62. Kräutchen Mache lieb.
67. Hundert Herbste.
69. Dschiwala, d.i. Lebekraut.
Erklärender Index der Sanskrit-Namen und -Worte.
Verzeichnis der unsicheren Lesarten und Änderungen.
Atharwaweda, Friedrich Rückert
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849600082
www.jazzybee-verlag.de
Atharwaweda
Vorwort.
Zu einer eingehenderen Beschäftigung mit FRIEDRICH RÜCKERTS indologischen Werken im weitesten Sinne führten mich zum ersten Male die Vorarbeiten zu einer Neuausgabe der Gitagowinda-Übertragung des Dichters, die im Jahre 1920 als Bändchen 303 der Inselbücherei des Inselverlages in Leipzig erschienen ist. Bei einer genaueren Prüfung der Rückertliteratur kam ich zu der mir besonders interessanten Feststellung, daß Rückert außer anderen wedischen Arbeiten, von denen die indologische Fachliteratur sonderbarerweise nichts erwähnt, eine umfangreiche Übertragung von Liedern des Atharwaweda hinterlassen habe. Wie mehrere gedruckte Zeugnisse von verschiedenen Seiten zeigten, konnte kein Zweifel darüber sein, daß die Atharwaweda-Version Rückerts irgendwann und irgendwo handschriftlich vorhanden gewesen war. Aber: war sie noch heute vorhanden? Und: wo konnte sie sich jetzt möglicherweise befinden? Das waren zwei Probleme, die bei der beispiellosen Zersplittertheit und dem gewaltigen Umfange des Rückertschen handschriftlichen Nachlasses zu lösen nicht leicht war. Ich wandte mich an alle irgendwie in Betracht kommenden Stellen, aber überall her kam die gleiche negative Antwort. Keine Bibliothek, kein Indologe, kein Literarhistoriker wußte über den Verbleib dieser zweifellos wertvollen Arbeit des Dichters irgendwelche Auskunft zu geben. Und als schließlich noch eine Anfrage bei der Familie Rückert, ob der Privatkatalog der in ihrem Besitze befindlichen handschriftlichen Nachlaßstücke etwas über das gesuchte Atharwaweda-Manuskript enthalte, auch noch erfolglos blieb, da war meine Hoffnung sehr gering, das Werk doch noch zu finden. Nun stellten mir die Erben des Dichters im Januar 1922 liebenswürdigerweise den ganzen riesigen Koburger orientalischen Nachlaß des Dichters zwecks wissenschaftlicher Bearbeitung zur Verfügung. Als die mehr als 40 zum Teil sehr umfangreichen Konvolute vor mir lagen, und ich daran ging, diese nicht ohne die größte Spannung durchzusehen, da stieß ich am 12. Januar 1922 auf ein umfangreiches Konvolut mit dem von späterer Hand auf den Umschlag geschriebenen viel- bzw. nichtssagenden Titel: »Weda-Übersetzungen mit Urtext« und erkannte darin zu meiner großen Freude sehr bald die lange gesuchte Atharwaweda-Übertragung Rückerts.
Das Manuskript, dessen genauere Beschreibung ich später geben werde, zeigte Spuren einer Beschädigung, woraus es sich erklärt, daß das sonst meist vorhandene Titelblatt von Rückerts Hand fehlt, dann, daß die Übersetzung ohne ersichtlichen Grund unvermittelt mit dem Hymnus 13 des ersten Buches beginnt. Es scheint mir sicher, daß mehrere Anfangsblätter des Manuskriptes bei der Beschädigung mitsamt dem Titelblatt verloren gegangen sein müssen. Und daraus, daß der Dichter diese wenigen Blätter nicht ergänzt hat, glaube ich schließen zu dürfen, daß die Beschädigung der Handschrift nach dem Tode des Dichters stattgefunden hat.
Das Manuskript enthält fast ein Drittel des ganzen Atharwaweda in lateinisch transskribiertem, accentuiertem und emendiertem Urtext mit darunter stehender metrischer Übersetzung und teilweise umfangreichen textkritischen, grammatischen, metrischen, prosodischen, mythologischen und etymologischen Anmerkungen. Mein Plan inbezug auf die Veröffentlichung des neuaufgefundenen Meisterwerkes ging zunächst dahin, die Übersetzung des Atharwaweda mitsamt den verwertbaren Noten des Dichters, die ich, wo nötig, ergänzen wollte, herauszugeben. Mit dem Druck der Übersetzung wurde baldmöglichst, im Spätherbst 1922, begonnen. Als diese Anfang März 1923 fertig ausgedruckt vorlag, stellte sich Heraus, daß deren Umfang allein bereits das vom Verlage ursprünglich vorgesehene Volumen ganz erheblich überschritten hatte. Dazu kam, daß es mir bis zum März 1923 infolge Überhäufung mit anderen dringenden Arbeiten nicht gelungen war, das Druckmanuskript der umfangreichen Anmerkungen einigermaßen zum Abschluß zu bringen. Da es mir weiter ebenso wie dem Verlage dringend wünschenswert erschien, unter Vermeidung eines zu hohen Preises das neue Werk Rückerts möglichst weiten Kreisen der deutschen Leserwelt zugänglich zu machen, bin ich mit Freuden dem Vorschlage des Verlages gefolgt, den Rückertschen Atharwaweda zunächst in einer kürzeren Ausgabe ohne Anmerkungen herauszugeben, der dann die große Ausgabe mit Erläuterungen später folgen soll. Der vorliegenden Ausgabe habe ich außer einer kleinen Einleitung über den Atharwaweda nur einen erklärenden Index der in Rückerts Übertragung vorkommenden Sanskrit-Namen und -Worte beigegeben. Die große Ausgabe, die erheblich umfangreicher sein wird als die vorliegende, soll außer Rückerts von mir allgemeinverständlich ergänzten und bearbeiteten Anmerkungen und einer zweiteiligen längeren, u.a. auch eine genaue Beschreibung des Rückertschen Manuskriptes enthaltenden Einleitung noch mit einem philologisch-kritischen Anhang ausgestattet werden, der alle zum Teil hochinteressanten rein philologischen Noten des Dichters der indologischen Fachwelt zugänglich machen wird.
Zur vorliegenden Ausgabe sei im einzelnen noch folgendes bemerkt: die Entzifferung des oft schwer lesbaren Manuskriptes bot besonders dort, wo der Dichter viel in der Übersetzung korrigiert hat, nicht selten ungeahnte Schwierigkeiten, die zu überwinden ich mit allen Mitteln bemüht gewesen bin. Einige Stellen, an denen ich trotz aller Sorgfalt nicht zu sicheren Lesungen gekommen bin, habe ich in einem kleinen Verzeichnis der unsicheren Lesarten am Ende des Buches namhaft gemacht.
Die Anwendung der modernen Orthographie schien mir von selber geboten, da das Buch für weiteste gebildete Kreise bestimmt ist. Außerdem mochte ich den zweifellosen Mißgriff E. A. BAYER'S, der in seinen Rückertausgaben die abstruse und inkonsequente Orthographie des Dichters beibehalten hat, nicht wiederholen, da ich der festen Oberzeugung bin, daß gerade die abschreckende Rückertsche Rechtschreibung die Verbreitung der Werke des Dichters nicht wenig gehemmt hat. – Kommata und Apostrophen habe ich, wo es mir der Klarheit halber angebracht erschien, nicht selten hinzugefügt oder auch gestrichen. Offenbare Schreibfehler des Originals habe ich stillschweigend berichtigt, ohne sie immer namhaft zu machen. Subjektivisch gebrauchte Partizipien, die Rückert öfter klein als groß schreibt, habe ich durchweg groß gedruckt. – Bei der Schreibung der Sanskrit-Namen und -Worte habe ich mit Rücksicht auf den Charakter der Ausgabe eine diakritische Zeichen und Längenstriche vermeidende, der Aussprache angeglichene Transskription angewandt, die mit der übrigens nicht konsequenten Umschreibung des Dichters manches gemeinsam hat. Um den primitiven Charakter der atharwanischen Poesie auch äußerlich wirksam hervortreten zu lassen, habe ich die von Rückert stets nur angedeuteten litaneienhaften Refrains, über die H. SCHURTZ: Urgeschichte der Kultur, Leipzig-Wien 1900, S. 523 ff. zu vergleichen ist, stets vollständig abdrucken lassen. – Wo Rückert längere Hymnen in ihre Teile zerlegt und diese einzeln in der Weise numeriert, daß er beispielsweise mit XII, 1 beginnt, um dann mit XII, 1, a; 1, b usw. fortzufahren, habe ich diese Zählung durchgehends dahin abgeändert, daß ich XII, 1, a; 1, b; 1, c usw. dafür eingesetzt habe. – Abgesehen von solchen unwesentlichen Änderungen bin ich bestrebt gewesen, in der vorliegenden Ausgabe den Text des Rückertschen Manuskriptes auf das Genaueste und Sorgfältigste wiederzugeben und hoffe, daß mir das gelungen ist.
Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle allen denen, welche die Herausgabe des vorliegenden Buches gefördert haben, meinen verbindlichsten Dank zu sagen: Zunächst der FAMILIE RÜCKERT, ganz besonders Herrn Geh. Justizrat H. RÜCKERT in Frankfurt a.M., der mir außerdem bereitwilligst zahlreiche wertvolle briefliche Auskünfte zukommen ließ, für die große Liebenswürdigkeit, mir den Koburger orientalischen Nachlaß Friedrich Rückerts zur Verfügung zu stellen. Dann Herrn Universitäts-Professor Dr. RICHARD SCHMIDT, der mich mit Rat und Tat zu unterstützen die Güte hatte. Endlich dem FOLKWANG-VERLAGE, vor allem seinem weitblickenden und großzügigen Leiter, Herrn ERNST FUHRMANN, für die geradezu hervorragende Ausstattung des Buches, die es zu einem der schönsten aller Rückertdrucke macht, die bisher erschienen sind.
Münster i. Westf., Ostern 1923.
HERMAN KREYENBORG.
Über den Atharwaweda.
Wie die Iranier, die Hebräer, die Muhammedaner und Christen haben auch die Inder ihre heiligen Religionsbücher, ihre »Bibel«, der sie, für ihre geistige Einstellung charakteristisch genug, den Namen »Weda«, das »Wissen« im Sinne des absoluten, heiligen, inspirierten Wissens gegeben haben. Von diesem altindischen Weda, einer ganzen riesigen religiösen Literatur, sind vier große religiöse Textsammlungen auf uns gekommen: 1. der Rigweda, das »Wissen von den Preisliedern«, in dem uns hauptsächlich die brachmanische Priesterpoesie der Götterhymnen überliefert ist; 2. Der Samaweda, das »Wissen von den Melodien«, eine Sammlung von Texten, die als Träger wedischer Hymnenmelodien dienten; 3. der Jadschurweda, das »Wissen von den Opfersprüchen«, eine Sammlung von Gebetstexten, die bei den großen wedischen Opfern gesprochen wurden; 4. der Atharwaweda, das »Wissen von den Zaubersprüchen«, eine Sammlung, die im Gegensatz zu den vorgenannten drei anderen Weden in Indien nie recht als kanonisch anerkannt worden ist. Das hat seinen Grund in dem mehr volkstümlichen Inhalt dieses eigenartigen Weda, der mehr für den Hausgebrauch bestimmt war, als daß er zu dem öffentlichen wedischen Opferwesen in Beziehung stand. Trotzdem ist der Gebrauch dieses Weda ein nicht weniger lebhafter gewesen, als der der anderen Sammlungen.
Der vierte altindische Weda hat mehrere beachtenswerte Namen, von denen der älteste »Atharwangirasas« lautet, d.h. »die Atharwans und die Angiras«, Namen uralter Feuer- und Zauberpriestergeschlechter, von denen der der Atharwans sicher in indoiranische Zeit zurückgeht, wie der iranische Parallelname der »Athrawans« im Awesta beweist. Im Laufe der Jahrhunderte scheint sich die Bedeutung dieser altehrwürdigen Namen dahin verschoben zu haben, daß man unter Atharwans und Angiras nicht mehr die alten Priestergentes selber, sondern deren Zaubersprüche verstand, wobei dann mit dem Worte atharwan der Begriff des Heils- und Glückszaubers, mit angiras dagegen der des feindlichen, unheilbringenden Zaubers verbunden wurde. Außerdem kommt der Name »Bhrigwangiras« vor, der sich dadurch erklärt, daß man für den Namen der Atharwans den der Bhrigu's, eines anderen mythischen Feuerpriestergeschlechtes, einsetzte. – Ein ganz später Name lautet »Brachmaweda«, der auch soviel wie »Weda der Zaubersprüche« bedeutet. Was endlich den Namen Atharwaweda angeht, so stellt dieser nur eine Kurzform der vollständigeren alten Bezeichnung Atharwangirasas dar und bedeutet einmal »Weda der Atharwans«, dann, wie schon erwähnt, »Wissen von den Zaubersprüchen«, und zwar sowohl von den atharwanischen wie von den angirasischen.
Was den Umfang des Atharwaweda anbetrifft, so enthält er 731 Hymnen mit zusammen annähernd 6000 Strophen in 20 Büchern, von denen das zwanzigste fast ausschließlich dem Rigweda entnommene Buch nicht ursprünglich zu der Sammlung gehört. Auch das neunzehnte Buch scheint diesem Weda erst später zugefügt zu sein. Die übrigen 18 Bücher, von denen etwa ein Drittel ihres Gesamtumfanges sich ebenfalls im Rigweda wiederfindet, lassen in ihrer äußeren Aufmachung eine gewisse vorwiegend nach der Strophenzahl der Lieder vorgehende redaktionelle Tätigkeit nicht verkennen. So sind in den ersten sieben Büchern hauptsächlich kürzere Hymnen in der Weise zusammengestellt, daß in den einzelnen Büchern in der Regel eine bestimmte Strophenzahl der Lieder vorherrschend ist. Die Hymnen mit höherer Strophenzahl dagegen finden sich im achten bis vierzehnten, siebzehnten und achtzehnten Buche vereinigt. Eine Berücksichtigung auch des Inhalts der Lieder bei der redaktionellen Zusammenstellung dieses Weda merkt man u.a. daran, daß öfter mehrere Lieder desselben Inhalts zusammengeordnet worden sind; mehr aber noch daran, daß zwei Bücher, das vierzehnte der Hochzeitslieder und das achtzehnte der Totenbestattungshymnen, dem Inhalte nach ganz einheitlich sind. Neben der Poesie macht sich im Atharwaweda die Prosa breit, die etwa ein Sechstel seines ganzen Umfanges, darunter das ganze fünfzehnte und sechzehnte Buch, umfaßt.
Wer nach dem Alter des Atharwaweda fragt, erwarte nicht eine Antwort in sauberen Jahreszahlen, wie wir Abendländer sie gewohnt sind. Es gibt in bezug auf die indische Literatur kein schwierigeres und dunkleres Gebiet als die Chronologie, um die sich der gänzlich unhistorische Sinn der alten Inder nie im geringsten gekümmert hat. Und daß unter diesen Umständen die chronologische Bestimmung in der indischen Literatur um so mißlicher wird, je älter die Werke sind, bedarf keiner Erwähnung. So hört für die wedische oder althochindische Literatur und ihre Werke jegliche Möglichkeit auch nur annähernder chronologischer Angaben auf. Und auch angenommen, sie wäre möglich, so wäre doch für die chronologische Festlegung des Atharwaweda die Schwierigkeit keineswegs behoben, da nämlich diese Sammlung Bestandteile verschiedensten Alters, von den allerjüngsten bis zu den allerältesten, enthält. Nur der Versuch einer relativen Altersbestimmung, nämlich in bezug auf den Rigweda, das älteste Werk der indischen Literatur, kann für den Atharwaweda in Betracht kommen, worauf hier kurz näher eingegangen werden soll. Man wird gut daran tun, hier ein Doppeltes auseinander zu halten: 1. das Alter der Zusammenstellung, bzw. Redaktion des Atharwaweda, wie sie uns vorliegt; 2. Das Alter des eigentlichen alten Zaubergutes in eben diesem Weda. – Abgesehen von Sprache und Metrik des Atharwaweda, die sich von der des Rigweda merklich unterscheiden, aber doch aus hier nicht weiter ausführbaren Gründen keine sicheren Alterbestimmungskriterien abgeben können, finden sich in dem Zauberbuche unzweideutige Anzeichen dafür, daß die Redaktion dieses Weda jünger ist als der Rigweda: Es hat sich im Atharwaweda eine bedeutende Veränderung der geographischen und kulturellen Verhältnisse gegenüber denen des Rigweda vollzogen. Die atharwanischen Inder sind bereits bis in das Gangesgebiet vorgedrungen und dort seßhaft geworden. Der Tiger, das im Rigweda noch unbekannte, in den Dschungeln Bengalens hausende königliche Raubtier, wird im Atharwaweda als gefürchteter Räuber häufig erwähnt. Das rigorose altindische Kastensystem ist hier völlig ausgebildet. Dem mehr und mehr schwindenden Einflusse der wedischen Götter entspricht eine zunehmende Häufigkeit theosophischer und kosmogonischer Spekulationen, die an die Philosophie der Upanischads erinnern. Am deutlichsten vielleicht zeigt sich das geringere Alter der Atharwaweda-Redaktion in dem zunehmenden Einflüsse des immer arroganter auftretenden brachmanischen Priestertums. Die Tatsache, daß die Atharwaweda-Redaktion durchaus brachmanisch-priesterlich orientiert erscheint, spricht unzweideutig dafür, daß ihre Redaktoren brachmanische Priester waren, auf die denn auch alle typisch brachmanischen Bestandteile der Sammlung, vor allem jene ganze Klasse von Hymnen, welche die Interessen der Brachmanenkaste zum Gegenstande haben, zurückzuführen ist. So ist es auch nicht verwunderlich, daß die eigentliche alte Zauberpoesie des Atharwaweda, die wie alle Zauberpoesie rein volkstümlichen Ursprungs ist, hier nicht mehr überall den Charakter reiner Volksdichtung trägt, sondern in weitgehendem Maße priesterlich zugestutzt, brachmanisiert erscheint. Das sind die hauptsächlichsten Gründe, die für ein geringeres Alter der Atharwaweda-Redaktion gegenüber dem Rigweda sprechen. – Auf der anderen Seite ist es unzweifelhaft, daß das eigentliche alte Zaubergut, das dem Atharwaweda seine eigentümliche Färbung gibt, uralt, ja älter als der Rigweda selber ist, daß es zurückreicht in namenlose vorgeschichtliche Zeiten, wie die Zauberpoesie aller anderen Völker, die so alt wie der Aberglaube, so alt wie die Menschheit ist.
Der Inhalt des Atharwaweda steht, wenn wir von den theosophischen und kosmogonischen Hymnen, von den Beschwörungsliedern im Interesse der Brachmanen, von den Liedern und Sprüchen zu Opferzwecken, von den Zauberliedern für die Wohlfahrt der Könige absehen, im wesentlichen unter dem Zeichen eines durchgehenden Dualismus von weißer und schwarzer Magie. Auf der einen Seite Lieder und Sprüche zur Heilung von Krankheiten und Gebrechen und zur Bannung ihrer als Teufel und Unholde vorgestellten Erreger; Gebete um Glück in Handel, Ackerbau und Viehzucht, Krieg und Spiel, um Gesundheit, langes Leben und Nachkommenschaft, um Erfolg in der Liebe und Segen in der Ehe; Entsühnungsformeln zur Abwendung der Folgen von Sünde und Fehl usw. – auf der anderen Seite wilde Verwünschungen und rasende Verfluchungen gegen Nebenbuhler und Nebenbuhlerinnen, gegen Feinde und Schädiger aller Art, gegen Nachtgespenster, Dämonen, Zaubergeister, Teufel und Kobolde: das ist in groben Zügen der Inhalt dieses seltsamen Zauberweda, der die Äußerungen des Fühlens und Denkens unserer ältesten arischen Vorfahren aus den weltgeschichtlichen Fernen mehrerer Jahrtausende in unsere Gegenwart hinübergerettet hat. –
Ästhetisch betrachtet, bietet der Inhalt des Atharwaweda eine Reihe poetischer Schönheiten. Selbst in den alten Zauberformeln wird den Leser der Schwung ihrer Sprache, die Schönheit ihrer Bilder, die Sinnigkeit ihrer Vergleiche nicht selten überraschen. Auch der urwüchsigen Wildheit und Rassigkeit in der Sprache der Verfluchungslieder wird sich niemand verschließen können. Und manche atharwanische Hymnen, die freilich kaum zum eigentlichen Befand des Zauberkodex gehören, sondern sich irgendwoher dahinein verirrt haben müssen, bedeuten Höhepunkte wedischer Poesie, die ihresgleichen suchen. Nur zwei Hymnen – »Hymnen« im wahren Sinne des Wortes! – seien hier namhaft gemacht, womit beileibe nicht gesagt sein soll, daß sich die Reihe poetisch wertvoller Atharwanlieder nicht erheblich verlängern ließe: zunächst der Hymnus Ath. IV, 16, jene großartige, in ihrer Sprache an die Psalmen erinnernde »Anrufung Waruna's« (S. 38), von der RUDOLF ROTH, der große Bahnbrecher der Wedaforschung, gesagt hat, es gebe kein Lied in der ganzen wedischen Literatur, das die göttliche Allwissenheit so nachdrücklich ausspräche. Dann der wundervolle Hymnus Ath. XII, 1 an die Erde (S. 185 ff.), »eines der schönsten Erzeugnisse der religiösen Dichtung Altindiens«, wie WINTERNITZ dieses unsterbliche Lied mit gutem Rechte nennt.
Den Geist des eigentlichen Atharwaweda trennt von dem des Rigweda eine Welt. Mit kurzen Warten kann man diesen abgrundtiefen Gegensatz so ausdrücken: Dort, im Rigweda, herrscht Religion, hier, im Atharwaweda, Magie. Dort der gottgläubige Priester und Sänger, der seine großen Götter verehrt und sich vor ihnen beugt. Hier der selbstherrliche magische Zauberer, der mächtiger ist als selbst die wedischen Götter, die er seinen Zwecken dienstbar macht; der mit seinen allmächtigen Zauberkräutern und Zauberamuletten unvermittelt eingreift in die Räder des Weltgeschehens und es seinen Wünschen entsprechend lenkt. Dort herrliche, glaubenerfüllte Preislieder, die hier auch in ihren schönsten Stücken in das Prokrustesbett der Zauberpraxis gespannt werden. Dort die lichte Welt des wedischen Götterhimmels, hier die düstere Welt der feindlichen Mächte, der Zaubergeister und Dämonen, der Nachtmahre und Kobolde, der Incubi und Succubi, der unheimlichen Nixen und Nymphen, der Poltergeister und Teufel, die alle überraschend an die proteushaft wechselnden Wahngestalten des germanischen Volksglaubens erinnern. Und hinter all diesem abenteuerlichen Spuk, hinter all den Zauberformeln und Beschwörungen gegen diesen, ja hinter dem Selbstbewußtsein der Magier selber grinst die unheimliche Weltangst des atharwanischen Menschen. Man wird erinnert an die Zeiten der Gotik. »Überall in der Natur und in der Menschheit webt es, brütet Unheil, bohrt, zerstört, verführt: das Reich des Teufels. Es durchdringt die ganze Schöpfung; es liegt überall auf der Lauer. Ein Heer von Kobolden, Nachtfahrenden, Hexen, Werwölfen ist ringsum da und zwar in menschlicher Gestalt. Niemand weiß von dem Nächsten, ob er sich nicht den Unholden verschrieben hat. Niemand weiß von einem kaum erblühten Kinde, ob es nicht schon eine Teufelsbuhle ist. Eine entsetzliche Angst, wie vielleicht nur noch in ägyptischer Frühzeit, lastet auf den Menschen, die jeden Augenblick in den Abgrund stürzen können«: Gelten diese Worte, die OSWALD SPENGLER im zweiten Bande seines »Untergangs des Abendlandes« (S. 354) über den Teufelsglauben zur Zeit der Gotik schreibt, nicht mutatis mutandis vielleicht auch für die Welt des Atharwaweda? Auch wenn sich das Erleben des atharwanischen Menschen wohl nicht entfernt mit der ungeheuren Wucht gotischer Weltangst vergleichen läßt, wenn es leiser ist, leise wie etwa der wedische Hymnus gegenüber der rauschenden Pracht althebräischer Lyrik und den inbrünstigen Dithyramben des gotischen Mittelalters? Und erwuchs nicht letzten Grundes die ganze Zauberwelt des Atharwaweda aus derselben Wurzel, wie die dämonischen Höllenfratzen, die »steingewordene Angst« gotischer Dome?





























