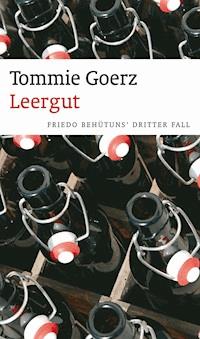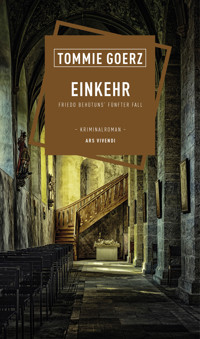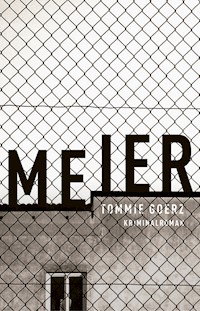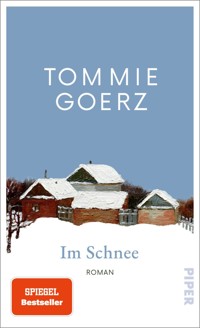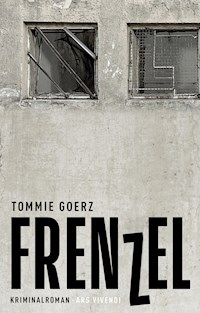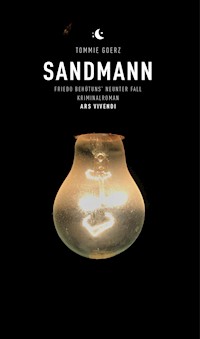Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Warum geht man in Franken "auf" den Keller? Warum wird man hier fast nie bedient? Warum sagt man fränkischen Wirten nach, sie seien oft mufflerd – und überhaupt: Warum sind die Franken so, wie sie sind? Tommie Goerz ist "Mibm Hans unterwegs" – in den Wirtshäusern, den Landschaften und auf den Kellern. Dabei schaut er den Leuten aufs Maul und tief in die Seele, setzt sich mit Stereotypen auseinander und stößt immer wieder auf Überraschendes. Auf dem Keller ist Franken, wie es riecht, schmeckt, klingt, motzt, schweigt, isst, trinkt. Eine ehrliche Liebeserklärung an diesen einzigartigen Landstrich – nicht nur in kurzen Krimis, aber immer kriminell gut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tommie Goerz
Auf dem Keller
Biergeschichten
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage April 2017)
© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © plainpicture/Christoph Eberle
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-832-9
»Wos könnersmern embfehln?«
»Der Rinderbrohdn müsserd wech. Und Brohdwöschd machn ah ned vill Ärbädd.«
Dieses Buch ist den fränkischen
Gastwirtinnen und Gastwirten gewidmet.
Wenn’s euch ned gäb ...
Inhalt
Zu diesem Buch
Verschdehsd?
Warum »auf«?
Gschbühr
Andwoddn
Oddnung
Wos griehngmern?
Es Glügg
Am Grohb
Griehng
Ahmoll bringinern nu umm
Obsdbäum
Im Kubf
Allah am Keller
Fungloch
Bfliedschn mid diggn »i«
Frohng
Schimbfm
Ohber des dauerd
Schrumblerd
Brachd werd niggs
Di Libb
Derhamm
Glüggskegs
Bleibd derhamm
Karbfm
Niened
Di Aung
Di leddsde Rundn
Wo is des Broblehm?
Midder Mudder
Ahned richdi
Kerng
Un meine Schie?
Edds is besser
Heimat, süße »Haimat«
Ah leddsdes Wodd nu
Gwelln
Textnachweis
Der Autor
Mibm Hans underwegs
Zu diesem Buch
Mit Landstrichen, ihren Bewohnern und Dialekten ist es wie mit der Liebe: Hat man jemanden ins Herz geschlossen, verzeiht man ihm einiges. Dann kann sich der oder die Geliebte ruhig einmal – und auch mehrmals – danebenbenehmen. Man wird sie oder ihn trotzdem gegen alle Kritiker in Schutz nehmen und verteidigen. Man wird Verständnis zeigen für das Handeln bzw. die Ausrutscher und Fehltritte der oder des Geliebten oder zumindest nach Gründen suchen, die sie einem verständlich machen.
Und die dann auch finden.
Garantiert.
Und dann sehr schnell darüber hinwegsehen.
So geht es dem Hans mit Franken und den Franken. Da betritt man, der Klassiker schlechthin, ein Wirtshaus – und wird erst einmal angeraunzt. Volles Brett.
»Däi Küchn hod zou.«
Oder: »Ihch sohgs der gleich: Brohdn is aus.«
Warum ist das so?
Keine Ahnung. Aber Vorsicht: Wahrscheinlich war es überhaupt kein Anraunzen, sondern man hat es nur falsch verstanden. Im Grunde war es gut gemeint, freundlich und sogar zuvorkommend. Man muss nur einmal einen Moment lang darüber nachdenken, was der Wirt mit seinem vermeintlichen Raunzer eigentlich meint. Dann versteht man es auch.
Auch, dass er gar nicht raunzt.
Oder, noch so ein Klassiker: Man setzt sich in die Gaststube und wird erst einmal minutenlang überhaupt nicht wahrgenommen.
Missachtet.
Man ist Luft.
Steht man dann auf und geht wieder? Als Fremder vielleicht, ja, aber als Franke nicht. Denn der Wirt wird schon seine Gründe dafür haben. Wahrscheinlich hat er im Moment Wichtigeres zu tun, außerdem will er sich – und das kann man doch nachvollziehen, dafür muss man Verständnis haben – nicht für jeden dahergelaufenen Gast sofort zum Knecht machen und ihn umgehend devot bedienen, bitte sehr, bitte gleich. Nein, weder »bitte« noch »gleich«, aber beides sehr.
Auf den Kellern übrigens wird man gleich gar nicht bedient. Grundsätzlich. Fertig. Da heißt es generell – nein, nicht Selbstbedienung, sondern: Selbstabholung, Buchstabe für Buchstabe schön auf Holz gemalt, wie etwa am Reifenberger Keller. Da macht man dem Gast nicht einmal bei den Begrifflichkeiten etwas vor. Bedienung? Kannst vergessen! Hol’s der selber!
Aber erleben kann man auf den Kellern viel – und wenn es nichts ist, was man erlebt. Das macht den Reiz und das Geheimnis der Keller aus. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es diese einzigartige Kultur. Einfach nur sitzen, trinken und nichts. Herrlich!
Bei diesem Sitzen auf den Kellern sowie bei Streifzügen durch die Wirtshäuser und Landstriche Frankens ist dieses Büchlein entstanden. Geschichten und Anekdoten aus Franken, die typisch sind für das Land.
Diese Geschichten übrigens haben sich alle zugetragen, nicht eine ist erfunden. Der Hans hat sie auf seinen Streifzügen entweder selbst erlebt, oder Freunde und Bekannte haben sie erlebt und ihm erzählt.
Im Grunde ist es mit diesem Büchlein wie mit dem Bier: Mit Bier kann man sich manches schöntrinken. Entsprechend lässt sich dieses Büchlein als Versuch verstehen, sich einen Landstrich mit seinen Bewohnern gnadenlos schönzuschreiben. Nicht immer ganz ernst gemeint, mit viel Lust und Liebe, voller Nachsicht und Verständnis, und immer auf der Suche nach einem möglichen Grund, warum die Franken so sind.
Und damit: Auf in die Wirtshäuser und auf die Keller!
Nicht verstehen kann man so oder so
Verschdehsd?
In Franken muss man mit dem Fränkischen halbwegs vertraut sein, sonst sitzt man schnell einmal einem Missverständnis auf, und manchmal ist man auch der Depp.
Grob geschätzt hat man es hier mit mindestens drei Arten des Nicht- oder Falschverstehens zu tun. Aus diesen muss nicht immer ein Missverständnis erwachsen, man kann ja, wenn man etwas nicht verstanden hat, ganz einfach mit einem dezenten »Hä?« noch einmal nachfragen. Dieses kleine »Hä?«, fragend und nicht aggressiv ausgesprochen, bedeutet so viel wie »Oh Verzeihung, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Könnten Sie das bitte noch einmal wiederholen?« In solchen Dingen ist das Fränkische erfrischend kurz.
Man muss dieses »Hä?« allerdings gut beherrschen und treffsicher setzen können, denn etwas länger gezogen mit zum Ende hin ansteigender Tonkurve und dadurch einem kaum hörbar aggressiven Unterton heißt dieses »Hä?« so viel wie: »Hey, habe ich gerade richtig gehört? Sag das noch einmal! Ich glaube, du tickst nicht ganz richtig! Bei dir hackt’s doch!« Es kann also bei Einsatz dieses »Hä?« aus dem Nichtverstehen sehr schnell ein Missverstandenwerden resultieren. Deshalb sollte man im Umgang mit und beim Einsatz des »Hä« sehr vorsichtig sein.
Doch zurück zu den drei eingangs erwähnten Arten des Nichtverstehens. Die erste ist die des rein akustischen Nichtverstehens. Dann hat man das Gesagte halt einfach nicht richtig gehört und fragt, wie gerade beschrieben, nach.
Dann gibt es die Art des Nichtverstehens, bei der man den Sinn nicht verstanden hat. Akustisch alles okay, aber aus der Lautfolge erschließt sich einem die Bedeutung nicht. Beispiele dafür, die gern und immer wieder genannt werden, gibt es wie Sand am Meer. Es sind Wendungen wie das berühmte »Amamalaadamala hamaadahamm«, »a ohdsullds Buddlersbah«, »Mohlodirolohroh« oder »douamolldoudi Rowäannahär, Doldi«. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass eine »Rowäanna« eine Rollwanne, also eine Schubkarre ist, ist der Hauptgrund des Nichtverstehens schon ausgeschaltet, und man begreift plötzlich, was der andere sagt und dass er dich einen Doldi geschimpft hat. Dann kann man entsprechend darauf reagieren, und was das für eine Reaktion ist, bleibt jedem selbst überlassen.
Oft kommt das Nichtverstehen, gerade bei Fremden, ja gar nicht vom Nichtverstehen der dialektspezifischen Eigenheiten und Ausdrucksweisen, sondern vielmehr daher, dass man schlicht abgelenkt ist – abgelenkt von der Faszination, mit der man den Mund des fränkisch Sprechenden beobachtet, im Speziellen die Zunge. Weil man immer das Gefühl hat, jetzt!, nein jetzt!, aber jetzt wirklich! verschluckt sich der Sprecher an dem dicken Lappen, der ihm im Mund beim Sprechen ständig irgendwie im Weg zu sein scheint, er gleichzeitig dieses Handicap aber mit erstaunlicher Leichtigkeit völlig unbeeindruckt meistert. Besonders tritt dies beim L zutage. Für diesen Buchstaben gibt es – ähnlich wie bei dem fast spanisch derb gerollten R – diverse gutturale Laute, für die unser Alphabet keinerlei Möglichkeiten der Notation bzw. Transskription bereitstellt.
Schon als Jugendlicher hatte Hans zusammen mit Freunden einmal begonnen, einen Sprachkurs fürs Fränkische zu entwerfen. Lektion eins umfasste, um den Einstieg nicht gleich zu schwer zu gestalten und die Kursteilnehmer nicht zu entmutigen, lediglich drei kurze Sätze. Zu Lektion zwei kam es dann nie.
Die drei Sätze von Lektion eins?
Ein wenig Gurke.
Ein bisschen Gelbwurst.
Ein wenig Möbelpolitur.
Aber auf Fränkisch.
Awengan Gurgne – das lässt sich nicht notieren. Brutalstmöglich gerolltes »r«, und das »gngne« nahtlos im Übergang vom »r« leicht guttural hinten am Gaumen oben hauchartig angeschnalzt – man muss das hören, es lässt sich nicht beschreiben.
Egal.
Awenga Gellbwoschd – der Franke weiß, wo beim »ll« die Zunge zu sein hat und wie zart und liebevoll-locker das »woschd« daherkommen muss.
Awengan Gurgne.
Awenga Gellbwoschd.
Und dann: Awenga Möhblbolliduhr – das ist dann schon sehr hohe Kunst für die Zunge. Vom ersten »b«, gesprochen am äußersten Rand der Lippen nahtlos nach vorne aufs »l« beinahe schon jenseits der Lippen, fast im freien Raum, aber trotzdem ganz leicht, wie aufblubbernd, gesprochen, die Zunge am Rand der Kontrolle, und sofort wieder zurück zum »b«. Und mit den tiefen Umlauten bzw. Vokalen »ö«, »o« und »u« dabei immer schön unterkühlt im Keller bleiben – daran müssen manche über Jahre üben. Der Franke kann das sogar schon mit dem Schnuller im Mund. Aber es kommt nicht von der Muttermilch.
Und dann gibt es noch die Art des Miss- bzw. Nichtverstehens, die eigentlich ein komplettes Falschverstehen ist. Das Beispiel, das Hans hierzu schon seit Jahren immer und immer wieder anführt, ist folgendes – und bedient, kaum vermeidbar, auch gleich wieder ein altes Klischee. Doch der Reihe nach.
Hans war, wie so oft, doch die Begebenheit ist jetzt auch schon wieder Jahre her, es war im späten Herbst, in der Fränkischen Schweiz unterwegs. Auf der Nordseite des Berges Hetzles. Von Gaiganz aus war er losgelaufen und kam nach Ermreus, ein kleines Kaff auf dem Weg hinüber nach Weingarts. Eines der wohl knapp zwanzig Häuser von Ermreus ist das Gasthaus Zum Bernd von Bernhard Distler. Seit Langem schon hatte Hans vor, dieses Gasthaus einmal zu besuchen. Doch jedes Mal, wenn er daran vorbeikam, war es entweder Sonntagmittag, und es standen schon so viele Autos davor, dass es sich von selbst erübrigte, überhaupt hineinzusehen.
Oder aber das Gasthaus war zu.
Diesmal aber standen dort lediglich zwei, drei Autos, es war an einem Wochentag, und er vernahm, noch draußen vor dem Gasthaus stehend, diverse Stimmen aus der Gaststube; auch klapperten Bestecke, Teller, Gläser. Auf jeden Fall: Es klang sehr einladend. Also beschloss Hans umgehend, einzutreten. Er klopfte sich die Schuhe draußen ab, denn er wusste, wie gerne es die Wirte sahen, wenn man mit Lehmklumpen an den Füßen in die Gaststube kam, ergriff die Klinke, drückte sie herunter, öffnete die Tür und setzte gerade den Fuß auf die Türschwelle, da ging am anderen Ende des Ganges hinten die Türe – die Tür ins Allerheiligste, die Gaststube – auf, eine Person, mit Sicherheit der Wirt, trat in den Rahmen, sah ihn kurz an und sagte: »Zeann Essn hammer fei niggs.«
Peng.
Kein Lächeln, kein »Grüß Godd«, im Gegenteil: Abweisung pur.
Fränkische Grantigkeit? Typisches Wirtsverhalten, wie es in Klischees immer und immer wieder bemüht wird? Klassisch mufflerde Unfreundlichkeit von Wirten, die den Gast nur als Belästigung empfinden – und das dem Gast gegenüber auch ungebremst, ja beinahe wollüstig, zeigen?
Weit gefehlt.
Sehr weit gefehlt!
Und das ist genau die dritte Art des Miss- bzw. Nichtverstehens. Wenn man den Wirt bei Ton und Wortbedeutung nimmt, dann hat man unweigerlich das Gefühl: »Der schmeißt mich raus«, er gibt mir ohne jede Blume zu verstehen: »Hau du bloß ab!«
»Zeann Essn hammer fei niggs.«
Was kann man hier denn missverstehen?
Das ist genau der Punkt, an dem Fränkische Kunst beginnt. Nur einmal ganz einfach und logisch gedacht:
Hier ist ein Wirt.
Wovon lebt der?
Von seinen Gästen.
Und die beißt er weg?
Wo ist da der Sinn?
Es gibt keinen – es macht keinen.
Jeder Wirt, der seine Gäste so behandelte, wäre ein Depp. Und binnen Monatsfrist auch pleite. Das ist logisch.
Was aber sagt einem der Wirt dann mit seinem »Zeann Essn hammer fei niggs«?
Im Grunde ist es ganz einfach, denn dieser Wirt ist ja nicht dumm. Keiner der Wirte im Fränkischen ist das.
Dieses direkte »Zeann Essn hammer fei niggs« ist, bei Licht betrachtet, Bedienung und Service in Reinkultur. Es ist zuvorkommend, zu hundert Prozent im Interesse des Gastes und macht dem Gast das Leben leicht. Oder leichter, zumindest für diesen Moment.
Denn der Hans war nicht der erste Gast, der im Leben dieses Wirtes das Wirtshaus betrat.
Und was macht ein Gast, wenn er im Spätherbst oder Winter in ein Wirtshaus kommt?
Er kommt herein.
Er sieht sich um.
Er nickt vielleicht den Männern zu, die am Stammtisch sitzen – und dann beschlägt schon seine Brille.
Er zieht die Handschuhe aus und stopft sie umständlich in die Jackentasche. Wo sie nicht richtig hineinpassen wollen. Vielleicht fällt sogar einer zu Boden.
Er nimmt die Brille ab und sucht nach einem Tuch.
Tastet umständlich mit seinen durchgefrorenen Fingern danach.
Er wischt die Brille ab, putzt sie und setzt sie wieder auf.
Er sieht sich wieder um und sucht nach einem Platz.
Schaut, wer so alles da ist.
Er nimmt die Mütze ab.
Er öffnet seine Jacke und pellt sich aus ihr heraus.
Er rollt den Schal, der noch um seinen Hals liegt, ab.
Er stopft die Mütze und den Schal in einen Ärmel seiner Jacke, halb blind, denn inzwischen ist die Brille längst wieder beschlagen.
Er putzt sie wieder.
Umständlich, unbeholfen, die Finger kalt.
Dann endlich – …
Nein, erst sucht er noch die Garderobe und hängt seine Jacke auf. Dann endlich nimmt er Platz.
Und wartet.
Er sieht sich um.
Die Brille beschlägt schon wieder …
Am Stammtisch schweigen die Männer.
Er wartet weiter.
Wartet.
Wartet.
Dann kommt der Wirt, stellt sich an seinen Tisch, und endlich hat der Gast Gelegenheit, etwas zu fragen.
»Gibds was zum Essn?«
Oder »Habdera Schbeisekaddn?«
Und erst jetzt kann der Wirt ihn davon in Kenntnis setzen, dass die Küche geschlossen ist.
Das alles kann er doch dem Gast ersparen. Und tut er auch.
Mit diesem Satz: »Zeann Essn hammer fei niggs.«
Sofort ausgesprochen, ehrlich, glasklar und direkt. Der Wirt mit seiner jahre-, wahrscheinlich oft jahrzehntelangen Erfahrung sieht es seinen Gästen doch auf den ersten Blick an, ob sie zum Essen oder nur zum Trinken kommen. Das muss man ihm schon zugestehen.
So.
Und wenn er nun dem Gast die für dessen Bedürfnislage wichtigste und zentrale Information umgehend und von Anfang an zur Verfügung stellt – wie kann er sich denn im Interesse des Gastes besser verhalten als so?
»Zeann Essn hammer fei niggs.«
Hans ist ja schon seit Langem davon überzeugt, dass das Klischee der Grantigkeit sich seit jeher nur aus solchen Missverständnissen speist. Denn vielfach wird die Offenheit und Direktheit der Wirte im Sinne des Gastes genau von jenem fehlgedeutet und somit nicht verstanden. Und so entstehen dann Legenden.
Aufn Keller
Unter Verwendung einer Passage aus dem Bierkrimi Leergut
Warum »auf«?
Bierkeller in Franken befinden sich vielfach außerhalb der Ortschaften, oft sogar weiter draußen und an Stellen, an denen man sie nicht vermutet. Nicht selten an einem Berghang, unter alten Bäumen und mit weiter Sicht ins Tal.
Hier kann man im Sommer herrlich sitzen und seine Gedanken weit treiben lassen, man denke nur an den Reifenbergkeller, den Schwarzen Keller oder den Senftenbergkeller, um nur drei zu nennen.
Warum die Keller oftmals weiter draußen und auch an Hängen gelegen sind, das hat dem Hans einmal der Inhaber vom Schwarzen Keller erzählt, der Brauer, Wirt und Biersommelier Stefan Pfister aus Weigelshofen. Denn der Schwarze Keller der Pfisters ist gut und gerne zehn Minuten zu Fuß von Ort und Brauerei entfernt. Bergauf.
Sie, also seine Vorfahren, hätten früher mehrere Keller gegraben, in den Sandstein hinein, hatte der Pfister erzählt, doch für das Bier sei es dort im Sommer immer zu warm gewesen. Warum? Weil diese Keller letztlich nur Löcher gewesen seien, irgendwo planlos hineingetrieben. Für den richtigen Standort eines Kellers aber müsse man sich ein wenig mit der örtlichen Geologie befassen – und das hat jetzt wieder speziell etwas mit Franken zu tun. Denn hier, zumindest in der Fränkischen Schweiz, besteht der Untergrund zu einem Teil aus dicken Schichten Sandstein, das ist vor Jahrmillionen irgendwann einmal abgelagerter Schwemmsand, und darauf einer dicken Schicht Muschelkalk, also Sediment, das auf den Grund des Meeres, welches hier einmal war, hinabgesunken ist, sich dort viele, viele Meter aufgetürmt hat und zu Fels geworden ist. Solche Kalkfelsen treten überall in der Fränkischen Schweiz hervor.
Der Kalk hat die Eigenschaft, dass er relativ leicht Wasser durchlässt. Er wird im Lauf der Zeit auch ausgeschwemmt, und es bilden sich Höhlen, von denen es in der Fränkischen Schweiz ja genügend gibt. Oder es entstehen unterirdische Wasserläufe, die, wenn sie zu voll sind, auch zeitweise als Quellen sprudeln, Tümmler genannt, wie etwa im Leinleitertal, in Dürrbrunn oder bei den zahlreichen unterirdischen Zuflüssen der Wiesent. Deshalb ist diese auch so kalt.
Um nun aber den richtigen Standort für einen Keller zu finden, muss man wissen, wo die Grenze zwischen diesen beiden Schichten verläuft – also die zwischen dem Kalk und dem Sandstein. Und dann muss man sich knapp unterhalb der Kalkschicht in den Sandstein graben. Das sind die besten Standorte.
Warum?
Weil das Wasser, das durch den Kalkstein sickert, dann die oberste Schicht des Sandsteins sommers wie winters schön feucht hält. Nur so bleibt der Keller auch im heißesten Hochsommer angenehm und gleichmäßig kühl und heizt sich nicht auf. Das klassische Kühlprinzip ständiger Verdunstung – und der eigentliche Grund dafür, warum sich die meisten Keller irgendwo am Hang befinden. Deshalb sind das dann fast immer auch die schönsten.
Einmal war der Hans bei seinem Schwager im Württembergischen. Der hat dort ein Wirtshaus, und in dem saßen sie am Nachmittag und plauderten. Da kam ein Freund des Schwagers, setzte sich mit an den Tisch und merkte sehr schnell, dass der Hans aus Franken kam. Wahrscheinlich an der Zunge im Mund. Und des Schwagers Freund erzählte, dass er mit Bekannten einmal von Stuttgart nach Bayreuth mit dem Rad gefahren sei – und dass es in Franken so etwas Gutes zum Essen gegeben habe, »Presssack« genannt. Und dass es dort auch so eine komische Redensart gegeben habe, nämlich »auf den Keller« zu gehen und nicht »zum Keller«, was ja eigentlich logischer wäre.
Vielleicht, hat sich der Hans gedacht, nachdem er das mit dem richtigen Kellerstandort alles vom Pfister erfahren hatte, liegt das ja daran, dass die Keller aus besagten Gründen meistens irgendwo am Hang lagen und man also immer zu ihnen hinaufmusste. Deshalb ging man »auf den Keller«.
Auf der anderen Seite, überlegte er sich, und das sprach wiederum dagegen, sagte man ja auch, »Ihch geh auf Bamberch«, genauso wie »Ihch geh auf Nämberch«, »Ihch fohr auf Bairaid«, oder »auf Rehngsburch«, »auf Windsbach« oder sonstwohin, egal, ob diese Orte vom momentanen Standort aus gesehen oben oder unten, höher oder tiefer, lagen. Also hatte das »auf« vielleicht doch nichts mit einem eventuellen Hinaufgehen zu tun? Dafür sprach auch, dass man den Sätzen mit »auf«, also zum Beispiel dem »Ihch geh auf Nämberch«, meistens noch, je nachdem, wo man sich geografisch gerade befand, ein »nauf«, »nüber«, »nunder« oder »ninder« bzw. »rinder« anfügte. Mehr Richtungen gibt es nicht, nur andere Worte dafür, das ist eine Geschichte, die auf Hans’ Sohn zurückgeht, der, beim Autofahren aus seinem Kindersitz heraus die Welt erforschend, naiv nach vorne gefragt hatte: »Papa, gibt es auch andere Kurven als sorum und sorum?« Doch sei’s drum. Wahrscheinlich heißt dieses »auf« nichts weiter als »hin« oder »zu«.
Ein Erklärungsversuch für dieses »auf« findet sich auch im Kriminalroman Leergut, derin Franken spielt. Der Kommissar in diesem Krimi, der Nürnberger Friedo Behütuns, hat gerade eine schwere Zeit hinter sich, denn er verzichtet seit Wochen auf sein geliebtes Bier. Diätetisch, also bauchbedingt. Doch jede Tortur hat ein Ende, und das Ende der bierfreien Zeit naht, denn draußen wird es langsam Frühling, es wird wärmer, und der Kommissar hat sich vorgenommen, auf einen Keller zu fahren, sobald es die Temperaturen wieder erlauben. Bei dieser Gelegenheit will er der Bremer Praktikantin Cela Paulsen einmal einen schönen Keller und vor allem die fränkische Kellerkultur zeigen. Im Krimi klingt das dann so:
•••
Die Sonne schien schon den dritten Tag hintereinander, und die Temperaturen stiegen auf mehr als zehn Grad, für heute waren sechzehn angesagt, und morgen sollten es sogar bis zu achtzehn Grad sein.
»Und dann mache ich meine Drohung wahr«, hatte er gestern schon angekündigt, »und gehe auf einen Bierkeller.«
»Wenn es draußen so warm ist«, hatte Cela Paulsen gefragt, »warum gehst du dann nicht in die Sonne?«
Behütuns hatte sie verständnislos angeschaut.
»Das tu ich doch.«
»Aber in einen Keller? Da ist es doch kalt, brrr«, und sie schüttelte sich.
»Ich geh doch in keinen Keller. Wer erzählt denn so etwas?«
»Du selber, gerade erst hast du es gesagt.«
Jetzt schwante dem Kommissar, wo das Problem lag – da musste man erst einmal drauf kommen. Er schüttelte den Kopf und grinste.
»Ich gehe nicht in einen Keller, sondern auf einen Keller.«
Das leuchtete Cela Paulsen nicht ein – kein Wunder, sie kam ja aus dem hohen Norden, und dass es in Bremen Bierkeller gibt, davon hatte Behütuns noch nichts gehört. Also musste er es ihr erklären. Nur – wie weit sollte er dazu zurückgehen? Sie sollte es ja richtig verstehen. Und ein lapidares »Das sagt man so« war ihm nicht genug.
»Also pass auf, Cela«, begann er seine Ausführungen. »Wenn du hier einmal hinausfährst aufs Land, also ins Fränkische, ganz egal in welche Richtung, dann findest du, meist außerhalb der Orte, immer wieder solche alten Kellereingänge. Meistens irgendwo am Weg und fast immer dort, wo der Sandstein ist. Weil in den kann man sich relativ leicht eingraben.«
»So etwas gibt es bei uns auch«, unterbrach ihn Cela Paulsen, »da haben früher die Bauern ihre Rüben drinnen gelagert, auch Kartoffeln und so. Weil es dort keinen Frost gab.«
»Das ist im Prinzip schon richtig«, stimmte Behütuns ihr zu und lobte sie fast wie eine Schülerin. »Hier aber hat man viele Keller dazu benutzt, auch Bier zu brauen.«
»Aber zum Gären muss es doch warm sein, denke ich«, stellte Cela Paulsen statt einer Frage fest. »In einem Keller aber ist es kalt. Da gärt doch nichts.« Man merkte, sie glaubte ihm kein Wort.
»Schon richtig gedacht«, lobte Behütuns sie wieder und spürte, dass, je näher er mit seinen Gedanken dem Bier kam, seine Lust auf dieses Getränk merklich zunahm. Schönes Gefühl, das würde er noch ein wenig auskosten!
»Im Prinzip ist das richtig. Es gibt obergäriges Bier, das reift in der Wärme. Aber es gibt auch untergäriges Bier – und das reift in den Kellern. Also dort, wo es kühl ist. Es dauert halt nur etwas länger.«
Davon hatte Cela Paulsen noch nie etwas gehört.
»So«, erklärte Behütuns und setzte seinen Kellergrundkurs fort, »und jetzt hatten die Bauern ihr Bier gebraut, oft auch im Winter, also untergäriges, und im Frühling war das dann fertig. Meistens im März, deshalb heißt das auch Märzen.«
Das hatte er jetzt alles einfach einmal so gesagt, er wusste gar nicht, ob das so stimmte. Aber jemandem aus Bremen kannst du das schon mal erzählen, dachte er sich, und hoffentlich fällt mir Dick nicht ins Wort. Aber der machte keine Einwände. Wahrscheinlich hatte er auch keine Ahnung.
»Das Bier gab es dann im März, im April, im Mai, bis es halt alle war. Das haben sich die Leute dann abends aus dem Keller geholt und in Kannen oder Krügen heimgeschleppt, um es zu trinken.«
Er spürte förmlich schon den Geschmack.
»Die meisten aber haben es wohl nicht erwarten können, bis sie mit dem Bier daheim waren, also haben sie schon mal am Keller ein paar Schluck genommen. Dazu hat man sich eine einfache Bank und einen Tisch hingebaut, aus Brettern, weil sich’s im Sitzen schöner trinkt. Dann kamen die Nachbarn mit dazu, dann hat die Bank nicht mehr gereicht, und man hat eine zweite dazu gebaut, noch einen Tisch …«
Wo hatte er diese Geschichte eigentlich her? Die war doch jetzt glatt erfunden. Das klang ja wie ein Janosch-Märchen. Hatte er sich einfach so einfallen lassen. Märchenstunde über Bierkeller – aber Cela Paulsen hörte interessiert zu. Dann lüg ich ihr halt noch ein bisschen Heimatkunde vor, dachte sich Behütuns belustigt und ließ seiner Fantasie freien Lauf.
»… und so ist die Kellerkultur entstanden. Man hat sich das Bier nicht mehr nach Hause geholt, sondern ist zum Bier hingegangen, also dorthin, wo es gebraut wurde. Hat sich da auf die Bänke gesetzt, vielleicht schön unter Bäumen oder davor in die Sonne, auf jeden Fall schön in der Natur, hat sich eine Brotzeit mitgebracht, Stadtwurst, Presssack, Gurke, Rettich, Brot und so und hat sich dann da betrunken.«
Herrliche Vorstellung, durchströmte es Behütuns. Morgen würde er auf einen Keller gehen.
»Aber dann geht man doch zum Keller, nicht auf den Keller, oder?«
Stimmt, das mit dem auf hatte er mit der Geschichte noch nicht beantwortet. Aber sonst war die doch schön, oder? Reichte das denn nicht aus? Jetzt hatte er keine Wahl mehr, jetzt musste er es doch sagen:
»Na ja, das sagt man halt so«, versuchte er den Einwand wegzuwischen. »Dialekt halt. Man geht auf den Keller. Nicht in den Keller oder zum.«
»Vielleicht hat man ja auch obendrauf gesessen«, versuchte es Cela Paulsen. »Über dem Keller.«
»Vielleicht«, gab ihr Behütuns weder recht noch unrecht.
»Warst du eigentlich schon einmal auf einem Keller?«, fragte er sie.
»Du meinst hier, in Franken? Nein. Bis jetzt war ja hier nur Winter.«
»Gut!«, sagte Behütuns, »sehr gut! Dann nehm ich dich morgen mal mit. Ich überleg mir noch einen schönen Keller, und dann fahren wir nachmittags da hin.«
»Da bin ich aber gespannt«, sagte Cela Paulsen zu, »aber gibt es das heute nicht mehr so mit den Kellern?«
»Dass die Leute dort selber brauen?«, fragte Behütuns zurück.
»Ja, so wie früher, so wie du das erzählt hast.«
Das Thema schien Cela Paulsen doch zu interessieren. Behütuns schmeckte schon das erste Bier so richtig wieder auf der Zunge, auch am Gaumen, spürte es schon in den Magen hinunterlaufen. Allein schon die Vorstellung des Geruchs … und erst die Farbe!
»Wenn du in die Gegend von Neustadt fährst, also von hier so grob nach Westen, Neustadt an der Aisch, und wenn du dann Glück hast in irgendeinem Kaff abseits der Straße, dann kannst du das noch erleben.« Da hatte er das manchmal noch gesehen, dass die Bauern vor einem Keller saßen. War aber auch schon Jahre her.
»Ja, oder in Seßlach, droben bei Coburg«, wusste jetzt Dick zu berichten, »die haben noch ein richtiges Kommunbrauhaus.«
»Was ist das denn nun wieder?«
»Also erst einmal Seßlach, das ist so eine richtig kleine alte Stadt, noch mit Stadtmauer und so, ganz außen herum, wo sie abends die Stadttore zumachen …«
»Jetzt lügst du mich aber an!« Cela lachte und schüttelte den Kopf. »Ich glaub dir kein Wort!«
»Ungelogen, das ist so. Abends machen sie die Stadttore zu, dass keine Autos mehr durchfahren. Weil das Kopfsteinpflaster so laut ist. Und dort haben sie noch ein Kommunbrauhaus, das gehört der Stadt, also den Bürgern, da brauen sie öffentlich ihr Bier, und dann kommen die Einwohner mit Kanistern und Fässern und holen sich das ab. Füllen das so richtig ab, mit Schläuchen.«
»Käse.« Cela Paulsen glaubte ihm nicht.
»Das ist halt noch Kultur«, sagte Behütuns, »nicht diese Becks-Plörre und was ihr da so habt im Norden. Industriebier, pläh!«
»Und aus dem Wirtshaus am Platz holen sich die Leute zum Mittagessen oder für den Abend noch eine Kanne Bier für zu Hause. Mit der leeren Kanne hin, mit der vollen zurück. Habe ich selbst gesehen.«
Jetzt schien Cela Paulsen doch ein wenig verunsichert.
Dick setzte noch eins drauf: »Und vom Kommunbrauhaus gibt es eine Leitung direkt ins Wirtshaus. Ein Rohr … eine Pipeline.«
»Ja, ja. Jetzt ist es dann genug. Ich glaube euch kein Wort.«
Cela Paulsen war wirklich ungläubig.
»Lügen wir?«, fragte Peter Dick zurück. »Sehen wir wohl so aus?«
»Du musst ja nur rüber in die Oberpfalz, gleich hinter Hersbruck. Da gibt’s auch noch so etwas ähnliches: Zoigl.«
»Was ist das denn jetzt schon wieder?«
Cela Paulsen kannte sich überhaupt nicht mehr aus.
»Zoigl ist ganz einfach«, erklärte Kommissar Behütuns und spielte den Oberlehrer, »da haben in einem Ort verschiedene Häuser ein Braurecht, die dürfen da Bier brauen. Und das geht immer reihum.«
»Jetzt veräppelt ihr mich aber wirklich, oder?«
»Nein, das ist wirklich so. Das eine Haus braut sein Bier, eine bestimmte Menge. Das wird dann ausgeschenkt. Und dann kommen reihum die anderen dran, bis man selber wieder brauen darf.«
»Aber ohne Bier geht hier wohl nichts?« Cela Paulsen schüttelte den Kopf und lachte.
»Ohne Bierkultur!«, verbesserte Behütuns.
Mit solchen Gesprächen verplätscherten sie den Vormittag. Die Sonne schien zum Fenster herein, die Welt war schön, und sie fühlten sich sehr gelöst. Auch der Fall war so weit gelöst, die paar Kleinigkeiten, die noch nicht stimmten, würden sich schon richten.
•••
So weit der – zugegebenermaßen letztlich ins Leere gelaufene – Erklärungsversuch zu der Frage, warum man in Franken »auf« den Keller geht. Aber man muss auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben, Hauptsache, es gibt noch genügend schöne Keller, auf die man gehen kann.
Im Wirtshaus
Gschbühr