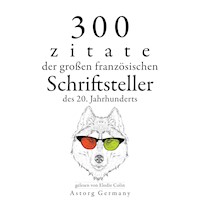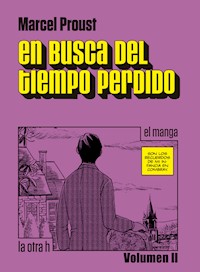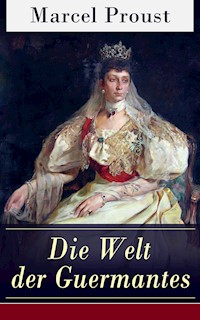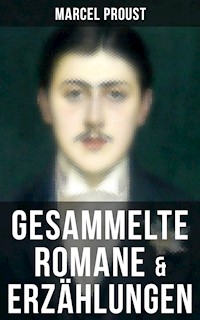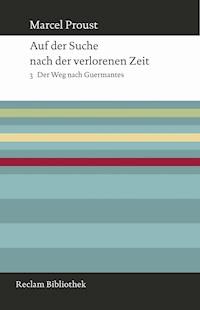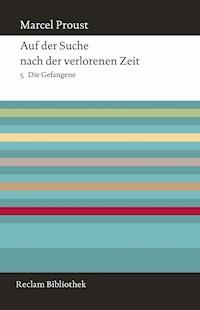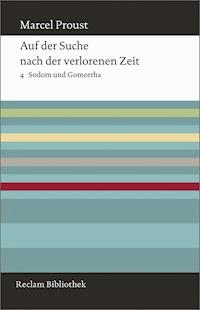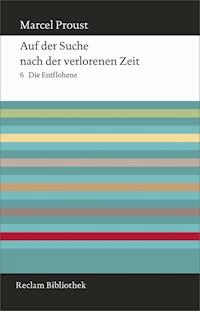23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Proust folgt den Wegen und Irrwegen des schwärmerisch verliebten und gesellschaftlich ambitiösen Romanhelden durch die Salons des Faubourg Saint-Germain und spürt sozusagen am eigenen Leib, daß es sich um vertane, vertrödelte Zeit handelt. Allerdings nicht für den Leser, bilden diese unnützen Jahre doch die eigentliche Substanz des Romans: raffinierte Schilderungen der mondänen Welt; satirische Charakterporträts von den Größen der adligen Gesellschaft; psychologische, soziologische und politische Betrachtungen – und dazu zwei Themen, deren Bedeutung weit über den engeren Kontext hinausreicht: der Tod der Großmutter und die vorerst nur andeutungsweise bezeichnete Homosexualität."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1410
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Marcel Proust
Guermantes Auf der Suche nach der verlorenen Zeit Band 3
Suhrkamp
Léon Daudet gewidmet
Dem Autor
von Le voyage de Shakespeare,
von Le partage de l’enfant,
von L’astre noir,
von Fantômes et vivants,
von Le monde des images,
von so manchem Meisterwerk.
Dem unvergleichlichen Freund
als Zeichen der Dankbarkeit und Bewunderung.1
M. P.
I
Das morgendliche Vogelgezwitscher kam Françoise fade vor.1 Jedes Wort der »Mädchen« ließ sie auffahren; ihr Hinundherlaufen ging ihr auf die Nerven, und sie fragte sich, was sie bloß treiben. Wir waren nämlich umgezogen. Gewiß hatten sich die Dienstboten im »Sechsten« unseres alten Wohnhauses nicht weniger geräuschvoll aufgeführt, doch die kannte sie; mit ihrem Kommen und Gehen hatte sie Freundschaft geschlossen. Jetzt begegnete sie sogar der Stille mit quälender Aufmerksamkeit. Und weil unser neues Viertel ebenso ruhig zu sein schien, wie der Boulevard, an dem wir vordem wohnten, lärmig gewesen war, trieb das Lied eines Vorübergehenden (deutlich hörbar selbst von ferne, wenn es leise klingt wie ein Orchestermotiv) Tränen in die Augen der aus ihrer Heimat vertriebenen Françoise. Während ich mich über sie lustig gemacht hatte, wie sie, untröstlich darüber, ein Haus verlassen zu müssen, in dem wir allgemein »von überallher so hochgeschätzt« waren, weinend ihre Koffer packte, den Riten von Combray folgend und unter Beteuerungen, das unsrige sei allen denkbaren sonstigen Häusern weit überlegen gewesen, kam ich, der ich mir ebenso schwer neue Dinge aneignete, wie es mir leichtfiel, alte aufzugeben, jetzt unserer bejahrten Bediensteten wieder näher, als ich sah, daß der Einzug in ein Haus, wo sie vom Concierge, der uns noch nicht kannte, die für ihre gesunde seelische Ernährung benötigten Achtungsbezeigungen nicht bekommen hatte, sie in einen Zustand fast der Verkümmerung versetzt hatte. Sie allein konnte mich verstehen; ihr Laufbursche sicherlich nicht; für ihn, der so wenig aus Combray war, wie man es überhaupt nur sein konnte, kam der Umzug in ein anderes Viertel einer Art von Urlaub gleich, bei dem die Neuheit der Dinge ebensoviel Erholung bot wie eine Reise; er glaubte sich auf dem Lande; ein Schnupfen verschaffte ihm noch dazu – als habe er etwa durch ein schlecht schließendes Fenster in der Eisenbahn »etwas eingefangen« – das köstliche Gefühl, er sei weit in der Welt herumgekommen; bei jedem Nieser beglückwünschte er sich, eine so schicke Stelle gefunden zu haben, denn von jeher hatte er sich eine Herrschaft gewünscht, die viel auf Reisen geht. Ohne einen Gedanken an ihn zu verschwenden, wandte ich mich daher direkt an Françoise; genauso wie ich über ihre Tränen bei einem Abschied gelacht hatte, der mich ungerührt ließ, zeigte sie sich eiskalt angesichts meiner Traurigkeit, denn sie teilte sie. Mit der angeblichen »Sensibilität« der Nervösen nimmt ihr Egoismus zu; sie ertragen bei den anderen das Zurschaustellen eines Unbehagens nicht, dem sie bei sich selbst in ständig zunehmendem Maße Beachtung schenken. Françoise, die nicht die allerkleinste derartige Regung bei sich unterdrückte, wandte den Kopf ab, wenn ich litt, um mir nicht die Genugtuung zu geben, mein Leiden beklagt oder auch nur bemerkt zu sehen. Ebenso machte sie es, sobald ich mit ihr über unser neues Heim reden wollte. Als sie im übrigen nach zwei Tagen ein paar Kleidungsstücke holen mußte, die in dem alten zurückgeblieben waren, kam sie – während ich infolge des Umzugs noch »Temperatur« hatte und ähnlich einer Boa, die einen Ochsen verschluckt hat, mich wegen einer langen Truhe, die ich erst »verdauen« mußte, schmerzhaft aufgebläht fühlte – zurück und tat mit weiblicher Treulosigkeit kund, daß sie gemeint habe, auf unserem alten Boulevard ersticken zu müssen, daß sie sich auf dem Weg dorthin ganz »verfahren« vorgekommen sei, daß sie niemals so unbequeme Treppen gesehen habe, daß sie nicht »für ein Königreich« und wenn man ihr Millionen böte – lauter ganz grundlose Annahmen – dorthin zurückkehren würde und daß alles (das heißt das, was die Küche und die Korridore anging) in unserem neuen Heim viel besser »angeordnet« sei. Nun ist es wohl an der Zeit zu sagen, daß dieses – wir waren hierher gezogen, weil es meiner Großmutter nicht besonders gut ging (ein Grund, den ihr gegenüber zu nennen wir uns gehütet hatten) und sie bessere Luft benötigte – eine Wohnung war, die zum Stadtpalais der Guermantes gehörte.
In dem Alter, da die Namen1 uns das Bild des Unergründbaren zeigen, das wir selbst in sie hineingelegt haben, zu demselben Zeitpunkt, da sie für uns auch einen wirklichen Ort benennen und uns demnach zwingen, das eine mit dem anderen in einem Maße gleichzusetzen, daß wir aufbrechen, um in einer Stadt nach einer Seele zu suchen, die sie nicht enthalten kann, die aus ihrem Namen zu vertreiben wir aber auch nicht mehr die Macht haben, verleihen sie nicht nur Städten und Flüssen eine Individualität, wie allegorische Bilder es tun, färben sie auf mannigfaltige Weise und bevölkern mit Wunderbarem nicht nur das physische Universum, sondern auch das soziale: jedes Schloß, jedes berühmte Stadthaus oder Palais besitzt dann seine Dame oder seine Fee, wie die Wälder ihre Schutzgeister und die Gewässer ihre Gottheiten haben. Manchmal, verborgen in der Tiefe ihres Namens, verwandelt sich die Fee je nach den Launen unserer Phantasie, die sie am Leben erhält; als nämlich die Atmosphäre, in der Madame de Guermantes in meinem Inneren existierte – Jahre über bloß Widerschein eines Laterna-magica-Glases oder eines Kirchenfensters – ihre Farben zu verlieren begann, da durchtränkten sie mit einem Mal ganz anders geartete Träume mit der schäumenden Nässe von Wildbächen.
Die Fee aber verkümmert, wenn wir mit der wirklichen Person, der ihr Name entspricht, in Berührung kommen, denn der Name beginnt nun, die Person widerzuspiegeln, der aber nichts von der Fee innewohnt; die Fee kann wieder aufleben, wenn wir zu der Person Abstand gewonnen haben; bleiben wir ihr aber nahe, so stirbt die Fee endgültig und mit ihr der Name, wie es dem Hause Lusignan erging, das an dem Tag erlöschen sollte, da die Fee Melusine1 entschwände. Dann ist der Name, unter dessen sukzessiven Übermalungen wir doch am Ursprung das schöne Porträt einer nie gekannten Fremden wiederfinden könnten, deren Bekanntschaft wir nie gemacht, nur noch der mit einer Photographie versehene Personalausweis, aufgrund dessen wir wissen, ob wir eine vorübergehende Person kennen, ob wir sie zu grüßen haben oder nicht. Sobald aber eine Empfindung aus vergangenen Jahren es unserem Gedächtnis möglich macht – wie jene Musikapparate, die Ton und Stil der darauf spielenden Künstler aufzeichnen und konservieren –, uns den Namen mit der ganz eigenen Klangfarbe vorzuspielen, die er damals für unser Ohr besaß, und dazu den scheinbar unverwandelten, wie er uns heute klingt, spüren wir, welche Entfernung zwischen den einzelnen Träumen liegt, die seine immergleichen Silben im Lauf der Zeit für uns bedeutet haben. Einen Augenblick lang können wir seinem wiederaufklingenden Blätterwerk2 aus einstigen Lenzen wie kleinen Farbtuben die genaue, vergessene, geheimnisvolle und frisch gebliebene Tönung der Tage entnehmen, an die wir uns zu erinnern glaubten, während wir, wie schlechte Maler, unserer gesamten, auf derselben Leinwand ausgespannten Vergangenheit die konventionellen und immergleichen Farbtöne der willentlichen Erinnerung auftrugen. In Wirklichkeit aber verwendete jeder einzelne der Augenblicke, aus denen die Vergangenheit besteht, um etwas Einzigartiges von unverwechselbarer Harmonie zu erschaffen, die Farben von damals, die wir nicht mehr kennen, die mich aber, um bei unserem Beispiel zu bleiben, immer noch plötzlich entzücken, wenn durch irgendeinen Zufall der Name Guermantes nach so vielen Jahren eine Sekunde lang den von dem heutigen so ganz verschiedenen Klang wieder annimmt, den er für mich am Hochzeitstag von Mademoiselle Percepied besaß, und ich jenen weichen, allzu lebhaft und neu glänzenden Mauveton wieder vor mir sehe, der die sich bauschende Krawatte der jungen Herzogin mit seinem Samt überzog, und zugleich, wie eine wiederaufblühende, unpflückbare Sinngrünblüte, ihre mit einem blauen Lächeln durchsonnten Augen. Der Name Guermantes von damals ist aber auch wie einer jener kleinen Ballons, in die man Sauerstoff oder ein anderes Gas eingeschlossen hat: bringe ich ihn zum Platzen und lasse herausströmen, was er enthält, so atme ich die Luft von Combray in jenem bestimmten Jahr, an jenem bestimmten Tag, durchflutet von Weißdornduft, den der Wind über den Platz trug, Vorbote des Regens, wenn er abwechselnd die Sonne verscheuchte oder ihr erlaubte, sich über den roten Wollteppich in der Sakristei zu breiten und ihn mit einem glänzenden, in Geranientönen fast rosa schimmernden Inkarnat sowie mit jener im freudigen Hochgefühl sozusagen wagnerschen Süße zu überziehen, die dem Feierlichen so viel Adel bewahrt.1 Doch selbst wenn außerhalb solcher seltenen Minuten, in denen wir plötzlich spüren, wie die ursprüngliche Wesenheit erbebt, wie sie inmitten der jetzt toten Silben wieder ihre Form und ihre Ziselierung gewinnt, die Namen im schwindelerregenden Wirbel des täglichen Lebens, in dem sie nur noch eine rein praktische Verwendung finden, jede Farbe verloren haben wie die Regenbogenfarben eines Kreisels, der sich zu schnell dreht und dadurch grau erscheint, so treten uns doch, sobald wir in träumerischem Nachdenken, um in die Vergangenheit zurückzukehren, die unablässige Bewegung, die uns fortträgt, zu verlangsamen, ja aufzuhalten suchen, eine neben der anderen, aber deutlich voneinander verschieden, die Tönungen allmählich wieder vor Augen, in denen wir denselben Namen im Laufe unseres Daseins sukzessive wahrgenommen haben.
Welche Form sich in diesem Namen Guermantes für mich abzeichnete, als meine Amme – die gewiß ebensowenig wie heute ich selber wußte, zu wessen Ehren es geschrieben worden war – mich mit dem alten Lied Gloire à la marquise de Guermantes in den Schlaf wiegte, oder als ein paar Jahre später der alte Marschall von Guermantes mein Kindermädchen mit Stolz erfüllte, weil er in den Anlagen der Champs-Élysées mit den Worten stehenblieb: »Was für ein schönes Kind!« und einer Bonbonniere im Taschenformat ein Schokoladetäfelchen entnahm, ist mir nicht bekannt. Jene Jahre meiner frühen Kindheit sind nicht mehr in mir, sie liegen außerhalb meiner Person, ich kann über sie – wie über Dinge, die sich vor meiner Geburt zugetragen haben – einzig aus den Erzählungen der anderen etwas erfahren. Doch später finde ich in mir zeitlich aufeinanderfolgend sieben oder acht verschiedene Bilder dieses Namens vor; die ersten waren die schönsten: nacheinander nämlich gab mein Traum, durch die Wirklichkeit gezwungen, eine unhaltbare Stellung auf, verschanzte sich erneut etwas weiter hinten, bis er sich neuerlich zurückziehen mußte. Und sooft Madame de Guermantes sich wandelte, tat dies auch ihre Wohnstätte, die ebenfalls aus diesem Namen hervorgegangen war. Er wurde von Jahr zu Jahr durch das eine oder andere aufgeschnappte Wort, das meine Träumereien veränderte, neu befruchtet; und jene Wohnstätte spiegelte diese Träumereien dann selbst auf ihren Steinen wider, die eine reflektierende Oberfläche bekommen hatten wie eine Wolke oder ein See. Eine Turmfeste ohne stoffliche Dichte, die eigentlich nur ein breiter Streifen orangefarbenen Lichtes war, von deren Höhe der Lehnsherr und seine Dame über Leben und Tod ihrer Vasallen geboten, hatte – im hintersten Teil jener »Gegend von Guermantes«, in der ich an so vielen schönen Nachmittagen mit meinen Eltern dem Lauf der Vivonne gefolgt war – dem von Wildbächen durchströmten Besitz Platz gemacht, wo die Herzogin mich das Forellenfischen und die Namen der Blumen lehrte, die die niederen Umfriedungsmauern mit dem Schmuck ihrer rotvioletten Blütentrauben bedeckten1 ; dann war es der angestammte Besitz gewesen, die poetische Domäne, auf der das stolze Geschlecht der Guermantes, wie ein goldener, fleuronverzierter Turm, der die Zeiten durchquert, sich schon über Frankreich erhob, als der Himmel noch leer war über den Stätten, an denen später Notre-Dame von Paris und Notre-Dame von Chartres emporragen sollten, als auf der Höhe des Hügels von Laon die Kathedrale sich noch nicht festgesetzt hatte wie die Arche Noah auf dem Gipfel des Ararat, bis zum Rand mit Patriarchen und Gerechten gefüllt, die sich angstvoll aus den Fenstern beugen, um zu sehen, ob Gottes Zorn sich beschwichtigt hat, beladen mit den Pflanzen, die auf Erden Frucht tragen sollen, und überquellend von Tieren, die sogar zu den Türmen herausschauen, wo Ochsen, die friedlich auf dem Dach sich ergehen, von oben herab die Ebenen der Champagne betrachten; als der Wanderer, der Beauvais bei Tagesende verließ, noch nicht die ihn begleitenden schwarzen und verzweigten Flügel der Kathedrale sah, die sich sachte drehend vor dem goldenen Schirm des Sonnenuntergangs entfalten.2 Freilich war dieses Guermantes, wie der Handlungsrahmen eines Romans, eine Phantasielandschaft, die ich mir nur mit Mühe vorstellen konnte und deshalb um so lieber entdeckt hätte, gleichsam als Enklave zwischen wirklichen Ländereien und Landstraßen gelegen, die sich auf einmal, zwei Meilen von einem Bahnhof entfernt, mit heraldischen Besonderheiten färben würden; ich rief mir die Namen von benachbarten Orten ins Gedächtnis, als seien sie am Fuß des Parnaß oder Helikon gelegen, Orte, die mir wertvoll schienen wie – in der wissenschaftlichen Topographie – die materiellen Voraussetzungen für die Erzeugung eines rätselhaften Phänomens. Ich sah wieder die unten auf den Kirchenfenstern von Combray aufgemalten Wappenschilder, deren Felder sich Jahrhundert für Jahrhundert mit all den Seigneurien angefüllt hatten, die durch Heirat oder Kauf dieses berühmte Haus aus allen Gegenden Deutschlands, Italiens und Frankreichs um sich geschart hatte: unermeßliche Ländereien im Norden, mächtige Städte im Süden waren zu Guermantes gestoßen, hatten sich mit Guermantes vereint und unter Aufgabe ihres stofflichen Charakters ihren heraldischgrünen Turm oder ihr silbernes Kastell allegorisch in sein azurblaues Feld eingeschrieben. Ich hatte von den berühmten Wandteppichen in Guermantes gehört und stellte sie mir mittelalterlich und blau vor, etwas derb, wie eine Wolke, die sich gegen den amarantenen, legendären Namen abhebt, zu Füßen des vorzeitlichen Waldes, in dem Childebert so häufig jagte, und in die rätselvolle Tiefe jener Ländereien, in die Ferne jener Jahrhunderte mit ihren Geheimnissen glaubte ich ebensogut wie durch eine Reise eindringen zu können, wenn ich mich einfach in Paris Madame de Guermantes, Lehensherrin des Ortes und Dame vom See1, einen Augenblick näherte, als müßten ihr Antlitz und ihre Worte den lokalen Zauber des Dickichts und der Gestade besitzen sowie dieselben von Jahrhunderten geprägten Züge des alten Rechtsspiegels ihrer Archive. Dann aber hatte ich die Bekanntschaft Saint-Loups gemacht und von ihm erfahren, daß das Schloß Guermantes2 erst seit dem siebzehnten Jahrhundert, da die Familie es erworben hatte, deren Namen trüge. Vorher hatte sie in der Nachbarschaft residiert, doch ihr Titel stammte nicht aus dieser Gegend. Das Dorf Guermantes war erst nach dem Schloß erbaut und nach ihm benannt worden; damit es dessen Anblick nicht beeinträchtige, bestimmte ein in Kraft gebliebenes Servitut die Straßenführung und die Höhe der Häuser. Was die Wandteppiche betraf, so waren sie von Boucher; ein Guermantes, der Kunstliebhaber war, hatte sie im neunzehnten Jahrhundert gekauft; sie hingen neben ein paar mittelmäßigen Jagdbildern, die er selbst gemalt hatte, in einem äußerst häßlichen, mit billigem rotem Baumwollstoff und Plüsch drapierten Salon. Durch solche Enthüllungen hatte Saint-Loup dem Namen Guermantes wesensfremde Elemente in das Schloß eingeführt, die es mir nicht länger erlaubten, allein aus der Klangfülle jener Silben das Mauergefüge der Bauwerke abzuleiten. So war denn auf dem Grund dieses Namens das in seinem See sich spiegelnde Schloß verblaßt, und als Wohnstätte, die Madame de Guermantes umgab, war mir ihr Pariser Stadtpalais erschienen, das Hôtel de Guermantes, hell leuchtend wie sein Name, denn kein materielles, opakes Element unterbrach und trübte seine Transparenz. Wie Kirche nicht nur Gotteshaus, sondern auch die versammelten Gläubigen bedeutet, umfaßte das Palais Guermantes alle, die das Leben der Herzogin teilten, doch waren diese Vertrauten, die ich niemals gesehen hatte, für mich nur berühmte Namen von poetischem Klang, und weil sie ausschließlich Leute kannten, die ihrerseits auch nichts als Namen waren, vermehrten und beschützten sie das Mysterium der Herzogin noch, indem sie sie mit einem weiten Halo umgaben, der höchstens ganz allmählich schwächer wurde.
Da ich mir bei den Festen, die sie gab, bezüglich der Geladenen keinen Körper, keinen Schnurrbart, keinen Stiefel vorstellte, keinen von ihnen geäußerten Satz, der banal gewesen wäre oder auch in menschlicher, vernunftmäßig zu fassender Weise originell, verlieh dieser Wirbel von Namen, der weniger Materie als ein Geistermahl oder ein Gespensterball mit sich führte und eine Meißener Porzellanfigur – Madame de Guermantes – umwogte, ihrem gläsernen Palais eine vitrinenhafte Transparenz. Dann, als Saint-Loup mir Anekdoten über den Hauskaplan und die Gärtner seiner Kusine erzählt hatte, war das Palais Guermantes – wie in früheren Zeiten vielleicht ein Louvre – zu einem Schloß geworden, das aufgrund eines alten, bizarrerweise weiterbestehenden Rechts mitten in Paris noch von seinen Erblanden umgeben war, auf denen sie noch immer ihre lehnsherrlichen Vorrechte genoß. Doch auch diese letzte Wohnstätte schwand dahin, als wir ganz in der Nähe von Madame de Villeparisis eine neben der von Madame de Guermantes gelegene Wohnung in einem Flügel ihres Stadtpalais bezogen. Es war eines jener alten Gebäude, wie sie vielleicht auch heute noch existieren, deren Ehrenhof – ob es sich nun dabei um Anschwemmungen der immer stärker ansteigenden Flut der Demokratie handelte oder um ein Vermächtnis älterer Zeiten, in denen die verschiedenen Handwerke sich um den Lehensherrn versammelten – oft von Ladenräumen und Werkstätten, ja sogar von der Bude eines Schuhmachers oder Schneiders flankiert war, wie jene, die man an die Seiten der Kathedralen sich anlehnen sieht, soweit die Ingenieursästhetik diese nicht freigelegt hat; oder es gab dort einen schusternden Concierge, der Hühner und Blumen züchtete – und zuhinterst, in dem eigentlichen »Palais«, eine »Gräfin«, die, wenn sie in ihrer alten zweispännigen Kalesche ausfuhr, mit ein paar Kapuzinerblumen am Hut, die dem Gärtchen der Concierge-Loge entsprungen schienen (neben dem Kutscher saß ein Lakai, der vor jedem aristokratischen Palais im Stadtviertel abstieg, um Karten abzugeben), unterschiedslos ein Lächeln und einen winkenden Gruß den in diesem Augenblick vorüberkommenden Kindern des Concierge oder den bürgerlichen Mietern des Hauses zusandte, die sie mit herablassender Liebenswürdigkeit und egalitärem Dünkel in denselben Topf warf.
In dem Haus, in dem wir jetzt Wohnung genommen hatten, war die große Dame ganz hinten im Hof eine Herzogin, elegant und noch jung. Es war Madame de Guermantes, und dank Françoise gewann ich ziemlich schnell Einblick in das Palais. Denn die Guermantes (die Françoise gemeinhin als »die da hinten« oder »da unten« bezeichnete) bildeten vom frühen Morgen an den Gegenstand ihres Interesses; schon während sie Mama frisierte, warf sie einen verbotenen, unwillkürlichen und verstohlenen Blick in den Hof und meinte: »Sieh an, zwei Klosterschwestern; die geh’n bestimmt nach hinten« oder »Oh! die schönen Fasanen am Küchenfenster, da braucht man nicht erst zu fragen, wo die herkommen, der Herzog wird auf Jagd gewesen sein«, bis zum Abend, wenn sie, während sie mir meine Nachtsachen herauslegte, entferntes Klavierspiel oder das Echo einer Singstimme hörte, beziehungsvoll bemerkte: »Sie haben Gäste da unten, da geht’s heute hoch her!« In ihrem regelmäßigen Gesicht unter den nun schon weiß gewordenen Haaren rückte dann ein lebendiges und zurückhaltendes Jugendlächeln für einen Augenblick alle Züge an ihren Platz und richtete sie in gezierter, kunstfertiger Ordnung aufeinander aus, als wäre es zu einem Kontertanz.
Kein Augenblick aber im Leben der Guermantes erregte so lebhaft die Neugierde von Françoise, befriedigte sie so sehr und bereitete ihr gleichzeitig mehr Kummer als derjenige, in dem die große Einfahrt ihre Flügel öffnete und die Herzogin ihren Wagen bestieg. Das geschah, jeweils kurz nachdem unsere Dienstboten jene Art von feierlichem Passahmal zu Ende zelebriert hatten, das niemand unterbrechen darf, eine heilige, »ihr Mittagessen« genannte Handlung, während der sie derart »tabu« waren, daß sogar mein Vater sich nicht erlaubt hätte zu schellen, zumal er wußte, daß auch beim fünften Mal ebensowenig wie beim ersten sich irgend etwas rühren würde, so daß er diese Ungehörigkeit umsonst begangen hätte, nicht jedoch ohne Nachteil für sich selbst. Denn Françoise (die, seitdem sie eine alte Frau geworden war, zu allem und jedem ein Gesicht zog) hätte nicht verfehlt, ihm den ganzen Tag ein Antlitz zu zeigen, auf dem mit kleinen roten Malen wie in Keilschrift, zwar äußerlich sichtbar, aber doch auf eine schwer zu entziffernde Weise, die lange Geschichte ihrer Leiden und die tiefen Gründe ihrer Unzufriedenheit aufgezeichnet standen. Sie sprach sich auch darüber aus, aber nur gleichsam in die Kulisse hinein, so daß wir kein Wort verstanden. Sie nannte das – übrigens glaubte sie, es sei ganz entsetzlich für uns, es würde uns »wurmen«, wir würden uns »zu Tode kränken« – den lieben langen Tag »stille Messen lesen«.
Nachdem die letzten Riten vollzogen waren, schenkte sich Françoise, die wie in der christlichen Urkirche gleichzeitig Zelebrant und Gläubiger war, ein letztes Glas Wein ein, nahm die Serviette vom Hals, faltete sie, indem sie sich einen Rest von Kaffee oder rotgefärbtem Wasser von den Lippen wischte, schob das Tuch in den Serviettenring, dankte mit leidender Miene »ihrem« Laufburschen, der, um seinen Eifer zu beweisen, zu ihr sagte: »Madame, so nehmen Sie doch noch ein wenig Trauben; sie sind exsellent«, worauf sie unter dem Vorwand, man komme um vor Hitze in dieser »elenden Küche«, das Fenster öffnete. Da sie, während sie den Fenstergriff drehte und frische Luft schöpfte, gleichzeitig äußerst geschickt und ganz beiläufig in den Hof schaute, stellte sie dort verstohlen, aber eindeutig fest, daß die Herzogin noch nicht bereit war, ließ ihre nichtachtenden, leidenschaftlichen Blicke eine Sekunde auf dem angespannten Wagen ruhen und hob, nachdem ihre Augen diese kurze Aufmerksamkeit an die Dinge der Welt gewandt hatten, diese dann zum Himmel, dessen Klarheit sie bereits erraten hatte, als sie die weiche Luft und die Wärme der Sonne spürte; dann schaute sie nach der Ecke des Daches hin, auf der jeden Frühling, gerade über dem Schornstein meines Zimmers, Tauben ihr Nest bauten, die ganz denen glichen, die in Combray in ihrer Küche gurrten.
»Ach Combray, Combray«, rief sie aus. (Der fast gesungene Tonfall, in dem sie diese Invokation vortrug, hätte ebenso wie die arlesische1 Reinheit ihrer Züge bei Françoise einen südfranzösischen Ursprung vermuten lassen und den Gedanken nahelegen können, daß die verlorene Heimat, der sie nachtrauerte, nur eine Wahlheimat war. Aber vielleicht würde man sich täuschen, denn es gibt offenbar keine Provinz, die nicht ihren »Süden« hätte, und wie vielen Savoyarden oder Bretonen begegnet man nicht, bei denen man in vollem Umfang jene weiche Verschiebung von Längen und Kürzen antrifft, die für die Franzosen des Südens charakteristisch ist!) »Ach Combray, wann werde ich dich wiedersehen, meine liebe, gute Heimat, wann werde ich den lieben, langen Tag bei deinem Weißdorn und unserem lieben, guten Flieder sein können und den Finken und der Vivonne zuhören, die murmelt, als ob jemand halblaut redet, anstatt auf die elende Schelle unseres jungen Herrn achtgeben zu müssen, der keine halbe Stunde vergehen läßt, ohne daß er mich durch diesen Malefizkorridor hetzt! Und dann findet er nicht einmal, ich mache schnell genug; man müßte ihn schon gehört haben, ehe er noch läutet, und wenn man sich eine Minute verspätet, bekommt er gleich einen fürchterlichen Wutanfall! Herrje, mein liebes, gutes Combray! Vielleicht sehe ich dich erst wieder, wenn ich tot bin, wenn man mich wie einen Stein ins Grabloch wirft. Deinen schönen Weißdorn rieche ich dann freilich nicht mehr. Doch selbst im Todesschlaf, glaube ich, werde ich noch das dreifache Schellen hören, das mir schon hier das Leben zur Hölle macht.«
Sie wurde aber von den Rufen des Westenmachers im Hof unterbrochen, jenes Mannes, der meiner Großmutter schon an dem Tag, als sie Madame de Villeparisis besuchen ging, so gut gefallen hatte und der keinen geringeren Platz in der Sympathie von Françoise einnahm. Er hatte, als er unser Fenster öffnen hörte, bereits eine Zeitlang die Aufmerksamkeit seiner Nachbarin auf sich zu ziehen versucht, um ihr guten Tag zu wünschen. Für Monsieur Jupien veredelte dann die Koketterie des jungen Mädchens, das Françoise gewesen war, das mürrische Gesicht unserer langjährigen, von Alter, Übellaunigkeit und der Hitze des Herdfeuers schwerfällig gewordenen Köchin, und sie sandte mit einer überaus reizvollen Mischung von Zurückhaltung, Zutrauen und Schamhaftigkeit dem Westenmacher einen anmutigen Gruß, ohne sich ihm jedoch in Worten mitzuteilen, denn wenn sie auch Mamas Anweisungen darin überschritt, daß sie in den Hof hinunterschaute, hätte sie doch nicht gewagt, ihnen soweit Trotz zu bieten, daß sie durchs Fenster einen Schwatz hielt, was zur Folge gehabt hätte, daß es von Madames Seite – wie Françoise es nannte – »einen absetzte«. Sie wies auf die bespannte Kalesche, als wolle sie sagen: Schöne Pferde, was?, murmelte aber dabei: »So was von Schabracke!«, und zwar vor allem, weil sie wußte, daß er, die Hände hohl vor den Mund haltend, damit sie ihn auch verstehe, wenn er nur halblaut sprach, ihr antworten würde: Ihr könntet doch auch welche haben, wenn Ihr nur wolltet, vielleicht noch mehr als die, aber Ihr mögt all das ja nicht!
Nach einer bescheidenen, ausweichenden und entzückten Gebärde, die etwa bedeutete: Jeder nach seiner Fasson; bei uns ist man fürs Schlichte, schloß Françoise das Fenster wieder aus Angst, Mama könne auftauchen. Die »Ihr«, die mehr Pferde hätten halten können als die Guermantes, waren wir; aber Jupien hatte recht, wenn er »Ihr« sagte, denn abgesehen von gewissen rein persönlichen Freuden der Eigenliebe (wie zum Beispiel, wenn sie pausenlos hustete und alle im Haus fürchteten, angesteckt zu werden, mit einem aufreizenden Grinsen zu erklären, sie sei überhaupt nicht erkältet), lebte Françoise ähnlich jenen Pflanzen, die von einem Tier, mit dem sie gänzlich eins sind und von dem sie mit der Nahrung, die es für sie erbeutet, frißt, verdaut und ihnen im letzten, gänzlich mühelos zu assimilierenden Zustand darbietet, gefüttert werden, in Symbiose mit uns; wir waren es, die mit unseren Tugenden, unserem Vermögen, unserem Lebenszuschnitt, unserer gesellschaftlichen Stellung ihr die kleinen Befriedigungen der Eigenliebe erschaffen mußten, aus denen – wenn man dazu noch das anerkannte Recht nahm, den Kult der Mittagsmahlzeit frei, nach altem Brauch auszuüben, einschließlich des darauffolgenden Luftschöpfens am Fenster, eines gemächlichen Herumbummelns auf den Straßen, wenn sie Einkäufe für den Haushalt machte, und des Ausgangs am Sonntag, wo sie ihre Nichte besuchte – sich das für ihr Leben unerläßliche Maß an Zufriedenheit ergab. Daher versteht man auch, daß Françoise an den ersten Tagen gleichsam verkümmerte, in einem Haus, in dem sämtliche Ehrentitel meines Vaters noch unbekannt waren, und zwar aufgrund eines Leidens, das sie selbst als Weh bezeichnete, Weh in dem starken Sinn, den das Wort »ennui« bei Corneille oder unter der Feder jener Soldaten hat, die sich schließlich das Leben nehmen, weil sie an zu starkem »Heimweh« nach ihrer Verlobten oder ihrem Heimatdorf leiden. Das Weh von Françoise war ausgerechnet von Jupien schnell geheilt worden, denn er verschaffte ihr auf der Stelle ein ebenso lebhaftes und vielseitiges Vergnügen, wie unser Entschluß, Wagen und Pferde zu halten, ihr bereitet hätte. »Ganz nette Leute, diese Juliens« (Françoise paßte gern neue Wörter den ihr schon bekannten an), »hochanständige Menschen, es steht ihnen ins Gesicht geschrieben.« Jupien hatte in der Tat Sinn dafür – und gab es auch allen Leuten zu verstehen –, daß wir, wenn wir uns keine Equipage hielten, eben keine wollten. Dieser Freund von Françoise war selten zu Hause, da er einen Angestelltenposten in einem Ministerium bekommen hatte. Nachdem er zunächst als Westenmacher mit dem »Mädel« gearbeitet hatte, das meine Großmutter einst für seine Tochter hielt, war dieser Beruf für ihn gänzlich uninteressant geworden, als das junge Ding, das damals, als meine Großmutter jenen Besuch bei Madame de Villeparisis machte, beinahe noch ein Kind, bereits aufs beste wieder einen Rocksaum annähen konnte, sich der Damenschneiderei zugewandt hatte und Rocknäherin geworden war. Zunächst als Gehilfin in einem Atelier, wo man sie nur brauchte, um eine Naht zu verstärken, einen Volant zu reihen, einen Knopf oder Druckknopf zu befestigen, ein Taillenband mittels Schlaufen anzupassen, war sie bald zur »Zweiten«, dann zur »Ersten« aufgerückt, und nachdem sie sich eine Kundschaft aus lauter Damen der besten Gesellschaft gesichert hatte, arbeitete sie bei sich zu Hause, das heißt in unserem Hof, meist mit einer oder zwei ihrer jungen Kameradinnen aus dem Atelier, die bei ihr das Handwerk erlernten. Seitdem war die Anwesenheit Jupiens weniger erforderlich geworden. Wohl hatte die Kleine, die inzwischen herangewachsen war, noch häufig Westen zu nähen. Aber da sie von ihren Freundinnen unterstützt wurde, brauchte sie niemanden sonst. So hatte denn Jupien, ihr Onkel, eine Stellung gesucht. Anfangs stand es ihm frei, mittags nach Hause zu gehen, dann aber hatte er endgültig den Platz des Angestellten bekommen, dem er zunächst nur als Hilfskraft zugeteilt war, und kam nun nicht vor der Stunde des Abendessens heim. Seine »Ernennung« erfolgte glücklicherweise erst einige Wochen nach unserem Einzug, so daß die Liebenswürdigkeit Jupiens noch lange genug auf Françoise einwirken konnte, um ihr ohne allzu großes Leiden über die ersten, so schweren Zeiten hinwegzuhelfen. Ohne den Nutzen zu verkennen, den er auf diese Weise für Françoise als »Übergangsmedikament« besaß, muß ich allerdings bekennen, daß Jupien mir auf den ersten Blick nicht besonders gefallen hatte. Wenn man ihn aus ein paar Schritten Entfernung sah, ließen seine Augen, deren mitleidiger, verzweifelter und versunkener Blick gleichsam überquoll, unter gänzlicher Aufhebung des Eindrucks, den ohne ihn seine dicken Wangen und seine blühende Gesichtsfarbe gemacht hätten, den Gedanken aufkommen, er sei sehr krank oder soeben von einem schweren Trauerfall heimgesucht worden. Nicht nur konnte davon keine Rede sein, vielmehr wirkte er, sobald er sprach, in makelloser Weise übrigens, eher spöttisch und kalt. Aus diesem Mißverhältnis zwischen seinem Blick und seinen Worten ergab sich etwas Falsches, was nicht sympathisch war und was ihn ebenso befangen zu machen schien, wie es ein Gast im Straßenanzug bei einer Abendgesellschaft ist, wo alles im Frack erscheint, oder jemand, der einer Hoheit Antwort geben soll, aber nicht recht weiß, wie man mit ihr zu sprechen hat, und die Schwierigkeit dadurch umgeht, daß er seine Sätze so verkürzt, daß fast nichts mehr bleibt. Jene von Jupien – denn das war ja nur ein Vergleich – waren hingegen bezaubernd. Als Entsprechung vielleicht zu jener Überflutung seines Gesichts durch die Augen (etwas, auf das man nicht mehr achtgab, wenn man ihn erst kannte) stellte ich tatsächlich sehr bald bei ihm eine ungewöhnliche Intelligenz fest, zudem eine der natürlichsten literarisch geprägten, die ich je hatte kennenlernen dürfen, insofern nämlich, daß er – wahrscheinlich ohne alle Bildung – spontan über die geistreichsten sprachlichen Wendungen verfügte oder sie sich durch rasches Überfliegen einiger Bücher angeeignet hatte. Die begabtesten Menschen, die ich kennengelernt hatte, waren jung gestorben. Ich war denn auch überzeugt, Jupiens Leben werde frühzeitig enden. Er besaß Güte, Mitgefühl, die zartesten, großherzigsten Gefühle. Seine Rolle im Leben von Françoise war nach kurzer Zeit nicht mehr unabdingbar. Sie hatte gelernt, andere für ihn einspringen zu lassen.
Selbst wenn irgendein Lieferant oder Dienstbote uns ein Paket brachte, nahm Françoise, wiewohl sie so tat, als beschäftige sie sich überhaupt nicht mit ihm, und ihm nur mit unbeteiligter Miene einen Stuhl zuwies, die wenigen Augenblicke, die er in der Küche verbrachte, während er auf einen Bescheid von Mama wartete, so geschickt wahr, daß einer nur selten das Haus wieder verließ, ohne daß sich die unverbrüchliche Gewißheit in seinen Geist eingegraben hätte, daß wir, »wenn wir keine hatten, eben keine wollten«. Wenn sie übrigens so großen Wert darauf legte, daß jedermann wußte, wir »hätten Geld« (wobei sie »d’argent« sagte und nicht »de l’argent«, denn sie wußte nichts vom Gebrauch dessen, was Saint-Loup als »partitiven Artikel« bezeichnete, und so hieß es: »avoir d’argent« oder »apporter d’eau«), wir seien reich, so war zwar nicht der Reichtum an sich, der Reichtum ohne Tugend in ihren Augen das höchste Gut, aber Tugend ohne Reichtum entsprach ebensowenig ihrem Ideal. Reichtum war für sie eine notwendige Voraussetzung, ohne die der Tugend Verdienst und Zauber abgehen würde. Sie trennte diese beiden so wenig voneinander, daß sie schließlich einer jeden die Eigenschaften der anderen zuerkannte, Annehmlichkeiten in der Tugend suchte und im Reichtum etwas Erbauliches fand.
Wenn sie das Fenster wieder geschlossen hatte, ziemlich schnell (denn sonst hätte sie von Mama, scheint es, »wer weiß was zu hören bekommen«), begann Françoise unter Seufzen den Küchentisch abzuräumen.
»Es gibt auch Guermantes, die in der Rue de la Chaise wohnen«, meinte der Kammerdiener, »ich hatte einen Freund, der dort gearbeitet hat; er war da zweiter Kutscher. Und ich kenne jemand, nicht dieser alte Freund, sondern sein Schwager, der hat seinerzeit mit einem Pikör des Barons von Guermantes im gleichen Regiment gedient. ›Doch was soll’s, er ist ja nicht mein Vater!‹«1 fügte der Kammerdiener hinzu, der, ebenso wie er gewöhnlich den Gassenhauer des Jahres auf den Lippen führte, jeweils auch seine Reden mit den aktuellsten Scherzen würzte.
Mit den Augen einer schon bejahrten Frau, die freilich in Combray, in unbestimmter Ferne, alles sahen, bemerkte Françoise den Scherz nicht, der in diesen Worten lag, wohl aber, daß einer darin liegen mußte, denn sie standen mit dem Rest der Rede in keiner Beziehung und waren mit Vehemenz von jemandem hingeworfen worden, den sie als Spaßmacher kannte. Daher lächelte sie wohlwollend und bewundernd, als wolle sie sagen: »Dieser Victor ist doch immer derselbe!« Im übrigen war sie glücklich, denn sie wußte, daß das Anhören solcher Einfälle von fern etwas mit ehrbaren, gesellschaftlichen Vergnügungen zu tun hatte, um derentwillen ja so eifrig Toilette gemacht und eine Erkältung in Kauf genommen wird. Und schließlich glaubte sie auch, der Kammerdiener sei ihr freundschaftlich gesinnt, weil er sich nicht genug tun konnte, ihr mit Entrüstung die furchtbaren Maßnahmen auszumalen, die die Republik gegen die Geistlichkeit plane. Françoise hatte noch nicht begriffen, daß unsere gefährlichsten Gegner nicht diejenigen sind, die uns widersprechen und uns zu überzeugen versuchen, sondern jene, die Nachrichten übertreiben oder erfinden, die uns Kummer bereiten, diesen aber dabei nicht einmal einen Anschein von Berechtigung geben, der unseren Schmerz lindern und uns vielleicht eine leise Achtung vor einer Partei einflößen würde, die sie uns vielmehr um jeden Preis, damit unsere Qual vollkommen sei, als erbarmungslos und unbegrenzt mächtig vor Augen stellen.
»Die Herzogin muß ja mit all dem da verschwiegert sein«, nahm Françoise die Unterhaltung bei den Guermantes aus der Rue de la Chaise wieder auf, so wie man in einem Stück beim Andante weiterspielt. »Ich weiß nicht mehr, wer mir gesagt hat, daß der eine von denen eine Kusine vom Herzog geheiratet hat. Auf alle Fälle ist es dieselbe ›Verbandschaft‹. Eine große Familie, diese Guermantes!« setzte sie respektvoll hinzu, indem sie die Größe des Hauses Guermantes gleichzeitig auf die Zahl seiner Glieder und den Glanz seines Ruhmes gründete wie Pascal die Wahrheit der Religion auf die Vernunft und die Autorität der Heiligen Schrift.1 Denn da ihr nur das eine Wort »groß« für die beiden Dinge zur Verfügung stand, schienen sie ihr ein und dasselbe zu sein; wie gewisse Steine wies ihr Vokabular hier und da eine Trübung auf, die dann verdunkelnd bis auf ihr Denken wirkte.
»Ich frage mich, ob das nicht diejenigen sind, welche ihr Schloß in Guermantes, zehn Meilen von Combray haben; dann sind sie auch mit ihrer Kusine von Alger verwandt.« Meine Mutter und ich haben uns lange gefragt, wer diese Kusine von Alger sein könne, und es dauerte eine ganze Weile, bis wir begriffen, daß Françoise mit dem Namen Alger die Stadt Angers2 meinte. Das Fernliegende kann uns vertrauter sein als das Nahe. Françoise, der der Name Alger von den fürchterlichen Datteln her bekannt war, die wir jeweils zum Neujahrstag bekamen, wußte den von Angers nicht. Ihre Redeweise war wie die französische Sprache selbst, vor allem ihre Ortsbezeichnungen, mit Irrtümern reich durchsetzt. »Ich wollte schon mal ihren Maître d’hôtel danach fragen. Wie spricht man ihn schon wieder an?« unterbrach sie sich, wie wenn sich ihr eine Frage der Etikette stellen würde; dann gab sie sich selbst die Antwort: »Ach ja, man spricht ihn mit Antoine an«, als ob Antoine ein Titel wäre. »Der könnte mir’s schon berichten, aber der tut ja so wichtig und so schwierig, als ob ihm die Zunge weg ist oder als hat er reden zu lernen vergessen. Er gibt nicht einmal Antwort, wenn man mit ihm spricht« (wobei sie »faire réponse« sagte wie Madame de Sévigné). »Aber«, fuhr sie unaufrichtig fort, »wenn ich vor meiner eigenen Tür gekehrt habe, kümmere ich mich nicht darum, was vor den anderen liegt. Auf alle Fälle, ganz koscher ist das nicht. Und dann ist er auch kein Mann mit Schneid.« (Dieses Urteil hätte den Gedanken nahelegen können, Françoise habe ihre Ansicht über die Tapferkeit geändert, die doch in ihren Combrayer Tagen die Männer ihrer Meinung nach zu wilden Tieren erniedrigte, aber so war es nicht. Schneid bedeutete nur Anstelligkeit.) »Es heißt auch, daß er wie eine Elster stiehlt, aber man muß ja nicht immer auf jedes Geschwätz hören. Hier bleibt ja niemand, von wegen den Hausmeistersleuten, die eifersüchtig sind und die Herzogin aufhetzen. Aber man kann schon sagen, daß dieser Antoine ein rechter Faulpelz ist, und seine ›Antoinesse‹ ist nicht besser als er«, setzte Françoise hinzu, die in ihrem Bemühen, zu Antoine ein Femininum zu finden, das die Frau des Maître d’hôtel bezeichnen könnte, sich bei ihrer sprachschöpferischen Tätigkeit wahrscheinlich unbewußt wieder an »chanoine« und »chanoinesse« erinnerte. Sie traf es damit gar nicht so schlecht. Noch heute gibt es in der Nähe von Notre-Dame eine Rue Chanoinesse1 genannte Straße, die diesen Namen (weil dort nur »chanoines« wohnten) von den Franzosen von damals erhalten hat, deren Zeitgenossin Françoise in Wirklichkeit war. Gleich darauf lieferte sie übrigens ein weiteres Beispiel für eine solche Bildung des Femininums, denn sie setzte hinzu: »Aber ganz todsicher gehört das Schloß Guermantes der Herzogin. Sie ist doch im Dorf die ›Madame la mairesse‹. Das ist schon was.«
»Das will ich glauben, daß das was ist«, sagte der Laufbursche im Brustton der Überzeugung, denn er hatte die Ironie nicht durchschaut.
»Das meinst du, mein Sohn, daß das was ist! Aber für Leute, wie die das sind, bedeutet es weniger als nichts, Maire und Mairesse zu sein. Herrje! wenn das Schloß Guermantes mir gehörte, mich sähe man nicht oft in Paris. Was müssen doch solche Herrschaften, die immerhin keine Bettler sind, wie Monsieur und Madame, für Ideen haben, daß sie lieber hier bleiben in dieser elenden Stadt, als daß sie jeden Augenblick, wo sie frei sind und niemand sie hält, statt dessen nach Combray fahren. Worauf warten sie bloß, um sich zur Ruhe zu setzen, wo sie doch haben, was man braucht; wollen sie erst sterben? Herrje! wenn ich nur trockenes Brot zu essen und im Winter Holz zum Heizen hätte, dann wäre ich schon längst wieder daheim, im bescheidenen Haus, das mein Bruder in Combray hat. Da spürt man doch wenigstens, daß man lebt, man hat nicht all diese Häuser vor sich, und nachts ist so wenig Lärm, daß man die Frösche mehr als zwei Meilen weit quaken hört.«
»Das muß aber schön sein, Madame«, rief der junge Laufbursche begeistert, als sei letzteres Merkmal ebenso charakteristisch für Combray wie für Venedig das Leben in den Gondeln.
Da er im übrigen weniger lange im Hause war als der Kammerdiener, brachte er Françoise gegenüber Dinge zur Sprache, die nicht ihn selbst interessierten, sondern sie. Und Françoise, die jedesmal das Gesicht verzog, wenn man von ihr als von der Köchin sprach, hegte für den Laufburschen, der sie als »die Wirtschafterin« bezeichnete, jene Art von Wohlwollen, die gewisse Fürsten zweiten Ranges jungen Leuten gegenüber an den Tag legen, wenn diese sie in bester Absicht mit Hoheit anreden.
»Wenigstens weiß man, was man tut und in was für einer Jahreszeit man lebt. Da ist es nicht wie hier, wo man zum heiligen Osterfest sowenig einen schäbigen Stengel Hahnenfuß wie an Weihnachten sieht und wo ich nicht das kleinste Angelusläuten höre, wenn ich mit meinen alten Gliedern aus dem Bett steige. Da hört man jede Stunde, es ist nur eine bescheidene Glocke, aber man sagt sich doch: ›Jetzt kommt mein Bruder vom Feld zurück‹, man sieht, wie der Tag zu Ende geht, man läutet für das, was die Erde uns schenkt1, man hat Zeit, sich noch einmal umzudrehen, bevor man Licht anmacht. Hier wird es Tag, es wird Nacht, man geht schlafen, und man kann sowenig sagen, was man eigentlich tut, wie das liebe Vieh.«
»Méséglise muß ja auch sehr hübsch sein«, fiel ihr der Laufbursche ins Wort, dessen Ansicht nach die Unterhaltung eine etwas abstrakte Wendung nahm und der sich zufälligerweise daran erinnerte, daß er uns bei Tisch von Méséglise hatte sprechen hören.
»Oh! Méséglise«, sagte Françoise mit dem breiten Lächeln, das man stets auf ihre Lippen brachte, wenn man die Namen von Combray, von Méséglise, von Tansonville aussprach. Sie bildeten einen so wichtigen Teil ihrer eigenen Existenz, daß sie, sobald sie ihr in einer Unterhaltung von außen her entgegentraten, ihre Heiterkeit weckten, wie es ein Lehrer tut, wenn er im Unterricht auf irgendeine zeitgenössische Persönlichkeit anspielt, deren Namen die Schüler nie von der Höhe des Katheders her zu vernehmen geglaubt hätten. Ihre Freude kam ihr auch aus dem Bewußtsein, daß diese Orte für sie etwas waren, was sie für die anderen nicht sein konnten, alte Kameraden, mit denen man vieles gemeinsam unternommen hat; sie lächelte ihnen zu, als ob sie sie geistreich fände, denn sie fand in ihnen viel von sich selber wieder.
»Ja, das kann man wohl sagen, mein Sohn, Méséglise ist recht hübsch«, fuhr sie mit feinem Lächeln fort; »aber wieso hast denn du von Méséglise gehört?«
»Wieso ich von Méséglise gehört habe? Aber das ist doch ganz bekannt; ich habe viel davon gehört, und zwar mehr als einmal«, behauptete er mit jener verbrecherischen Ungenauigkeit von Informanten, die jedesmal, wenn wir uns ein objektives Bild von der Wichtigkeit machen wollen, die eine uns selbst betreffende Sache für andere hat, es uns verunmöglichen, damit zum Ziel zu kommen.
»Ah! Das könnt Ihr mir glauben, daß es dort unter den Kirschbäumen angenehmer ist als am Herd.«
Sogar von Eulalie sagte sie nur Gutes. Denn seitdem Eulalie tot war, hatte Françoise vollkommen vergessen, daß sie sie bei Lebzeiten so wenig gemocht hatte, wie sie eben alle die nicht mochte, die nichts zu beißen und zu brechen hatten, die »am Hunger krepierten« und dann wie rechte Taugenichtse dank der Güte der Reichen sich auch noch »fein taten«. Sie litt nicht mehr darunter, daß es Eulalie so gut verstanden hatte, jede Woche von meiner Tante sich etwas »in die Hand drücken« zu lassen. Was nun diese betraf, so wurde Françoise nicht müde, ihr Lob zu singen.
»Aber Sie waren doch damals in Combray selbst, bei einer Kusine von Madame?« fragte der junge Laufbursche.
»Ja, bei Madame Octave, o ja! das war eine wirklich fromme Frau, meine lieben Leute, und da war alles vorhanden, immer ein guter Happen im Haus, alles vom Schönsten und Besten, eine gute Frau, das kann man wohl sagen, der war kein Rebhuhn, kein Fasan leid, nichts, da konnte man zu fünft, zu sechst kommen, Fleisch war immer da und noch dazu die allerbesten Stücke, weißer und roter Wein, und alles, was man braucht!« (Françoise gebrauchte die Verbalkonstruktion »leid sein« ohne Präposition und ganz im Sinne La Bruyères1 .) »Alles fiel ihr immer zur Last, auch wenn die Familie monatelang und jah-re-lang im Hause blieb.« (Diese Betrachtung hatte nichts Kränkendes für uns, denn Françoise gebrauchte »zur Last fallen« für »zu Lasten gehen«, also nicht im moralischen Sinn.) »Ah! Ihr könnt mir glauben, hungrig ging da keiner fort. Wie es uns der Herr Pfarrer auch gesagt hat: wenn eine Frau darauf rechnen kann, schnurstracks in den Himmel zu kommen, so ist es ganz todsicher sie. Die arme Madame, ich höre sie noch sagen mit ihrer schwachen Stimme: ›Françoise, Sie wissen, ich esse selber nichts, aber ich will, daß es für alle so gut ist, als äße ich selber!‹ Klar war es nicht für sie. Ihr hättet sie sehen sollen, sie wog nicht mehr als ein Säcklein Kirschen. Es war schon gar nichts mehr an ihr dran. Aber sie wollte mir nicht glauben und ging und ging einfach nicht zum Arzt. Oh! dort in Combray wäre nichts husch-husch verdrückt worden. Sie wollte, daß das Personal anständig genährt war. Hier aber haben wir ja erst heute kaum Zeit gehabt, einen Brocken zu uns zu nehmen. Alles geht wie der Teufel!«
Besonders regten sie die gerösteten Brotscheiben2 auf, die mein Vater zu essen pflegte. Sie war überzeugt, daß er es nur tat, um sich wichtig zu machen und sie »auf Touren zu bringen«. »Ich muß sagen«, stimmte der Laufbursche ihr zu, »ich habe so etwas noch nie und nirgends gesehen!« Er machte diese Bemerkung, als habe er alles gesehen und als erstreckten sich die aus einer tausendjährigen Erfahrung gewonnenen Einsichten bei ihm auf alle Länder und ihre Gebräuche, wobei jener des gerösteten Brotes nirgendwo vorgekommen war. »Ja, ja«, brummte der Kammerdiener1, »aber das alles kann sich ja ändern. Die Arbeiter sollen in Kanada streiken, und der Minister hat neulich abend zu Monsieur gesagt, daß er dafür zweihunderttausend Francs bekommen hat.« Der Kammerdiener war weit entfernt, ihn deswegen zu tadeln; nicht, daß er nicht selbst vollkommen ehrlich gewesen wäre, aber da er alle Politiker für korrupt hielt, kam ihm die Annahme von Schmiergeldern weniger schwerwiegend vor als das kleinste Diebstahlsdelikt. Er fragte sich nicht einmal, ob er diesen historischen Ausspruch auch wirklich recht gehört hatte und wunderte sich keineswegs über die Unwahrscheinlichkeit, daß es der Schuldige selbst war, der sich in dieser Weise meinem Vater gegenüber geäußert hatte, ohne daß dieser ihn hinauswarf. Doch die Philosophie von Combray erlaubte es Françoise nicht, zu hoffen, ein Streik in Kanada könne Auswirkungen auf den Gebrauch von geröstetem Brot haben. »Solange die Welt bestehen bleibt«, sagte sie, »wird es immer Herren geben, die einen herumhetzen, und Diener, die sich nach ihren Launen werden richten müssen.« Ungeachtet dieser Theorie von der ewigen Hetze fragte sich meine Mutter, die offenbar die Dauer von Françoises Mittagessen nicht mit der gleichen Elle wie jene maß, seit einer Viertelstunde schon: »Was mögen sie bloß machen, jetzt sind sie schon mehr als zwei Stunden bei Tisch.« Und schüchtern läutete sie drei- oder viermal. Françoise, »ihr« Laufbursche und der Kammerdiener hörten das Klingelzeichen nicht wie einen an sie gerichteten Appell und in dem Gedanken, daß sie daraufhin zu erscheinen hätten, wohl aber wie die ersten Töne von Instrumenten, die gestimmt werden, wenn ein Konzert bald wiederbeginnt und man spürt, daß die Pause nur noch Minuten dauern wird. Wenn aber die Klingelzeichen sich zu mehren begannen und immer dringlicher wurden, bequemten unsere Hausbedienten sich, davon Notiz zu nehmen; sie befanden dann, sie hätten bis zur Wiederaufnahme der Arbeit nicht mehr viel Zeit vor sich, und bei einem noch etwas ausdrucksvolleren Läuten, als die letzten es gewesen waren, ergaben sie sich schließlich seufzend in ihr Los; der Laufbursche ging und rauchte eine Zigarette vor der Tür; nach ein paar Betrachtungen über uns, wie etwa »die haben wohl die Rasitis«, stieg Françoise in ihr Mansardenzimmer, um ihre Sachen zu versorgen, und der Maître d’hôtel, der sich aus meinem Zimmer Briefpapier geholt hatte, erledigte in Eile seine private Korrespondenz.
Trotz der dünkelhaften Art ihres Maître d’hôtel hatte mich Françoise bereits in den ersten Tagen darüber aufklären können, daß die Guermantes ihr Palais nicht aufgrund unvordenklicher Rechte bewohnten, sondern kraft eines verhältnismäßig neuen Mietvertrages, und daß der Garten, auf den das Gebäude nach der mir unbekannten Seite zu ging, ziemlich klein und den anderen anstoßenden Gärten vollkommen ähnlich war; und ich erfuhr schließlich auch, es gebe dort weder einen Blutgerichtsgalgen noch eine befestigte Mühle zu sehen, weder einen Karpfenteich noch einen Taubenschlag auf Pfeilern, weder Zwangsbackhaus, Hallenscheune, Gerichtslaube noch Stein- oder Zug-, geschweige denn Hänge- oder Zollbrücken, weder Turmspitzen, Wandchartas noch Denkmäler aus heldischer Frühzeit.1 Doch wie Elstir der Bucht von Balbec, als sie ihr Geheimnis verloren hatte und für mich ein beliebiger, mit jedem anderen auswechselbarer Teil der Salzwassermengen auf dem Erdball geworden war, plötzlich wieder Individualität verliehen hatte, indem er mir sagte, sie sei die Opalbucht Whistlers in seinen Harmonien in Blau und Silber1, so hatte der Name Guermantes unter den Schlägen von Françoise bereits die letzte aus ihm entsprossene Behausung sterben sehen, als ein alter Freund meines Vaters eines Tages in bezug auf die Herzogin folgendes sagte: »Sie nimmt im Faubourg Saint-Germain eine einzigartige Stellung ein, sie führt das eleganteste Haus im Faubourg Saint-Germain.« Gewiß war der erste Salon, das erste Haus im Faubourg Saint-Germain nur sehr wenig verglichen mit den sonstigen Wohnstätten, die ich mir nacheinander erträumt hatte. Doch schließlich hatte auch diese noch, die die letzte sein sollte, etwas, was (wie bescheiden es sich auch ausnehmen mochte) über das bloß Stoffliche hinausging und eine geheimnisvolle Andersartigkeit einschloß.
Es war um so notwendiger für mich, im »Salon« von Madame de Guermantes, in ihren Freunden, das Geheimnis ihres Namens suchen zu können, als ich es in ihrer Person nicht fand, wenn ich sie des Morgens zu Fuß oder am Nachmittag im Wagen das Haus verlassen sah. Gewiß war sie mir schon in der Kirche von Combray im Blitzstrahl einer Metamorphose erschienen, mit nicht mehr veränderbaren Wangen, die undurchdringlich waren für die Farben des Namens Guermantes und der Nachmittage am Ufer der Vivonne; sie erschien mir anstelle meines zerstobenen Traumbilds, wie ein Schwan oder ein Weidenbaum, die nunmehr, als neue Gestalten eines verwandelten Gottes oder einer Nymphe, den Gesetzen der Natur unterworfen, auf dem Wasser gleiten oder vom Wind zerzaust würden. Doch kaum war ich nicht mehr in Gegenwart ihrer Person, als sich die aufgelösten Spiegelungen schon wieder zusammenfügten wie die rosigen und grünen Reflexe der untergegangenen Sonne hinter dem Ruder, dessen Schlag sie zum Verschwinden gebracht hat, und in der Stille meines Denkens hatte es der Name schnell verstanden, sich die Erinnerung an dieses Gesicht zu eigen zu machen. Jetzt aber sah ich sie oft an ihrem Fenster, im Hof, auf der Straße, und wenn es mir nicht gelang, den Namen Guermantes zu einem Teil von ihr werden zu lassen, zu denken, sie sei Madame de Guermantes, so legte ich meinem Geist und seiner Ohnmacht zur Last, daß er den Akt, den ich von ihm forderte, nicht zu vollenden vermochte; sie, unsere Nachbarin, aber schien dem gleichen Irrtum verfallen zu sein, ja viel mehr noch, ihn ohne Sorge, ohne irgendwelche Bedenken, wie ich sie hatte, ja sogar ohne allen Argwohn, daß es sich um einen Irrtum handle, zu begehen. So bewies Madame de Guermantes in ihrer Kleidung das gleiche Bemühen, der Mode zu folgen, wie wenn sie sich nun für eine Frau wie alle andern ansähe und nach jener Eleganz der Toilette strebe, in der beliebige andere Frauen ihr gleichkommen, sie vielleicht übertreffen konnten; ich hatte auf der Straße beobachtet, wie ihre bewundernden Blicke auf einer gutangezogenen Schauspielerin ruhten; und am Morgen konnte ich sie vor ihrem Spaziergang – ganz als ob die Meinung der Leute auf der Straße, deren Gewöhnlichkeit sie dadurch noch unterstrich, daß sie ihr unerreichbares Dasein ganz zwanglos unter ihnen durch die Menge trug, für sie ein Tribunal sein könnte – vor dem Spiegel stehen sehen, wie sie mit einer der Verstellung und Ironie völlig entbehrenden Hingabe, mit Leidenschaft, mit ungehaltenen Gesten, mit Eitelkeit, gleich einer Königin, die sich dazu herabläßt, in einer Komödie bei Hofe als Soubrette aufzutreten, diese so tief unter ihr stehende Rolle der eleganten Frau spielte; und in dem mythologischen Vergessen ihrer angeborenen Größe prüfte sie, ob ihr Schleier auch straff gezogen sei, glättete ihre Ärmel, zupfte den Mantel zurecht, so wie der göttliche Schwan alle Bewegungen seiner Tiergattung macht, seine aufgemalten Augen zu beiden Seiten seines Schnabels hält, ohne Blicke hineinzulegen, und sich unvermittelt auf einen Knopf oder Regenschirm stürzt, ganz Schwan, ohne sich zu erinnern, daß er ein Gott ist. Doch wie ein Reisender, den der erste Anblick einer Stadt enttäuscht hat, sich sagt, daß er vielleicht tiefer in ihren Zauber eindringen wird, sobald er ihre Museen besucht, Bekanntschaft mit ihren Einwohnern schließt, in den Bibliotheken arbeitet, sagte ich mir, daß ich, wenn ich erst einmal von Madame de Guermantes empfangen worden wäre, wenn ich zu ihrem Freundeskreis gehörte und tiefer in ihr Dasein eindringen könnte, gewiß in Erfahrung bringen würde, was unter seiner orangefarbenen, strahlenden Hülle ihr Name für andere Leute tatsächlich und objektiv einschloß, da ja schließlich der Freund meines Vaters gesagt hatte, das Milieu der Guermantes sei etwas ganz Besonderes innerhalb des Faubourg Saint-Germain.
Das Leben, das man meiner Vorstellung nach dort führte, entstammte einer von jeder Erfahrung so grundverschiedenen Quelle und schien mir etwas so Einzigartiges zu sein, daß ich mir bei den Abendgesellschaften der Herzogin keine Leute denken konnte, die ich auch anderswo schon getroffen hätte, keine realen Personen. Denn da sich diese ja nicht mit einem Mal eine andere Natur zulegen konnten, hätten sie dort Reden geführt, die den mir bekannten entsprachen; ihre Gesprächspartner hätten sich vielleicht so weit herabgelassen, ihnen in der gleichen menschlichen Sprache zu antworten, und es hätte somit auf einer Abendgesellschaft im ersten Salon des Faubourg Saint-Germain Augenblicke gegeben, die aufs Haar solchen glichen, wie ich sie schon durchlebt hatte: das aber war unmöglich. Freilich war mein Geist von gewissen Schwierigkeiten bedrängt, und die Gegenwart des Leibes Jesu Christi in der Hostie schien mir kein undurchdringlicheres Geheimnis zu bergen als jener erste Salon des Faubourg, der auf dem rechten Ufer lag und dessen Möbel, wie ich es von meinem Zimmer aus hören konnte, am Morgen ausgeklopft wurden. Auch wenn die Demarkationslinie, die mich vom Faubourg Saint-Germain trennte, nur ideeller Natur war, kam sie mir doch nicht weniger wirklich vor; ich spürte deutlich, daß die auf der anderen Seite dieses Äquators ausgebreitete Fußmatte der Guermantes, von der meine Mutter, als sie, wie ich selbst, sie eines Tages hinter ihrer geöffneten Haustür liegen sah, zu sagen gewagt hatte, sie sei in recht schlechtem Zustand, bereits der Faubourg Saint-Germain war. Wie hätte übrigens ihr Speisezimmer, ihre düstere Galerie mit den roten Plüschmöbeln, die ich manchmal von unserem Küchenfenster aus erkennen konnte, in meinen Augen nicht den geheimnisvollen Zauber des Faubourg Saint-Germain besitzen, auf eine wesenhafte Art einen Teil davon bilden, im geographischen Sinn bereits darin gelegen sein sollen, wo doch die Tatsache, daß man in diesem Speisezimmer empfangen worden war, bedeutete, daß man im Faubourg Saint-Germain verkehrt, seine Luft eingeatmet hatte, weil diejenigen, die, bevor man zu Tisch ging, sich neben Madame de Guermantes auf das Ledersofa in der Galerie gesetzt hatten, alle dem Faubourg Saint-Germain angehörten? Gewiß konnte man gelegentlich auch außerhalb des Faubourg, auf gewissen Abendgesellschaften, majestätisch thronend inmitten des gewöhnlichen Volkes eleganter Leute, einen dieser Männer sehen, die nur Namen sind und die, wenn man sie sich vorzustellen versucht, abwechselnd die Gestalt eines Turniers oder einer dominialen Waldung annehmen. Aber hier, im ersten Salon des Faubourg Saint-Germain, in der düsteren Galerie, gab es keine anderen als sie. Sie waren, aus einem kostbaren Stoff geschaffen, die Säulen, die den Tempel trugen. Selbst bei zwanglosen Einladungen konnte Madame de Guermantes ihre Gäste nur unter ihnen wählen, und bei den Diners für zwölf Personen glichen sie, wenn sie um den gedeckten Tisch versammelt waren, den goldenen Statuen der Apostel in der Sainte-Chapelle, symbolische Pfeiler und Weihegestalten vor dem Tisch des Herrn.1 Und was den kleinen Gartenplatz anging, der, von hohen Mauern umschlossen, hinter dem Hauptgebäude lag und in dem Madame de Guermantes im Sommer nach dem Abendessen die Liköre und die Orangeade reichen ließ: wie hätte ich nicht denken sollen, daß es ebenso unmöglich sei, auf den Eisenstühlen dort – die die gleiche Macht besaßen wie das Ledersofa – zwischen neun und elf Uhr abends zu sitzen, ohne den ganz besonderen Windhauch des Faubourg Saint-Germain einzuatmen, wie etwa eine Siesta in der Oase von Figuig2 zu halten, ohne daß man sich damit auch in Afrika befand? Nur Einbildungskraft und innere Überzeugung sind imstande, gewisse Wesen, gewisse Dinge von allen anderen zu unterscheiden und eine Aura zu erschaffen. Ach! Gewiß würde es mir nie vergönnt sein, meine Schritte zu den malerischen Stätten, landschaftlichen Besonderheiten, lokalen Sehenswürdigkeiten, künstlichen Werken des Faubourg Saint-Germain zu lenken. Und so begnügte ich mich damit, ehrfürchtig zu erschauern, wenn ich von hoher See aus (ohne Hoffnung, dort je anzulegen) wie ein vorgeschobenes Minarett, eine erste Palme, einen Beginn von exotischer Produktion oder Vegetation, die abgenutzte Fußmatte am Ufer liegen sah.
Doch wenn das Palais Guermantes für mich bei der Tür zu seinem Vestibül begann, so mußten die dazugehörenden Ländereien sich nach der Auffassung des Herzogs wohl noch viel weiter erstrecken, denn da er alle Mieter als Pächter, Bauernlümmel oder als Käufer enteigneter kirchlicher Güter ansah, deren Meinung nicht zählt, rasierte er sich morgens im Nachthemd am Fenster, begab sich je nachdem, ob es ihm mehr oder weniger warm war, in Hemdsärmeln, im Pyjama, in einem zottigen schottischen Jackett mit ausgefallenen Farben, in hellen, leichten Überziehern, die kürzer waren als sein Jackett, in den Hof und ließ sich von einem seiner Piköre ein neues Pferd vorführen, das er erworben hatte. Mehr als einmal beschädigte dieses die Auslage Jupiens, der dann den Herzog dadurch in Empörung versetzte, daß er Anspruch auf Schadenersatz erhob. »Allein schon wenn man daran denkt, wieviel Gutes die Herzogin im Hause und in der Gemeinde tut«, sagte Monsieur de Guermantes, »ist es von diesem Quidam eine Unverschämtheit, etwas von uns zu verlangen.« Doch Jupien gab nicht nach und machte allen Anschein, gar nicht zu wissen, was die Herzogin denn eigentlich je »Gutes« getan hatte. Dennoch stimmte es, aber da man seine Wohltätigkeit nicht auf alle ausdehnen kann, ist die Erinnerung daran, daß man sie dem einen erwiesen hat, ein Grund, dem anderen gegenüber, bei dem man dann um so größere Unzufriedenheit erregt, darauf zu verzichten. Unter anderen Gesichtspunkten übrigens als dem der Wohltätigkeit schien dem Herzog das Stadtviertel, in dem er wohnte – und zwar auf eine weite Entfernung hin –, nur eine Fortsetzung seines Hofes zu sein, eine verlängerte Bahn für seine Pferde. Nachdem er sich angesehen hatte, wie ein neues Pferd allein trabte, ließ er es anspannen und alle benachbarten Straßen durchfahren, wobei der Pikör neben dem Wagen herlief, die Zügel hielt und wieder und wieder das Gefährt vor dem Herzog vorbeiführte, der riesig, massig, hellgekleidet, die Zigarre im Mund, mit hocherhobenem Kopf und neugierig blitzendem Monokel bis zu dem Augenblick auf dem Bürgersteig stand, da er sich auf den Sitz schwang und das Pferd selber lenkte, um es zu erproben; dann fuhr er mit dem neuen Gespann ab, um seine Mätresse in den Champs-Élysées zu treffen. Im Hof pflegte Monsieur de Guermantes zwei Ehepaare zu grüßen, die mehr oder weniger seiner Welt angehörten: ein entfernt mit ihm verwandtes, das wie ein Arbeiterpaar nie zu Hause war und sich um die Kinder nicht kümmerte, denn schon am Morgen begab die Frau sich in die »Schola«1, um Kontrapunkt und Fugentechnik zu studieren, und der Mann in sein Atelier, wo er Holzschnitzereien und Lederpunzarbeiten machte; ferner Baron und Baronin von Norpois, die, beide immer in Schwarz, die Frau wie eine Stuhlvermieterin und der Mann wie ein Leichenträger, mehrmals am Tag das Haus verließen, um in die Kirche zu gehen. Sie waren Neffen des ehemaligen Botschafters, den wir kannten und den mein Vater einmal auf dem Treppenabsatz getroffen hatte, ohne zu begreifen, woher er kam; denn mein Vater meinte, daß eine so bedeutende Persönlichkeit, die mit den hervorragendsten Männern Europas in Beziehung gestanden hatte und wahrscheinlich gegenüber eitlem aristokratischen Standesbewußtsein vollkommen gleichgültig war, kaum jene klerikalen, beschränkten und bedeutungslosen Adligen besuchen werde. Sie wohnten erst seit kurzem im Haus; Jupien, der über den Hof kam, um dem Mann etwas mitzuteilen, als dieser gerade Monsieur de Guermantes begrüßte, nannte ihn, da er seinen Namen nicht genau wußte, »Monsieur Norpois«.
»Ha! ›Monsieur Norpois!‹ Ha! Das ist wirklich gut! Nur weiter so! Bald wird dieses Individuum Sie ›Citoyen Norpois‹ nennen!« rief, zu dem Baron gewandt, der Herzog von Guermantes. Endlich konnte er seiner Abneigung gegen Jupien Luft machen, der ihn mit »Monsieur« und nicht mit »Monsieur le Duc« anzureden pflegte.
Eines Tages, als Monsieur de Guermantes eine Auskunft brauchte, die mit der beruflichen Tätigkeit meines Vaters zusammenhing, hatte er sich ihm höchst
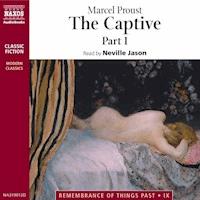
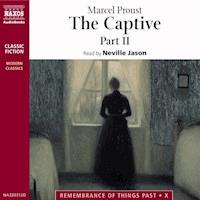
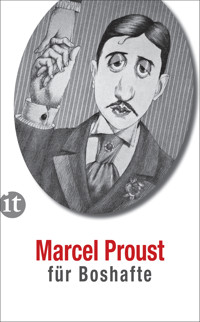
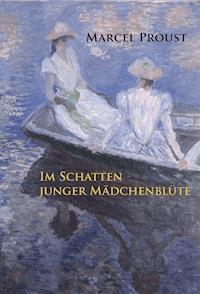
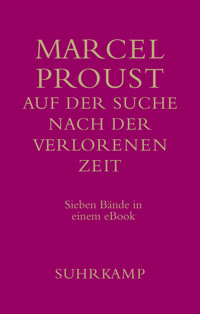
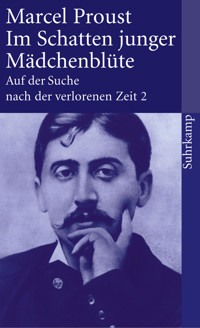
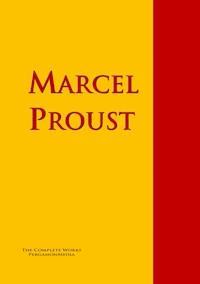
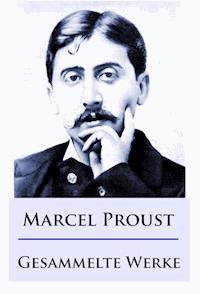
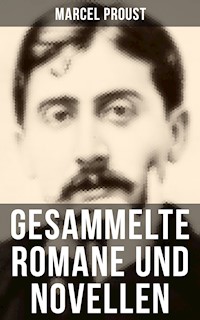

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)