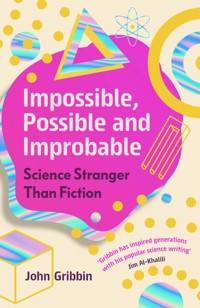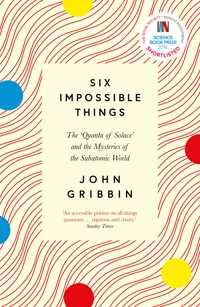9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Quantenphysik gilt als eine der größten Leistungen unserer Zeit – und als eine der erfolgreichsten. Klar und anschaulich führt John Gribbin in ihre Welt ein und erläutert von den Anfängen der Atomtheorie des 19. Jahrhunderts bis zur gegenwärtigen Forschung eine der aufregendsten Wissenschaften, ohne die weder Laser noch Computer denkbar wären.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Friedrich Griese
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
9. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95677-2
© 1984 John und Mary Gribbin Titel der englischen Originalausgabe: »In Search of Schrödinger's Cat«, Wildwood House, London 1984 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 1987 Covergestaltung: semper smile, München Covermotiv: Mendola, New York Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
»Ich mag sie nicht, und es tut mir leid, daß ich jemals etwas mit ihr zu tun hatte.«
ERWIN SCHRÖDINGER1887–1961
»Nothing is real.«
JOHN LENNON1940–1980
Danksagungen
Meine Bekanntschaft mit der Quantentheorie reicht über mehr als zwanzig Jahre bis in meine Schulzeit zurück, als ich entdeckte, wie das Elektronenschalen-Modell des Atoms auf magische Weise das periodische System der Elemente und praktisch die gesamte Chemie erklärte, mit der ich mich in so mancher langweiligen Stunde herumgequält hatte. Als ich dieser Entdeckung auf eigene Faust nachging und mir aus der Bibliothek Bücher besorgte, die angeblich für meinen bescheidenen Wissensstand »zu fortgeschritten« waren, fiel mir sofort die schöne Einfachheit der quantentheoretischen Erklärung der Atomspektren auf, und ich erlebte zum ersten Mal die Offenbarung, daß die besten Dinge in der Wissenschaft zugleich schön und einfach sind, eine Tatsache, die allzu viele Lehrer zufällig oder absichtlich vor ihren Schülern verbergen. Ich empfand dasselbe wie die Gestalt in C. P. Snows Buch The Search – das ich erst sehr viel später las –, die in etwa die gleiche Entdecckung macht: »Ein wahlloses Durcheinander von Fakten nahm vor meinen Augen plötzlich eine erkennbare Ordnung an. ›Aber es ist wahr‹, sagte ich mir. ›Es ist sehr schön, und es ist wahr.‹« (engl. Ausgabe 1963, S.27)
Diese Erkenntnis war mit für meinen Entschluß verantwortlich, Physik zu studieren. Mein Wunsch ging schließlich in Erfüllung, und ich wurde Student an der Universität von Sussex in Brighton. Dort ging jedoch die Einfachheit und Schönheit der zugrundeliegenden Ideen unter in einer Fülle von Details und mathematischen Rezepten für die Lösung spezifischer Probleme mit Hilfe der Gleichungen der Quantenmechanik. Die praktische Anwendung dieser Ideen schien mit der zugrundeliegenden Wahrheit und Schönheit genauso viel zu tun zu haben wie das Steuern einer Boeing 747 mit dem Drachenfliegen, und obwohl jene erste Erkenntnis für meine weitere Laufbahn bestimmend blieb, habe ich die Quantenwelt lange links liegen lassen und andere wissenschaftliche Weidegründe erkundet.
Es waren mehrere Faktoren, die mein ursprüngliches Interesse wieder aufleben ließen. Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre erschienen Bücher und Artikel, die sich mit unterschiedlichem Erfolg bemühten, die seltsame Welt der Quanten für Laien zu beschreiben. Diese angeblich »allgemeinverständlichen« Darstellungen waren teilweise so unerhört weit von der Wahrheit entfernt, daß ich mir nicht vorstellen konnte, wie durch ihre Lektüre auch nur ein einziger Leser die Wahrheit und Schönheit der Naturwissenschaft entdecken könnte; und so kam in mir der Wunsch auf, die Sache richtig zu machen. Außerdem erfuhr ich damals, daß man immer noch an Experimenten arbeitete, durch die mittlerweile bewiesen ist, daß einige der merkwürdigsten Erscheinungen, die aus der Quantentheorie folgen, zutreffen. Deshalb vergrub ich mich erneut in den Bibliotheken, um meine Kenntnisse von diesen merkwürdigen Dingen aufzufrischen. Schließlich wurde ich zu Weihnachten von der BBC gebeten, in einer Rundfunksendung gewissermaßen als naturwissenschaftlicher Gegenspieler von Malcolm Muggeridge aufzutreten, der kurz zuvor mitgeteilt hatte, er sei zum katholischen Glauben übergetreten. Er war bei diesem festlichen Anlaß Hauptgast. Nachdem dieser bedeutende Mann seinen Standpunkt erläutert und auf die Mysterien des christlichen Glaubens hingewiesen hatte, wandte er sich mir zu und sagte: »Aber hier ist der Mann, der alle Antworten kennt oder behauptet, alle Antworten zu kennen.«In der begrenzten Zeit, die mir zur Verfügung stand, versuchte ich, darauf einzugehen, indem ich erklärte, die Wissenschaft behaupte gerade nicht, alle Antworten zu kennen, und nicht sie, sondern die Religion stütze sich auf einen vorbehaltlosen Glauben und auf die Überzeugung, die Wahrheit zu kennen. »Ich glaube an gar nichts«, erklärte ich, und ich war gerade im Begriff, diese Auffassung zu begründen, als die Sendung zu Ende ging. Die ganze Weihnachtszeit hindurch hielten mir Freunde und Bekannte bei jeder Gelegenheit diese Worte vor und erklärten mir stundenlang, auch wenn ich an nichts vorbehaltlos glaubte, würde mich das doch nicht hindern, wie alle anderen von einer so vernünftigen Hypothese auszugehen wie der, daß die Sonne wahrscheinlich nicht über Nacht verschwindet.
So klärte sich für mich allmählich, worum es in der Naturwissenschaft überhaupt geht, und im Laufe vieler Diskussionen über die Realität oder Irrealität der Quantenwelt wurde mir bewußt, daß ich drauf und dran war, das Buch zu schreiben, das Sie jetzt in Händen halten. Während es entstand, habe ich viele der schwierigeren Gedankengänge in meinen regelmäßigen Wissenschaftsbeiträgen zu der von Tommy Vance moderierten Rundfunksendung ausprobiert, die vom British Forces Broadcasting Service ausgestrahlt wird; Toms gründliches Nachfragen deckte Mängel in meiner Darstellung auf und führte dazu, daß ich sie klarer ordnete. Das Quellenmaterial, das ich bei der Abfassung des Buches benutzte, fand ich überwiegend in der Bibliothek der Universität von Sussex, die eine der besten Sammlungen von Büchern über Quantentheorie besitzen muß; entlegenere Quellen spürte Mandy Caplin vom New Scientist, die mit Fernschreiben manches auszurichten vermag, für mich auf. Christine Sutton korrigierte eine Reihe von Mißverständnissen bezüglich Teilchenphysik und Feldtheorie. Meine Frau war mir nicht nur durch ihre Literaturrecherchen und die Organisation des Stoffes eine wesentliche Hilfe, sondern sie hat auch viele holprige Ausdrücke und Ungereimtheiten beseitigt, die noch in meinen Erläuterungen steckten, obwohl sie den Filter von Tommy Vances intelligenter Unwissenheit passiert hatten.
Falls man Vorzüge an diesem Buch findet, so liegt das Verdienst daran bei den »fortgeschrittenen« Lehrbüchern der Chemie, die ich mit 16Jahren in der Bibliothek des Kent County fand und an deren Titel ich mich nicht mehr erinnere; den irreführenden »allgemeinverständlichen Darstellungen« der Quantentheorie, die mich zu der Überzeugung brachten, daß ich es besser könnte; Malcolm Muggeridge und der BBC; der Bibliothek der Universität von Sussex; Tommy Vance und dem BFBS; Mandy Caplin und Christine Sutton; und besonders bei Min. Etwaige Beschwerden über die noch verbliebenen Mängel des Buches sind natürlich an mich zu richten.
John Gribbin
Einleitung
Würde man alle Bücher und Artikel, die dem Laien die Relativitätstheorie erklären sollen, aneinander legen, so würden sie vermutlich bis zum Mond reichen. »Jeder weiß«, daß Einsteins Relativitätstheorie die größte Errungenschaft der Wissenschaft des 20.Jahrhunderts ist, und jeder irrt sich. Würde man dagegen alle Bücher und Artikel, die dem Laien die Quantentheorie erklären sollen, aneinander legen, so würden sie gerade meinen Schreibtisch bedecken. Was nicht heißt, daß man außerhalb der Gelehrtenwelt noch nichts von der Quantentheorie gehört hätte. In manchen Kreisen ist die Quantenmechanik sogar sehr populär geworden; man erklärt mit ihr Erscheinungen wie die Telepathie oder das Löffelbiegen, und für eine Reihe von Science-Fiction-Stories hat sie fruchtbare Ideen geliefert. In der Alltagsmythologie wird die Quantenmechanik, sofern man überhaupt etwas von ihr weiß, mit dem Okkulten und der außersinnlichen Wahrnehmung in Verbindung gebracht; man sieht in ihr einen sonderbaren, esoterischen Wissenschaftszweig, den keiner versteht und keiner praktisch anwenden kann.
Das vorliegende Buch wurde geschrieben, um dieser Einstellung zu dem in Wirklichkeit grundlegendsten und bedeutendsten Gebiet wissenschaftlicher Forschung entgegenzutreten. Das Buch verdankt seine Entstehung mehreren Faktoren, die im Sommer 1982 zusammentrafen. Erstens war ich gerade mit Spacewarps, einem Buch über die Relativitätstheorie, fertig geworden, und nach meiner Überzeugung war es nun an der Zeit, auch das andere große Gebiet der Wissenschaft des 20.Jahrhunderts zu entmystifizieren. Zweitens ärgerte ich mich damals zunehmend über die falschen Vorstellungen, die sich unter Nichtwissenschaftlern ausbreiteten, nachdem Fritjof Capra mit seinem ausgezeichneten
Buch Das Tao der Physik Nachahmer angeregt hatte, die weder von Physik noch von Tao etwas verstanden, aber glaubten, mit der Verbindung von westlicher Wissenschaft und östlicher Philosophie Geld machen zu können. Schließlich wurde im August 1982 aus Paris gemeldet, einem Forscherteam sei ein entscheidendes Experiment gelungen, das für diejenigen, die noch immer Zweifel hatten, die Richtigkeit der quantenmechanischen Beschreibung der Welt bestätigte.
Prolog: Nichts ist real
Die Katze aus unserem Titel ist ein fiktives Tier, doch Schrödinger war ein realer Mensch. Erwin Schrödinger war ein österreichischer Wissenschaftler, der Mitte der 20er Jahre unseres Jahrhunderts dazu beigetragen hat, die Gleichungen eines Wissenschaftsgebietes zu entwickeln, das wir heute als Quantenmechanik bezeichnen. Wissenschaftsgebiet ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, denn die Quantenmechanik ist die Grundlage aller modernen Naturwissenschaft. Die Gleichungen beschreiben das Verhalten sehr kleiner Objekte – die, allgemein gesagt, so groß wie ein Atom oder kleiner sind –, und sie allein machen die Welt des sehr Kleinen verständlich. Ohne diese Gleichungen könnten die Physiker keine Atomkraftwerke (oder Atombomben) planen, keine Laser bauen, nicht erklären, warum die Sonne nicht erkaltet. Ohne die Quantenmechanik wäre die Chemie noch im dunklen Mittelalter, und von der Molekularbiologie, vom Verstehen der DNS und von Gentechnik könnte gar keine Rede sein.
Die Quantentheorie ist die größte wissenschaftliche Errungenschaft; sie ist weitaus bedeutsamer und von sehr viel direkterem praktischem Nutzen als die Relativitätstheorie. Dabei macht sie einige ganz merkwürdige Vorhersagen. Die Welt der Quantenmechanik ist in der Tat so merkwürdig, daß sogar Albert Einstein sie unverständlich fand und sich weigerte, sämtliche Implikationen der von Schrödinger und seinen Kollegen entwickelten Theorie anzuerkennen. Einstein und mit ihm viele Wissenschaftler fühlten sich wohler in der Annahme, die Gleichungen der Quantenmechanik seien so etwas wie ein mathematischer Kunstgriff, der für das Verhalten atomarer und subatomarer Teilchen zufällig einen leidlich brauchbaren Anhaltspunkt liefert, der jedoch eine tiefere Wahrheit verbirgt, die eher der Realität in unserem üblichen Sinne entspricht. Der Quantenmechanik zufolge ist nämlich nichts real, und wir können nichts über das Verhalten von Dingen aussagen, die wir nicht beobachten. Schrödingers sagenumwobene Katze zitiert man, um die Unterschiede zwischen Quantenwelt und der gewöhnlichen Welt zu verdeutlichen.
In der Welt der Quantenmechanik gelten die physikalischen Gesetze, die wir aus der uns vertrauten Welt kennen, nicht mehr. Die Vorgänge werden vielmehr durch Wahrscheinlichkeiten bestimmt. Nehmen wir zum Beispiel ein radioaktives Atom; vielleicht zerfällt es und emittiert dabei, sagen wir, ein Elektron, vielleicht aber auch nicht. Mit einer bestimmten Versuchsanordnung kann man eine Wahrscheinlichkeit von genau fünfzig Prozent dafür erreichen, daß eines der Atome einer radioaktiven Substanz innerhalb einer bestimmten Frist zerfällt und daß der Zerfall, wenn es tatsächlich zu ihm kommt, von einem Detektor registriert wird. Schrödinger, der über die Folgerung der Quantenmechanik genauso beunruhigt war wie Einstein, wollte ihre Absurdität aufzeigen und ersann ein Gedankenexperiment, bei dem sich in einem abgeschlossenen Raum oder Behälter eine lebende Katze sowie eine Phiole mit Gift befindet. Falls der radioaktive Zerfall tatsächlich stattfindet, zerbricht die Phiole und die Katze stirbt. In der gewöhnlichen Welt besteht eine Wahrscheinlichkeit von fünfzig Prozent, daß die Katze getötet wird, und man kann, ohne in den Behälter hineinzuschauen, ganz getrost sagen, daß die Katze darin entweder tot oder lebendig sein wird. Aber hier stoßen wir auf die Merkwürdigkeit der Quantenwelt. Nach der Theorie ist keine der beiden Möglichkeiten, die für die radioaktive Substanz und damit für die Katze bestehen, in irgendeiner Weise real, sofern sie nicht beobachtet wird. Der Atomzerfall hat weder stattgefunden, noch hat er nicht stattgefunden, und die Katze ist weder getötet worden, noch ist sie nicht getötet worden, sofern wir nicht in den Behälter hineinschauen, um zu sehen, was passiert ist. Ein Theoretiker, der die unverfälschte Quantenmechanik vertritt, würde sagen, die Katze befinde sich in einem unbestimmten Zustand, sie sei weder tot noch lebendig, solange nicht ein Beobachter in dem Behälter nachschaut, wie sich die Dinge entwickeln. Nichts ist real, falls es nicht beobachtet wird.
Für Einstein und andere war diese Vorstellung ein Greuel. »Der Herrgott würfelt nicht«, sagte er im Hinblick auf die Theorie, nach der die Welt eine Ansammlung der Resultate von im Grunde willkürlichen »Entscheidungen« auf der Quantenebene ist. Davon, daß Schrödingers Katze sich in einem unwirklichen Zustand befindet, wollte er nichts wissen; er meinte, den Dingen müsse ein »Uhrwerk« zugrunde hegen, das dafür sorgt, daß sie in einem ganz fundamentalen Sinne Realität besitzen. Er hat jahrelang über Versuche nachgegrübelt, durch die sich das Wirken dieser fundamentalen Realität zeigen lassen sollte, aber erst nach seinem Tode wurde es möglich, einen entsprechenden Versuch durchzuführen. Vielleicht ist es gut so, daß er nicht mehr erlebt hat, wohin eine der von ihm angeregten Überlegungen führt.
Im Sommer 1982 schloß ein Forscherteam unter der Leitung von Alain Aspect an der Universität Paris-Sud eine Reihe von Experimenten ab, welche die fundamentale Realität unter der unwirklichen Welt der Quanten auf decken sollten. Der Realität, die allem zugrunde hegt – dem fundamentalen Uhrwerk –, hatte man den Namen »verborgene Variablen« gegeben. Bei dem Experiment ging es um das Verhalten von zwei Photonen, also Licht»teilchen«, die von einer Quelle in entgegengesetzter Richtung davonfliegen. Im zehnten Kapitel werden wir das Experiment, das im wesentlichen als ein Prüfstein für die Realität aufgefaßt werden kann, ausführlich beschreiben. Die beiden Photonen aus einer einzigen Quelle können mit Hilfe von zwei Detektoren beobachtet werden, die eine Polarisation genannte Eigenschaft messen. Der Quantentheorie zufolge existiert diese Eigenschaft nicht, solange sie nicht gemessen wird. Nach der Vorstellung von »verborgenen Variablen« weist aber jedes Photon vom Augenblick seiner Erzeugung an eine »wirkliche« Polarisation auf. Da die beiden Photonen gleichzeitig emittiert werden, besteht zudem ein Zusammenhang zwischen ihrer jeweiligen Polarisation. Die Art des Zusammenhangs, die tatsächlich gemessen wird, hängt jedoch davon ab, welche der beiden erwähnten Realitätsvorstellungen man vertritt. Die Ergebnisse dieses entscheidenden Experiments waren eindeutig. Man fand nicht jenen Zusammenhang, der nach der Theorie von den verborgenen Variablen zu erwarten war, sondern im Gegenteil den Zusammenhang, den die Quantenmechanik vorhersagte. Außerdem stellte man fest, daß die Messung, die an einem Photon vorgenommen wird, sich – wie ebenfalls von der Quantentheorie vorhergesagt – direkt auf die Eigenschaften des anderen Photons auswirkt. Beide sind unentwirrbar durch eine Wechselwirkung miteinander verbunden, obwohl sie sich mit Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernen und wir aus der Relativitätstheorie wissen, daß kein Signal sich schneller als Licht fortpflanzen kann. Die Experimente beweisen, daß es eine der Welt zugrunde liegende Realität an sich nicht gibt. »Realität« im üblichen Sinne ist keine angemessene Vorstellung über das Verhalten der fundamentalen Teilchen, aus denen das Universum sich zusammensetzt. Andererseits scheinen diese Teilchen gleichzeitig unzertrennlich in einem unteilbaren Ganzen verbunden zu sein, so daß jedes weiß, was mit den übrigen geschieht.
Die Suche nach einer Erklärung für das Verhalten von Schrödingers Katze war die Suche nach der Quanten-Realität. Nach diesem kurzen Abriß könnte man meinen, die Suche sei fruchtlos gewesen, da es eine Realität im üblichen Sinne des Wortes nicht gibt. Aber damit ist die Geschichte noch nicht ganz zu Ende, und es könnte sein, daß wir auf jener Suche zu einem neuen Verständnis jener Realität gelangen, welche die herkömmliche Interpretation der Quantenmechanik übersteigt und dennoch einschließt. Es ist allerdings ein langer Weg. Er begann mit einem Wissenschaftler, den es wohl noch stärker gegraust hätte als Einstein, hätte er die Antworten sehen können, die wir inzwischen auf jene Fragen gefunden haben, über die er sich bereits den Kopf zerbrach. Isaac Newton hat, als er vor dreihundert Jahren die Natur des Lichts studierte, nicht ahnen können, daß er sich schon auf dem Wege befand, der zu Schrödingers Katzenparadoxien führt.
Erster Teil Die Quanten
»Wer über die Quantentheorie nicht entsetzt ist, der hat sie nicht verstanden.«
NIELS BOHR 1885–1962
1. Kapitel: Licht
Isaac Newton »erfand« die Physik, und die gesamte Naturwissenschaft beruht auf Physik. Gewiß hat Newton sich auf die Arbeit anderer gestützt, aber erst mit der Veröffentlichung seiner drei Bewegungsgesetze und der Gravitationstheorie vor genau 300Jahren (1687) wurde die Wissenschaft auf jenen Weg gebracht, an dessen Ende die Raumfahrt, der Laser, die Atomenergie, die Gentechnologie, das Verständnis der Chemie und noch vieles mehr stehen. Zweihundert Jahre lang herrschte unangefochten die Newtonsche Physik, die man heute die »klassische« nennt. Neue, revolutionäre Erkenntnisse führten die Physik im 20.Jahrhundert weit über Newton hinaus, aber ohne die zwei Jahrhunderte wissenschaftlichen Fortschritts wäre man wohl nie zu jenen Erkenntnissen gelangt. Dieses Buch gibt keine Wissenschaftsgeschichte, und es handelt nicht von den erwähnten klassischen Vorstellungen, sondern von der neuen Physik, der Quantenphysik. Sogar in Newtons 300Jahre altem Werk hat es jedoch schon Hinweise auf künftige Wandlungen gegeben, die weder aus seinen Untersuchungen über Planetenbewegungen und Umlaufbahnen noch aus seinen berühmten drei Gesetzen entspringen, sondern aus seinen Erkundungen über die Natur des Lichts.
Diese Gesetze erklärten, zusammen mit Newtons Gesetz der Schwerkraft, die Bahnen der Planeten um die Sonne und den Umlauf des Mondes um die Erde. Wenn man die Reibung berücksichtigte, erklärten sie auch das Verhalten von Objekten auf der Erdoberfläche und bildeten daher die Grundlage der gesamten Mechanik. Sie hatten allerdings auch verwirrende philosophische Implikationen. Gemäß Newtons Gesetzen ließ sich das Verhalten eines Teilchens auf der Grundlage seiner Wechselwirkungen mit anderen Teilchen und der auf es einwirkenden Kräfte exakt Vorhersagen. Wenn es jemals möglich wäre, Ort und Geschwindigkeit eines jeden Teilchens im Universum zu kennen, dann wäre es möglich, mit größter Präzision die Zukunft jedes Teilchens und damit die Zukunft des Universums vorherzusagen. Bedeutete das, daß das Universum wie ein Uhrwerk, das der Schöpfer einmal aufgezogen und in Gang gesetzt hatte, seine exakt vorhersagbare Bahn ablief? Newtons klassische Mechanik lieferte eine Fülle von Bestätigungen für diese deterministische Sicht des Universums, ein Bild, das allerdings für den freien menschlichen Willen oder den Zufall wenig Raum ließ. Konnte es wirklich sein, daß wir alle Marionetten sind, die auf einer vorher festgelegten Route durchs Leben gehen und im Grunde überhaupt keine Wahl haben? Die meisten Wissenschaftler ließen gern die Philosophen über diese Frage debattieren. Aber sie stellte sich wieder mit vollem Gewicht als zentrale Frage der neuen Physik des 20.Jahrhunderts.
Wellen oder Teilchen?
Da seine Physik der Teilchen ein solcher Erfolg war, ist es kaum verwunderlich, daß Newton auch das Verhalten des Lichts im Sinne von Teilchen zu erklären versuchte. Man sieht ja, daß Lichtstrahlen sich geradlinig fortpflanzen und daß Licht von einem Spiegel in ganz ähnlicher Weise abprallt wie ein Ball von einer harten Wand. Newton baute das erste Spiegelteleskop, er erklärte das weiße Licht als eine Überlagerung aller Farben des Regenbogens und leistete in der Optik noch vieles mehr. Und doch beruhten seine Theorien stets auf der Annahme, daß Licht aus einem Strom von winzigen Teilchen, Korpuskeln genannt, besteht. Wenn Lichtstrahlen die Grenze zwischen einer leichteren und einer dichteren Substanz, etwa zwischen Luft und Wasser oder Glas, überschreiten, werden sie gebeugt (deshalb scheint das Rührstäbchen in einem Glas Gin-Tonic geknickt zu sein). Die Korpuskulartheorie kann diese Brechung treffend erklären, indem sie annimmt, daß die Korpuskeln sich in der »optisch dichteren« Substanz schneller bewegen. Für das alles gab es jedoch auch schon zu Newtons Zeiten eine andere Erklärung.
Abbildung 1.1Parallele Wasserwellen, die ein kleines Loch in einer Barriere durchsetzen, pflanzen sich von dem Loch aus als kreisförmige Wellen fort, ohne daß ein »Schatten« bleibt.
Der niederländische Physiker Christiaan Huygens war ein Zeitgenosse Newtons, allerdings, da er 1629 geboren wurde, dreizehn Jahre älter. Er entwickelte die Vorstellung, daß Licht nicht ein Strom von Teilchen ist, sondern eine Welle – ähnlich wie die Wellen, die über die Oberfläche eines Sees wandern –, daß es sich aber durch eine unsichtbare Substanz fortpflanzt, den »leuchtenden Äther«. Er dachte sich, daß die Lichtwellen sich ähnlich wie die Kräuselwellen, die ein Stein hervorruft, den man in einen Teich wirft, von einer Lichtquelle aus nach allen Seiten ausbreiten. Die Wellentheorie erklärte die Beugung und die Brechung ebenso gut wie die Korpuskulartheorie. Man sagt zwar, daß Lichtwellen in einer optisch dichteren Substanz nicht schneller, sondern langsamer werden – anders als die Lichtteilchen nach Newton; doch konnte man im 17.Jahrhundert die Geschwindigkeit des Lichts nicht messen, und so konnte dieser Unterschied den Widerspruch zwischen den beiden Theorien nicht auflösen. Es gab jedoch einen entscheidenden Punkt, in dem sich die beiden Vorstellungen in ihren beobachtbaren Vorhersagen unterschieden. Wenn Licht auf eine scharfe Kante trifft, erzeugt es einen scharf begrenzten Schatten. So sollten sich auch Ströme von Teilchen, die sich in gerader Linie fortbewegen, verhalten. Eine Welle aber wird eher noch ein wenig in den Schatten hinein gebeugt – man denke an die Kräuselwellen auf einem Teich, die sich um einen Felsen herum ausbreiten. Vor 300Jahren sprachen die Tatsachen eindeutig für die Korpuskulartheorie, und die Wellentheorie wurde fallengelassen, auch wenn man sie nicht ganz vergaß. Zu Beginn des 19.Jahrhunderts hatte sich jedoch die Wertschätzung der beiden Theorien fast ins Gegenteil verkehrt.
Abbildung 1.2Auch kreisförmige Wellen, wie sie ein Stein erzeugt, wenn er in einen Teich fällt, pflanzen sich, wenn sie eine schmale Öffnung passieren, von dem Loch als Mittelpunkt aus als kreisförmige Wellen fort (und natürlich werden die Wellen, die auf die Barriere treffen, zurückreflektiert).
Im 18.Jahrhundert nahm kaum jemand die Wellentheorie des Lichts ernst. Einer der wenigen, der sie nicht nur ernst nahm, sondern sie in seinen Schriften vertrat, war der Schweizer Leonhard Euler, der führende Mathematiker seiner Zeit, der zur Entwicklung der Geometrie, der Differentialrechnung und der Trigonometrie erheblich beitrug. Die moderne Mathematik und Physik wird mit Hilfe arithmetischer Ausdrücke durch Gleichungen dargestellt; einen Großteil der Verfahren, auf denen diese arithmetische Darstellung beruht, entwickelte Euler; dabei führte er Kurzbezeichnungen ein, die sich bis heute erhalten haben – beispielsweise die Bezeichnung »pi« für das Verhältnis des Umfangs zum Durchmesser eines Kreises, den Buchstaben i für die Quadratwurzel aus Minus 1 (der wir, zusammen mit »pi«, wieder begegnen werden), und die Symbole, die von Mathematikern benutzt werden, um die Operation zu bezeichnen, die man Integration nennt. Merkwürdigerweise wird jedoch in der Encyclopaedia Britannica im Artikel über Euler seine Auffassung zur Wellentheorie des Lichts nicht erwähnt, eine Auffassung, von der ein Zeitgenosse sagte, sie werde »von keinem einzigen bedeutenden Physiker« geteilt.1 Fast der einzige bedeutende Zeitgenosse Eulers, der diese Auffassung teilte, war Benjamin Franklin, doch konnten die Physiker sie leicht ignorieren, bis der Engländer Thomas Young gleich zu Anfang des 19.Jahrhunderts und kurz danach der Franzose Augustin Fresnel neue Experimente anstellten, die von entscheidender Bedeutung waren.
Der Triumph der Wellentheorie
Young griff auf das zurück, was er über die Ausbreitung von Wellen auf der Oberfläche eines Teiches wußte, und entwarf ein Experiment, mit dem er feststellen wollte, ob Licht sich in der gleichen Weise ausbreitet. Wir wissen alle, wie eine Wasserwelle aussieht; allerdings sollte man sich eher eine Kräuselwelle als eine große Sturzwelle vorstellen, damit der Vergleich stimmt. Was eine Welle auszeichnet, ist die Tatsache, daß sie im Zuge ihrer Ausbreitung den Wasserspiegel ein wenig ansteigen und anschließend sinken läßt; der Abstand des Wellenkamms von der ruhigen Wasserfläche ist ihre Amplitude, und bei einer idealen Welle ist sie genauso groß wie die Strecke, um die der Wasserspiegel beim Weiterwandern der Welle gesenkt wird. Die Kräuselwellen, die wir mit dem Stein hervorrufen, den wir in den Teich werfen, folgen einander in einem regelmäßigen Abstand, der als Wellenlänge bezeichnet und von einem Wellenkamm bis zum nächsten gemessen wird. Um den Punkt herum, wo unser Stein ins Wasser fällt, breiten sich die Wellen kreisförmig aus, doch die Wellen auf dem Meer oder die Kräuselwellen, die der Wind auf einem See hervorruft, können eine geradlinige Form annehmen und als parallele Wellen aufeinander folgen. Ob kreisförmig oder parallel – aus der Zahl der Wellenkämme, die innerhalb einer Sekunde an einem bestimmten Punkt, etwa einem Felsen, vorbeiwandern, können wir die Frequenz der Welle entnehmen. Die Frequenz ist die Anzahl der Wellenlängen, die pro Sekunde vorbeilaufen, und daher ist die Geschwindigkeit der Welle, das Tempo, mit dem der einzelne Wellenkamm voranschreitet, gleich der Wellenlänge, multipliziert mit der Frequenz.
Abbildung 1.3Daß Wellen Ecken umrunden können, bedeutet auch, daß sie den Schatten hinter einem Hindernis rasch ausfüllen können, vorausgesetzt, das Hindernis ist nicht sehr viel größer als ihre Wellenlänge.
Das entscheidende Experiment beginnt mit parallelen Wellen, ähnlich den geradlinigen Wellen, die auf den Strand zulaufen, bevor sie sich brechen. Man kann sie sich als Wellen denken, die dadurch entstanden sind, daß in sehr großer Entfernung ein sehr großes Objekt ins Wasser gefallen ist. Wenn man vom Entstehungsort der Kräuselwellen weit genug entfernt ist, wirken die sich immer weiter ausbreitenden »Kräuselwellen« wie parallele oder ebene Wellen; denn wenn die Welle weit genug gewandert ist, kann man die Krümmung um den Punkt, von dem die Störung ausging, kaum noch erkennen. In einem Wassertank läßt sich leicht untersuchen, was mit solchen ebenen Wellen geschieht, wenn ihnen ein Hindernis in den Weg gelegt wird. Ist das Hindernis klein, so krümmen sich die Wellen um das Hindernis herum und füllen den Raum dahinter durch Beugung aus, so daß nur wenig »Schatten« verbleibt; ist das Hindernis dagegen, verglichen mit der Wellenlänge der Kräuselwellen, sehr groß, so krümmen sie sich nur ein wenig in den Schatten hinein, und ein Teil der Wasserfläche bleibt unbewegt. Wenn Licht nun eine Welle darstellt, kann man dennoch einen scharf abgegrenzten Schatten erhalten, falls man voraussetzt, daß die Wellenlänge des Lichts sehr klein ist im Vergleich zur Größe des Objekts, das den Schatten wirft.
Jetzt betrachten wir die Sache umgekehrt. Wir stellen uns ein paar hübsche ebene Wellen vor, die durch unseren Wassertank wandern, aber nicht auf ein von Wasser umgebenes Hindernis stoßen, sondern auf eine durchgehende Wand, in deren Mitte sich ein Spalt befindet. Ist der Spalt sehr viel größer als die Wellenlänge der Störung, so wird genau jener Teil der Welle, der in die Öffnung paßt, hindurchwandern und sich dahinter ein wenig verbreitern, doch zum größten Teil wird das Wasser hinter der Barriere ruhig bleiben, wie bei den Wellen, die auf die Einfahrt einer Hafenmauer treffen. Ist das Loch in der Mauer aber sehr klein, dann wirkt es wie eine neue Quelle von kreisförmigen Wellen, so als würden an dieser Stelle Steine ins Wasser geworfen. Auf der anderen Seite der Mauer breitet sich diese kreisförmige (oder, genauer halbkreisförmige) Welle über die ganze Wasseroberfläche aus, so daß kein Teil ungestört bleibt.
Abbildung 1.4Daß Licht an Kanten und kleinen Löchern gebeugt wird, läßt sich nachprüfen: An einem Spalt entsteht eine kreisförmige Welle, an einem Doppelspalt entsteht Interferenz.
Abbildung 1.5Wie Wasserwellen, die ein Loch durchsetzen, pflanzen sich die Lichtwellen hinter dem ersten Spalt »im Gleichschritt« als kreisförmige Wellen fort.
So weit, so gut. Jetzt kommen wir endlich zu Youngs Experiment. Man denke sich die gleiche Anordnung wie zuvor, einen Wassertank, in dem parallele Wellen auf ein Hindernis stoßen, das nun aber zwei kleine Löcher aufweist. In dem Gebiet hinter der Trennwand wirkt jedes der Löcher wie ein neuer Entstehungsort von halbkreisförmigen Wellen, und da diese beiden Wellenzüge von den gleichen parallelen Wellen jenseits der Wand erzeugt werden, bewegen sie sich exakt im Gleichschritt oder, wie man sagt, in Phase. Wir haben nun zwei Wellenzüge, die sich über das Wasser ausbreiten, und dadurch entsteht auf der Oberfläche ein komplizierteres Wellenmuster. Dort, wo beide Wellen den Wasserspiegel steigen lassen, erhalten wir einen höheren Wellengang; dort, wo eine Welle einen Wellenkamm und die andere ein Wellental zu erzeugen versucht, heben beide einander auf, und der Wasserspiegel bleibt unverändert. Diese Wirkungen, als konstruktive und destruktive Interferenz bezeichnet, lassen sich unschwer in einer gewissen Näherung beobachten, wenn wir zwei Steine gleichzeitig in einen Teich werfen. Falls Licht nun eine Welle ist, müßte ein entsprechendes Experiment eine ähnliche Interferenz von Lichtwellen ergeben, und genau das beobachtete Young.
Abbildung 1.6Von beiden Löchern des mit zwei Spalten versehenen Schirms breiten sich kreisförmige Wellen aus, und ihre Überlagerung ergibt auf dem Beobachtungsschirm ein Muster von Licht und Schatten – ein klarer Beweis dafür, daß Licht sich bei diesem Experiment wie eine Welle verhält.
Er warf Licht auf einen Schirm, in dem sich zwei schmale Spalte befanden. Das aus den beiden Spalten tretende Licht breitete sich hinter diesem Hindernis aus und interferierte. Falls die Analogie zum Wasser zutraf, mußte sich hinter dem Hindernis ein Interferenzmuster ergeben, also abwechselnd helle und dunkle Zonen, hervorgerufen durch konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenz der aus den beiden Spalten austretenden Welle. Als Young hinter den Spalten einen weißen Schirm aufstellte, beobachtete er genau das: ein Muster von hellen und dunklen Streifen.
Doch Youngs Experiment fand in der wissenschaftlichen Welt, besonders in Großbritannien, nicht gerade begeisterte Aufnahme. Für das wissenschaftliche Establishment war es beinahe Ketzerei und mit Sicherheit unpatriotisch, wenn man irgendeiner der Ideen Newtons widersprach. Newton war erst im Jahre 1727 gestorben, und im Jahre 1705 – weniger als hundert Jahre, bevor Young von seinen Entdeckungen berichtete – war er als erster für seine wissenschaftlichen Arbeiten in den Adelsstand erhoben worden. Für eine Entthronung des Idols war es in England noch zu früh, und so war es vielleicht richtig, daß in jener Zeit der napoleonischen Kriege ein Franzose, nämlich Augustin Fresnel diese »unpatriotische« Idee aufgriff und der Deutung des Lichts als Welle schließlich eine sichere Grundlage gab. Fresnels Arbeit erschien zwar einige Jahre nach der von Young, aber sie war vollständiger und bot für fast alle Aspekte des Verhaltens von Licht eine Wellenerklärung. Unter anderem erklärte sie ein Phänomen, das uns allen heute vertraut ist – die herrlich bunten Reflexe, die entstehen, wenn Licht auf einen dünnen Ölfilm fällt. Auch hier ist eine Interferenz von Wellen die Ursache. Ein Teil des Lichts wird von der Oberfläche des Ölfilms reflektiert, doch ein Teil dringt auch hindurch und wird von der Unterseite der Ölschicht zurückgeworfen. So entstehen zwei verschiedene Strahlen, die interferieren können. Da nun jede Farbe des Lichts einer bestimmten Wellenlänge entspricht und weißes Licht durch die Überlagerung aller Farben des Regenbogens entsteht, wird weißes Licht, das von einem Ölfilm zurückgeworfen wird, eine Vielzahl von Farben hervorrufen, denn einige Wellen (Farben) interferieren destruktiv und einige konstruktiv, je nachdem, wo sich unser Auge relativ zu dem Film befindet.
Als um die Mitte des 19.Jahrhunderts Leon Foucault, jener französische Physiker, der für das nach ihm benannte Pendel berühmt ist, den Beweis führte, daß die Geschwindigkeit des Lichts, anders als Newtons Korpuskulartheorie es vorhersagte, in Wasser geringer ist als in Luft, war das nicht mehr, als jeder vernünftige Wissenschaftler damals erwarten konnte. Inzwischen »wußte jeder«, daß Licht eine Art von Wellenbewegung ist, die sich durch den Äther, was immer das sein mochte, ausbreitet. Allerdings hätte man dennoch gern gewußt, was das genau ist, das sich da in einem Lichtstrahl »wellt«. In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte es schließlich den Anschein, als sei die Theorie des Lichts nun endlich abgeschlossen, denn der große schottische Physiker James Clerk Maxwell zeigte, daß Wellen mit der Veränderung von elektrischen und magnetischen Feldern zu tun haben. Maxwell sagte voraus, daß die elektromagnetische Strahlung abwechselnd stärkere und schwächere elektrische und magnetische Felder aufweisen werde, genau wie Wasserwellen, die im Wasserspiegel Wellenkämme und Wellentäler hervorrufen. Heinrich Hertz gelang es 1887 – vor nur hundert Jahren –, elektromagnetische Strahlung in Gestalt von Radiowellen, die den Lichtwellen ähneln, aber eine sehr viel größere Wellenlänge aufweisen, auszusenden und zu empfangen. Endlich war die Wellentheorie des Lichts vollständig, genau rechtzeitig, um durch die größte Revolution im wissenschaftlichen Denken seit der Zeit Newtons und Galileis umgestoßen zu werden. Ende des 19.Jahrhunderts hätte nur ein Genie oder ein Narr behauptet, Licht sei korpuskular. Dieses Genie oder dieser Narr war Albert Einstein; bevor wir jedoch verstehen können, warum er diesen kühnen Schritt machte, müssen wir etwas mehr über die Vorstellungen in der Physik des 19.Jahrhunderts wissen.
2. Kapitel: Atome
In populären Darstellungen der Wissenschaftsgeschichte heißt es vielfach, die Idee des Atoms gehe auf die alten Griechen zurück, auf eine Zeit, in der die Wissenschaft geboren wurde; und anschließend werden die alten Griechen dafür gepriesen, daß sie die wahre Natur der Materie schon so früh erkannt hätten. Diese Darstellung ist jedoch leicht übertrieben. Richtig ist, daß Demokrit von Abdera, der um 370v.Chr. gestorben ist, behauptet hat, die komplexe Natur der Welt ließe sich erklären, wenn alle Dinge aus verschiedenen Arten von unwandelbaren Atomen zusammengesetzt wären, wobei jede Atomart ihre eigene Form und Größe hätte, und alle Atome befänden sich in ständiger Bewegung. »Was existiert, sind allein Atome und leerer Raum; alles andere ist bloße Meinung«, schrieb er1, und später übernahmen Epikur von Samos und der Römer Lucretius Carus diese Idee. Sie war jedoch in jener Zeit nicht der Spitzenreiter unter den Theorien, mit denen die Natur der Welt erklärt wurde. Die Auffassung des Aristoteles, alles, was es im Weltall gibt, bestehe aus den vier »Elementen« Feuer, Erde, Luft und Wasser, erwies sich als sehr viel beliebter und langlebiger. Während die Idee der Atome um die Zeit von Christi Geburt weitgehend in Vergessenheit geraten war, wurden die vier Elemente des Aristoteles 2000Jahre lang akzeptiert.
Wohl benutzte der Engländer Robert Boyle im 17.Jahrhundert in seinem Werk über die Chemie den Begriff des Atoms, und Newton hatte ihn ebenfalls im Sinn, als er über Physik und Optik schrieb, doch zu einem richtigen Bestandteil des wissenschaftlichen Denkens wurden Atome erst im späten 18.Jahrhundert, als der französische Chemiker Antoine Lavoisier erforschte, warum Dinge brennen. Lavoisier identifizierte eine ganze Reihe von natürlichen Elementen, reinen chemischen Substanzen, die nicht in andere chemische Substanzen aufgespalten werden können, und er erkannte, daß das Verbrennen einfach der Prozeß ist, bei dem sich der Sauerstoff der Luft mit anderen Elementen verbindet. In den ersten Jahren des 19.Jahrhunderts stellte John Dalton die Rolle der Atome in der Chemie auf eine sichere Grundlage. Er hielt fest, daß Materie aus Atomen besteht, die ihrerseits unteilbar sind, daß alle Atome eines Elements identisch sind, daß aber die Atome der einzelnen Elemente sich (in Größe oder Form) voneinander unterscheiden; daß Atome nicht erzeugt oder zerstört werden, aber durch chemische Reaktionen neu angeordnet werden können; und daß eine chemische Verbindung aus zwei oder mehr Elementen sich aus Molekülen zusammensetzt, die jeweils von jedem der beteiligten Elemente eine kleine, feststehende Anzahl von Atomen enthalten. Das atomare Konzept der materiellen Welt, so wie es heute in Schulbüchern gelehrt wird, entstand also vor weniger als 200Jahren.
Was man im 19.Jahrhundert über das Atom dachte
Gleichwohl fand die Idee bei den Chemikern des 19.Jahrhunderts zunächst nur zögernd Anklang. Joseph Gay-Lussac bewies experimentell, daß bei der Verbindung zweier gasförmiger Substanzen die Volumina der beiden Gase sich stets in einer einfachen Proportion zueinander verhalten. Ist die entstandene Verbindung ebenfalls ein Gas, so verhält sich das Volumen dieses dritten Gases ebenfalls in einer einfachen Proportion zu den beiden anderen. Das stimmt mit der Vorstellung überein, daß jedes Molekül der Verbindung aus einem oder zwei Atomen des einen und aus wenigen Atomen des anderen Gases zusammengesetzt ist. Der Italiener Amadeo Avogadro leitete aus diesem Beweis im Jahre 1811 seine berühmte Hypothese ab, daß ein bestimmtes, mit Gas gefülltes Volumen bei gleicher Temperatur und gleichem Druck immer die gleiche Anzahl von Molekülen enthält, unabhängig von der chemischen Natur des Gases. Später wurde durch Experimente bewiesen, daß Avogadros Hypothese richtig ist; man kann beweisen, daß jeder Liter Gas bei einem Druck von einer Atmosphäre und einer Temperatur von 0°C ungefähr 27000Milliarden Milliarden (27×1021) Moleküle enthält. Doch erst nach 1850 entwickelte Stanislao Cannizzaro, ein Landsmann Avogadros, die Idee soweit, daß sie nicht mehr von nur einigen Chemikern ernst genommen wurde. Trotzdem gab es noch um 1890 viele Chemiker, die die Vorstellungen von Dalton und Avogadro nicht anerkannten. Sie waren aber inzwischen von der Entwicklung der Physik überholt worden, denn der Schotte James Clerk Maxwell und der Österreicher Ludwig Boltzmann hatten mit Hilfe des Atomkonzepts das Verhalten von Gasen in wesentlichen Einzelheiten erklärt.
In den 60er und 70er Jahren des 19.Jahrhunderts hatten diese Pioniere die Idee entwickelt, daß ein Gas aus sehr vielen (wieviele, davon gibt die aus Avogadros Hypothese abgeleitete Zahl eine gewisse Vorstellung) Atomen oder Molekülen besteht, die man sich als kleine harte Kugel vorstellen kann. Sie hüpfen in dem Behälter, in dem das Gas sich befindet, herum und prallen aufeinander und gegen die Behälterwände. Hier ergab sich ein direkter Zusammenhang mit der Vorstellung, daß Wärme eine Form von Bewegung ist: Wenn ein Gas erhitzt wird, bewegen sich die Moleküle schneller, wodurch der Druck auf die Wände des Behälters wächst, und wenn die Wände nicht starr sind, dehnt sich das Gas aus. Das Entscheidende an diesen neuen Ideen war, daß man das Verhalten eines Gases dadurch erklären konnte, daß man die Gesetze der Mechanik – die Newtonschen Gesetze – in einem statistischen Sinne auf eine sehr große Zahl von Atomen oder Molekülen anwandte. Gleichgültig, in welche Richtung ein einzelnes Molekül des Gases sich irgendwann bewegt, die Gesamtwirkung vieler Moleküle, die in jeder Sekunde gegen die Wände des Behälters prallen, erzeugt einen konstanten Druck. Daraus entwickelte sich eine mathematische Beschreibung der Vorgänge in Gasen, die man als statistische Mechanik bezeichnet. Es gab aber noch immer keinen direkten Beweis für die Existenz von Atomen; einige führende Physiker jener Zeit wandten sich entschieden gegen die atomare Hypothese, und noch in den 90er Jahren war Boltzmann (möglicherweise irrtümlich) überzeugt, als einzelner gegen den Strom der wissenschaftlichen Meinung anzukämpfen. 1898 veröffentlichte er seine detaillierten Berechnungen in der Hoffnung, »daß, wenn man wieder zur Gastheorie zurückgreift, nicht allzu viel noch einmal entdeckt werden muß«2; krank und bedrückt, unglücklich über den fortgesetzten Widerstand vieler führender Wissenschaftler gegen seine kinetische Gastheorie, nahm er sich 1906 das Leben, nicht ahnend, daß ein unbekannter Theoretiker namens Albert Einstein einige Monate zuvor einen Aufsatz veröffentlicht hatte, der die Realität der Atome über jeden vernünftigen Zweifel hinaus bewies.
Einsteins Atome
Dieser Aufsatz war nur einer von dreien, die Einstein 1905 in ein und demselben Band der Annalen der Physik – nämlich Band 77 – veröffentlichte, drei Aufsätze, von denen jeder ihm einen Platz in den Annalen der Wissenschaft gesichert hätte. Einer der Aufsätze – seine Darstellung würde den Rahmen dieses Buches sprengen – führte die spezielle Relativitätstheorie ein; ein anderer behandelte die Wechselwirkung von Licht mit Elektronen und wurde später als die erste wissenschaftliche Arbeit anerkannt, die sich mit dem befaßte, was wir heute Quantenmechanik nennen – im wesentlichen für diese Arbeit erhielt Einstein 1921 den Nobelpreis. Der dritte Aufsatz enthielt eine enttäuschend einfache Erklärung eines Rätsels, das die Wissenschaftler seit 1827 nicht losgelassen hatte, eine Erklärung, die, soweit ein theoretischer Aufsatz das überhaupt konnte, die Realität der Atome bewies.
Einstein hat später gesagt, sein Hauptziel sei damals gewesen, »Tatsachen zu finden, welche die Existenz von Atomen von bestimmter endlicher Größe möglichst sicherstellten«,3 eine Zielsetzung, an der man vielleicht ablesen wird, wie wichtig diese Arbeit zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts war. Zu dem Zeitpunkt, als diese Aufsätze erschienen, arbeitete Einstein als Patentprüfer in Bern – wegen seines unkonventionellen Herangehens an die Physik kam er nach dem formalen Abschluß seines Studiums nicht unbedingt für einen akademischen Posten in Frage, und die Arbeit im Patentamt behagte ihm. Sein logisches Denken befähigte ihn, unter den eingereichten Erfindungen die Spreu vom Weizen zu trennen, und da ihm die Arbeit leicht von der Hand ging, hatte er viel Zeit, um über physikalische Fragen nachzudenken, auch in den Dienststunden. Dabei befaßte er sich auch mit den Entdeckungen, die der britische Botaniker Robert Brown fast achtzig Jahre zuvor gemacht hatte. Brown hatte unter dem Mikroskop beobachtet, daß ein Pollenkorn, das in einem Tropfen Wasser schwebt, unregelmäßige, zufällige Bewegungen ausführt, die man heute als Brownsche Bewegung bezeichnet. Einstein zeigte, daß die Bewegung zwar zufällig ist, aber doch einem bestimmten statistischen Gesetz gehorcht, und daß das Verhalten genau dem entsprach, was man erwarten sollte, wenn das Pollenkorn wiederholt von unbeobachteten mikroskopischen Teilchen »angestoßen« wird, die sich gemäß der Statistik bewegen, die Boltzmann und Maxwell benutzten, um die Bewegungen von Atomen in einem Gas oder einer Flüssigkeit zu beschreiben. Heute erscheint uns das so selbstverständlich, daß wir uns kaum vorstellen können, was für einen Durchbruch dieser Aufsatz bedeutete. Für uns ist die Vorstellung, daß es Atome gibt, etwas Vertrautes, und deshalb leuchtet uns sofort ein, daß es, wenn Pollenkörner von unbeobachteten Teilchen angerempelt werden, sich bewegende Atome sein müssen, die sie herumstoßen. Doch bevor Einstein den Beweis vorgelegt hatte, konnten angesehene Wissenschaftler immer noch an der Realität der Atome zweifeln; nach dem Erscheinen seines Aufsatzes war für Zweifel kein Raum mehr. Nach der Erklärung erscheint es uns so einfach wie die Tatsache, daß der Apfel vom Baum fällt; doch wenn es so offenkundig war, warum war es dann nicht in den acht Jahrzehnten zuvor erkannt worden?
Es wirkt wie Ironie, daß dieser wissenschaftliche Aufsatz auf deutsch (in der Zeitschrift Annalen der Physik) veröffentlicht wurde, denn es scheint, als habe der Widerstand führender deutschsprachiger Wissenschaftler wie Ernst Mach, Wilhelm Ostwald und Boltzmann ihn, Einstein, zu der Ansicht gebracht, er sei ein einsamer Rufer in der Wüste. Tatsächlich gab es zu Beginn des 20.Jahrhunderts eine ganze Reihe von Beweisen für die Realität der Atome, auch wenn es, genaugenommen, nur Indizienbeweise waren; britische und französische Physiker unterstützten die Atomtheorie sehr viel überzeugter als viele ihrer deutschen Kollegen; und es war ein Engländer, Joseph John Thomson, der im Jahre 1897 das Elektron entdeckt hat, von dem wir heute wissen, daß es einer der Bestandteile des Atoms ist.
Elektronen
Im ausgehenden 19.Jahrhundert hatte es eine lange Kontroverse über die Natur der Strahlung gegeben, die entsteht, wenn in einer Röhre, aus der die Luft herausgepumpt wurde, ein Draht von elektrischem Strom durchflossen wird. Diese Kathodenstrahlen, wie man sie nannte, konnten eine Art von Strahlung sein, die durch Schwingungen des Äthers hervorgerufen wird, sich aber in ihrem Charakter sowohl von Lichtwellen als auch von den kurz zuvor entdeckten Radiowellen unterscheidet; sie konnten aber auch Ströme von winzigen Teilchen sein. Die Mehrheit der deutschen Wissenschaftler unterstützte die Idee der Ätherwellen, die Mehrheit der britischen und französischen Wissenschaftler meinte, daß die Kathodenstrahlen Teilchen sein müßten. Die Situation wurde noch zusätzlich dadurch verwirrt, daß Wilhelm Röntgen 1895 zufällig mit ihrer Hilfe die Röntgenstrahlen entdeckt hatte (1901 erhielt er für diese Entdeckung den ersten Nobelpreis für Physik), aber das lenkte, wie sich dann herausstellte, nur von der eigentlichen Frage ab. So bedeutend die Entdeckung war, sie kam in einem gewissen Sinne zu früh, nämlich bevor es einen theoretischen Rahmen der Atomphysik gab, in den die Röntgenstrahlen eingefügt werden konnten. Wir werden ihnen im weiteren Verlauf unserer Geschichte in einem logischeren Zusammenhang erneut begegnen.
Thomson arbeitete in den 80er Jahren als dritter Cavendish Professor der Physik am Cavendish Laboratorium, einem Forschungsinstitut, das Maxwell in Cambridge begründet hatte. Er entwarf ein Experiment, das darauf beruhte, die elektrischen und magnetischen Wirkungen auf ein sich bewegendes geladenes Teilchen gegeneinander auszugleichen.4 Ein solches Teilchen kann sowohl von magnetischen als auch von elektrischen Feldern von seinem Weg abgelenkt werden, und deshalb war Thomsons Apparatur so beschaffen, daß diese beiden Effekte einander aufhoben und ein Bündel von Kathodenstrahlen von einer negativ geladenen Metallplatte (der Kathode) geradlinig auf einen Detektorschirm zulief. Dieser Trick funktioniert nur bei elektrisch geladenen Teilchen; somit bewies Thomson, daß Kathodenstrahlen in der Tat negativ geladene Teilchen sind (heute als Elektronen5 bezeichnet); und aufgrund des Gleichgewichts zwischen den elektrischen und den magnetischen Kräften konnte er das Verhältnis der elektrischen Ladung eines Elektrons zu seiner Masse (e/m) berechnen. Welches Metall er auch für die Kathode benutzte, stets erhielt er das gleiche Resultat, und er zog daraus den Schluß, daß Elektronen Teile von Atomen sind und daß, obwohl verschiedene Elemente aus unterschiedlichen Atomen bestehen, alle Atome identische Elektronen enthalten.
Dies war keine glückliche Zufallsentdeckung wie die der Röntgenstrahlen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Planung und ausgeklügelter Experimente. Maxwell hatte das Cavendish Laboratorium begründet, aber unter Thomson wurde es zu einem führenden Zentrum der Experimentalphysik – zu dem führenden Physiklabor der Welt. Hier wurden hochwichtige Entdeckungen gemacht, die zu dem neuen Verständnis der Physik im 20.Jahrhundert führten. Außer Thomson selbst erhielten sieben Mitarbeiter, die in der Zeit vor 1914 unter seiner Leitung am Cavendish arbeiteten, den Nobelpreis. Das Cavendish ist bis heute ein weltweit angesehenes Forschungszentrum der Physik geblieben.
Ionen
Die Kathodenstrahlen, die in einer Vakuumröhre von der negativ geladenen Platte erzeugt werden, erwiesen sich als negativ geladene Teilchen, als Elektronen. Nun sind Atome jedoch elektrisch neutral, und daher muß es logischerweise positiv geladene Gegenstücke zu den Elektronen geben – Atome, aus denen ein Teil der negativen Ladung herausgeschlagen wurde. Wilhelm Wien von der Technischen Hochschule Aachen, später an der Universität Würzburg, war einer der ersten, der diese positiven Strahlen im Jahre 1898 erforschte. Er bewies, daß die Teilchen, aus denen sie bestehen, sehr viel schwerer sind als Elektronen, ganz so wie man es erwarten würde, wenn sie einfach Atome sind, denen ein Elektron fehlt. Nach seiner Arbeit über die Kathodenstrahlen nahm Thomson die Herausforderung an, diese positiven Strahlen in einer Reihe von schwierigen Experimenten, die sich bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts hinzogen, weiter zu untersuchen. Heute werden die Strahlen als ionisierte Atome oder einfach »Ionen« bezeichnet; früher nannte man sie Kanalstrahlen, und Thomson untersuchte sie mit Hilfe einer modifizierten Kathodenstrahlröhre, in der nach dem Einsatz der Vakuumpumpe ein wenig Gas zurückblieb. Die Elektronen, die durch dieses Gas wanderten, stießen mit dessen Atomen zusammen und schlugen andere Elektronen aus ihnen heraus, so daß die positiv geladenen Ionen zurückblieben, die mit Hilfe elektrischer und magnetischer Felder in der gleichen Weise beeinflußt werden konnten, wie es Thomson schon an den Elektronen ausprobiert hatte. Im Jahre 1913 maß Thomsons Gruppe die Ablenkung der positiven Ionen von Wasserstoff, Sauerstoff und anderen Gasen. Eines der Gase, das Thomson bei diesen Experimenten benutzte, war Neon. Eine geringe Menge Neon in einer luftleer gepumpten Röhre, durch die ein elektrischer Strom floß, glühte hell, und damit war Thomsons Apparat ein Vorläufer der modernen Neonröhre. Doch was er fand, war weit bedeutender als eine neue Art von Reklamemittel.
Es zeigte sich, daß – anders als bei den Elektronen, die alle das gleiche Verhältnis e/m haben – drei verschiedene Neon-Ionen existieren, deren Ladung genauso groß ist wie die des Elektrons (aber +e statt −e), die aber eine unterschiedliche Masse haben. Dies war der erste Beweis dafür, daß chemische Elemente vielfach Atome enthalten, die eine unterschiedliche Masse (ein unterschiedliches Atomgewicht) haben, aber in ihren chemischen Eigenschaften identisch sind. Solche Variationen über das Thema eines Elements nennt man heute »Isotope«, aber es sollte noch lange dauern, bis man für ihre Existenz eine Erklärung fand. Thomson wußte allerdings schon genug, um einen ersten Erklärungsversuch zu wagen, wie das Atom aufgebaut sein könnte: kein letztes unteilbares Teilchen, wie einige griechische Philosophen gemeint hatten, sondern ein Gemisch aus positiven und negativen Ladungen, aus denen Elektronen herausgeschlagen werden konnten.
Thomson stellte sich das Atom so ähnlich wie eine Wassermelone vor, als eine relativ große Kugel, über die die gesamte positive Ladung verteilt war, mit kleinen Elektronen, die wie Samen in sie eingebettet waren und jeweils eine geringe Menge negativer Ladung trugen. Es zeigte sich, daß er nicht recht hatte, doch gab er den Wissenschaftlern im buchstäblichen Sinne ein Ziel, auf das sie schießen konnten, und ihr Schießen führte zu einem genaueren Verständnis des Atomaufbaus. Um das nachzuvollziehen, müssen wir in der Wissenschaftsgeschichte zunächst einen Schritt zurückgehen und anschließend zwei Schritte vorwärts tun.
Röntgenstrahlen
Die Entdeckung der Radioaktivität im Jahre 1896 erwies sich als der Schlüssel zum Geheimnis des Atomaufbaus. Sie war, genau wie die Entdeckung der Röntgenstrahlen einige Monate zuvor, weitgehend ein glücklicher Zufall, allerdings in beiden Fällen ein glücklicher Zufall jener Art, wie er in irgendeinem Physiklabor zur damaligen Zeit zwangsläufig eintreten mußte. Wie viele Physiker in den 90er Jahren experimentierte auch Wilhelm Röntgen mit Kathodenstrahlen. Wenn diese Strahlen – die später als Elektronen erkannt wurden – auf ein materielles Objekt fallen, kann es sein, daß durch den Zusammenprall eine sekundäre Strahlung entsteht. Diese unsichtbare Strahlung ist nur feststellbar anhand ihrer Wirkung auf eine fotografische Platte, einen Film oder eine Gerätschaft, die man als fluoreszierenden Schirm bezeichnet, auf dem, wenn er von der Strahlung getroffen wird, eine leuchtende Spur entsteht. Bei Röntgen lag, als er mit dem Kathodenstrahl experimentierte, zufällig ein fluoreszierender Schirm auf dem Tisch, und er bemerkte sofort, daß dieser Schirm leuchtete, wenn bei dem Kathodenstrahlexperiment die Entladungsrohre in Betrieb war. So kam er zu der Entdeckung der sekundären Strahlung, die er »X« nannte, weil X traditionell die unbekannte Größe in einer mathematischen Gleichung ist. Bald konnte man zeigen, daß die X-Strahlen sich wie Wellen verhielten (heute wissen wir, daß sie eine Form der elektromagnetischen Strahlung sind, ganz ähnlich den Lichtwellen, aber mit sehr viel kürzeren Wellenlängen); und diese Entdeckung in einem deutschen Labor bestärkte die meisten deutschen Wissenschaftler in ihrer Ansicht, daß die Kathodenstrahlen ebenfalls Wellen sein müßten.
Die Entdeckung der X-Strahlen (im Englischen werden sie noch heute so bezeichnet, während wir in Deutschland – auf ursprünglich englischen Vorschlag! – »Röntgenstrahlen« sagen – Anm. d. Ü.), wurde im Dezember 1895 bekanntgegeben und erregte großes Aufsehen in der wissenschaftlichen Welt. Die Forscher bemühten sich, Röntgenstrahlen oder ähnliche Strahlungsformen auf andere Weise zu erzeugen, und der erste, dem es gelang, war Henri Becquerel, der in Paris arbeitete. Das Interessanteste an der Röntgenstrahlung war, daß sie ungehindert zahlreiche lichtundurchlässige Substanzen wie etwa schwarzes Papier durchdringen konnte, um auf einer fotografischen Platte, die nicht belichtet worden war, ein Bild zu erzeugen. Becquerel ging es um die Phosphoreszenz, die Lichtemission einer Substanz, die zuvor Licht absorbiert hat. Ein fluoreszierender Schirm wie der, der bei der Entdeckung der Röntgenstrahlen benutzt worden war, emittierte nur dann Licht, wenn er durch auftreffende Strahlung »angeregt« wurde; eine phosphoreszierende Substanz kann dagegen auftreffende Strahlung speichern und diese im Dunkeln noch Stunden danach mit nachlassender Intensität in Form von Licht abgeben. Es lag nahe, nach einem Zusammenhang zwischen der Phosphoreszenz und der Röntgenstrahlung zu suchen, doch was Becquerel entdeckte, war ebenso unerwartet, wie es zuvor die Entdeckung der Röntgenstrahlen gewesen war.
Radioaktivität
Im Februar 1896 wickelte er eine fotografische Platte in eine doppelte Lage schwarzen Papiers, beschichtete das Papier mit Uranbisulfat und Kalium und setzte das ganze mehrere Stunden lang dem Sonnenlicht aus. Nach der Entwicklung zeigte die Platte den Umriß der Beschichtung mit den Chemikalien. Becquerel glaubte, das Sonnenlicht habe, so wie es auch Phosphoreszenz erzeugt, in der Beschichtung, in einem Uransalz, Röntgenstrahlung hervorgerufen. Zwei Tage später präparierte er in der gleichen Weise eine andere Platte, um das Experiment zu wiederholen, doch an diesem und am folgenden Tag war der Himmel bedeckt, und die präparierte Platte blieb in einem Laborschrank verschlossen. Am 1.März entwickelte Becquerel diese Platte gleichwohl, und erneut fand er die Umrisse der Beschichtung mit Uransalz. Was immer es auch sein mochte, das auf den beiden Platten die Schleier hervorgerufen hatte, mit Sonnenlicht oder Phosphoreszenz hatte es nichts zu tun, sondern es war eine zuvor unbekannte Form der Strahlung, die, wie sich herausstellte, spontan, ohne irgendeinen Einfluß von außen, von dem Uran selbst ausging. Diese Fähigkeit, spontan Strahlung zu emittieren, nennen wir heute Radioaktivität.
Ende der Leseprobe