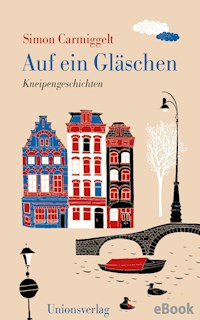
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der niederländische Kultautor Simon Carmiggelt kannte sie alle: die Kneipen Amsterdams. Selbst ein begabter Kneipengänger, schnappte er seine besten Geschichten dort auf und schrieb sie nieder. Unversehens sind dabei nicht nur Texte über Kneipen und mehr oder minder trinkfeste Zeitgenossen entstanden, sondern auch ein großes Welttheater auf kleinem Raum. Carmiggelts Kneipengeschichten sind in den Niederlanden Kult.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Der niederländische Kultautor Simon Carmiggelt kannte sie alle: die Kneipen Amsterdams. Selbst ein begabter Kneipengänger, schnappte er seine besten Geschichten dort auf und schrieb sie nieder. Unversehens sind dabei nicht nur Texte über Kneipen und mehr oder minder trinkfeste Zeitgenossen entstanden, sondern ein großes Welttheater auf kleinem Raum.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Simon Carmiggelt (1913-1987) galt als der Amsterdamer Kultautor. Seine Erzählungen von Menschen, Tieren und Alltagsmomenten begeistern noch heute durch Witz und Charme. Bekannt wurde Carmiggelt durch seine Kolumnen in populären Tageszeitungen der Niederlande.
Zur Webseite von Simon Carmiggelt.
Gerd Busse (*1959) ist neben seinem Hauptberuf als promovierter Sozialwissenschaftler seit vielen Jahren als Publizist und Übersetzer aus dem Niederländischen tätig.
Zur Webseite von Gerd Busse.
Ulrich Faure, geboren 1954 in Halle/Saale, lebt in Düsseldorf. Er ist Publizist, Lektor und Herausgeber. 1992 erschien seine Geschichte des Malik-Verlags.
Zur Webseite von Ulrich Faure.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Simon Carmiggelt
Auf ein Gläschen
Kneipengeschichten
Kronkels
Aus dem Niederländischen von Gerd Busse und Ulrich Faure
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Erzählungen dieses Bandes erschienen im Werk Alle Kroegverhalen. Kroeglopen I / Kroeglopen II, erschienen in Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969. Für diese Ausgabe wurden sie zusammengestellt von Reintje Gianotten.
Deutsche Erstausgabe
Die Übersetzung dieses Buches wurde von der niederländischen Stiftung für Literatur gefördert.
Lektorat: Anne-Catherine Eigner
© by Simon Carmiggelt 2019
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Lavandaart (Shutterstock)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31016-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 13.06.2022, 23:56h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
AUF EIN GLÄSCHEN
Das kleine GlasZwei KundenEs krachen lassenDer andereFrische LuftFachmannEin MannAbends auf ein GläschenHeulsuseDie DoseDer SchemenHerbe SchönheitFür etwas gut seinGerdaKundschaftAuf der SucheTagtraumSich lustig machenAlte WundenMütterchenVor der TürAndere ZeitenLeckeres BrotGlückDer feste StammAusblick auf einen HeringsverkäuferTschüss, ChefFreischaffendEin TräumerDas strenge NeinTitanenMordJoops UrlaubDie LeidsestraatJunger Mann mit blauem AugeZwei KäsebrötchenHerbstnachtDer Nutzen des PrassensZiellos dahinGrabspruch für JapieDie SpezisDie StilleWir lernen es nieNachwortMehr über dieses Buch
Über Simon Carmiggelt
Über Gerd Busse
Über Ulrich Faure
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Simon Carmiggelt
Zum Thema Niederlande
Das kleine Glas
Glück ist dem Dichter Jacques Bloem zufolge ein nebelverhangener Horizont, nach einem deutschen Professor ein Sich-selbst-und-die-Welt-bejahen. Viele Leute haben damit einigermaßen Mühe, sodass die Existenz geistiger Getränke auf dieser Erde, wenn auch nicht zu billigen, so doch zumindest zu erklären ist.
Nun hat jedes Volk das Getränk, das es verdient. Der Niederländer, geduckt unter die Schreckensherrschaft eines wenig erbaulichen Klimas, ist viel stärker zu einem herb-trockenen Leben verurteilt als die von der Sonne kandierten Volksstämme des Südens. Da uns die Natur so gar nicht zum wohligen Faulenzen oder anmutigen Auf-den-Putz-Hauen inspiriert, müssen wir mit unseren Pflichten Ernst machen, solange Geist und Fleisch noch mithalten. Während der Franzose oder der gebenedeite Italiener den lieben langen Tag Wein trinkt und so sein ganzes Tun und Lassen ins Zwielicht eines freundlichen Impressionismus hüllt, bleibt dem Niederländer nicht viel anderes übrig, als den dunklen Stollen bis zur Theke zu durchschreiten.
Es ist kein Zufall, dass dieser Brauch gegen siebzehn Uhr seinen Anfang nimmt. Denn zum Ende des Nachmittags, wenn sich das Tagwerk mit Anstand als beendet erklären lässt, gerät der durchschnittliche Niederländer in den gefährlichen Strudel eines depressiven Nihilismus. Er scheut den Absprung in den Abend, der Fähigkeiten voraussetzt, über die er kaum oder gar nicht verfügt, und betritt zur Überbrückung der Kluft eine Lokalität, die über eine Ausschankgenehmigung verfügt.
Der Alkohol, der in solchen Etablissements zum Verkauf angeboten und dem menschlichen Organismus zugeführt wird, scheint eine nicht aus reinen Grundstoffen bestehende Substanz zu sein. Ich halte das nur am Rande fest, um deutlich zu machen, dass das Frequentieren von Bars, Cafés und Kneipen ebenso unvernünftig sein würde wie die Einnahme von Salpetersäure oder zerstoßenem Glas, wäre nicht die aufkommende Dämmerung der Zweck, der das Mittel heiligt.
Nun habe ich mal gehört, wie das Trinken als ein »vom Dach springen mit dem Vorsatz, nur eine Etage tief zu fallen« charakterisiert wurde. Da jeder Teilnehmer an der traditionellen vaterländischen Trinkstunde tief im Herzen weiß, dass er sich während der ersten Gläser entschließt, wie viele Etagen eventuell noch hinzukommen könnten, versteckt er sich ängstlich hinter der Maske eines Menschen, der gleich brav nach Hause geht – denn anfangs kann seine noch intakte Logik es nicht über sich bringen, seine eher geheime Absicht beim Namen zu nennen.
Doch ist es allein gut organisierten Geistern gegeben, sich zu einer bestimmten Stunde zu erheben und mit einem dezenten »Guten Abend, die Herren« aufzubrechen. Der eher dionysisch veranlagte Mensch ist ein Zeitgenosse mit Sitzfleisch, der immer auf gespanntem Fuß mit der in den Niederlanden so heiligen Abendbrotzeit steht. Besser als er weiß seine Frau, wie schnell seine beim Betreten einer Kneipe durchaus bestehenden guten Vorsätze zerbröckeln. Es ist erschütternd, einen solchen Mann in Gesellschaft seiner Ehefrau während des sogenannten ersten Viertels zu beobachten.
Der Mann ist in diesem Augenblick ein außerordentlich brillanter Causeur. Er redet ohne Punkt und Komma und lässt sein Glas hin und wieder ganz beiläufig noch einmal auffüllen. Währenddessen sitzt ihm die in die Enge getriebene Frau mit ihrem Gläschen Eierlikör vor der Nase. Sie ist sich völlig sicher, dass er alles andere als jetzt mit nach Hause kommen will. Zugleich steht für sie fest, dass all dieses bemühte Geschwätz verstummen wird, sobald er genügend getrunken hat, um nicht länger auf ihre lauernde Aufsicht Rücksicht nehmen zu müssen. Zwar verkörpert sie am Anfang noch mit niederschmetternder Deutlichkeit, was vernünftig wäre. Im zweiten Viertel streift der Mann jedoch die Gewissensbisse ab, die ihr unleugbar gutes Recht anfangs noch in ihm geschürt hat. Ihm ist jetzt ein Plan eingefallen, der sein eigenes Recht nicht länger infrage stellt. Ein feines Lächeln spielt um seine Mundwinkel: Er hat die Welt überlistet und verspürt gerade noch ein leichtes Mitleid mit der beschränkten Frau, die seinem Höhenflug nicht folgen und das Heil auch fürderhin nur in pünktlich beginnenden Mahlzeiten und ähnlichen Gewohnheitshandlungen von minderer Bedeutung erblicken kann.
In diesem Augenblick ist der Trinker in höchstem Maße eins mit sich. Seine Konversation bekommt einen etwas stärkeren Anstrich, er benennt die Dinge nun sehr treffend und greift mutig nach Themen, die er sonst lieber meidet. Er ergötzt sich an seinen eigenen Formulierungen, die er ausnahmslos für erhaben hält, und produziert einen Lärm, der, objektiv betrachtet, aus ein oder zwei angreifbaren Behauptungen besteht, die unnötig oft wiederholt werden. Nur dumme und taktlose Frauen bringen diesen Einwand brüsk zum Ausdruck. So eine hellsichtige Bemerkung reißt denn auch ein riesiges Leck in die Illusion des Trinkers. Aus Selbstschutz wendet er sich nun definitiv von dem Wesen ab, das die Perlen seines Geistes verschmäht. Er ist nicht länger glücklich, sondern erbost – ein Gefühl, an das er sich klammert, um unbeherrscht und herausfordernd eine Bestellung aufzugeben.
»Willem, gib mir doch noch eins.«
Der lässige Ton des »Man kann doch nicht mit trockener Kehle reden« hat nun dem polemischen Schwadronieren eines Unverstandenen Platz gemacht, der schon weiß, dass er gegen Windmühlen kämpft.
Jetzt ist sich die Frau ganz sicher, dass es heute Abend spät werden wird. Sie macht sich von dem Mann los und schließt die Tür geräuschvoll hinter sich. Sobald sie verschwunden ist, kommt in das Verhalten des Trinkers eine gewisse Geschäftigkeit. Er schlendert herum und hält, erst mit dem, dann mit jenem ein Schwätzchen. Der Abend breitet sich vor ihm aus wie ein die verschiedensten Möglichkeiten verheißendes Abenteuer. Noch ein einziges Glas wird er hier trinken – aber dann lässt er sich in den Mantel helfen und tritt ins Freie.
Zwei Kunden
I
Abends um zehn kamen die beiden Alten in die Kneipe. Da war der Buchhalter schon gehörig in Fahrt und schwadronierte ausgiebigst an der Theke, hinter der der Wirt mit kritischem Schweigen die Gläser spülte. Er hat es nicht so mit dem Buchhalter. Der ist ihm viel zu laut. Man darf sich in seiner Kneipe zwar volllaufen lassen, aber es muss schweigend geschehen und mit einem gerade noch verständlichen »Guten Abend, die Herren« enden – das ist ein ungeschriebenes Gesetz.
Aber der Buchhalter haut jeden Tag ausufernd auf den Putz, flutet das zarte Dämmerlicht der Kneipe mit seiner schrillen Stimme und wird nur geduldet, weil er so ein guter Kunde ist.
Denn wenn er abends um sechs mit seiner Arbeit fertig ist, kommt er herein; man kann die Uhr danach stellen. Er strahlt dann eine gewisse Feierlichkeit aus, weil er sich sorgfältig in dunkle, gut geschnittene Anzüge kleidet und nach so einem Tag verbissener Pflichterfüllung noch ganz der zurückhaltend schweigende, etwas gehemmte Herr ist, für den er auch im Berufsleben durchgeht. Aber doch schon ein Herr am Rande des Brunnens, der seinen Durst löschen wird. Er fängt immer mit einem kleinen Pils an. Die Bestellung des ersten Kurzen entschlüpft ihm fünf Minuten später wie eine Beiläufigkeit. Aber dieser erste ist der Anfang einer Kette, an der er bis abends um zehn immer weiter fädelt.
Er ist dann ein vollkommen anderer Mensch geworden, gänzlich befreit von der scheuen, zwanghaften Zurückhaltung, die ihn tagsüber quält wie ein Paar zu enger Schuhe. Sein breites, ein wenig geschwollenes Gesicht strahlt vor lauter unbeschwertem Glück, das der Alkohol in ihm auslöst, und seine metallische Stimme schlägt jedem entgegen, der nicht rechtzeitig die Flucht ergreift. Den Bauchredner nennen sie ihn. Sein immer etwas frotzelnder Diskurs dominiert die ganze Kneipe, denn die Trinker seiner Altersklasse sind längst zu Hause, und das restliche Dutzend besteht aus schweigsamen Männern, die das Gassigehen ihres korpulenten Hundes mit einem heimlichen Schnäpschen verbinden, oder betagte Ehepaare, die eine Runde gedreht haben und noch ein Glas Bier trinken wollen, ehe sie ins Bett gehen.
Die beiden Alten gehörten zur letzten Kategorie. Sie kamen um zehn Uhr – vorneweg die Frau, in Ehren ergraut, und der Mann, ein kleiner, schmächtiger Opa mit einer Brille aus Flaschenbodengläsern, den ein bloßer Hauch umstoßen könnte, wackelte hinterdrein. Sie boten den entwaffnenden Anblick von Menschen, die ihr Leben nach bestem Wissen aufgebraucht hatten und jetzt nur noch ein bisschen herumbummeln und in Gottvertrauen auf das Ende warten.
»Ach, da haben wir Muttern!«, rief der Buchhalter mit schriller, übermütiger Stimme. »Muttern geht heute Abend aus. Muttern will sich zu einem jungen Burschen setzen. Jaja, ich weiß schon. Muttern braucht auch mal was Frisches, stimmts? Also, ich regele das mal für dich. Warte ein Momentchen. Halt einen Platz frei, wenns recht ist!«
Die alte Frau war, ein bisschen verdattert von dem ganzen unerwarteten Jahrmarktgeschrei, auf den Hocker geklettert. Der Buchhalter nahm einen seiner gierigen Schlucke und rief mit einem völlig entspannten Grinsen auf seinem runden Gesicht: »Jetzt pass mal auf, Muttchen. Halte den zweiten Platz schön frei. Sonst setzt sich der Alte da wieder zu dir!«
Die Frau sah kurz zu ihrem zerknitterten Ehemann hinüber. Dann sagte sie mit einer Stimme voll naivem Stolz: »Er liegt bald neben mir.«
II
Herr Geurs arbeitet bei einer Bank. Seit Jahren schon sitzt er in einer Ecke und verrichtet etwas sehr Geräuschloses. Wenn der Tag wieder einmal geschafft ist, spaziert er in seine Kneipe und trinkt drei Schnäpse. Er redet dabei nicht viel – lacht höchstens, wenn es angemessen ist. Punkt sechs steigt er die schmale Treppe zu Frau Smit hinauf und nimmt die Mahlzeit ein, die sie ihm vorsetzt.
Denn Herr Geurs wohnt als Untermieter bei Frau Smit. Als ihr Mann, ein lebenslustiger Handelsreisender mit Hang zu halbseidenen Anzügen, vor Jahren eines bösen Tages bei Nacht und Nebel verduftet war, hatte sie eine Anzeige für einen anständigen Kostgänger geschaltet und sich Herrn Geurs eingefangen. Für eine Zimmerwirtin ist er ein Geschenk des Himmels, denn er liest und schweigt, geht früh zu Bett und isst alles, was man ihm hinstellt.
Die Nachbarschaft meint, dass sie mal heiraten sollten, und die beiden selbst finden das eigentlich auch, aber es ist so mühselig, die Atmosphäre zu schaffen, die zu solch einem Willensakt führen könnte. Sie versuchen es wieder und wieder. Dann geht an einem Samstagabend die Kneipentür auf, und sie kommen zusammen herein, Frau Smit ein bisschen herausgeputzt, Herr Geurs genau wie immer, aber mit einem frischen Kragen.
Und es wird getrunken – das Übliche für ihn und Zitronenjenever mit Zucker für sie. Der Wirt bringt die Getränke auf Zehenspitzen, denn er weiß, dass etwas sehr Bedeutendes in seinem Hause vorgeht. Nach dem vierten Glas wird Herr Geurs etwas lockerer und beginnt mit leiser Stimme zu sprechen.
»Griechenland«, sagt er dann, »das ist das Älteste vom Ältesten. Die Griechen hatten eine Hochkultur. Leute, denen es gut ging, lebten in prächtigen Palästen. Aber die sind alle kaputtgegangen durch die Kriege und Revolutionen, die da gewütet haben.«
»Menschen sind wie Kinder«, sagt Frau Smit bedauernd. »Alles machen sie kaputt.«
»Alle möglichen Götter haben sie angebetet«, nimmt Herr Geurs ermutigt den Faden wieder auf, »und an Philosophen herrschte kein Mangel. Sokrates – der konnte reden wie ein Weltmeister, den hat keiner vom Thron gestoßen. Und Plato war auch ein sehr großer Philosoph.«
Glücklich lächelnd leert er sein Glas.
»Dafür muss man sicher viel studieren«, sagt Frau Smit ehrfürchtig. »Aber man muss es schon mögen, all die Bücher zurate zu ziehen. Mich würde das total verrückt machen. Die Buchstaben würden anfangen, vor meinen Augen zu tanzen.«
Dann wird erneut etwas bestellt. Und noch etwas. Die ganze Kneipe sieht wohlwollend zu. Gegen elf läuft es wie geschmiert. Schon etwas benebelt, greift Herr Geurs sein Thema wieder auf: »Theseus … und jetzt komme ich auf die Halbgötter zu sprechen …«
Aber fast jedes Mal ungefähr zu dieser Stunde beginnt Frau Smit, ein wenig herumzukrakeelen: »Dieser Halunke! Einfach so abzuhauen! Und ich habe ihn verhätschelt wie einen kleinen Prinzen …«
Denn die Zitronenjenever mit Zucker haben ihre Schweigsamkeit hinweggespült, und bis zur Sperrstunde muss sich Herr Geurs alles über den sauberen Herrn Handelsreisenden anhören – wie er tanzen konnte und Witze reißen und was er alles mitbrachte von der Reise.
Während der Wirt bekümmert die nutzlos gewordenen Gläser bringt, sitzt der Herr Geurs wieder für viele Wochen zugeknöpft da und nickt wohlmeinend. Doch erst, als sie gehen, macht er hinter ihrem Rücken die bittere »Na bitte?«-Geste, der der Wirt mit einem niedergeschlagenen Kopfnicken beipflichtet.
Es krachen lassen
Als die Band einen Cha-Cha-Cha anstimmte, stellte der Kellner die im Eiskübel lehnende Flasche mit dem feierlichen Ernst auf den Tisch, den eine Bestellung für fünfzig Gulden erheischt. Das Mädchen, das seine Brigitte-Bardot-Frisur wie eine kohlrabenschwarze Elefantitiswucherung am Hinterkopf mit sich herumschleppte, warf einen kalten, triumphierenden Blick darauf, und der Mann, sehr dick und sehr betrunken, versuchte, mit baronesker Würde aus Augen zu schauen, die so klein und schmierig waren, dass Mutter sie mit einer nassen Spitze des Handtuchs sauber gewischt hätte. Mit umständlichem Mienenspiel, wie ein Chirurg bei der Operation, begann der Kellner mit dem Entkorkungsritual. Der Mann hob eine kleine pummelige Hand und sagte: »Lassehn.«
»Was wünschen der Herr?«
»Dass er sie sehen will«, dolmetschte das Mädchen.
Der Kellner hob die Flasche aus dem rasselnden Eis, zärtlich, wie eine Mutter ihr Baby herumzeigt. Dösig sah der Mann auf das Etikett.
»Dassis okay«, sagte er.
Der Kellner deutete eine kleine Verbeugung an, als hätte man ihm persönlich ein Kompliment gemacht. Fachmännisch mit der Serviette hantierend, löste er das Goldpapier und betastete den Drahtverschluss, der den Korken festhielt, so behutsam, als berühre er empfindliche innere Organe. Sein glattes Gesicht zeigte den Ausdruck eines Menschen, der in eine höchst gewichtige Arbeit versunken ist. Währenddessen dachte er: »Der Sack. Zeigt man ihm ein Witzetikett, und er findet es auch noch okay. Der Herr Weinkenner. Wird gleich preziös an dem moussierenden Dreck nippen, den sich der Lebensmittelhändler nicht für einen Heiermann zu verkaufen trauen würde …«
Er hatte den Drahtverschluss längst gelöst. Jetzt kam der Trick mit dem Korken. Echter Champagner knallt, aber bei diesem billigen Gesöff klappte das nicht, sodass das Personal den feierlichen Moment mimisch nachstellen musste. Hastig zog er die Flasche aus dem Eis, schaute panisch, drehte sich halb um und zog den Korken ganz normal heraus, aber so, dass die beiden am Tisch seinen Rücken kurz erschüttern sahen. Er hatte einen Kollegen, der bei dieser Gelegenheit auch noch mit der Zunge schnalzte, aber das ging ihm zu weit. Eilfertig schenkte er einen kleinen Schluck in ein Glas, wandte sich wieder dem Kerl zu und begann mit der Vorverkostungsnummer. Sie sahen ihn beide an, das Mädchen herrisch, der Mann leicht mit dem Kopf wackelnd und blinzelnd, er versuchte hartnäckig, zwei unscharfe Bilder zu einem zu verschmelzen. Jetzt hatte der Kellner die Flüssigkeit auf der Zunge, ließ sie kurz durch die Mundhöhle wandern und schluckte sie dann mit einem sich betont bewegenden Adamsapfel herunter. Er schaute sehr introvertiert, als würde er in die eigene Seele horchen. Fragend zog er kurz die Augenbrauen hoch, offenbar einen fürchterlichen Moment lang in grässlichem Zweifel. War mit dem Champagner etwas nicht in Ordnung? Er nahm noch ein Schlückchen und machte dann der Anspannung ein Ende, indem er freudige Entzückung über sein Antlitz huschen ließ. Behutsam schenkte er jetzt dem Mann ein bisschen ein.
Der griff erst neben das Glas, bekam es dann zu fassen und stürzte den Inhalt hinunter. In einem Magen voller Bier, Whisky und Jenever konnte dieser armselige Tropfen weiter keinen Schaden anrichten.
»Dassis okay«, sagte er. »Leckeres Tröpfchen.«





























