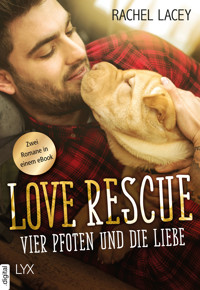4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love to the rescue
- Sprache: Deutsch
Chronisch pleite tut Merry alles, um ihre Organisation zur Rettung von Hunden vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Da kommt ihr das Angebot von T.J. gerade recht, der verzweifelt eine Tiertherapeutin für sein Sommercamp sucht. Ehe er sichs versieht, hat der attraktive Veterinär nicht nur Merry engagiert, sondern auch eine Promenadenmischung bei sich zu Hause aufgenommen. Einziges Problem: T.J. hat panische Angst vor Hunden ...
Herzerwärmende Liebesgeschichten voller Romantik und Humor - die Love to the rescue Reihe von Rachel Lacey:
Band 1: Kein Plan für die Liebe
Band 2: Auf vier Pfoten ins Glück
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:
be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Chronisch pleite tut Merry alles, um ihre Organisation zur Rettung von Hunden vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Da kommt ihr das Angebot von T. J. gerade recht, der verzweifelt eine Tiertherapeutin für sein Sommercamp sucht. Ehe er sichs versieht, hat der attraktive Veterinär nicht nur Merry engagiert, sondern auch eine Promenadenmischung bei sich zu Hause aufgenommen. Einziges Problem: T. J. hat panische Angst vor Hunden …
RACHEL LACEY
Auf vier Pfoten ins Glück
Aus dem amerikanischen Englisch von Katrin Mrugalla und Richard Betzenbichler
Für meinen Boxer Lacy, ebenfalls von einer Rettungsorganisation. Du bist einmalig.
1
Merry Atwater tat etwas, was sie seit Ewigkeiten nicht mehr getan hatte: Sie schloss die Augen, faltete die Hände und betete. Sie wollte tatsächlich mit Gott sprechen. Ob der alte Knabe ihr zuhörte? Sie glaubte es eigentlich nicht, aber sie war nun einmal maßlos verzweifelt.
Als sie die Augen wieder öffnete, hatten sich die Zahlen auf dem Schirm ihres Laptops natürlich nicht verändert. Sie hatte auch nicht geglaubt, dass Gott das Konto des Triangle Boxer Rescue ausgleichen würde, aber ließ er nicht manchmal Wunder geschehen? Sie musste jedenfalls der Wahrheit ins Auge sehen: Die Organisation zur Rettung von Boxern, in die sie die letzten sechs Jahre ihre ganze Kraft gesteckt hatte, war komplett pleite.
»Was soll ich nur tun?« Grübelnd stützte sie das Kinn in die Hände.
Ralph, ihr sechsjähriger Boxer, rückte auf der Couch näher. Er legte ihr den Kopf in den Schoß und blickte zu ihr auf, mit sehnsüchtigen braunen Augen. Hinter ihm lagen ihre beiden Pflegehunde Chip und Salsa, zwei Welpen, übereinander. Alle miteinander füllten sie fast die ganze Couch aus, aber das störte Merry nicht im Geringsten. Sie genoss es, eine mit lauter glücklichen Hunden gefüllte Couch zu haben, besonders weil sie wusste, dass sie jeden von ihnen vor einer ungewissen Zukunft im Tierheim gerettet hatte. Nun konnten sie sich alle an einem sicheren Ort ihres Lebens freuen.
Sie hatte das TBR damals als zweiundzwanzigjährige, frisch ausgebildete Krankenschwester in der kleinen Stadt Dogwood, North Carolina, gegründet, weil sie geradezu süchtig danach war, den Hunden zu helfen, die sie so sehr lieben gelernt hatte. Seit damals hatte sie so viel Zeit und schwer verdientes Geld wie möglich für die Rettung verlassener und misshandelter Hunde aufgewendet.
Und am Anfang war sie auch erfolgreich gewesen. Bis vor ein paar Jahren hatte sie monatlich regelmäßig tausend Dollar von einem unbekannten Wohltäter erhalten. Erfolglos hatte sie versucht herauszubekommen, wer hinter den milden Gaben steckte, und schließlich war sie von ihnen richtig abhängig geworden. Aber dann, vor sechs Monaten, war der Geldfluss versiegt, das Konto ihrer Organisation war leer gefegt, und sie hatte ihre Kreditkarte bis zum größtmöglichen Betrag belastet, um das Minus auszugleichen.
Zerstreut zog sie mit einem Finger das Zickzackmuster auf ihrer Pyjamahose nach. Es war fast neun Uhr, und sie beschloss, es jetzt gut sein zu lassen. Morgen stand ihr eine Zwölf-Stunden-Schicht bevor, und dafür brauchte sie ihren Schlaf.
In dem Moment wurde leise an die Tür geklopft. Ralph hob den Kopf und bellte müde, Chip und Salsa ließen sich von der Couch fallen und landeten auf wackligen Beinen.
Merry hielt die Luft an. Hatte Gott ihr Gebet schließlich doch erhört? Stand ein Retter vor der Tür, der TBR vor dem finanziellen Ruin rettete?
Wahrscheinlich eher nicht, aber sie war nun einmal eine Frau, für die ein halb leeres Glas immer halb voll war.
»Einen Moment«, rief sie und sperrte die beiden Welpen hinter der Gittertür in der Küche weg. Mit Ralph ging sie zur Tür und sah durch das Guckloch. Sie wollte nicht einfach so aufmachen, nachdem sie schon im Pyjama steckte.
Draußen stand eine Frau in einem lila Tanktop und Jeansshorts. Ihre lockigen Haare klebten an ihren Wangen, nass vom Regen, der außerhalb der überdachten Terrasse vom Himmel strömte. Irgendwie kam sie Merry bekannt vor. Vielleicht war es eine Nachbarin.
Merry machte die Tür auf. Ralph bellte kräftig und fixierte den verwahrlosten Hund an der Seite der Frau. Der schien eine Labradormischung zu sein, mit nassem, bernsteinfarbenem Fell und dem glasigen Blick, den Merry schon allzu oft gesehen hatte.
Ralph wurde mit einem schnellen Handzeichen angewiesen, den unbekannten Neuankömmling nicht zu begrüßen. Also blieb er auf dem Holzfußboden sitzen und wedelte mit dem Schwanz.
»Hallo«, sagte die Frau und streckte ihre regennasse Hand aus. »Kelly Pointer, ich wohne ein paar Häuser weiter.« Sie deutete in die Richtung, in der die Straße in einer Sackgasse mündete.
Genau. Merry hatte sie schon gesehen, wenn sie mit ihren Hunden Gassi ging. Sie schüttelte Kelly die Hand. »Kann ich etwas für Sie tun, Kelly?«
»Na ja, ich habe gehört, dass Sie sich um Hunde kümmern.« Kelly zeigte auf das Tier zu ihren Füßen. Das stand zitternd und mit eingekniffenem Schwanz da, und sofort wurde Merry schwer ums Herz.
Gott hatte ihre Bitten nicht erhört, im Gegenteil, eine weitere Last war zu den übrigen hinzugekommen.
»Ja«, antwortete sie zögernd. »Ich leite Triangle Boxer Rescue.«
Sie warf Ralph einen strengen Blick zu, aber der saß immer noch brav zu ihren Füßen. Er legte den Kopf auf die Seite und sah ihre Besucherin mit einem Blick an, der jedes Herz zum Schmelzen bringen musste.
»Diesen Stromer habe ich aufgelesen. Er hat sich in der Nachbarschaft herumgetrieben, und ich hatte Angst, dass er angefahren wird. Ich hoffe, dass Sie ihn nehmen können.«
Merry betrachtete den Herumtreiber ein bisschen genauer. Der durchnässte Labradormischling mied ihren Blick. Er sah drein, als würde er sofort abhauen, wenn sich ihm auch nur die geringste Chance bot. »Haben Sie schon im Tierheim von Dogwood nachgefragt, ob er von irgendjemandem vermisst wird?«
»Oh, nein, ich habe ihn einfach hergebracht, weil ich dachte, Sie könnten ihn nehmen.« Die Nachbarin hielt ihr ein dünnes weißes Seil entgegen, das sie zu einer Leine und einem provisorischen Halsband gebunden hatte.
»Hören Sie, eigentlich mache ich so etwas …« Merry griff nach der Leine und blickte auf das erbarmungswürdige Tier hinunter, das da auf ihrer Terrasse stand. Es war nicht das erste Mal, dass jemand mit einem Streuner vor ihrer Tür aufkreuzte und auf Rettung hoffte, einfach, weil sie in der Tierhilfe tätig war. Es würde auch nicht das letzte Mal bleiben.
Sie fand immer, dass das ein bisschen unüberlegt und rücksichtslos war. Kelly hatte schließlich selbst ein Haus, in dem der Hund gut aufgehoben wäre, warm und im Trockenen. Merry hätte ihr gerne bei der Suche nach einer Heimat für den Streuner geholfen. Aber nein, ihr Haus war offensichtlich der Sammelpunkt für alle ungewollten und ungeliebten Hunde der Gegend, ob es ihr nun gefiel oder nicht.
»Viel Glück mit ihm – er wirkt doch ganz süß, oder?« Kelly steckte die Hände in die Hosentaschen und wandte sich zum Gehen.
»Danke, aber ich glaube, ich muss ihn morgen ins Tierheim geben.«
Kelly machte große runde Augen. »Wieso das? Ich habe gedacht, Sie würden ihn behalten und sich um ihn kümmern.«
»Meine Organisation ist dafür da, Boxern zu helfen. Das da ist wirklich kein Boxer. Und ich habe schon zwei Pflegehunde, dazu noch meinen eigenen. Ich glaube nicht, dass ich noch einen halten kann.« Die Worte kamen ohne Zögern über Merrys Lippen, und irgendwie glaubte sie auch daran. Aber dann schaute sie auf den Hund, der wie ein Häufchen Elend auf ihrer Terrasse stand, und ihr wurde auf der Stelle klar, dass sie sich wohl nicht an diese Worte würde halten können.
Kelly zuckte mit den Schultern. »Schade. Ich hoffe, die finden da einen Platz für ihn.« Mit diesen Worten ging sie weg, hinaus in den Regen.
Merry schaute auf den Hund, der auf jeden Fall für diese Nacht bei ihr bleiben würde. »Na, gleich kommst du erst mal rein.« Der Labrador stand durchgeweicht auf der Terrasse und roch ziemlich intensiv nach nassem Hund. Merry band ihn am Geländer fest. »Bin sofort wieder da.«
Sie trat ins Haus und steckte Ralph zu den anderen beiden. Den Neuen konnte sie ihnen an diesem Abend nicht vorstellen, sie wusste ja noch gar nichts von ihm, und außerdem hatte sie fest vor, ihn nicht zu behalten. Sie musste ihn auf jeden Fall nach einem Mikrochip absuchen und die Tierheime in der Umgebung informieren. Wenn das zu nichts führte, konnte sie immer noch ein anderes Tierheim für ihn suchen. Aber auf Dauer konnte sie ihn wirklich nicht behalten, mehr als drei gingen einfach nicht.
Und außerdem – wenn Gott es auch vergessen zu haben schien: Sie war pleite. Vor langer Zeit schon hatte sie kapiert, dass sie einfach nicht alle Hunde dieser Welt retten konnte. Diese bittere Pille hatte sie schlucken müssen, und daran musste sie sich immer wieder erinnern, wenn sie nicht in Schuldgefühlen versinken wollte.
Sie kam mit einem Handtuch auf die Terrasse zurück und trocknete das durchnässte Fell, so gut es ging. »Jetzt kannst du reinkommen.«
Der Hund, ein Weibchen im Übrigen, drückte die Beine durch und wollte sich nicht bewegen. Merry ließ sich nicht beeindrucken. Sie setzte sich auf die oberste Stufe und starrte in die Sommernacht hinaus. Trotz der späten Stunde war es immer noch schwülwarm.
»Das Leben war in letzter Zeit wohl nicht besonders gut zu dir, oder?«, sagte sie mit leiser Stimme. »Ich weiß, wie man sich da fühlt. Aber es wird schon wieder werden. Fürs Erste hast du schon mal ein trockenes Bett heute Nacht.«
Sie redete immer weiter und sah dabei hinaus in den Regen, der vor dem Terrassendach in Strömen fiel. Schließlich wagte die Streunerin doch einen zögernden Schritt zu ihr hin.
Merry streckte die Hand aus, kraulte ihr die Brust und murmelte freundliche Worte. So gewann sie langsam ihr Vertrauen. Schließlich stand sie auf und zog behutsam an der Leine. Der Hund folgte ihr ins Haus.
Die Boxer in der Küche bellten und sprangen herum, sie wollten ihre Besucherin kennenlernen. Aber das kam überhaupt nicht infrage. Der Neuling an ihrer Seite war noch viel zu angespannt und ängstlich.
Merry kauerte sich neben ihr nieder, sie sollte sich an sie und die neue Umgebung gewöhnen. Sie stellte ihr Futter und Wasser hin und nahm sie mit nach draußen, damit sie ihr Geschäft erledigen konnte. Dann führte sie den immer noch verängstigten Hund zu dem Korb im Gang, der für frisch Angekommene bestimmt war.
Für diese Nacht sollte das genügen.
T. J. Jameson lehnte am Rezeptionstresen der Praxis und beobachtete, wie sich das Stirnrunzeln der hübschen Brünetten verstärkte. So wie es aussah, hatte sein Kumpel David Johnson gerade ihre Kreditkarte zurückgewiesen. David Johnson war der Besitzer der Tierklinik von Dogwood. T. J. war draußen in Creedmore gewesen, bei einem Pferd mit Koliken, und hatte auf dem Weg nach Hause bei seinem Freund vorbeigeschaut. Er hoffte, dass der ihm eine neue Hundetherapeutin empfehlen konnte, seine bisherige hatte den Job gerade hingeschmissen.
Die Brünette pustete sich eine Locke aus der Stirn und durchsuchte ihre Brieftasche. Sie war angezogen wie eine typische Vorstadtbewohnerin, mit engen Jeansshorts, einer lila Bluse und Flipflops mit Pailletten. Zu ihren Füßen saß ein Hund. T. J. stellte sie sich in langen Wranglerjeans vor und mit Cowboystiefeln, und das Bild gefiel ihm viel besser. So gekleidet hätte er den Blick kaum von ihr abwenden können.
Sie schaute herüber, und ihre Blicke trafen sich. Ihre Augen waren von einem tiefen Haselnussbraun und glitzerten – vor Sorge.
Sie drehte sich wieder zu David. »Probieren Sie mal die da!«, sagte sie und gab ihm eine blaue Kreditkarte.
David zog sie durch den Kartenleser. »In letzter Zeit haben Sie eine Menge für die Pflegehunde mit Ihrer privaten Kreditkarte bezahlt.«
»Der da ist eigentlich kein Pflegehund. Ich behalte sie nur für ein, zwei Tage, bis sich herausstellt, wem sie gehört.«
Hinter T. J. ging die Tür auf, und ein Teenager in viel zu weiten Jeans und einem T-Shirt mit dem Aufdruck »Toll, oder?« kam herein und sprach dabei ohne Pause in sein Handy. Er führte einen braun-weiß gefleckten Hund an der Leine, eine ziemliche Promenadenmischung. Der wollte sofort auf den Hund der Brünetten losgehen, bellte und kläffte und zerrte an der Leine.
»Hör auf!«, schrie der Teenager und versuchte, den Hund an das andere Ende des Wartezimmers zu ziehen.
Bei T. J. stellten sich die Härchen am Unterarm auf. Ganz klar, dieses Tier war kein Schoßhündchen. Früher oder später würde es zubeißen. Unbewusst fuhr er sich mit der Hand über die Kehle und tastete nach den Narben dort, die längst schon verblasst waren.
Er richtete den Blick wieder auf die Brünette, die ihren Hund außer Sichtweite hinter den Rezeptionsschalter gezogen hatte und gerade die Zahlungsbestätigung unterschrieb.
»Danke, Dr. Johnson. Ich komme dann nächste Woche mit den Welpen für die zweite Runde Impfungen.« Sie wandte sich zur Tür, dicht gefolgt von dem braunen Hund.
Sofort wurde der Hund des Teenagers wieder wild, und dieses Mal konnte der ihn nicht halten. Mit ein paar Sprüngen kam er quer durch die Lobby geschossen, und schon war er bei der Brünetten und ihrem Tier.
Zorniges Bellen erfüllte den Raum, und T. J.s Adrenalinspiegel schoss in die Höhe. Die Brünette erstarrte, und ihr Hund drückte sich voller Angst an ihre Beine.
T. J. zog sich der Magen zusammen, wenn er sich vorstellte, wie sie sich verteidigen musste, verletzt wurde und Blut ihre schöne Bluse versaute. Nein. Das durfte nicht geschehen.
»He!« T. J. stellte sich dem aggressiven Tier in den Weg.
Das kam zum Stehen und knurrte ihn mit gebleckten Zähnen an. Wieder stellten sich T. J. die Haare auf. Er breitete die Arme aus, als wolle er ein störrisches Kalb zurücktreiben, und ging einen Schritt auf den Hund zu.
Der legte die Ohren an und knurrte zornig weiter.
»Brutus, halt!« Der Teenager schnappte sich das Ende der Leine und zerrte den Hund, der immer weiterkläffte, in ein leeres Behandlungszimmer.
T. J.s Herz klopfte heftig. Er spürte die alten Narben am Hals, böse Erinnerungsstücke an die Nacht, in der ihm fast die Kehle durchgebissen worden war. Immer noch hatte er das geifernde Bellen von damals in den Ohren, spürte die Zähne, die sich in seinen Hals gruben, sein eigenes warmes Blut, wie es ihm über die Haut rann.
»Heilige Scheiße!«
Er drehte sich um und sah der Brünetten in die weit aufgerissenen Augen. Ohne dass es ihm richtig bewusst war, was er tat, legte er ihr die Hand auf die Schulter. »Ist alles in Ordnung?«
Sie nickte. »Sie haben verdammtes Glück gehabt, dass er sie nicht gebissen hat!«
Ja, das war ihm durchaus klar, klarer wohl als den meisten anderen. Er trat zurück und hängte seine Daumen in die Gürtelschlaufen. »Besser, es hätte mich erwischt als Sie.«
»Er war wohl kaum hinter mir her, eher hinter meinem Hund. Aber ich hätte schon reagiert.« Sie öffnete die rechte Hand und zeigte ihm eine kleine schwarze Spraydose.
T. J. zog die Stirn in Falten. »Tränengas?«
»Zitronensäure. Bei Hunden wirkt das ähnlich, aber es ist für sie nicht so schädlich.« Sie steckte die Dose wieder ein. »Und, in Ihrem eigenen Interesse … wenn Sie das nächste Mal auf einen aggressiven Hund treffen, wedeln Sie nicht mit den Armen herum, das macht die Sache nur schlimmer. Trotzdem – vielen Dank! Die meisten Leute hätten nicht einmal versucht, mir zu helfen. Sie sind unser Held!«
Sie schenkte ihm ihr bezauberndstes Lächeln, drehte sich um – und schon war sie aus der Tür, den Hund an ihrer Seite.
T. J.s offener Mund klappte zu, er fühlte sich eher verwirrt als heldenhaft. Langsam drehte er sich zu David um, der immer noch hinter dem Rezeptionstresen stand. »Wer war das denn?«
David lächelte und grinste ihn ein wenig spöttisch an. »Merry Atwater. Sie ist Krankenschwester und hätte dich wieder zusammenflicken können, wenn es nötig geworden wäre.«
T. J. stöhnte. Gut zu wissen. »Der Junge mit dem bösartigen Tier – ist das ein Kunde von dir?«
»Sein Vater, aber der ist gerade nicht da. Brutus ist nicht immer so. Aber die Familie will ihn einfach nicht kastrieren lassen. Wenn er auf einen anderen Hund trifft, reagiert er zunehmend unberechenbar.«
»Brutus heißt der also – das könnte einem ja eine Warnung sein.« T. J. hatte nie einen Hund besessen und wollte auch jetzt keinen, aber wenn es je dazu käme, würde er sich an einen erfahrenen Züchter halten. Er würde auf die Vorfahren achten und darauf, dass er vernünftige Eigenschaften hatte. Es war ihm unbegreiflich, dass manche Leute völlig unbekannte Tiere aufnahmen, über deren Herkunft sie nichts wussten und die dazu offensichtlich oft noch Verhaltensprobleme hatten.
Er war schon häufiger Zeuge geworden, wenn solche Tiere durchdrehten. Er hatte gesehen, dass ganze Viehherden von streunenden Hunden angegriffen wurden. Er selbst war ja beinahe umgekommen, zu Tode gebissen von einem wilden Köter. Hunde wie Brutus waren wirklich ein Problem.
»Als Erstes braucht er einen Maulkorb«, sagte David. »Dann muss ich mit den Haltern reden. Aber warum bist du eigentlich hier?«
»Ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht helfen kannst.«
David stand auf, um in den hinteren Raum zu gehen, und bat T. J., ihm zu folgen. »Wie denn?«
»Die Hundetrainerin, die ich für das Sommercamp engagiert hatte, hat plötzlich gekündigt.« Er war stinksauer deswegen. Es hatte monatelang gedauert, alles zu organisieren, und jetzt, eine Woche vor Beginn, musste er wieder von vorne anfangen.
»Dann lass die Kinder mehr mit den Pferden arbeiten«, meinte David mit einem Achselzucken.
»Grundsätzlich ginge das schon. Aber die Hunde waren als wichtiger Teil des Camps eingeplant, besonders wegen Noah.« Und der einzige Grund für das ganze Projekt war ja, dass er seinem Neffen helfen wollte. Bei Noah war vor ein paar Jahren hochfunktionaler Autismus diagnostiziert worden. Noah war ein aufgewecktes, blitzgescheites Kind, aber er hatte massive Probleme, mit Gleichaltrigen Kontakt aufzunehmen, und das hatte zu Schwierigkeiten in der Schule geführt.
T. J.s Schwester war alleinerziehende Mutter, und sie hatte alle Hände voll zu tun, dafür zu sorgen, dass der Alltag einigermaßen funktionierte. Geld nahm sie von ihm nicht an, so sehr er es ihr auch aufzudrängen versuchte. Deshalb hatte er beschlossen, dieses Jahr auf seiner Farm ein Sommercamp zu organisieren. Da sollte Kindern wie seinem Neffen geholfen werden, man konnte seine Pferde dafür therapeutisch nutzen, und außerdem sollte es noch Hundetherapeuten mit ausgebildeten Tieren geben.
Mit Hunden kam Noah besser zurecht als mit seinen Artgenossen, den Menschen. Für ihn war ein Camp ohne Hunde einfach nicht vorstellbar.
»Da hätte ich schon eine Idee.« David griff in einen Drahtkäfig und überprüfte den Infusionszugang eines Cockerspaniels. »Merry Atwater, die Dame, die uns eben verlassen hat. Sie leitet eine Rettungsorganisation für Boxer. Wenn ich mich recht erinnere, ist eines ihrer Tiere ein zertifizierter Therapiehund. Vielleicht könnte sie einspringen.«
»Meinst du wirklich?« T. J. rief sich das Bild der Brünetten noch einmal ins Gedächtnis. Mit ihren perfekt manikürten Fingernägeln schien sie kaum zu Dreck und Pferden auf seiner Farm zu passen.
David nickte. »Sie ist ein herzensguter Mensch. Außerdem, unter uns gesagt, ihre Organisation steckt gerade in finanziellen Schwierigkeiten. Wenn du ihr im Gegenzug für ihre Hilfe eine größere Spende zukommen lässt, machst du sie sicher mehr als glücklich.«
»Ich weiß nicht recht. Wie der Typ für eine Farm hat sie nicht ausgesehen.« Alles konnte er gebrauchen, nur keine Tussi, die bei ihm herumlief und jammerte, weil ihre teuren Schuhe dreckig wurden und ein Fingernagel eingerissen war.
Aber das Camp sollte nun einmal nächste Woche beginnen, und im Moment hatte er keine andere Wahl.
»Sie ist ganz anders, als sie wirkt.« David ging zurück in das Wartezimmer, wo er aus einem Stapel auf dem Rezeptionstresen eine Visitenkarte zog. »Du kannst sie ja anrufen und dir anhören, was sie dazu sagt.«
Merry presste die Lippen aufeinander und versuchte, den schmollenden Hund im Korbkäfig auf der anderen Seite der Küche zu ignorieren. Sie hatte jedes Heim in der Gegend angerufen, es hatte sich aber kein Besitzer gefunden. So, wie das Tier aussah, hatte es wahrscheinlich in letzter Zeit gar kein Herrchen gehabt. Das Fell war matt, verdreckt und voller Kletten, die Krallen seit Langem nicht geschnitten, und die Rippen standen deutlich hervor.
Merry war einfach nicht in der Lage, das Tier ins Heim zu bringen, sie konnte es aber auch nicht behalten. Zum einen war es nicht einmal ein Boxer. Außerdem war ihr kleines Haus mit Ralph, Chip und Salsa schon an der Grenze seiner Kapazität. Und dass sie pleite war, konnte man auch nicht einfach außer Acht lassen.
Damit war sie zurück bei der E-Mail auf dem Bildschirm. Eine Tracy Jameson hatte ihr geschrieben, dass sie ihren Namen von David Johnson, ihrem Tierarzt, bekommen habe. Sie suchte jemanden, der als Hundetherapeut mitsamt Hunden bei einem Kindersommerlager einspringen konnte. Dafür sollte es einen Tausend-Dollar-Scheck für Triangle Boxer Rescue geben.
Verlockend. Sehr verlockend.
Schließlich war Ralph ein geprüfter Therapiehund. Einmal in der Woche nahm Merry ihn mit in die Kinderabteilung des Krankenhauses in Dogwood. Er würde genau zu dem Sommercamp passen.
Dem Hund würde es mit Sicherheit besser gefallen als ihr selbst. Für Merry klang das Wort »Sommercamp« eher nach Dreck, Schweiß und Anstrengung. Mit ihren angesparten Urlaubstagen aus dem Krankenhaus hätte sie sich lieber zum Spendensammeln für ihr Heim aufgemacht, als in der Hitze auf der Farm dieser Frau zu schmelzen.
Auf der anderen Seite klangen gerade im Moment tausend Dollar ziemlich unwiderstehlich.
Aber zuerst musste anderes erledigt werden. Sie musste entscheiden, was mit dem Neuzugang in der Küche passieren sollte. Merry ging zu seinem Korb und sah der armen Namenlosen in die Augen. »Vielleicht sollte ich Zettel in der Nachbarschaft aufhängen. Kommst du mit?«
Der Hund sah auf, mit traurigen, ganz leeren Augen, sodass Merrys Herz wieder zu schmelzen begann. So ein Tier konnte man einfach nicht ins Heim geben. Dort würde es nicht eine Woche überstehen. Merry öffnete die Tür des Käfigs und lockte die verschüchterte Hündin. Sie holte Leckerlis aus einem Schrank und setzte sich ihr gegenüber auf den Boden. Für jedes Schwanzwedeln bekam sie eine Belohnung, wurde gelobt und gestreichelt.
Nach diesem Schub fürs Selbstwertgefühl konnte man Namenlos anleinen. Merry griff sich die Flugblätter, die sie schon vorher ausgedruckt hatte, dazu eine Rolle Klebestreifen, und schon war sie bereit zum Aufbruch.
»Du brauchst noch einen Namen.« Jeder neue Pflegehund bekam einen Namen von ihr, aber bei dem hier konnte sie sich einfach zu keinem durchringen.
Bei jeder Laterne, an die sie in der Nachbarschaft einen ihrer Zettel klebte, blieb der Hund geduldig stehen. Aber es sah nicht danach aus, als würde sich in dieser Gegend einer melden, zu dem er gehört hatte und der ihn zurückhaben wollte.
Stumpf starrte Namenlos auf ihrem Gang vor sich hin und vermied jeden Blickkontakt mit ihr. Sie zeigte keine Gefühlsreaktion, und ihr Schwanz hing schlapp zwischen den Beinen. Gut, das war ein Fortschritt im Vergleich zu dem eingeklemmten Schwanz am Vortag. Aber selbst das süßeste Schmeicheln brachte sie nicht dazu, mal wieder mit ihm zu wedeln.
»Hundi, Hundi!« Diese hoch und schrill gerufenen Worte waren die einzige Warnung, bevor ein kleines Mädchen mit ausgestreckten Armen auf sie zulief.
Merry griff die Leine fester und versuchte, sich zwischen Kind und Tier zu stellen. Zu spät, es umhalste schon stürmisch den Hund und quietschte vor Vergnügen.
»Violet!« Mit diesem Schrei stürzte eine Frau die Garagenauffahrt hinunter, hin zu ihrem Liebling. »Oh Gott!«
Merry war angespannt wie eine Feder, bereit jederzeit einzugreifen, wenn es notwendig werden sollte. Aber nein – der Schwanz von Namenlos wedelte ohne Pause, gleichmäßig und friedlich. Sie wirkte ganz ruhig, fast glücklich.
»Gott sei Dank mag Ihr Hund Kinder«, seufzte die Mutter.
Das war eine Untertreibung. Merry hätte den ihr unbekannten Hund niemals mit einem fremden Kind zusammenkommen lassen. Aber jetzt, wo es passiert war, war alles anders: Namenlos schien geradezu verzückt zu sein.
Ungeschickt patschte das Mädchen mit seinen kleinen Händen auf dem Kopf des Tiers herum, ließ es dann los und lief zu einem lilafarbenen Dreirad, das in der Auffahrt herumlag. Die Mutter winkte noch kurz und ging dann hinter ihr her. Namenlos hatte das kleine Mädchen immer noch im Blick und wedelte weiter mit dem Schwanz.
Merry schaffte sie hastig nach Hause, und als sie die Wohnung betraten, klingelte das Handy. Sie warf einen Blick auf das Display: »Hallo, Liv.«
»Hallo, Merry. Ich habe deine Nachricht erhalten, und – leider nein, ich kann gerade keinen Hund nehmen. Mich hätten sie beinahe aus der Wohnung geworfen wegen meiner kleinen Pflegehunde.«
»Ach komm, bitte! Meiner wäre schon ausgewachsen. Und außerdem ist er stubenrein und bellt kaum. Mit dem hast du es ganz leicht.«
»Tut mir leid, nein.« Olivia Bennett hatte sich tatsächlich nie offiziell als Partnerin für Triangle Boxer Rescue angeboten. Sie war eine Freundin von Cara Medlen, und die war vor ein paar Monaten nach Massachusetts gezogen. So hatte Merry eine sichere Pflegestelle verloren, und die beste Freundin noch dazu. Beide Stellen hatte Olivia für einige Zeit eingenommen.
»Weißt du niemanden, der gerade einen Hund sucht? Es ist ein Labradormischling, ein Weibchen, sehr schüchtern und scheu, aber völlig gutartig.«
»Ich werde mich umhören, aber auf die Schnelle … nein.«
»Na gut, okay, trotzdem vielen Dank.« Merry führte den Hund wieder in die Küche. Nachdem ihr der Tierarzt bestätigt hatte, dass er gesund war, hatte sie ihn mit Ralph zusammengebracht, und das hatte prima geklappt. Namenlos hatte den Schwanz eingezogen und den Kopf unterwürfig gesenkt, nachdem Ralph sie begrüßt hatte. Für den Anfang war das ganz gut, trotzdem wagte Merry es noch nicht, Namenlos mit den beiden Welpen zusammenzubringen. Man wusste einfach nicht, wie die reagieren würden.
Jetzt schliefen sie gerade oben im Schlafzimmer. Wenn Namenlos länger bleiben sollte, mussten sie irgendwann alle miteinander bekannt gemacht werden. Aber vielleicht fand sie ja einen Platz für ihn, bevor das wirklich notwendig wurde.
Sie klappte ihren Laptop auf, um nachzusehen, ob irgendwelche Antworten gekommen waren. Nein, gar keine – aber die E-Mail von dieser Tracy Jameson wartete immer noch darauf, beantwortet zu werden.
Eigentlich wollte sie wirklich nichts mit einem Sommercamp zu tun haben, aber vielleicht … vielleicht brachte es doch etwas. Sie schrieb Tracy eine Kurzantwort und schlug ihr ein Treffen vor, bei dem sie alles bereden könnten. Dann klappte sie den Laptop zu und bereitete für sich und die Hunde das Abendessen vor.
Am nächsten Tag brachte sie erst einmal ihre übliche Zwölf-Stunden-Schicht im Dogwood Krankenhaus hinter sich. Ziemlich ausgelaugt fuhr sie noch schnell zum Bojangel Drive-In, um sich ein Avocado-Sandwich zu besorgen, und machte sich dann auf den Weg zu Tracys Farm.
Wie viele andere Orte in der Gegend war Dogwood in den letzten zehn Jahren förmlich aus allen Nähten geplatzt. Das lag am Triangle-Forschungspark, einer Ansammlung von pharmazeutischen Unternehmen und allen möglichen High-Tech-Firmen. Und dann fand man sich nach einem hochmodernen Gewerbegebiet plötzlich auf einer der uralten Landstraßen wieder, die sich seit Jahrzehnten nicht verändert hatten.
Auf so einer fuhr Merry jetzt zwischen verfallenden Scheunen und Getreidefeldern einige Meilen weit durch offenes Gelände. Sie öffnete die Fenster und ließ die frische Luft in ihre Lungen strömen. Sie liebte es, auf dem Land zu sein, Kühe und Pferde auf den grünen Wiesen zu sehen und alle Gerüche aufzusaugen. Die Ärmel hochzukrempeln und schmutzig zu werden – das war natürlich weit weniger attraktiv. Aber wenn es ihrem Projekt helfen würde, könnte sie das durchaus auf sich nehmen.
Tracys Farm lag am Ende der Straße, ein schlichtes, zweistöckiges Backsteingebäude. Tracy hatte ihr vor ein paar Minuten die Nachricht geschickt, dass sie sich ein bisschen verspäten würde. Also fuhr Merry ums Haus herum, blieb im Wagen sitzen und aß ihr Sandwich zu Ende. Es schmolz regelrecht im Mund, sie spülte es mit einem Schluck Eistee hinunter – und seufzte zufrieden.
Hinter der Scheune grasten zwei Pferde auf einer saftig grünen Weide, ein drittes stand friedlich im Schatten eines Baums. Merry wusste ziemlich wenig über Pferde, gerade so viel wie von der Lektüre von »Black Beauty« hängen geblieben war. Aber bei denen hier spürte jeder sofort: Das waren herrliche Tiere, gepflegt, mit glänzendem Fell, das sich über kraftvollen Muskeln spannte und in der untergehenden Sonne glänzte.
Sie lehnte sich ein wenig in ihrem Sitz zurück, um sie zu beobachten. Das größere der beiden, ein männliches Tier, schwenkte eifrig seinen Schweif hin und her und wehrte die Fliegen ab, von sich und dem Tier neben ihm, einer Stute. Wow! Ein Kavalier auf Hufen. Kurz darauf rauschte ein Ford 350T Pick-up mit röhrendem Motor auf den Hof und hielt direkt neben ihrem Honda CR-V. Sie war schwer beeindruckt: Für eine Frau war das ein heißes Fahrzeug.
Merry klopfte sich ein paar Sandwichkrümel von der Bluse und stieg aus. Während sie um ihren SUV herumging, wurde die Fahrertür des anderen Wagens geöffnet.
Das Erste, was sie sah, waren bestickte Cowboystiefel aus Leder, mindestens Herrengröße 12! Sie ließ ihren Blick weiter aufwärts wandern, an Jeans entlang. die mit sehr männlichen Muskeln ausgefüllt waren. Der Typ, der in ihnen steckte, schwang sich aus der Fahrerkabine. Mit einem Finger tippte er lässig an seinen Cowboyhut.
Schau an! Das war doch tatsächlich der selbst ernannte Lebensretter aus Dr. Johnsons Praxis. Was um alles in der Welt trieb der hier?
Sie war nie ein großer Freund von Cowboys gewesen, aber der hier war eins ganz bestimmt, nämlich ziemlich sexy. Unter dem Hut war von seinem dunklen Haar nicht allzu viel zu sehen. Die Krempe beschattete Stirn und Augen, aber dass er ihr tief in die ihren sah, spürte sie. Sein knackig enges, blaues T-Shirt steckte in den Jeans und umhüllte einen muskulösen Oberkörper.
So einer konnte locker als Model für das Titelbild eines Katalogs für Westernkleidung posieren. Meine Güte, was für ein Anblick! Aber ganz bestimmt keine Tracy Jameson.
»Sie sind Merry Atwater!« Die Stimme entsprach absolut dem Aussehen – tief und weich.
»Ja. Aber wer sind Sie?«
Er gab ihr die Hand. »T. J. Jameson. Vielen Dank, dass Sie den langen Weg hierher auf sich genommen haben. Aber ich dachte, Sie sollten sich wenigstens einen Eindruck von dem Ort verschaffen, bevor Sie sich entscheiden.«
»T. J. also. Aber wo ist Tracy?«
Er lächelte amüsiert: »Tracy Allen Jameson III. heißt es in voller Länge. Meinen Großvater nannten sie Tracy, mein Vater nennt sich Trace, und ich bin eben T. J.«
»Dann sind Sie also Tracy!?« Sie verschluckte sich fast an ihrer Zunge.
»Jawohl, Madam. Aber sagen Sie bitte T. J. zu mir.«
Merry atmete tief durch. Tracy war also ein Mann. Und nicht bloß irgendeiner, sondern ein extrem gut aussehender, dem aus allen Poren Testosteron entströmte.
Auf einmal war das Sommercamp ganz schön heiß geworden, aber auf andere Weise, als sie es erwartet hatte.
2
T. J. lehnte sich mit den Ellbogen auf die oberste Holzstange des Koppelzauns und schaute zu seinen Pferden hinüber. Er zeigte auf den hübschen Fuchs, der beim Tor stand: »Das ist Tango, und die braune Stute bei ihm ist Twilight. Sie kommen beide von der Farm meiner Eltern und sind dort auch aufgewachsen. Der Palomino dort hinten ist Peaches. Die reitet mein Neffe.«
Er beobachtete Merry, um ihre Reaktion zu sehen. Seine Pferde kamen immerhin aus einem der besten Zuchtställe in North Carolina. Es waren außerordentliche Geschöpfe, und wenn sie hier wirklich einen Monat mit ihm arbeiten sollte, musste er sicher sein, dass sie sich dieser Tatsache bewusst war. Ihr lockiges Haar bewegte sich leicht im Wind, als sie sich den beiden Pferden zuwandte. Heute war sie nicht gekleidet, um Eindruck zu schinden: Sie trug eine Schwesternjacke aus dem Krankenhaus und Gesundheitsschuhe mit Gummisohlen, aber selbst damit gelang es ihr, irgendwie klasse auszusehen.
»Sie sind einfach wunderschön!«, sagte sie.
Das war sie auch. Auf diese mädchenhaften Typen stand er überhaupt nicht, aber einer wirklich schicken Lady konnte er etwas abgewinnen. Ihre grazilen, aber durchaus kurvenreichen Formen wurden durch die Schwesterntracht heute mehr verhüllt als betont, aber er konnte sich noch gut an die knappen Jeansshorts vom Vortag erinnern. Was ihn aber am meisten gefangen nahm, waren ihre Augen, die Pupillen wie Teiche, goldene und ein wenig grün gefleckte Oberfläche, warm und voller Leben und Gefühl, sodass er alles andere vergaß, wenn er in ihre Tiefen blickte.
»Ist die Arbeit mit Tieren Ihr Beruf?«, wollte sie wissen.
»Ja, gewissermaßen. Ich bin Veterinär für Großtiere, das heißt, ich arbeite mit Kühen, Pferden, Schafen, mit allem, was es an Vieh so gibt.«
»Also, mit solchen Tieren kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber dass Ihre Pferde einfach prachtvoll sind, das sehe ich.«
»Können Sie reiten?«
Sie sog die Unterlippe ein und schüttelte den Kopf. »Nein. Was haben Sie mit den Pferden vor, was sollen die Kids mit ihnen machen, und wie passe ich in das Konzept?«
»Ein Kumpel von mir hat Erfahrung mit Pferdetherapie, die Kids bewegen und führen die Tiere, arbeiten mit ihnen und reiten sie. Das bringt enorm viel fürs Selbstbewusstsein und trainiert außerdem die motorischen Fähigkeiten. Wir möchten, dass sie für ein paar Stunden ihre Probleme und Schwierigkeiten vergessen können.«
»Sind das Kinder mit Entwicklungsstörungen, oder haben sie auch körperliche Einschränkungen?«
»Beides. Bis jetzt wollen vier teilnehmen. Noah, mein achtjähriger Neffe, ist Autist. Dann gibt es einen Jungen mit Wahrnehmungsstörungen, ein Mädchen mit zerebralen Störungen des Bewegungsapparats und eins mit Downsyndrom. Sie sind alle in der zweiten oder dritten Klasse.«
»Das ist eine großartige Idee, und ich nehme mal an, dass Ihr Neffe der Hauptgrund ist, warum Sie das Ganze machen. Ihr Pferdetherapiecamp haben Sie dann doch eigentlich zusammen. Warum dazu noch ich, warum Hunde?«
»Na ja, eigentlich habe ich nur zwei Pferde dafür.« Er sah zur Weide. »Tango ist zu lebhaft für Kinder. Also bleiben nur Twilight und Peaches. Außerdem sind Hunde der entscheidende Teil bei der Sache, besonders wegen Noah. Hunde scheinen die einzigen Wesen zu sein, die ihn aus seinem Schneckenhaus locken, das schaffen weder Pferde noch Menschen.«
»Okay, verstanden. Sie haben noch gesagt, dass Sie an Therapiehunden Interesse haben. Ich hätte einen, Ralph, ein sechsjähriger Boxer, und er ist absolut phänomenal. Ich arbeite einmal pro Woche mit ihm im Krankenhaus von Dogwood, auch mit Kindern.«
»Und Sie sind geprüfte Hundetherapeutin?«
»Ich bin zertifiziert als Hundeführerin von Ralph. Außerdem leite ich eine Boxer-Rettungsorganisation. Ich könnte mir vorstellen, dass man zuverlässige Pflegehunde mit den Kindern zusammenbringt, und sie daran beteiligt, die Tiere zu trainieren. Jedes Kind bekommt ein Tier zugeordnet und übt mit ihm die Grundlagen der Hundeerziehung, Gehorsam, Hund-Herrchen-Bindung, solche Sachen. So könnte man die Hunde auch noch auf die spätere Übernahme in eine Familie vorbereiten.«
T. J. schüttelte den Kopf. »So habe ich mir das nicht vorgestellt. Tierheimhunde zusammen mit diesen Kindern?«
Merry reckte das Kinn vor. »Das sind Hunde aus dem Tierheim, die wir vermittelt haben, Hunde mit einer vollständigen Verhaltensprüfung, sodass gesichert ist, dass sie mit Kindern arbeiten können. Außerdem würden sie ständig von mir beaufsichtigt.«
»Ich weiß nicht recht …«
Sie unterbrach ihn sofort. »Ich habe zurzeit zwei bei mir zu Hause, die wären absolut perfekt. Welpen, noch lange kein Jahr alt, vollkommen harmlos. Aber die könnten eine Menge Gehorsamstraining brauchen. Mir gehen noch eine Menge anderer Hunde durch den Kopf, die prima für das Programm geeignet wären. Ein oder zwei könnte man ja während des Camps hier auf der Farm unterbringen.«
»Wie bitte?« Irgendwie war das Gespräch vollständig aus dem Ruder gelaufen.
»Sie erwarten, dass ich eine Menge Zeit aufwende. Ich muss vom Krankenhaus freinehmen. Dafür können Sie doch sicher eine gewisse Gegenleistung erbringen? Wie wär es, wenn Sie zusätzlich Ihre Spende für Triangle Boxer Rescue erhöhen würden?«
Er hob abwehrend die Hände. »Also, nein, da liegt nun ein komplettes Missverständnis vor. Ich brauche Therapiehunde, keine aus dem Tierheim. Außerdem gibt es hier keinen Zwinger oder so etwas, wo man sie unterbringen könnte.«
Sie trommelte mit den Fingern auf den Koppelzaun und betrachtete die Pferde. »Hundekäfige könnte ich besorgen. Ihnen entstehen keine Kosten. Sollte es medizinische Probleme geben, zahlt meine Organisation. Sie müssten nur für Futter und Wasser sorgen.«
»Käfige? Sie wollen sie in solchen Drahtverschlägen im Hinterhof einsperren?«
Ihre Nasenflügel bebten. »Natürlich nicht. Aufhalten werden sich die Hunde bei Ihnen im Haus. Die Käfige sind nur zu Trainingszwecken da.«
»Im Haus?« T. J. nahm kurz den Hut ab und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Auf der Farm war er mit Hunden aufgewachsen. Sie liefen überall im Freien herum, zwischen Scheunen und Ställen, ernährten sich von Essensresten und schliefen in Hundehütten hinter dem Haus – aber doch nicht im Haus!
Er hatte das Gespräch einfach nicht mehr im Griff. Keinesfalls würde er Merrys Tierheimhunde bei sich aufnehmen – weder im Haus noch außerhalb. Der Zwischenfall im Wartezimmer von Davids Praxis am Tag zuvor hatte ja gezeigt, wie unvorhersehbar solche Hunde reagieren konnten.
»Passen Sie mal auf. Ich habe kein Interesse, hier Hunde aufzunehmen. Ich brauche Therapiehunde, keine aus dem Tierheim. Sie sollen nämlich mit den Kindern arbeiten. Wenn Sie zufällig an einen weiteren herankommen, dann können Sie gerne mit ihm und Ihrem Ralph im Camp arbeiten – das wäre perfekt.«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich habe nur den einen.«
Die beiden starrten sich einen Moment lang stumm an.
»Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hier herauszukommen. Aber ich muss mich wohl nach jemandem umsehen, der für diese Aufgabe besser geeignet ist.«
Sie funkelte ihn aus ihren schönen Augen an, die jetzt vor Zorn blitzten. »Dann machen Sie das mal! Und – viel Glück mit Ihrem Sommercamp.«
Damit drehte sie sich um und stapfte so entschieden davon, dass der Staub hinter ihr aufwirbelte.
Merry kochte vor Wut – was für ein arroganter Mistkerl. Als sie ihn noch für eine Frau gehalten hatte, war er ihr deutlich sympathischer gewesen. Der hatte Nerven, rümpfte die Nase über ihre Pflegehunde, als wollte sie seine Hätschelkinder als Köder im Ring für Hundekämpfe hernehmen, statt Therapiehündchen von ihnen tätscheln zu lassen. Idiot! Dabei brauchte sie das Geld so dringend. Außerdem hatte sie darauf gehofft, dass sie einen ihrer Pflegehunde auf Dauer bei ihm unterbringen konnte, dann hätte sie einen Pflegeplatz für Namenlos gefunden. Sie trommelte auf das Lenkrad und schaltete das Radio ein, das auf ihren Top-40-Lieblingssender eingestellt war. Countrymusik würde es in ihrem Auto nicht geben – die konnte sie wirklich nicht ertragen.
Als sie schließlich zu Hause ankam, stand sie noch immer unter Strom. Die letzte Stunde Tageslicht mit ihren Hunden hatte sie leider verpasst, wegen des Besuchs bei diesem Knallkopf. An den Tagen, an denen sie arbeiten musste, bezahlte sie der Nachbarstochter ein bisschen Geld dafür, dass sie die Tiere nach draußen ließ. Das war auch heute so, also hatten sie wenigstens nicht wegen dieses blöden Ausflugs leiden müssen.
Mit hängenden Schultern betrat sie das Haus, angespannt und erschöpft zugleich. Ralph, Chip und Salsa warteten in der Küche schon auf sie und fiepten und wälzten sich vor Freude über ihre Rückkehr. Ihre Krallen veranstalteten einen regelrechten Stepptanz – Klickediklack – auf dem Linoleum, bis sie zwischen ihnen auf die Knie sank und sich mit feuchten Küssen überschütten ließ. Als sie damit fertig waren, ließ Merry sie zur Hintertür hinaus und ging zu Namenlos, die ruhig in ihrem Korb lag,
Mit dem bekannten herzzerreißenden Blick schaute sie zu ihr auf, ihr Schwanz schaffte nur einen einzigen schwachen Schlag auf den Boden des Korbs. Merry hob sie heraus und setzte sie ab. »Weißt du, es ist schon zum Heulen mit dir.«
Namenlos ließ sich mit einem Seufzer zum Steinerweichen auf dem Boden nieder.
»Heute habe ich gedacht, dass ich dich in einer ruhigeren Pflegestelle unterbringen kann, aber es ist nichts draus geworden.« Sie fuhr langsam mit dem Finger durch das weiche Fell des Tiers. »Nachdem du nun immer noch da bist, muss ich dich endlich allen vorstellen, okay?«
Ralph und Namenlos hatten sich am Tag zuvor schon kennengelernt, und dabei hatte es keine Probleme gegeben. Ralph war ruhig und bestens erzogen, und es hatte noch bei keinem neuen Pflegehund Schwierigkeiten mit ihm gegeben. Chip und Salsa waren noch ganz jung und hatten noch keinen Reviertrieb entwickelt. Für sie würde Namenlos einfach eine neue gute Freundin sein.
Namenlos selbst war der Unsicherheitsfaktor. Bisher hatte sie keinerlei Aggression gezeigt, aber sie schien wenig kontaktfähig. Man wusste nicht, wie sie reagieren würde, wenn sie auf einmal drei neuen Artgenossen begegnen würde, besonders wenn zwei davon hyperaktive Welpen waren.
Merry begann damit, Namenlos an die Leine zu legen, um einen kleinen Spaziergang in der Nachbarschaft zu unternehmen. So hatte der Hund die Möglichkeit, sich die Beine zu vertreten, die Spannung des Tages abzubauen und ein wenig zur Ruhe zu kommen.
Als sie zurück waren, holte sie die anderen Hunde von draußen ins Haus und trennte die Küche vom Gang durch die Gittertür. Merry legte die Leine aus der Hand, ließ sie aber am Halsband von Namenlos befestigt, damit sie jederzeit wieder die volle Kontrolle übernehmen konnte, falls es nötig sein sollte.
Namenlos hob den Kopf und schaute durch die Gittertür auf die anderen drei. Chip und Salsa warfen sich aufgeregt immer wieder gegen das Gitter, Ralph hielt sich hinter ihnen, mit ausdauernd wedelndem Schwanz und aufgestellten Ohren, voll freundlichem Interesse.
Namenlos näherte sich vorsichtig und beschnüffelte Chip. Salsa drängte sich heran und presste das Gesicht gegen Namenlos’ Schulter. Sie machten Männchen, hechelten und drückten ihre Schnauzen durch das Gitter, um sich gegenseitig zu beschnüffeln. Namenlos zog den Schwanz ein und zeigte die gewünschten Unterwerfungsgesten.
Merry saß dabei und beobachtete alles – und es sah sehr gut aus. Bei anderen Pflegehunden, die nicht miteinander auskamen, hatte sie die Tiere getrennt halten müssen. Sie konnten sich dann nicht gemeinsam frei im Haus bewegen. Aber wenn sich die Hunde gut verstehen würden, hätte sie mehr Zeit, einen geeigneten Platz für Namenlos zu finden.
Nachdem sich die Kleinen etwas beruhigt hatten, zog sie die Gittertür ein wenig zur Seite. Während die Hunde sich beschnüffelten, schickte sie eine SMS an ihre beste Freundin. Du fehlst mir. Wann bist du mal wieder hier?
Die Antwort kam sofort: Nächsten Monat. Mädelsabend im Red Heels?
Merry musste grinsen. Wie viele Abende hatten sie nicht schon gemeinsam mit einer Menge Martinis im Red Heels verbracht? Ich zähle die Tage. Übernachtest du bei mir?
Das wäre klasse. Danke.
Ich kann dir ein paar Pflegehunde mit nach Hause geben.
Ha! Matt bringt mich um. Ich habe schon drei und dazu noch Caspar und Sadie.
Merry seufzte. Wie sehr sie Cara doch vermisste!
Sie sah Namenlos an Salsas Hintern schnüffeln, dann ging sie ihre E-Mails durch. Linda fragte nach einem Termin für die Kastration ihres Pflegehunds. Der Hund von Trista brauchte Medikamente gegen seinen Herzwurm, und der von John wartete immer noch auf die Operation seines Kreuzbandrisses – und auf dem Konto von Triangle Boxer Rescue war noch die Riesensumme von fünf Dollar.
Es war zum Verzweifeln. Sie brauchte nicht nur weitere Geldquellen für die jetzigen Hunde, sondern auch für die, die in Zukunft dazukommen würden. Außerdem hatte sie Cara nichts von dem Schlamassel erzählt, in dem sie steckte, und sie wollte das alles unbedingt wieder in Ordnung gebracht haben, bevor ihre Freundin sie besuchte. Merry hatte Triangle Boxer Rescue gegründet, aufgebaut und zum Erfolg geführt. Jetzt brauchte ihre geliebte Organisation eine Wiederbelebungsaktion, und zwar sofort!
Das Ganze war mehr als nur ein finanzieller Notstand. Wenn TBR untergehen sollte, war das auch eine persönliche Niederlage, das Scheitern der einzigen Sache in ihrem Leben, die sie wirklich auf die Reihe bekommen hatte. Wie schrecklich und gleichzeitig erniedrigend! Für die Hunde war es noch schlimmer – für die war es eine Frage von Leben und Tod.
Mit einem Auge bei den Hunden wechselte Merry zum Esstisch und klappte ihren Laptop auf. Sie sandte E-Mails an alle Tierhandlungen in der Gegend, die sie kannte, und bat, Spendensammlungsaktionen für sie zu organisieren. Das brachte immer ein paar neue Zusagen für die Übernahme von Pflegehunden, ein bisschen Geld kam auch herein und vor allem – es machte eine Menge Spaß.
Eine ihrer Freundinnen hatte letzthin erwähnt, dass sie über Facebook einigen Erfolg hatte verbuchen können. Merry loggte sich auf die TBR-Seite ein, die sie eröffnet hatte: Sie hatte einhundertzweiunddreißig »Likes«. Das war gar nicht schlecht, wenn man berücksichtigte, dass sie selbst die sozialen Netzwerke kaum nutzte. Die Seite gab es nun ungefähr seit einem Jahr, und sie hatte sich fast gar nicht darum gekümmert.
Was sollte sie posten? Fast eine Minute lang trommelte sie nervös mit dem Finger neben der Tastatur auf den Tisch. Dann stellte sie ein Foto von Jake, dem Hund mit der Knieoperation, ins Netz und schrieb dazu: Jake braucht eine Knieoperation, um seinen Bänderriss zu kurieren. Das ist eine sehr schmerzhafte Verletzung, und er soll wiederhergestellt sein, bevor er seinen endgültigen Platz bekommt. Für die OP müssen wir 600 Dollar zusammenbringen. Bitte besucht unsere Website und spendet alle massenhaft, damit Jake wieder herumrennen kann!
Dann lehnte sie sich zurück und lächelte. Bei einhundertzweiunddreißig Followern sollten sich doch ein paar finden, die großzügig waren.
Fünf Minuten später kam die Nachricht von Paypal, dass eine Spende eingegangen war. »Jaaa!« Sie stieß die Faust in die Luft.
Die Spende war von Cara.
Merrys Gesicht verfinsterte sich wieder. Natürlich schätzte sie auch das Geld ihrer Freundin – schließlich brauchte sie jeden Cent –, aber sie hatte von ihr doch schon so viel Unterstützung erhalten. Neue Helfer mussten her, neue Geldquellen sollten sprudeln, um die Lücke zu schließen, die entstanden war, seit der anonyme Wohltäter seine Zahlungen eingestellt hatte.
Andererseits – es waren ja erst fünf Minuten vergangen.
Nie hatte sie sich überlegen müssen, wie sie genügend Geld auftreiben könnte, immer war das Geld von selbst eingetrudelt. Das würde sie jetzt lernen, sie musste es einfach.
Alle Hunde hatten sich inzwischen beruhigt. Namenlos war zu ihrem Korb gegangen und hatte sich auf der Matte daneben zusammengerollt. Merry hielt es für das Beste, sie erst mal in Ruhe zu lassen.
Morgen musste sie ins Krankenhaus zur Arbeit. Aber dann hatte sie vier Tage frei, und in der Zeit wollte sie das Kennenlernen endgültig abschließen.
Und – Namenlos brauchte endlich einen Namen, verdammt noch mal!
Am nächsten Morgen fuhr Merry im Dogwood Hospital mit dem Aufzug zur Kinderabteilung im dritten Stock, wo sie die nächsten zwölf Stunden verbringen würde. Die Handtasche kam in den Spind, und sie machte sich auf zur Übergabe, bei der sie von der Oberschwester der Nachtschicht alle notwendigen Informationen erhielt.
Zum Glück war es eine ruhige Nacht gewesen, und so war die Besprechung schnell beendet. Auf der Station suchte sie im Dienstplan, welche Patienten ihr zugeteilt waren. Charlene war die Nachtschwester, die für drei von Merrys Schützlingen zuständig gewesen war. Das war prima, denn sie war sehr sorgfältig bei ihren Aufzeichnungen und überhaupt eine sehr gute Krankenschwester.
Merry erwischte sie noch auf halbem Wege und rief ihr ein »Guten Morgen« zu.
Die Kollegin lächelte. »Auch dir einen guten Morgen. Für wen bist du zuständig?«
»Die drei-null-fünf, die drei-null-acht und die drei-zehn.«
Charlene zeigte zum Raum 310 hin. »Mach dich auf was gefasst. 310 ist erst eine Woche alt und leidet unter postnatalem Entzugssyndrom. Er wurde diese Nacht eingeliefert.«
Merry überlief ein Schauder. Gerade diese Babys gingen ihr immer total nahe. Und wenn sie es mit solch einem armen Säugling zu tun bekam, hätte sie gern auf irgendjemanden eingeschlagen. Und am liebsten immer auf die Mutter. »Wie schlimm ist es?«
»Heroin. Das arme Ding hat praktisch die ganze Nacht lang geschrien. Die Mutter sitzt wegen Kaufhausdiebstahl im Knast. Der Sozialdienst kümmert sich um den Fall.«
Merry schluckte schwer und ging mit Charlene zunächst in Raum 305. Drinnen lag die vierjährige Tori friedlich im Bett und schlief. Sie schmiegte sich an ein Püppchen in einem knallrosa Tutu. Die Mutter im Ruhesessel daneben schenkte den Schwestern ein schwaches Lächeln.
»Morgen, Alice«, flüsterte Merry.
Charlene erklärte den beiden, wie es der Kleinen jetzt ging. Ein gemeiner Darmvirus hatte ihre Einweisung ins Krankenhaus veranlasst, sie war in der Nacht zuvor völlig dehydriert angekommen. Nun sollte ihre intravenöse Versorgung bei der nächsten Runde von Merry abgenommen werden. Wenn sie dann wieder selbstständig Flüssigkeiten zu sich nehmen konnte, wäre es möglich, sie am Nachmittag zu entlassen.
Merry prüfte Puls, Atmung und den Sitz der Nadel in der Armbeuge und bemühte sich nach Kräften, Toris Schlaf nicht zu stören. Dann wurden die neuesten Messergebnisse online in die Patientendatei eingegeben. Das kleine Mädchen war noch so erschöpft, dass sie nicht einmal bemerkte, wie ihr Blutdruck gemessen wurde. Merry winkte Alice freundlich zu, als sie mit Charlene das Zimmer verließ.
Als Nächstes war Peter im Zimmer 308 dran. Bei dem kleinen Jungen war sein gebrochener Arm mithilfe einer Operation eingerichtet worden. Er war schon wach und sah seine Comics an. Merry unterhielt sich nebenbei mit ihm über Baseball, während sie die üblichen Kontrollen durchführte. Jetzt kam Zimmer 310.
Man hörte dort nichts außer dem gleichförmigen Piepen des Instruments, das jeden einzelnen der wertvollen Schläge des kleinen Herzens von Baby Jayden registrierte, aufgenommen durch ein Kabel, das mit einem Pflaster am winzigen Fuß angeklebt worden war. Merry näherte sich leise dem Kinderbett.
»Schließlich ist er doch noch eingeschlafen«, flüsterte Charlene von der Tür her. Sie verließ das Zimmer, weil sie durch den Piepser ins Schwesternzimmer gerufen wurde.
Mit einem tiefen Seufzer atmete Merry aus, als sie das Würmchen dort liegen sah, ganz allein in einem sterilen Krankenzimmer. Er lag auf dem Rücken, gewickelt und mit einem blau gestreiften Käppchen auf dem Kopf. Die Brust hob und senkte sich heftig, die Wangen waren gerötet.
Unbewusst trat ihr das Bild eines anderen Babys vor die Augen, ganz ähnlich gewickelt, das Gesicht aber totengrau. Wie immer traf sie der Schmerz wie ein Faustschlag, und sie musste die Faust an den Mund pressen, um nicht aufzuschreien.
Kein Laut kam von ihren Lippen, als es ihr gelang, das Bild zu verdrängen, und sie beginnen konnte, Jaydens Zustand zu untersuchen. Er verzog schmerzlich sein Gesicht, ein zartes Wimmern war zu hören, die Unterlippe zitterte leicht. Ein Winzling, so klein, so unschuldig. Er hätte niemals den Schmerzen eines Heroinentzugs ausgesetzt sein sollen.
Mit einem leisen »Shshsh« strich sie ihm mit einem Finger über die Brust, und er drückte sich dagegen, in Erwartung seiner nächsten Mahlzeit. Sie zog das MedLink-Handy aus ihrer Tasche und rief Jessie an, ihre Hilfsschwester. Sie sollte ihm sein nächstes Fläschchen bringen. Eigentlich hatte sie das dringende Bedürfnis, ihn aus dem Bettchen zu heben und ein wenig zu knuddeln, aber sie konnte sich zurückhalten.
Zu vielen der Babys hier hatte sie eine innere Beziehung, aber sie in den Arm zu nehmen und an die Brust zu drücken, ihren süßen Geruch einzuatmen – das hatte sie sich noch nie erlaubt.
Jetzt rief jedenfalls die Pflicht. Ihr vierter Patient mit einem Schädeltrauma würde bald aus der Notaufnahme kommen. Bis alles erfasst war, konnte es dann noch gut eine Stunde dauern.
Jessie kam mit dem Fläschchen und hob das Neugeborene hoch. Merry fühlte den Schmerz in ihrer Brust nachlassen, als sie sah, wie es sicher in ihren Armen gehalten wurde, gehegt und gepflegt und ernährt.
Sie erlaubte sich keinen weiteren Blick und ging geradewegs zum Schalter im Eingangsbereich, um die Aufnahme von Noah Walton vorzubereiten. Sie rief den Onlinebericht auf: Acht Jahre, Schädeltrauma, Autist, Mutter: Amy Jameson.
Merry runzelte die Brauen. T. J. hatte einen achtjährigen autistischen Neffen namens Noah. Merry überprüfte die angegebenen Notfallkontakte der Mutter. Tatsächlich – da stand T. J. Jameson.
Wie wahrscheinlich war es wohl, dass er schon heute seinen Neffen besuchen würde?
»Verdammter Mist!«, murmelte sie und merkte, wie sich ein rasender Schmerz in ihrem Kopf zusammenbraute.
Zielstrebig stiefelte T. J. eilig über den abgenutzten Linoleumboden der Kinderabteilung des Krankenhauses von Dogwood. Ziel: Zimmer 311. Noah war auf dem Spielplatz seiner Schule auf den Kopf gestürzt und hatte das Bewusstsein verloren. Der Notarzt hatte ihn schnellstens mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Das war vor zwei Stunden passiert, und T. J. war leider der Letzte von allen, die angekommen waren. Er hasste es, so spät bei seinem Neffen zu sein, es war bei seinem Job aber unvermeidlich. Er war bei einer Kuh gewesen, die kalbte, und das Ganze war ziemlich kompliziert geworden – eine Steißgeburt. Mittendrin hatte Amy angerufen. Solche Schwierigkeiten beim Kalben waren nicht selten, aber ohne Geburtshilfe war es möglich, dass Kuh und Kalb starben. Diesmal war alles gut gegangen, beide hatten überlebt und waren gesund, und das war das bestmögliche Ergebnis.
T. J. trat ins Krankenzimmer, und sein Herz krampfte sich zusammen, als er Noah im Bett liegen sah, bleich, mit geschlossenen Augen und ohne seine gewohnte Brille. Amy saß links neben ihm, hielt seine Hand in der ihren und sah mit geschwollenen und geröteten Augen auf ihn hinunter. Die Großeltern saßen auf der Besuchercouch und unterhielten sich flüsternd.
Alle Köpfe im Raum drehten sich zu ihm, als er hereinkam und sofort an das Bett seines Neffen trat. »Wie geht es ihm?«
»Er hat eine Gehirnerschütterung«, erwiderte Amy. »Er wird schon wieder, aber sie wollen ihn ein paar Tage zur Beobachtung dabehalten. Sie befürchten, dass er es uns nicht sagt, wenn es ihm schlechter gehen sollte.«
»Wie ist das passiert? Wo waren seine Lehrer?« T. J. beugte sich über das Bett und nahm die kleine Hand seines Neffen in seine. Noahs Vater hatte sich aus dem Staub gemacht, sobald bei seinem Sohn die ersten Anzeichen von Autismus sichtbar geworden waren. T. J. hatte versucht, seine Stelle einzunehmen, damit Noah eine männliche Bezugsperson hatte.
»Niemand hat ihn stürzen sehen. Eins der Kinder sah ihn dann auf dem Boden liegen.«
»Das klingt völlig abwegig. Er ist doch nie auf den Klettergerüsten herumgestiegen.«
Amy nickte. »Ich weiß, aber heute hat er es offensichtlich getan.«
»Er wird wieder gesund. Er ist ein kräftiger Kerl.« Trace Jameson, der Großvater, trat ebenfalls an das Bett, ein kräftiger, groß gewachsener Mann in weißem Button-down-Hemd, Jeans und abgetragenen Lederstiefeln.
Die Tür ging auf, und die Krankenschwester, die hereinkam, brachte T. J.s Blut aus völlig unpassenden Gründen in Wallung. Merry Atwater. Meine Güte, was für ein seltsamer Zufall!
Sie warf ihm rasch einen Blick zu, und es gelang ihr, nicht allzu überrascht auszusehen, oder sie überspielte ihren Schreck ziemlich gut. »Hallo, T. J.« Ein freundliches Nicken in seine Richtung, und schon wandte sie sich an Amy. »Hat sich irgendetwas verändert?«
Amy schüttelte den Kopf. »Sie beide kennen sich?«
»Wir haben uns gestern kennengelernt«, sagte Merry. Sie kontrollierte souverän den Infusionsschlauch, fühlte Noahs Puls und maß seinen Blutdruck.
Heute trug sie einen blauen Kittel, der über und über mit Ballons bedruckt war. Noah liebte Ballons, deshalb versuchte T. J. seinen Neffen dazu zu bringen, die Augen zu öffnen und sie anzuschauen.
»Haben Sie Kühe oder Pferde?«, fragte Amy.
»Nein, wieso?«, fragte Merry verwundert zurück.
»Na ja, T. J. ist Großtierveterinär. Ich hätte mir vorstellen können, dass Sie sich deswegen getroffen haben.«
»Nein, wir haben über das Sommercamp gesprochen, das er organisiert.«
Amys Augen leuchteten, und sie wollte schon weitersprechen, als T. J. sie unterbrach: »Wie steht es denn mit Noah? War er seit dem Sturz die ganze Zeit ohne Bewusstsein?«
Merry schüttelte den Kopf. »Jetzt schläft er, er ist nicht mehr bewusstlos. Er ist nach den ganzen Prozeduren in der Notaufnahme völlig erschöpft hier in der Kinderabteilung angekommen.«
Diese Augen! Ihr Ton war ganz sachlich und höflich, aber ihr Blick brachte ihn beinahe dazu, sich wegen ihrer Auseinandersetzung gestern zu entschuldigen, obwohl es gar nichts gab, wofür er sich hätte entschuldigen müssen.
Er brauchte doch nur jemanden mit Therapiehunden für sein Camp!
Amy ließ sich nicht ablenken. »Sie helfen T. J. also bei seinem Camp?«
»Nein, das wird wohl nichts«, antwortete Merry. »Ich bin bald zurück, um noch einmal nach Noah zu sehen. Wenn Sie mich vorher brauchen, drücken Sie einfach die Ruftaste.«
Amy nickte, und Merry verließ das Zimmer.
Als sie draußen war, sah Amy ihren Bruder seltsam an. »Was geht denn da vor zwischen euch beiden?«
»Sie war draußen auf der Ranch wegen eines Jobs im Camp, aber es ist nichts geworden. Ich will jemanden mit Therapiehunden, aber sie leitet eine Hunderettungsorganisation. Sie hat sich eingebildet, sie könnte ihre Pflegehunde einsetzen, und die Kinder helfen dabei, die zu erziehen und zu trainieren.«
»Das klingt doch super«, meinte Amy. »Und was ist dann passiert?«
»Ich will nicht, dass die Kinder mit einem Rudel halb wilder Pflegehunde spielen.« Da konnte schließlich so manches passieren, und das Risiko wollte er nicht auf sich nehmen.
»Wieso? Sie arbeitet schließlich die ganze Zeit hier mit Kindern, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendetwas zulässt, was sie in Gefahr bringen würde. Noah würde es bestimmt total gut gefallen, beim Erziehen eines Hunds mitzuhelfen.«
»Hund?« Ein dünnes Stimmchen kam vom Bett, und Noah blinzelte unter halb geschlossenen Lidern zu ihnen hoch.
»Hallo, Kumpel. Wie geht’s dem Kopf?« T. J. lehnte sich an das Bett, dessen Matratze nachgab, als seine Mutter sich dazusetzte und nach der Hand ihres Enkels griff.
Noah zuckte mit den Schultern, den Blick auf die sonnengelbe Wand gegenüber gerichtet.
»Tut weh, oder?«
Ein kurzes Nicken, dann zupfte der Junge an der Decke, in die er gewickelt war. Viel sprach er nie, besonders dann nicht, wenn er aufgeregt war, daran war T. J. gewöhnt. Er selbst war auch eher mundfaul, aber er machte sich sofort Sorgen, wenn der Junge sich ganz in sich zurückzog und gar nichts mehr sagte.
»Weißt du, ich bin auch auf den Kopf gestürzt, als ich ungefähr so alt war wie du jetzt«, erzählte T. J. »Wochenlang hatte ich deinen Großvater genervt, bis er nachgab und ich endlich King reiten durfte. Der warf mich ab wie einen Sack Kartoffeln, und ich bin mit dem Kopf am Zaun gelandet.«
»Stimmt genau«, sagte Trace und kam ebenfalls ans Bett seines Enkels. »Ein sturer kleiner Teufel, so war dein Onkel. Deine Mutter war übrigens genauso. Scheint in der Familie zu liegen.«
Noah strich mit dem Finger über die Bettdecke. »Hat es wehgetan?«
»So sehr, dass ich geweint habe.«
Noah drückte sich ins Kissen und sah weg. Seine kleine Hand zupfte noch immer an der Decke herum.
Emmy Lou beugte sich über ihren Enkel. »Wir sind so froh, dass dir nicht mehr passiert ist, mein Kleiner. Ruh dein Köpfchen aus, und sieh zu, dass es dir wieder besser geht.«
Noah nickte vorsichtig und schloss die Augen. Er kam gut zurecht, wenn alle Umstände gleich blieben, Änderungen und Aufregung warfen ihn aus der Bahn, deswegen hatte er jetzt schwer zu kämpfen. Dass er wegen seiner Umgebung nicht noch mehr durcheinander war, zeigte, wie schlecht es ihm ging.
Sobald Noah eingeschlafen war, gingen T. J. und Amy in die Cafeteria, um einen Kaffee zu trinken und ein Sandwich zu essen. Sie hatte Nachtschicht in Finnegan’s Pub gehabt und schlief normalerweise, während Noah in der Schule war.
»Ein Sturz auf den Kopf? Ich kann mir das einfach nicht erklären.« Sie rieb sich die müden Augen und nahm dankbar einen tiefen Schluck Kaffee.