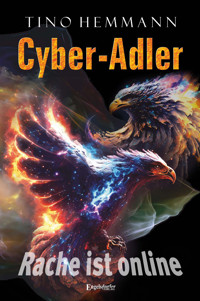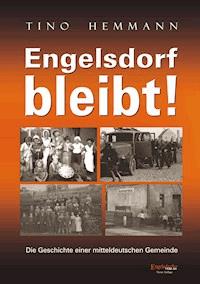Auf Wiedersehen, Bastard! (Proshchay, ublyudok!) 1 - Die Schlacht in Magnitogorsk E-Book
Tino Hemmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kurz nach dem Millennium wird Sorokins Sohn geboren. Ein weiteres blindes Kind in der umweltverschmutzten Stadt Magnitogorsk. Kurz darauf stirbt Galina, Sorokins Frau und Fedors Mutter, in einem der gigantischen, halbstaatlichen Metallurgiebetriebe. Als man ihm auch noch den blinden Sohn nehmen will, flüchtet Sorokin – bis zu jenem Tag Angehöriger der Spezialeinheit OMON – mit Fedor aus Russland, findet eine neue Heimat in der Nähe von Leipzig und wird dort im SEK integriert. Dreizehn Jahre später holt die Vergangenheit Anatolij Sorokin auf bestialische Weise ein. Mit Fedor reist er nach Moskau, um das Rätsel um den Tod seiner Frau zu lösen. Die Korrupten von damals kennen keine Gnade. Sorokin muss zum tötenden Einzelkämpfer werden, um einen Weg in die Zukunft zu ebnen – bis hin zur Schlacht in Magnitogorsk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Прощай, ублюдок!
Auf Wiedersehen, Bastard!
Tino Hemmann
AUF WIEDERSEHEN, BASTARD!
(1)
Прощай, ублюдок! (Proshchay, ublyudok!)
Die Schlacht in Magnitogorsk
Thriller
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Bis auf die historisch erwiesenen Tatsachen, sind alle Ereignisse und Personen in diesem Buch frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit Geschehnissen und Personen unserer realen Welt wäre daher zufällig und unbeabsichtigt.
Copyright (2013) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte bei Tino Hemmann
Cover: Tino Hemmann unter Verwendung der Fotos von
(Mann) © Alexander Trinitatov - Fotolia.com und
(Junge) © laurent hamels - Fotolia.com
ISBN 9783954888559
www.engelsdorfer-verlag.de
www.tino-hemmann.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Leipzig 10. Juni
Moskau 10. Juni
Leipzig 11. Juni
Moskau 11. Juni
Leipzig 11. Juni
Moskau 12. Juni
Leipzig 12. Juni
Berlin 12. Juni
Moskau 12. Juni
Leipzig 13. Juni
Moskau 13. Juni
Leipzig 13. Juni
Moskau 13. Juni
Leipzig 13. Juni
Moskau 13. Juni
Leipzig 14. Juni
Moskau 14. Juni
Leipzig 14. Juni
Moskau 14. Juni
Moskau 15. Juni
Leipzig 15. Juni
Moskau 15. Juni
Leipzig 15. Juni
Moskau 15. Juni
Magnitogorsk 15. Juni
Leipzig 15. Juni
Magnitogorsk 16. Juni
Moskau 16. Juni
Leipzig 16. Juni
Magnitogorsk 16. Juni
Leipzig 16. Juni
Magnitogorsk 17. Juni
Epilog 1. August
Über den Autor
Leipzig 10. Juni
Düster war es und geheimnisvoll. Mit scharrendem Geräusch schob sich eine Gestalt dicht über dem Boden auf dem Asphalt entlang, erhob das Haupt, den sterbenden Blick gerichtet auf die schäbige, mit bunten Plakaträndern beklebte und mit nicht gänzlich entfernten Graffitis besudelte Tür einer trostlosen Taverne, die sich eben in diesem Moment mit einem bizarr klingenden Knirschen öffnete. Eine blutjunge, zarte Blondine tauchte auf, im Licht der Straßenlaterne war nur wenig der von Tränen aufgeweichten, übermäßig aufgetragenen Schminke zu erkennen, die dünnen Waden des Mädchens schauten unten aus dem Prinzessinnenkleidchen heraus, unterhalb der graziösen Knöchelchen steckten die zarten Füße in modernen pinkfarbenen Teenieturnschuhen.
»Tom Dudley!«, rief die kindliche Frau heiser und schluchzend, sich neben dessen gebrochener Gestalt am Bordstein niederkniend, ganz ohne Rücksicht auf das herrlich und reich verzierte weiße Kleidchen zu nehmen. »Was nur ist mit dir geschehen? Haben sie dich nun doch noch verletzt?«
Dudley, ein nicht minder junger Mann, stöhnte übertrieben laut und so herzzerreißend, als wollte er alle Welt von seinem baldigen Dahingehen überzeugen. Er röchelte angestrengt, als hätte man ihm gerade die Kehle durchgeschnitten: »Joanna, es ist vorbei! Zwar wurde das Schmähliche besiegt, doch unserer Hinneigung ward keine Zukunft gegeben.«
Sie heulte beklagenswert auf: »Oh nein, mein Tom!« Und warf sich fast auf ihn. »Du wirst gänzlich gesunden, versprich mir, dass du bei mir bleibst für all die Zeit, die uns gegeben wurde, in dieser Welt der Lebenden weilen zu dürfen!« Rasend schaute sie sich um, als wäre bereits alles zu spät. »Hilfe!«, rief ihr zierliches, sich überschlagendes Stimmchen. »Hilfe! Hilfe! Hilfe! So helft doch meinem einzig wahren, tapferen und edlen Geliebten!«
Aber niemand konnte helfen, denn es war weit und breit keine andere Menschenseele zu sehen. Also blieb Joanna nichts weiter übrig, als heulend die eigenen Lippen auf die des sterbenden Jungen zu drücken und in ihn hinein zu flehen: »Bitte verlass mich nicht, Tom Dudley! Das darfst du nicht! Zum Sterben bist du viel zu jung! Ich bitte dich, bleib bei mir! Meine Zuneigung sei dir allzeit geschenkt! Nur bleib bei mir!«
Stille.
Dann aber, fast etwas unerwartet, ertönte die deutliche Stimme Dudleys ein letztes Mal: »Schon fühle ich die erbarmungslos brutale Kälte, die mein Herz für alle Zeit gefrieren lassen wird. Vorbei ist es mit der bezaubernden Wärme des Daseins. Oh ja! Es ist so weit, meine angebetete, vergötterte Joanna. Ich muss nun von dir gehen. Schau nur! Ich erblicke ihn bereits! Da ist er, der Gevatter Tod, er naht mit schnellen Schritten, im wehenden Leichentuchgewand, die blitzend geschärfte Sense zum letzten Schlag weit ausgeholt! Doch nehme ich mein Ende mit bestem Gewissen in Kauf, so viel Gutes erreicht zu haben. Denn all die abscheulichen Ganoven und Verbrecher, die unsere wundervolle Stadt tyrannisierten, konnte mein Schwert vernichten! Wenngleich ich selbst mit ihnen heimkehren muss, so jubelt doch allseits und trauert nicht! Was ist des einen Leben wert gegen all die Hoffnung, die er der Masse spenden wird? Leb nun wohl, Joanna, Liebste mein, leb wohl in der Obhut des Friedens, den ich dir zu geben versuchte. Leb wohl und vergiss mich niemals! Bis wir uns eines Tages im Himmel wiederfinden werden!«
Ein letztes Röcheln und Stöhnen entfuhr seinem Mund, dann rollte der Junge vom Bordstein auf die Straße und blieb tot und starr auf seinem Rücken liegen; ja die Zunge hing ihm aus dem offenen, atemlosen Mund.
Joanna fasste nach seiner Hand, hob sie an und ließ sie wieder fallen. »Gewiss, Tom Dudley! Der Jubel wird meine Tränen ersticken! Wie nur sollte ich dich jemals vergessen können?« Jetzt kreischte sie voller Leid und brach neben dem toten Geliebten zusammen.
Diesem letzten Akt folge fast eine Minute lang andauernde Todesstille.
*
Das derbe Klatschen zweier Hände beendete schlagartig die Ruhe, weitere Hände suchten einen Rhythmus, das beifällige Klatschen steigerte sich zu einem tobenden Applaus. Fast mittig in der ersten Reihe des Schultheaters sprang ein hünenhafter Kerl von seinem Stuhl auf und rief ungeniert: »Bravo! Molodzy! Bravo!« Und schon erhob sich das gesamte Publikum nach seinem Vorbild. Mehrere Scheinwerfer tauchten die Bühne in grellbuntes Licht, rasende Musik des Orchesters ertönte, durch die aus Pappe gebastelte Tavernentür hüpften die restlichen Schauspieler des Schultheaters, allesamt um die zwölf, dreizehn Jahre, während der Darsteller des Protagonisten Tom Dudley noch immer regungslos auf dem Bretterboden lag.
Der Mann aus der ersten Reihe, der über einen athletischen Körper verfügte, lediglich ein schwarzes ärmelloses Shirt unter dem zweifelsohne nicht billigen Jackett trug, sprang aus dem Stand auf die Bühne hinauf, lief zu dem am Boden liegenden Toten und schaute ernst von oben auf ihn herab.
Der Junge rührte sich noch immer nicht, ihm hing die Zunge nach wie vor aus dem Mund. Und doch zierte allmählich ein Grinsen sein Gesicht.
»Ich weiß, dass du hier bist, Papa!«
Sein Vater, der wegen seiner muskulösen Gestalt und seines ungezügelten Auftretens von einigen älteren Kerlen im Publikum mit neidvollen und von etlichen jungen Damen mit eher gierigen Blicken bedacht wurde, streckte dem Jungen seinen rechten Arm entgegen und ergriff den linken Oberarm des Kindes. »Gut gemacht, Fedor. Nur etwas unrealistisch.« Als er den Jungen mühelos nach oben zog, ihn kurz in die Luft hob und dann auf den Bühnenbrettern abstellte, spannten sich seine Oberarmmuskeln derart, dass man befürchten musste, die Substanz der Jackettärmel würde nachgeben.
»Unrealistisch?«, fragte der Junge mit kaum gebrochener hoher Stimme. »Wie meinst du das?«
»Ihr habt die Welt viel schlimmer dargestellt, als sie es in Wirklichkeit ist«, erklärte Anatolij Sorokin. »Aber ...«
»Aber was?«, fragte Fedor, während der Vater ihn zu einer mit den anderen Darstellern halbwegs synchronen, tiefen Verbeugung zum Publikum zwang.
»Aber zweifellos. Der Typ, der diesen Tom Dudley gespielt hat, war mit Abstand der Beste. Keine Frage.« Sorokins Blick huschte zu jenem blonden Mädchen, das unter dem noch immer anhaltenden Beifall des Publikums ihn und vor allem seinen Sohn unablässig anschmachtete. »Außer vielleicht ...«
»Papa?«
»Außer die Darstellerin der Joanna vielleicht, die war auch sehr, sehr gut. Wenigstens scheint sie das Küssen vollendet zu beherrschen.«
»Sie? Papa! Joanna heißt in Wirklichkeit Laura. Und die ist absolut nicht besser als ich!«, erwiderte der Junge. »Außerdem ... Du solltest nicht hier oben sein. Das ist peinlich.«
Sorokin spielte den Ernsten. »Peinlich? Bin ich dir tatsächlich peinlich? Ich habe dich gefühlte vierhundert Mal zur Probe gefahren. Also werde ich wohl das Recht haben, mal kurz auf diesen Brettern stehen zu dürfen.« Er wandte sich ab, während Fedor die Augen verdrehte. Noch bevor Sorokin von der Bühne sprang, rief er jedoch: »In zehn Minuten am Bühneneingang! Okay?«
Zehn Minuten später stand der Mann mit etlichen anderen Erziehungsberechtigten am Nebeneingang, zog an einer Zigarette und blickte wiederholt auf die goldene Armbanduhr. Der Frühsommerabend fühlte sich angenehm an, und obwohl kaum Wolken den Himmel bedeckten und einige Sterne funkelten, war es noch recht warm.
Die blonde Laura erschien strahlend, warf Sorokin, der fast doppelt so groß war wie sie, einen verschämt liebevollen Blick zu und lief zu einer Frau in vornehmer Abendgarderobe. Deren Blicke trafen sich mit denen von Sorokin, während sie leise fragte: »Ist das der Vater des Russen?« Keineswegs sprach sie leise genug, als dass es Sorokin nicht hätte hören müssen.
Verschämt nickte Laura der Mutter zu. Die wiederum nickte Sorokin zu und zwang sich eine beifällige Mimik ins Gesicht. Sorokin nickte ebenfalls, jetzt mit einem breiten, aufgesetzten Lächeln, das seine Zahnreihen blitzen ließ, und spürte den einatmenden Blick von Lauras Mutter. Dann verließen die beiden Damen die Bildfläche. Das Lächeln verschwand aus Sorokins Gesicht.
Russen. Ja! Russen aus Magnitogorsk. »Magnitogorsk? Davon habe ich ja noch nie gehört.« Redeten Amerikaner von bleihaltiger Luft, dann lächelte Sorokin bedauernd. Ausschließlich in Magnitogorsk war die Luft tatsächlich bleihaltig. Nicht nur mit Blei, auch mit Schwefeldioxid und vielen Schwermetallen war sie geschwängert, ebenso das Wasser. Die meisten Kinder wurden krank geboren. Doch in Moskau stießen die Hinweise der verantwortungsbewussten Leute auf ein höchst überschaubares Interesse. Solange die riesigen Magnitogorsker Werke Stahl, Erze und Metalle im geplanten Umfang lieferten, waren Umweltprobleme für die Regierung ohne ernstzunehmende Bedeutung. Die Stadt am Ufer des Ural war mit inzwischen über vierhunderttausend Bewohnern fast genauso groß wie die mitteldeutsche Stadt Leipzig, in deren Nähe Sorokin seit zwölf Jahren mit seinem Söhnchen Fedor lebte. Eben dieses, sein Söhnchen, das bei der Umsiedlung gerade mal ein winziges Häufchen Mensch gewesen war, wurde heute von einer äußerst attraktiven dreizehnjährigen Blondine aufs Ärgste umgarnt! Und das, ohne dass sie den Vater des Söhnchens um Erlaubnis gebeten hätte.
»Alles okay?«, fragte Sorokin und legte eine Hand um die Schultern des Jungen, um ihn zum Auto zu führen.
Fedor nickte.
»Und?«
»Was und?«
»Findest du sie nett?«
»Wen?«
»Wen schon? Diese Laura natürlich.«
»Papa!« Fedor kniff dem Vater in den linken Oberschenkel. »Laura ist ein Mädchen!«
»Gerade deshalb frage ich dich. Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Und du bist ein halbwegs nett anzuschauender Junge. Ich glaube, dass ihr ganz gut harmonieren würdet.«
Fedors Gesicht machte einen äußerst ernsten Eindruck. Und es schwieg.
Sorokin hielt den Jungen fest, denn sie waren am Fahrzeug angekommen. Er öffnete den grauen Sportwagen, dann die Seitentür und schob den Jungen auf den Beifahrersitz.
»Sag mir ein Mädchen, das einen blinden Jungen will«, flüsterte Fedor, als er saß.
Rasch warf Sorokin die Tür zu, lief um den BMW Z4 herum und stieg auf der Fahrerseite ein. Für den Sportsitz wirkte Sorokins Figur zu voluminös. Die Kniescheiben berührten fast das Lenkrad. Während er Fedor anschnallte, sah er Tränen, die über dessen Wangen rollten. Er startete den Wagen, fuhr sanft an und schwieg. Was hätte er zu diesem leidigen Thema auch sagen sollen?
»Ist sie wirklich so schön?«, flüsterte Fedor.
»Wenn sie bloß nicht so jung wäre. Leider ist sie viel zu jung für mich.«
Fedor lachte übertrieben heftig. »Kannst du dir das vorstellen, Papa? Sie hat mich ständig geküsst. Bei allen Proben. Manchmal wollte sie die Szene zwanzig Mal hintereinander wiederholen«, flüsterte er. Und nach einer Weile: »Schade nur, dass ich sie niemals sehen werde.«
Sorokin atmete tief durch. »Wenn du alt genug bist, wirst du sie sehen. Mit deinen Fingern. Du wirst ihr Gesicht berühren. Und alles andere auch.«
»Papa!«
»Was ist? Das macht man, wenn man sich liebt. Egal ob blind oder nicht. Und außerdem: Die Deutschen behaupten, Liebe würde blind machen. In dieser Beziehung hast du einen großen Vorteil. Du bist es dann längst gewohnt, blind zu sein.«
Der Junge schwieg und achtete auf die Bewegungen des Fahrzeuges.
»Ich bin stolz auf dich, Fedor. Und Mama wäre es ganz sicher auch.«
»Ich wünschte, Mama hätte das heute erleben können.«
»Ja.« Sorokin nickte, was der Junge nicht sehen konnte. »Das wünschte ich auch, mein Schatz. Aber leider ...« Das zweite leidige Thema.
Sekundenlang fuhr er unkonzentriert.
*
Sorokin sah ein Erinnerungsbild der gigantischen Plattenbaustadt Magnitogorsk, jener Stadt am magnetischen Berg im Ural. Erst Ende der zwanziger Jahre gegründet, wurde die Arbeiterstadt schon bald das Monument der sowjetischen Wirtschaftsmacht, entwickelte sich zum Standort der wohl weltweit größten Eisen- und Stahlproduktion, Grundstock russischer Militärkraft im Zweiten Weltkrieg, heute brachialer Profitlieferant der Stahlgiganten Russlands.
Wen bitte interessierte das Schicksal des unbedeutenden Kindes Fedor, das bereits blind geboren worden war, blind deshalb, weil die bleihaltige Luft das Erbgut der Eltern zerstört hatte? Ein Schicksal, das den Polizisten Anatolij Sorokin, Angehöriger der Polizei-Spezialeinheit OMON, die in Magnitogorsk für die Sicherheit der Großanlagen und eines Nuklearrestlagers zuständig war, und dessen Frau erwachen ließ. Fortan nahm Sorokin Kontakt mit Green Cross und kurz darauf mit einem Institut in New York auf, um die Gesellschaften für die ohnehin bekannten Umweltprobleme in Magnitogorsk aktiv zu sensibilisieren.
Zwei Tage vor Galina Sorokinas Einladungsreise zu einem Kongress in die Schweiz kam die fünfundzwanzigjährige Frau auf mysteriöse Weise ums Leben. Sie war eine einfache junge Mutter, die bis dahin in der Datenauswertungsstation einer halbstaatlichen Firma beschäftigt gewesen war, in der im Anschluss an Testbohrungen für den Erzabbau im Ural die Bohrkerne untersucht, ausgewertet und neue Bohrungen geplant wurden. Die Firmenleitung der Russisch Montanindustriellen Gesellschaft Magnitogorsk – im Russischen Russkoye Gorno-Promyshlennaya Kompaniya (RGPK) genannt – ließ den Vorfall zwar untersuchen, doch Galinas Tod wurde von der Magnitogorsker Kriminalpolizei sehr schnell als Unfall abgetan. Galina Andrejewna Sorokina quetschte ein Container zu Tode, ausgerechnet in einer Abteilung, in der sie sich normalerweise nie aufhielt.
Ihr Mann, der plötzlich mit seinem blinden, drei Monate alten Sohn allein war, bildete sich ein, die in Magnitogorsk ansässigen Stahlfirmen hätten seine geliebte Frau Galina umbringen lassen, weil sie Sanktionen der Umweltbehörden befürchteten. Er wandte sich an Alexander Komsomolzev vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB, der einst einer von Sorokins liebsten Schulfreunden in Magnitogorsk gewesen war und nun meist in Moskau arbeitete. Sascha – Komsomolzevs Rufname – versprach, sich der Sache anzunehmen.
Nur wenige Tage später erhielt Sorokin überraschend ein offizielles Schreiben der Vormundschaftsbehörde, in dem geschrieben stand, dass er seinen Sohn unverzüglich in staatliche Vormundschaft abzugeben habe. Das hätte für Fedor die grauenvollste Form einer Zukunft bedeutet, denn die Heime, wo auch immer sie in der russischen Föderation angesiedelt waren, in denen blinde Kinder aufbewahrt wurden, zählten zu den unerträglichsten in der Welt. Hinzu kamen überbezahlte Adoptionen zum Teil aus dem Ausland, so dass Kinder auf Nimmerwiedersehen verschwanden. All dessen war sich der junge Vater durchaus bewusst.
Hals über Kopf flüchtete Sorokin mit seinem kleinen Fedor zunächst in die Ukraine, von dort aus in die Schweiz, wo man den jungen Vater und sein blindes Kind jedoch nicht behalten wollte. Die Deutsche Botschaft versprach Hilfe, doch auch hier griffen die Gesetze zur Zuerkennung von Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Erst als die Behörden von Sorokins OMON-Zugehörigkeit in Russland und dessen guter und auch deutschsprachiger Ausbildung erfuhren, ebnete sich ganz plötzlich ein Weg durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, auf dem Sorokin die Asylanträge nicht ausfüllen, sondern nur noch unterschreiben musste. Blitzartig fand er sich in einem Büro des Bundesnachrichtendienstes wieder, eine nette Dame – perfekt auch in Russisch – sprach mit ihm die Möglichkeiten durch, die ein junger, gut gebauter und physisch wie psychisch belastbarer Russe von Deutschland erwarten konnte. Fortan besuchte Sorokin eine Polizeischule und trainierte Kraft und Wissen für seinen Einsatz in einer SEK-Einheit, wo er im Allgemeinen nur zu präventiven Maßnahmen wie dem Schutz hoher Persönlichkeiten bei öffentlichen Auftritten eingesetzt wurde. Er arbeitete aber auch eng mit den Leuten der Leipziger Kripo zusammen, verdiente gutes Geld und wohnte unweit einer Stadt, von der ihn nur wenige im Sozialismus entstandene Stadtteile an Magnitogorsk erinnerten, in einem netten Häuschen in dörflicher Idylle im Freistaat Sachsen.
Galina würde er niemals vergessen können. Praktisch jede Nacht brach die tiefe, schmerzende Wunde der Erinnerung in ihm auf. Denn sah Sorokin seinen Sohn, dann sah er auch sein Mädchen, Fedor wurde seiner Mutter unübersehbar ähnlich. Die fast schwarzen, strahlenden, wenngleich nutzlosen Kulleraugen, die Grübchen neben dem Kinn, die dunklen, dichten Haare und vor allem die Mundpartie mit den prallen herzförmigen Lippen – all das war Galina. Oft kniete Sorokin am Bett des schlafenden Sohnes, beobachtete ihn lange und heulte plötzlich los. Irgendwann schlich er zum Kühlschrank, nahm eine Flasche Wodka, trank, bis sie leer war, und fiel – egal wo er sich gerade aufhielt – ins Koma.
Sorokin bereute es nicht, die Heimat verlassen zu haben. Nirgends in der Welt hätte man seinem Sohn mehr Aufmerksamkeit und Förderung geboten, außer eben in diesem Land, in dem zweifellos auch nicht alles Gold war, was glänzte. Doch ging man hier auf den blinden Jungen ein, hier entwickelte er sich, als gäbe es seine Blindheit nicht.
Fedor bewegte sich mit Hilfe der Echoortung fast ungehindert auch in völlig unbekannten Gegenden. Durch das ständige Schnalzen mit der Zunge erkannte er fast alle Hindernisse. Er benutzte zudem einen hochmodernen Blindenstock, verließ sich auf Ohren und Nase, arbeitete und spielte am Rechner ebenso wie andere, sehende Kinder, besaß auf seiner Seite im sozialen Netzwerk Tausende Freunde, lernte fleißig oder weniger fleißig und beschäftigte sich oft mit seinem Handy.
Doch die größte innere Freude stieg in Sorokin stets dann auf, wenn er seinen Sohn herzlich lachen hörte.
*
»Es wird keine weiteren Aufführungen geben«, flüsterte Fedor voller Leid.
Im steilen Winkel blickte Sorokin hinauf zur roten Ampel. Sein rechter Fuß berührte sanft das Gaspedal. »Das ist schade, aber nicht zu ändern. – Hast du Kontakt zu Laura?«
»Nein«, raunte Fedor und errötete. »Und außerdem habe ich ihr Gesicht schon berührt.«
Sorokin lächelte zwar, sagte jedoch nichts. Dumme Frage.
Fast gleichzeitig ertönten zwei Klingelmelodien. Sowohl Fedors Handy als auch Sorokins Freisprechanlage meldeten eingehende Anrufe.
»Ist sie das?«, fragte der Fahrer und startete, denn die Ampellampen sprangen auf Grün.
»Nur eine SMS.«
»Dafür, dass ihr keinen Kontakt habt, hat sie dir verdammt schnell geschrieben.« Wieder lächelte Sorokin. Dann berührte er einen Knopf und sagte laut: »Privet!«, während Fedor die Nachricht auf dem eigenen Handy von einer monotonen Frauenstimme vorlesen ließ und dabei lauschte.
Eine raue, alte Stimme erklang aus den Bordlautsprechern. »Hallo Ameise, hier ist der alte Schnüffler.«
»Ameise« war das geläufige Pseudonym für Anatolij Sorokin in Kreisen des SEK, was sich bis zur Kripo herumgesprochen hatte. Der Anrufer war kein Geringerer als Hans Rattner, ein ewig stoppliger, alter, erfahrener Hauptkommissar, der nach jedem Mord in der Stadt zugegen war, denn er leitete seit Jahren die Mordkommission. Sorokin war übrigens die seltene Ausnahme, die bei der Aussprache des Namens »Rattner« das »e« betonte.
»Kommissar Rattner. Was gibt es?«, fragte Sorokin erstaunt. »Um diese Uhrzeit habe ich keinen Anruf mehr erwartet.«
»Ich brauche Ihre Hilfe. Tut mir leid, wenn ich störe. Es ist dringend.«
»Kein Problem. Nur ... der Kleine ist dabei.«
»Ich bin kein Problem, Papa«, flüsterte Fedor dazwischen.
»Südallee 17. Lass den Jungen im Wagen. Er muss das hier nicht sehen.« Rattner erkannte sofort die Dummheit in seinem eben geäußerten Satz. »‘tschuldigung. Mit ›nicht sehen‹ meine ich selbstverständlich ›nicht mitkriegen‹.«
Der rechte Zeigefinger Sorokins wollte bereits die Adresse ins Navi eingeben, doch dann zögerte er und ließ es bleiben.
»Sagten Sie wirklich Südallee 17? In sechs Minuten bin ich da«, sprach er und brach die Verbindung ab.
*
»Ich beeile mich. Okay?« Sorokin fuhr dem Jungen über das Haupt. »Alles klar bei dir?«
»Geht schon.«
»›Geht schon‹ heißt, dass du mich etwas fragen willst.«
»Ihre Eltern haben Laura erlaubt, mich einzuladen. Morgen, am Samstag, zum Kaffee.«
Einen Moment lang zögerte Sorokin. Dann sagte er: »Klar doch. Ich bring dich hin. Okay?«
Fedor atmete erleichtert auf. »Beeil dich bitte, Papa. Ich bin müde.«
»Versprochen.« Sorokin stieg aus dem Wagen, der zwischen zwei Polizeifahrzeugen parkte, deren schrecklich blendende Rundumleuchten nach amerikanischer Manier die erweiterte Umgebung in blaues Licht tauchten. Er sah sich flüchtig um und lief zum Portal der wie ein Fußballstadion beleuchteten Gründerzeit-Villa im Stadtteil Leutzsch. Am Eingang nickte ihm ein Polizist zu, ohne ein Wort zu verlieren. Das Untergeschoss hatte die Spurensicherung bereits für sich gepachtet und ganz oben, auf einer breiten Treppe, stand Rattner, wie gewohnt mit altem 20er-Jahre-Mantel und rundem Chicago-Hut bekleidet, und hob grüßend die rechte Hand.
Mit zwei Stufen pro Schritt eilte Sorokin hinauf.
»Und, wie hat er sich geschlagen?«, fragte Rattners tiefe, alte Stimme, nicht so, als wenn es ihn nicht interessieren würde. Rattner kannte Fedor seit Jahren und nahm an dessen Entwicklung einen regen und gut gemeinten Anteil.
»Es hätte nicht besser laufen können. Bombastisch. Die meisten Leute im Publikum haben wahrscheinlich nicht einmal bemerkt, dass der Junge blind ist.« Sorokin schaute sich um. »Es gibt allerdings ein neues Problem.«
Rattner schob einen Beamten zur Seite und zeigte auf eine offen stehende Zimmertür. »Ist es ernst?«
»Ich glaube, ja. Mein kleiner Fedor ist zum ersten Mal richtig verliebt. Zum allerersten Mal in seinem Leben. – Was ist hier passiert?«
Sie betraten den Raum, Rattner antwortete nicht auf Sorokins Frage. Vier in sterilen Anzügen steckende, auf dem Boden kniende Mitarbeiter der Spurensicherung schauten gleichzeitig auf.
»Und, wie ist die Schwiegertochter so?«, fragte Rattner.
»Süß. Nur ...«
Einer der Männer von der Spurensicherung zog die weiße Abdeckung von einem der beiden menschlichen Körper, die vor einem Kamin lagen. Auf Boden, Kaminsteinen und der angrenzenden Wand waren Blut und Gewebefetzen zu sehen, als hätte hier ein Massaker stattgefunden.
»Nur?«, raunte Rattner.
»Sie kann sehen.« Sorokin ging wortlos in die Knie. Auf dem Boden lag der Körper eines toten Kindes. Ein schmächtiger Junge, etwa zehn Jahre. Sein Kopf ruhte seitlich in einer Blutlache. In der Stirn des wie im Schlaf wirkenden puppenhaften Gesichtes befand sich ein kleines Einschussloch, sein Hinterkopf war zerfetzt.
»Mein Gott, Igor! Chto eto ...?«, hauchte Sorokin, dessen Gesicht augenblicklich blass wurde.
»Zwei Hinrichtungen aus nächster Nähe«, sagte Rattner, der von oben herab auf das Kind starrte. »Der Junge und sein Kindermädchen.«
Eine Beamtin in Weiß zog ein weiteres Laken zur Seite. Der regungslose Körper einer jungen Frau kam zum Vorschein, somit auch ihr Kopf, mit den gleichen Erschießungsmerkmalen wie bei dem des Kindes.
»Der kleine Igor!« Mit einem geflüsterten »Bosche Moi ...« erhob sich Sorokin, der damit beschäftigt war, ein Erbrechen zu vermeiden. »Was ist das für eine verfluchte Sauerei?«
»Sergei Michailowitsch Smirnow. Das hier war sein einziger Sohn Igor. Neun Jahre, besucht seit drei Jahren eine deutsche Schule hier in der Stadt. Das Kindermädchen, Anja Weiß, siebzehn Jahre, wurde von einer Agentur vermittelt und passt seit Monaten auf Smirnows Kronprinzen auf.«
»Das sind keine Neuigkeiten für mich!« Mit der linken Hand öffnete Sorokin einen Fensterflügel. Unten sah er seinen BMW. Der Innerraum war dunkel. Fedor benötigte kein Licht. Die frische Nachtluft tat gut, Sorokin atmete tief durch. »Ich kenne dieses Haus. Ich weiß das alles. Aber warum ...? Wo hält sich Sergei momentan auf?«, fragte er.
»Das wollen wir gerade herausbekommen. Der Wirtschaftsfunktionär Smirnow koordiniert Geschäfte zwischen Deutschland und Russland. Nicht die kleinen Dinge, sondern die ganz großen. Mehr weiß ich auch noch nicht. Smirnow ist einer Ihrer Landsmänner. Deshalb wollte ich, dass Sie sich das anschauen. – Sie kennen ihn tatsächlich?«
Das Gesicht von Sorokin zerfiel mehr und mehr. »Sergei ist Russe, ich bin Russe. Natürlich kennen wir uns. Und Igor ...«
»War ein Freund von Fedor?«
Sorokin nickte. Dieses Nicken war Rattner vertraut. Es hieß: »Ich weiß nun Bescheid, brauche meine Ruhe und melde mich kurzfristig, wenn ich etwas erfahre.«
»Tut mir leid. Bringen Sie es Fedor schonend bei.« Er reichte Sorokin die Hand, der den Gruß erwiderte, einen letzten Blick auf die Leiche des Jungen warf und gerade gehen wollte, als Katie den Raum betrat. Katie, die modelverdächtige, strohblonde, superschlanke, langbeinige, allerdings abseits des Bettes stets und ständig gefühllos auftretende Assistentin von Hauptkommissar Rattner, die Sorokin einen Blick zuwarf, ein ernstes Gesicht aufsetzte und sprach: »So etwas habe ich noch nie erlebt. Wie in einem schlechten Hollywoodfilm! So eine verfluchte Schweinerei. – Smirnow ist eine Woche in Moskau. Er sollte übermorgen zurückkehren.«
»Fedor hat nicht sehr viele gute Freunde. Und Igor war einer der besseren.« Mit diesen Worten verließ Sorokin den Raum und schlich die Treppe hinunter.
Unten, im Eingangsbereich, stand Fedor – der es im Wagen nicht ausgehalten hatte – neben einem Beamten. Seine Nasenflügel bebten, er saugte Gerüche in sich ein.
Wortlos nahm Sorokin den Sohn an die Hand und verließ mit ihm die Villa. Nachdem sie in den BMW eingestiegen waren, atmete Sorokin erneut tief durch.
Fedor griff nach der Hand des Vaters. »Du sollst mich um drei Uhr bei Laura abgeben.« Der Junge streichelte über Sorokins kalte Faust. »Was ist passiert, Papa? Alle klingen so aufgeregt. Und Katie hat mir nicht mal richtig Guten Tag gesagt.«
»Der kleine Igor ...«, hauchte Sorokin, während sein Kopf schmerzerfüllt auf das Lenkrad sank.
»Was ist mit Igor?«
»Er ... Du wirst ihn nicht wiedersehen können.«
Sichtlich traurig fragte Fedor: »Hat ihn Onkel Sergei zurück nach Russland gebracht?«
Einen Moment benötigte Sorokin. Es lief blitzschnell in seinem Gehirn ab: Er könnte den eigenen Sohn belügen, der sofort über Handy oder über ein soziales Netzwerk mit Igor und Sergei Kontakt suchen würde und spätestens dann mit neuen bohrenden Fragen aufwarten könnte.
»Nein«, sagte er deshalb. »Igor und auch Anja wurden umgebracht. Sie wurden beide ermordet. Heute Nacht. Sie leben nicht mehr.« Nun streichelte Sorokin die Hand des Sohnes, sah wieder auf, sagte: »Es tut mir sehr leid, Fedor«, legte die kleine Hand zur Seite und startete das Fahrzeug.
»Du meinst, beide sind für immer tot?« Aus Fedors Augen traten Tränen im Dutzend. Wenigstens weinen konnten diese Augen. Er flüsterte: »Papa, findest du immer noch, dass unser Theaterstück unrealistisch ist?«
Der Vater verheimlichte die Antwort.
Sorokin fuhr hart an der Grenze zum Verkehrsrowdy aus der Stadt, gab auf der Autobahn Vollgas und blinkte – entgegen seiner Gewohnheit – einen Audi an, der mit Tempo 180 die linke Spur blockierte. Adrenalin sorgte für einen hohen Puls und für niedrige Selbstkontrolle.
Igor und Fedor waren bereits seit anderthalb Jahren gute Freunde. Sie hatten sich bei den Integrationsnachmittagen kennengelernt. Die Villa in der Südallee 17 kannte Fedor in- und auswendig. Die russischen Väter Smirnow und Sorokin hingegen hatten oft genug so manches Glas geleert, während die Jungs im Haus getobt hatten.
*
»Wer hat die Morde gemeldet?« Endlich, nach dem vierten Glas Wodka, hatte Sorokin über eine spezielle Nummer bei Rattner angerufen.
»Es war ein anonymer Anruf in der Notrufzentrale. Männliche, elektronisch entstellte Stimme. Die Spezialisten arbeiten daran.«
»Schicken Sie mir den Mitschnitt?«
»Sie werden mich lynchen, wenn das rauskommt. Trinken Sie gerade?«
»Es wird nicht rauskommen. – Ich trinke Wodka. Fedor hat auch Wodka getrunken. Jetzt schläft er endlich.«
»Sie sollten dem Kind keinen Alkohol geben. – Ich saufe gerade Whisky. Und da wir beide ein Glas halten, sollten wir uns endlich duzen. Okay?«
»Hans, du bist der alte Mann, der das Recht dazu hat, so etwas vorzuschlagen. Habt ihr Sergei informiert?«
»Man sagt nicht ›der alte‹, sondern ›der ältere Mann‹, Anatolij. – Wir haben es mehrfach probiert, konnten ihn jedoch nicht erreichen. Interpol versucht momentan Sergei Michailowitsch Smirnow ausfindig zu machen.«
»Sergei hat oft vom Russia Tower in Moskau City gesprochen. Er sagte, das wäre eine einmalige Chance für deutsche Bauunternehmen.«
»Moskau City?«
Sorokin goss sein Glas erneut voll und prüfte mit einem Blick, wie viel Wodka noch in der Flasche war. »Das Moskauer Internationale Handelszentrum. Der Bau an Moskwa City wurde 1992 begonnen. Es entstand direkt an der Moskwa. Riesige Luxus-Tower, einer neben dem anderen. Das zweithöchste Bauwerk der Welt sollte der Russia Tower werden, ein absolutes Prestige-Projekt, einhundertachtzehn Stockwerke, über sechshundert Meter Höhe, Kosten anderthalb Milliarden US-Dollar, mehr als hundert Fahrstühle wollte man einbauen. 2007 wurde mit dem Bau offiziell begonnen, sie schafften nicht mal das Fundament, dann zerschlug die Finanzkrise das Konsortium der Geldgeber. 2012 beschloss die Moskauer Regierung, den Bau in einer abgemagerten Form fortzusetzen. Wir haben viel darüber philosophiert.«
»Ich verstehe. Also vertritt Smirnow die deutschen Anbieter?«
»Es hat den Anschein, als wäre das so. Ich wage mich jedoch daran zu erinnern, dass das Konsortium eher einen internationalen Anstrich hat.«
»Also ein Wirtschaftskrieg der Bau-Mafiosi?«
»Das wäre nicht mehr als eine treffende Vermutung.«
Moskau 10. Juni
»Sergei Michailowitsch Smirnow?«
Der kräftige Mann im Hotelzimmer betrachtete den kindlichen Pagen, der mit seiner bunten Kappe auf dem Kopf wie ein frecher Ersatzclown aus einem mittelprächtigen russischen Zirkus wirkte. »Ja. Was willst du?«
Aus sicherer Entfernung überreichte der Page dem Geschäftsmann einen verschlossenen Umschlag. »Der ist für Sie. Ich soll ihn nur abgeben.«
Smirnow nahm den Brief an sich. Der Page rührte sich nicht von der Stelle. Er hielt stattdessen die Hand auf. Was blieb Smirnow, als dem Jungen ein paar Rubel zu übergeben, damit er endlich verschwinden würde? »So leicht möchte ich auch mal mein Geld verdienen«, raunte er.
Sogleich steckte der Page das Geld ein. »Glauben Sie, mein Herr, leicht ist es nicht. Ich muss ein Jahr für den Hotelbesitzer arbeiten, ohne dass ich auch nur eine Kopeke kriege.« Er schickte sich an zu gehen.
»Und warum musst du das tun?«, fragte Smirnow mit faltiger Stirn.
»Mein Vater schuldet dem Hotelbesitzer Geld aus nicht gezahlten Mieten«, sprach der Page. Dann lächelte er. »Aber was soll’s. Hier ist es trocken und im Winter wärmer als auf der Straße. Und fast jeden Tag gibt’s was zu futtern.« Der Junge verschwand in einem Aufzug.
Smirnow ging bedächtig langsam in sein Zimmer zurück. Er hätte den Jungen fragen können, wer ihm den Brief gegeben hatte. Doch dazu war es jetzt zu spät. In diesem riesigen Hotelkomplex würde er den Pagen wahrscheinlich niemals wiederfinden.
Ganz offiziell nannte sich Smirnows Einmannunternehmen »Deutsch-Russische Wirtschaftsagentur SMS«, wobei SMS die Initialen seines Namens verkörperten. Eine Frau Smirnowa hatte sich vor knapp sieben Jahren von ihm scheiden lassen, den damals dreijährigen Igor musste sie beim Exgatten zurücklassen, die beiden älteren Mädchen behielt sie.
Smirnow ließ sich in einem urigen Sessel nieder und öffnete den Brief, nachdem er mehrmals die Fingerkuppen mit der Zungenspitze befeuchtet hatte.
Erwartungsgemäß war der Inhalt in russischer Sprache verfasst. Kurz und knapp. »Ich empfehle Ihnen, dass Sie vor dem Ausschuss zur Fortführung der Baumaßnahmen am ›Башня Россия‹ das deutsche Angebot als unhaltbar einschätzen und zurückziehen. Ich warne Sie nur einmal.« Und unten stand in großen kyrillischen Lettern:
»ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ – В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ!«
»Fürchtest du die Wölfe, dann geh lieber nicht in den Wald«, flüsterte Smirnow unbeeindruckt. Dann kratzte er sich am Kinn. Schließlich nahm er sein Handy und wählte eine Nummer. Er sprach deutsch mit dem Mädchen am anderen Ende, per Luftlinie 1.730 Kilometer entfernt. »Anja? Ich hatte versprochen anzurufen. Hier ist alles in Ordnung. Bei euch auch? Du musst heute Nacht nicht bei Igor bleiben.«
»Aber Herr Smirnow, ich ...«
Smirnow äußerte sich in kurzen Sätzen: »Gib meinem Jungen einen Kuss und grüß ihn ganz lieb von seinem Vater. Das Gespräch kostet viel Geld. Du hast alles verstanden, Anja?«
»Ja, Herr Smirnow, aber ...«
»Dann ist ja gut.« Er unterbrach die Verbindung und wählte sogleich eine andere Nummer in Moskau. »Artjom? Ich brauche dich hier. Baltschug Hotel. Sofort.«
*
Siebenundfünfzig Minuten später. Artjom stand in der Zimmertür.
Ein unbeschreiblicher Hüne. Auch er arbeitete als Einmannunternehmen, nannte sich selbst »Der Unschlagbare« und hatte einst seine Kraft dem KGB gespendet. Als man jedoch den sowjetischen Geheimdienst 1991 zerschlug und die beiden »lächerlichen Vereine« – wie sich Artjom auszudrücken pflegte – FSB und SWR gründete, weil der KGB angeblich den gesamten Sowjetstaat übernehmen wollte, sollte Artjom im »Sluschba Wnechney Raßwedki« integriert werden, dem neuen Auslandsnachrichtendienst der Russen, was dem SWR jedoch nicht gelang, denn Artjom hatte als damals Vierundzwanzigjähriger seine ganz ureigenen Vorstellungen von der persönlichen Zukunft, und die deckten sich nicht einmal ansatzweise mit denen eines russischen Auslandsnachrichtendienstes. Also gründete er sein eigenes Unternehmen, in dem er sich und seine Kraft anderen zur Verfügung stellte. Er war niemals nur mit Muskeln bewaffnet und konzentrierte sich auf drei Dienstleistungen, die da waren privater Personenschutz, Einschüchterungsarbeit, die er liebevoll »Obraßowanie Taktiki« nannte, sollte heißen »taktische Erziehung«, und schlussendlich sein teuerstes Angebot »Taktitscheskowo Liquidazii«, also die Liquidierung. Selbstverständlich gab es in Artjoms Umfeld keinen Preiskatalog und er arbeitete häufig allein und in einem klar abgesteckten Rahmen. Doch all seine Aufträge bewerkstelligte er so geschickt, dass die beiden Herren vom FSB, die ihn im Auftrag des Inlandgeheimdiensts beschatteten, bereits seit Jahren ein Phantom ohne jeden Beweis jagten. Einen Nachnamen benutzte Artjom, dessen Herkunft völlig unklar war, übrigens niemals.
»Bitte tritt ein.« Smirnow umarmte den Hünen und gab ihm die gewöhnlichen Freundschaftsküsschen auf die Wangen. Er hatte Artjom in der Vergangenheit bereits viel Geld zahlen müssen, wobei es ausschließlich um sehr subtile Aufträge gegangen war, Diese hatte der Hüne stets zur vollsten Zufriedenheit seines Auftraggebers erledigt. Gemeinsame Umtrünke sorgten derweil für eine innige und bleibende Freundschaft. Artjom trug auch heute praktische militärische Kleidung und halbhohe Fallschirmspringerstiefel. Einer Gesinnung folgte er angeblich nicht.
Der Zweimetermann Artjom ging zielstrebig zur Bar des noblen Hotelzimmers und goss sich einen kristallklaren Wodka ein. »Du solltest auch einen trinken, Sergei. Du siehst verdammt beschissen aus.«
»Ich danke deiner Ehrlichkeit. Was glaubst du, was ich die ganze Zeit tue?« Ohne zu zögern reichte ihm Smirnow den anonymen Brief. »Lies das bitte.«
Mehrmals überflog Artjom den Zettel. »Hast du eine Vermutung, wer hinter diesem Schwachsinn stecken könnte?«, fragte der Hüne schließlich, goss teuren Wodka in ein weiteres Glas und reichte es dem Geschäftsmann.
Der trank das Glas in einem Zug aus. »Wie soll ich es sagen. Im Grunde genommen habe ich mehrere Vermutungen.«
Beide setzten sich, Artjom legte die Füße samt Tretern auf ein hochglanzpoliertes kleines, güldenes Tischchen, das als Beistelltisch für Getränke dienen sollte. »Und die wären?«
»Hier, schau dir das an.« Smirnow nahm ein buntes Prospekt zur Hand, ließ es auf den Tisch zwischen beide Herren gleiten und lehnte sich zurück. »Ich schulde dir ein paar Erklärungen. Sollte ich dich langweilen, dann sag es einfach.«
Lächelnd gab Artjom von sich: »Da ich für meine Zeit bezahlt werde, würde ich ein Dummes tun, dich zu unterbrechen, Sergei.«
Ausführlich erklärte ihm der Geschäftsmann die Situation und dass er ein von deutschen Unternehmen geleitetes internationales Konsortium vertrete, dass es noch zwei russische und einen internationalen Anbieter gebe, die alle behaupten, die Bauarbeiten am Russia Tower ordentlich beenden zu können, wobei das deutsche Angebot für die Moskauer Verwaltung wahrscheinlich das interessanteste sein könne, da es vorsehe, den Tower in die ursprünglich geplante Höhe wachsen zu lassen.
Artjom holte tief Luft. »Einer der Anbieter will das deutsche Angebot also sabotieren. Das leuchtet mir ein. Aber welcher?«
»Wahrscheinlich werden wir das erst nach der Angebotsübergabe erfahren.«
»Wann und wo?«
»Im Tower 2000 in Moskau City.« Smirnow schob ein Blatt Papier zu Artjom hinüber. »Am 12. Juni, 12:00 Uhr bin ich geladen. Der Moskauer Bürgermeister wird anwesend sein und die halbe Stadtverwaltung. Es ist ein formeller Akt mit ausgewählten Presseleuten, die praktisch nicht berichten dürfen, bis der Deal in Sack und Tüten ist. Mir werden zwanzig Minuten gewährt, um das Angebot zu übergeben. Der deutsche Architekt Prof. Dr. Helge Grollmann wird mit anwesend sein, falls die Fragen zu speziell werden.«
»Wer ist das?«
»Er wurde mir von BDI und Bund zur Seite gestellt. Wir kennen uns seit Langem. Ein erfahrener Sesselquetscher aus dem Institut für angewandte Hochbautechnologie Potsdam. Wir hatten nur zwei Mal telefonischen Kontakt, er hat auch die Unterlagen auf sachliche Richtigkeit geprüft.«
»Wann triffst du diesen Grollmann?«
»11:45 Uhr im Foyer des Towers 2000.«
»Okay. Ich werde mir ein Zimmer nebenan besorgen und mich ein wenig umhören. Mehr können wir im Moment nicht tun.«
Leipzig 11. Juni
»Fedor?«
Es war Samstag, 10:30 Uhr. Sorokin war bereits um 6:00 Uhr von seinem Wecker aus dem Schlaf gerissen worden. Nun war auch Fedor aus dem Tiefschlaf erwacht. Selbst wenn er sich durchaus einer pädagogischen Untat bewusst gewesen war, hatte Sorokin seinen Sohn in der Nacht mit reichlich Wodka ruhiggestellt. Fedor hatte es im Heulen fast zerrissen, als er sich im Bett liegend der Tragweite des grauenvollen Doppelmordes bewusst wurde.
»Papa?« Der Junge stand im Schlafanzug hinter dem Bürostuhl des Vaters und hielt sich an der hohen Lehne fest. »Was ist?«
»Bitte hör dir das an.« Sorokin zog den Sohn herum, der sich auf seinem Oberschenkel niederließ, und setzte ihm Kopfhörer auf.
Fedor lauschte. Ein Rauschen ertönte. Und dann die hässlich verzerrte Stimme: »Ich wollte nur sagen, es gab eine Schießerei. In der Südallee 17.« Wieder ein kurzes Rauschen. »Ich wollte nur sagen, es gab eine Schießerei. In der Südallee 17.« Mehrmals folgte der gleiche Wortlaut.
Dann nahm Sorokin dem Jungen die Kopfhörer ab. »Kennst du zufällig die Stimme?«, flüsterte er.
»Nein«, antwortete Fedor. »Muss ich sie kennen?«
Sorokin drückte den Jungen an sich. »Musst du nicht, mein Schatz.« Er dachte kurz nach. »Was meinst du, was für ein Mensch steckt hinter dieser Stimme?«
Nun setzte sich Fedor die Kopfhörer selbst auf und lauschte lange.
»Ich wollte nur sagen, es gab eine Schießerei. In der Südallee 17.«
Sorokin wartete geduldig. Als Fedor die Kopfhörer wieder absetzte, flüsterte er: »Ein Mann, ein Deutscher, schon etwas älter.«
»Sehr alt?«
»Nein.«
»Um die dreißig?«
»Älter.«
»Vierzig?«
»Vielleicht.«
»Hast du einen Dialekt erkannt?«
»Ich weiß nicht. Nur ... Ja. Der neue Bürgermeister redet so.«
»Der neue Bürgermeister? Welcher neue Bürgermeister?«
»Ein Grüner. Es kam in den Nachrichten.«
»Ein grüner Bürgermeister? Du meinst den Stuttgarter? Meinst du den Bürgermeister in Stuttgart?«
»Ja. Der ist doch von den Grünen?«
»Ist er. Und er redet schwäbisch. Der Anrufer hat also einen schwäbischen Dialekt?« Sorokin setzte sich selbst die Kopfhörer auf. So sehr er seine Ohren auch bemühte, er konnte weder das Alter des Anrufers nachvollziehen noch irgendeinen Dialekt in der Stimme erkennen.
»Ganz sicher?«
»Hm.« Der Junge blickte geradeaus, als könne er den Bildschirm des Computers sehen, vor dem beide saßen.
»Fedor, bist du dir ganz sicher?«
»Ja. Bin ich.«
»Okay.« Sorokin ließ den Sohn vom Schoß rutschen. »Zieh dich jetzt an und komm dann frühstücken.«
»Ich will duschen. Denkst du daran? In vier Stunden und zweiundzwanzig Minuten musst du mich bei Laura abgeben.«
»He, kleiner Mann«, Sorokin lachte und hielt den Jungen fest. »Du zählst die Zeit rückwärts?«
Fedors Gesicht errötete wieder einmal. »Natürlich nicht«, sagte er. »Ich will nur nicht, dass wir zu spät kommen.«
»Ich weiß, das wäre dir peinlich. Du bist eine richtige kleine Maus. Wir werden pünktlich sein. Versprochen!«
Während Fedor selbstsicher das Haus durchquerte und im Bad verschwand, telefonierte Sorokin erneut mit Hauptkommissar Hans Rattner.
»Es war definitiv kein Russe, der angerufen hat«, erklärte Sorokin. »Fedor würde das sofort hören.«
»Anatolij, hör zu, so weit sind unsere Techniker auch gekommen. Sie sagen, es wäre ein Sachse ...«
»Sie irren, er ist ein Schwabe!«, warf Sorokin ein.
»... zirka fünfzig Jahre ...«
»Nein. Um die vierzig!«
»Das hat dein Junge alles gehört? Unsere Spezialisten haben die ganze Nacht dazu gebraucht.«
»Habt ihr Smirnow ausfindig gemacht?«
»Ja, die russischen Behörden sprechen mit ihm. Wir wissen nur, dass er sich morgen mit dem Moskauer Bürgermeister trifft und dann zurückfliegt.«
»Er kommt nicht sofort?«
»Scheint so. Vielleicht hat er seine Gründe. Vielleicht will er Stärke beweisen?«
»›Vielleicht‹ ist weder ›Ja‹ noch ›Nein‹. – Gibt es neue Hinweise?«
»Nichts. Wir haben absolut nichts. Wir wissen ja nicht mal, ob der Anrufer überhaupt etwas mit der Tötung zu tun hatte. Die Schlösser im Haus waren ganz, keine Spur rings um das Haus. Selbst die Patronen, die bei beiden Opfern ausgetreten waren, sind verschwunden.«
»Er war es«, sagte Sorokin selbstsicher.
»Woher ...?«
»Der Anrufer war es. Ich fühle es. Und es war definitiv kein Russe, der angerufen hat. Das wissen wir jetzt.«
»Hat Smirnow Feinde? Hier?«
»Ich kenne Sergei, doch er ist keinesfalls mein Bruder. Das soll heißen, dass Sergei nicht all seine Geheimnisse mit mir teilen wird.« Zorn schwang in Sorokins Stimme mit. »Jedoch egal wer es war, der Junge und das Mädchen – sie haben nichts mit Sergeis beruflichen Aktivitäten zu tun. Wer immer das war, ich will ihn finden.« Eine kurze Pause entstand. »Warum nur gerade diese zwei jungen, wehrlosen und gutmütigen Menschen?«, brüllte er plötzlich.
Fedor stand in der Badtür. Er zitterte am ganzen Körper.
*
»Ich will allein hochgehen.« Fedor drückte fest die Hand des Vaters und schüttelte sie dann ab.
»Schick eine Nachricht, wann ich dich holen soll. Viel Spaß und bleib anständig.« Wie immer beim Abschied gab Sorokin seinem Sohn zwei Küsse auf die Wangen. Dann beobachtete er, dass der Junge den Blindenstock bis zur ersten Stufe einsetzte, das Geländer ergriff und von da an mit der Echoortung arbeitete. Auf dem ersten Treppenabsatz hielt Fedor inne und sagte: »Du kannst jetzt bitte gehen, Papa. Ich brauche keinen Babysitter.«
»Okay. Bin schon weg.« Sorokin machte kehrt. An der gläsernen Haustür standen die Namen der Bewohner. Es waren nur drei, wahrscheinlich sehr große Etagenwohnungen in diesem recht neu und kalt wirkenden Haus. In der dritten Etage wohnte Laura. Am oberen Namensschild stand der Name »Frank Sonberg«.
Auf dem Weg zum Wagen – Sorokin hatte sich gerade eine Zigarette angezündet – meldete sich sein Handy. Sergei!
*
Fedor stand unschlüssig vor der Wohnungstür. Er schnalzte so lange, bis er die Umrisse der Türzarge verinnerlicht hatte. Zeitig, in frühester Kindheit, hatte der Junge die aktive menschliche Echoortung, Klicksonar genannt, erlernt, wobei mit der Zunge ein dezenter Klicklaut einen Schall aussendete. Das von Gegenständen oder Hindernissen ausgehende Echo des Klicklautes wurde im visuellen Kortex seines Gehirns ausgewertet. Durch jahrelanges Training und aufgrund einer hohen Begabung war es Fedor gelungen, diese Echosignale von anderen akustischen Quellen zu unterscheiden. Sein Gehirn erzeugte durch die Echos einfache, jedoch brauchbare Bilder seiner Umgebung. Im Alter von neun Jahren hatte er dieses Verfahren bereits so verinnerlicht, dass er auch Echos fremder passiver Schallquellen intellektuell verarbeiten konnte. Diese vervollständigten das Gesamtbild seiner Umgebung. Mitunter sah der Junge eine ganze Straße bildlich vor sich, nur weil reichlich Lärm herrschte.
Nun tastete er die Tür ab. Sie war glatt und kühl, die Türklinke war aus Guss und verziert. Direkt darunter befanden sich gleich zwei Schlösser für schmale Schlüssel. An der rechten Türzarge fand er den Klingelknopf, rund, mit einem Druckknopf in der Mitte, alles verhältnismäßig hoch angebracht. Darüber ein flaches glattes Schild, in das ein Name eingraviert war. Mit den Fingern las Fedor die Gravur einer geschwungenen Schrift: »Frank Sonberg«.
Fedor zog die Hose zurecht und holte tief Luft, dann drückte er kurz auf den Klingelknopf. Ein sanftes Gong-Gong-Läuten erklang.
An den Schritten hinter der Tür erkannte der Junge, dass sich die Mutter von Laura näherte, die Tür von innen zweimal aufschloss und diese anschließend erst ein Stückchen und dann ganz öffnete.
»Ah, da ist ja unser kleiner Star!« Sie hielt Fedor die rechte Hand hin, der seine gleichsam anhob und nach der ersten Berührung zugriff.
»Guten Tag, Frau Sonberg«, sagte Fedor mit einer leichten Verbeugung. »Vielen Dank für die Einladung.«
»Komm doch rein. – Aber pass auf, da ist eine Stufe.«
Lächelnd betrat Fedor den Flur. »Ich weiß, dass da eine flache Stufe ist.« Es machte fast den Eindruck, als würde sich Fedor umsehen. »Sie haben eine sehr schöne, große Wohnung.«
Ein wenig staunte die Dame. »Woher weißt du das? Ich denke, du bist ...«
»... blind. Natürlich bin ich blind. Wissen Sie, Fledermäuse sind auch ziemlich blind. Und trotzdem fliegen sie nie gegen eine Wand. Ich sehe so, wie es die Fledermäuse tun. Oder die Delfine, die machen das auch so. Soll ich es beweisen?« Fedors Zunge klickte einige Male. »Dort steht ein großer Schrank.« Er zeigte auf einen Kleiderschrank. »Da ist ein Kleiderständer. – Dort eine Tür, dort eine schmalere Tür und ... Hallo Laura, da bist du ja.« Zielgerichtet ging Fedor auf die Stelle zu, von der er glaubte, dass Laura dort stehen würde. Er hörte ihren Atem, kannte ihren dezenten Parfümgeruch und wusste, wie groß sie war.
»He Fedor.« Laura warf der Mutter einen jener Teenie-Blicke zu, die Eltern verschwinden lassen konnten, ergriff Fedors Hand und zog ihn mit sich. »Soll ich dich in der Wohnung rumführen?« Bevor der Junge etwas sagen konnte, begann die Führung. »Also: Hier ist die erste Toilette mit dem einen Bad. Auf der anderen Seite die zweite. – Das ist unser Wohnzimmer. Wir haben einen riesigen Fernseher. Hier geht es zum Balkon, der um das ganze Haus führt. – Da ist mein Zimmer, da gehen wir gleich hin. Hier ist ein Gästezimmer für die bucklige Verwandtschaft. Und hier«, Laura öffnete eine Tür und schob Fedor in ein Zimmer, »ist das Arbeitszimmer meines Vaters. Eigentlich darf ich hier nicht rein. Er kommt gleich, hatte noch einen Termin.«
Fedor wollte das Zimmer bereits verlassen, als er plötzlich innehielt. Er sog die Luft in sich ein. »Was riecht hier so?«, flüsterte er.
»Riecht? Ich rieche nichts«, antwortete Laura. »Vielleicht meinst du seine Zigarren? Manchmal raucht er hier Zigarre.«
»Ich rieche das. Vanille. Also Tabak und Vanille«, flüsterte Fedor. Ein Schaudern ging durch seinen Körper. »Welche Sorte raucht er denn?«
»Es sind immer die gleichen Zigarren. Warte mal.« Laura ging zum Schreibtisch des Vaters. »Hier ist eine Schachtel. Die Dinger heißen ›Independence‹ und dann steht da noch ›Xtreme Vanilla‹.« Sie lief rasch zurück zur Tür und schnüffelte. »Stimmt. Vanille ist mit drin. Los, komm, wir gehen in mein Zimmer.«
Moskau 11. Juni
Artjom lauschte der Abhöranlage in Smirnows Zimmer. Doch die funktionierte nicht so recht. Lediglich ein Knirschen und Knattern aus dem prähistorischen Lautsprecher verriet ihm eine Unregelmäßigkeit. So gab er nur ein harmloses »Blin!« von sich, was so viel wie »Verflixt!« hieß, stand auf und verließ das eigene Hotelzimmer, nachdem er die Waffe entsichert und griffbereit in einer Beintasche platziert hatte. Acht Schritte musste er über den mit dunkelroten, samtig glänzenden Teppichen ausgelegten Flur laufen, um die Tür zu Smirnows Zimmer zu erreichen, vor der ein magerer Typ mit Schnauzbart und billigem Anzug stand, die Kopie eines russischen Gangsters der sechziger Jahre.
Der Hüne betrachtete diesen Mann aus einer Entfernung von fünfzig Zentimetern. »Ich will zu meinem Freund. Was machen Sie hier? Wer sind Sie?« Seine Stimme ließ keine ausweichenden Antworten zu.
»Sergei Michailowitsch Smirnow kann Sie jetzt nicht empfangen«, antwortete der dürre Typ trotzig und zuckte mit dem nikotingelb gefärbten Oberlippenbart. »Gehen Sie zurück in Ihr Zimmer.«
»Kennen wir uns nicht?«, fragte Artjom mit einem Hauch Ironie in der Stimme.
Argwöhnisch blickte der Mann hinauf zum Gesicht des Hünen. »Nicht, dass ich wüsste.«
Ein kurzer, harter, trockener Schlag folgte, der Schnauzbärtige klopfte mit dem Schädel dumpf gegen die Zimmertür und ging ansonsten lautlos zu Boden. »Jetzt kennst du mich bestimmt«, raunte Artjom, zog die Waffe aus der Beintasche und wartete.
Die Zimmertür öffnete sich nach dem Kopfklopfen einen Spalt, den Artjom rasch vergrößerte. Sogleich stand er mitten in Smirnows Zimmer, die Laufmündung am Kopf eines zweiten Mannes. Smirnow saß in seinem Sessel, eine Wodkaflasche in der Hand, und hob abwehrend den zweiten Arm. »Ganz ruhig, das sind ...«
»Komsomolzev?«, unterbrach Artjom, den zweiten Mann keine Sekunde aus den Augen lassend. »Was suchst du hier?« Er kannte diesen Mann mit der Pistolenlauföffnung an der Schläfe recht gut. Alexander Komsomolzev, Inlandsgeheimdienst, sie waren sich oft begegnet, denn Komsomolzev hatte Artjom beschatten müssen.
»Es geht nicht um dich, Artjom. Also nimm die Waffe gefälligst runter, du machst dich sonst unglücklich«, raunte Komsomolzev, ohne auch nur mit einer einzigen Wimper zu zucken. »Passt du etwa auf Smirnow auf? Dann solltest du dein Geschäft wegen fehlender Eignung überdenken!«
»Was soll das dämliche Gequatsche?« Artjom ließ die Waffe sinken, hielt sie jedoch schussbereit und entsichert in der rechten Hand.
»Jemand hat Smirnows Sohn und dessen Kindermädchen hingerichtet. In Deutschland. Und du, unfähiger, überdimensionierter Affe, hast du was davon gewusst? Immerhin: Du konntest nichts dagegen unternehmen.«
»Ihr Idioten wusstet doch auch nicht davon!« Zehn Sekunden lang schaute Artjom in Smirnows leichenblasses Gesicht. Dann schlug er mit der Pistole zu, wütend und hart.
Komsomolzev ging augenblicklich zu Boden, hielt sich die blutende Stirn und fluchte jaulend: »Das wirst du bitter bereuen!«