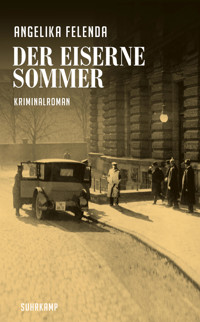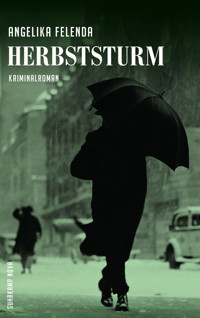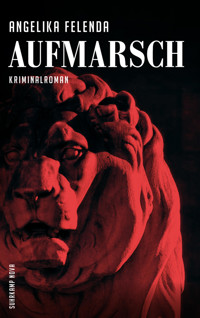
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissär-Reitmeyer-Serie
- Sprache: Deutsch
München im Sommer 1923. Die Stadt ächzt unter Inflation und Wohnungsnot. Rechte Verbände rufen auf zum Widerstand gegen die Besetzung des Rheinlands und zum »Marsch auf Berlin«. Und Kommissär Reitmeyer steht massiv unter Druck, der von der Presse so genannten »Spielseuche« Herr zu werden. Da nimmt ihn ein Frauenmord in Beschlag, der aussieht wie die Tat eines rasenden Liebhabers, hinter dem aber noch mehr zu stecken scheint.
Während Reitmeyer bei seinen Ermittlungen auf schmierige Immobilienspekulanten und dubiose Anwälte trifft, stößt sein unermüdlicher Assistent Rattler auf eine Gruppe von Jugendlichen, die sich auf die eine oder andere – nicht immer legale – Weise durchs Leben schlagen. Eine von ihnen, das Blumenmädchen Leni, könnte in der Mordnacht etwas beobachtet haben, doch sie hat offensichtlich Angst auszusagen. Auch ihre Freunde hüllen sich in Schweigen. Dann verschwindet Leni plötzlich …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Angelika Felenda
Aufmarsch
Kriminalroman
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Aufmarsch
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
26
27
Epilog
8. November 1923
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Aufmarsch
Die Kolossalorgie des Hasses und der Zerstörung ist vorbei. Genießen wir die zweifelhaften Amüsements des sogenannten Friedens! Nach den blutigen Ausschweifungen des Krieges kam der makabre Jux der Inflation! Welch atemberaubende Lustbarkeit, die Welt aus den Fugen gehen zu sehen! Haben einsame Denker einst von der »Umwertung aller Werte« geträumt? Statt dessen erleben wir nun die totale Entwertung des einziges Wertes, an den eine entgötterte Epoche wahrhaft geglaubt hatte, des Geldes.
Klaus Mann, Der Wendepunkt
Prolog
Er hatte die beiden letzte Woche schon gesehen, als er auf dem Weg zu seinem Sportverein das Fahrrad über den Viktualienmarkt schob. Zwei kleine Mädchen, nicht älter als fünf und neun, die scheinbar unbeteiligt zwischen den Ständen herumwanderten und plötzlich losflitzten, um sich einen Apfel oder eine Kartoffel zu sichern, die irgendwo heruntergefallen waren. Manchmal stolperten sie auch und stießen wie zufällig an eine der Auslagen mit den aufgehäuften Waren, um der Schwerkraft ein bisschen nachzuhelfen. Im Moment sah er die beiden im Augenwinkel links neben sich. Während er die Preise vor dem Milchkiosk studierte – ein Pfund Butter 30000 Mark, zehn Eier 26000 –, machten sich die Mädchen offenbar zu einer Attacke auf den Obststand bereit.
Doch sie hatten die Rechnung ohne die Inhaberin des Standes gemacht. Die Händlerin hatte das kleinere Mädchen am Schopf erwischt und zerrte das Kind so brutal an den Haaren, als wollte sie ihm den Skalp abreißen. »Ihr Hundskrippel, ihr elenden!«, brüllte sie. »Euch werd ich’s zeigen!« Die Kleine zappelte und schlug keuchend um sich. Das ältere Mädchen schoss wie ein Derwisch hin und her, um die Furie abzulenken. Aber die ließ nicht ab von dem spindeldürren Geschöpf und schwenkte es herum wie eine Stoffpuppe.
Rattler warf sich in Positur. »Loslassen! Sofort!«, rief er und zückte seine Marke.
»Die Polizei?«, kreischte die Händlerin. »Da kommt einer von der Polizei und will das Diebsgesindel schützen!«
»Das sind doch Kinder!«, rief er. »Die allenfalls Mundraub begangen haben!«
Das hätte er wahrscheinlich nicht sagen sollen. Weil damit alles nur noch schlimmer und eine Schar weiterer Händlerinnen auf den Plan gerufen wurde. Sie seien doch nicht da, um die Mäuler von irgendwelchen »Schraatzen« zu füttern, schrien sie durcheinander. Und von der Polizei würden sie was anderes erwarten, als sich um Lumpenpack zu kümmern, das wie Heuschrecken auf den Markt einfalle. Er hatte Mühe, die zornigen Frauen abzuwehren, die ihm bedrohlich auf den Leib rückten. Aber immerhin gelang es den Mädchen, sich in dem Aufruhr aus dem Staub zu machen.
Nachdem er dem zeternden Haufen entkommen war, sah er die beiden an der Ecke Klenzestraße wieder. Die Größere winkte ihm zu. Er reagierte nicht. Er hatte ihnen einmal geholfen, aber das wollte er nicht zur Gewohnheit werden lassen. Dass sie meinten, er würde sie immer raushauen, wenn sie beim Klauen erwischt worden waren. Doch als er aufs Rad stieg, versperrten ihm zwei Lieferwagen den Weg. Die Gelegenheit nutzte das ältere Mädchen und kam mit ein paar Sätzen auf ihn zu gerannt. »Herr Polizist«, rief sie. »Können Sie uns helfen?«
»Habt ihr schon wieder was mitgehen lassen?«
Sie warf die Zöpfe zurück und sah ihn entrüstet an, als wäre es unter ihrer Würde, darauf zu antworten. »Meine Schwester hat bloß was anschauen wollen, aber die narrische Standlfrau is gleich wie eine Wilde auf sie los.«
Seit wann man zum »Anschauen« die Hände brauche, wollte er sagen, schüttelte aber bloß den Kopf und stieg aufs Rad.
Das Mädchen hielt ihn am Arm fest. »Die Rosmirl hat was im Fuß und kann nimmer laufen.« Sie deutete auf das schmächtige Kind, das am Boden kauerte und nur aus Ellbogen, Knien und hervorstehenden Knochen zu bestehen schien. Ohne den Mopp aus braunen Locken hätte es tatsächlich wie eine Heuschrecke ausgesehen.
»Ich hab nicht viel Zeit«, sagte er abweisend, lehnte dann aber doch sein Fahrrad an eine Hauswand und folgte dem Mädchen über die Straße. »Also, wo tut’s weh?«, fragte er und beugte sich hinunter. Rosmirl streckte ihm einen nackten Fuß entgegen und deutete auf den großen Zeh. Rattler nahm seine Lupe aus der Tasche. »Ich seh’s. Da steckt was drin.« Er holte sein Schweizer Messer heraus und klappte die Pinzette aus. Es dauerte eine Weile, bis er das Ding zu fassen kriegte, und als er es herausgezogen hatte, entpuppte es sich als ziemlich großer Dorn, der so tief ins Fleisch gedrungen war, dass nun Blut aus der Wunde tropfte. »Da müsst man ein Pflaster drüberkleben«, sagte er. »Damit kein Dreck reinkommt. Aber wir haben keins.« Er nahm sein Taschentuch. »Dann bind ich dir das halt rum. Also, Operation beendet. Patient wohlauf?«
Rosmirl sah ihn mit großen Augen an.
»Kann die nicht reden?«
»Können schon. Sie tut’s aber nicht.«
»Warum?«
»Seit unser Vater fort is, redet’s nimmer.«
»Wo ist der hin?«
Das Mädchen zuckte die Achseln.
»Und was machen wir jetzt? Mit dem Verband kann sie schlecht laufen. Wohnt ihr hier in der Nähe?«
»Wir müssten bloß bis zum Gärtnerplatz zu dem Blumenladen. Da helf ich abends beim Aufräumen.«
»In die Richtung muss ich auch. Dann setz ich sie auf mein Rad.« Er hob das Kind hoch, trug es über die Straße und setzte es auf den Gepäckträger. »Wie alt ist die Rosmirl denn?«, fragte er, während sie Straße entlanggingen.
»Sieben. Eigentlich müsst sie in die Schul gehen, aber da hat man sie nicht g’nommen, weil’s nicht redet. Die Rosmirl ist aber nicht blöd, die versteht alles. Sie sagt halt bloß nix.«
»Und wie heißt du?«
»Leni.«
»Und wie alt bist du?«
»Zwölf. Bald dreizehn.«
Er hatte die beiden für deutlich jünger gehalten. Wahrscheinlich lag es an den Hungerzeiten im Krieg, dass sie nicht richtig gewachsen waren, und jetzt bekamen sie auch nicht genug zu essen. Aber da waren sie nicht die Einzigen.
Als sie auf den Gärtnerplatz einbogen, deutete Leni auf den Laden mit den Blumenkübeln auf dem Gehsteig. »Da is es. Da helf ich am Abend. Aber nicht bloß beim Aufräumen. Ich lern auch, wie man Sträuße bindet. Und aus den Blumen, wo die Stiele abgebrochen sind, mach ich kleine Bouquets, und die verkauf ich später vorm Theater drüben. Wenn ich groß bin, werd ich Floristin und hab meinen eigenen Laden.«
»Das ist gut, wenn man Ziele hat im Leben.«
Leni nickte. »Das Taschentuch wasch ich aus und kann’s Ihnen geben, wenn Sie später nochmal hier vorbeikommen? Sie müssten bloß an der Ladentür klopfen.«
»Mal sehen«, sagte er und hob Rosmirl vom Rad. »Und bei dir alles in Ordnung?«
Sie schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, das ihre Zahnlücken entblößte. Dann hob sie grüßend die Hand, humpelte über den Gehsteig und verschwand in den Laden.
Leni sah ihrer Schwester kopfschüttelnd nach. »Die Rosmirl mag Sie«, sagte sie.
Seine Rührung hielt sich in Grenzen. Sie wollte sich einschleimen, ihn einwickeln, auf ihre Seite ziehen. Dass es von Vorteil war, einen Polizisten auf ihrer Seite zu haben, hatte er ihnen gerade vorgeführt. Er musterte sie noch einmal kurz. Sie wirkte nicht ganz so spindlig wie ihre Schwester, sondern war eigentlich ganz hübsch mit den langen Zöpfen und dem rundlichen Gesicht. »Ich muss jetzt los«, sagte er und schob sein Fahrrad zum Rand des Gehsteigs.
Leni folgte ihm. »Also dann bis später«, sagte sie und blieb plötzlich stehen, als ihr Blick auf den Platz fiel. Ein jüngerer Mann, der aus der Cornelius eingebogen war, kam mit lässigem Schritt auf sie zu. Er war nach neuester Mode gekleidet und sah in den Knickerbockern und der Clubjacke aus, als käme er gerade aus dem Tennisverein. »Ah, Leni«, sagte er mit einem vagen Lächeln. »Wo warst’n gestern?«
Sie wirkte irritiert. »Am Theater drüben«, stieß sie hervor. »Also dann, Herr Polizist«, fügte sie hin. »Ich muss jetzt auch rein.«
Der Mann musterte ihn kurz und setzte seinen Weg Richtung Klenzestraße fort. Rattler stieg aufs Rad. Was hatte das kleine Mädchen mit diesem Schnösel zu tun? Warum wollte sie ihm unbedingt mitteilen, dass er Polizist war? Ein unbehagliches Gefühl stieg in ihm auf. Genau das hatte er eigentlich vermeiden wollen. Dass sie ihn reinzogen in ihre Schwierigkeiten. Dass er es ausbügeln durfte, wenn sie was ausgefressen hatten. Es war besser, wenn er auf Abstand blieb. Das Taschentuch konnten sie behalten.
1
Reitmeyer lehnte sich zurück und sah die Frau an. Den Typus kannte er. Leute, die unerschütterlich glaubten, im Recht zu sein. Nichts ließ sie zweifeln oder zaudern. Nachdenken war bloß hinderlich. Manieren ebenso. Und keinerlei Bereitschaft zur Verständigung. Das hatte sie gleich zu Anfang klargemacht, als sie wie eine Gewitterwolke in sein Büro gefegt war, die Handschuhe auf seinen Schreibtisch gepfeffert hatte und ihre Tasche wie einen Kriegsschild auf den Knien aufpflanzte, nachdem ihr massiger Leib auf einen Stuhl gesunken war. Wieso man sie ins Kommissariat zitiert habe, wollte sie wissen. Wieso die Schikane? Sie habe den Polizisten bereits alles gesagt. Das Gesindel, das sie in ihrem eigenen Heim angegriffen habe, wolle die Wohnung nicht verlassen und mache sich weiterhin in ihren Räumen breit. Obwohl sie die Beamten unmissverständlich aufgefordert habe, das Pack mitzunehmen und einzusperren. Während sie kurz Luft holte und ein paar graue Haarsträhnen hinterm Ohr befestigte, unterbrach Reitmeyer die Kanonade.
»Erst mal guten Tag, Frau Waldmüller. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich beruhigen. Dann erklär ich Ihnen den Sachverhalt.«
»Sachverhalt?«, rief sie und deutete auf die Schramme an ihrer Stirn. »Das ist mir Sachverhalt genug! Ich will mein Recht!«
»Tja, ganz so einfach ist das nicht. Die beiden Leute, die Sie als Gesindel und Pack bezeichnen, das Ehepaar Bittner, hat Anzeige erstattet. Gegen Sie.« Er schlug die Akte vor sich auf.
Frau Waldmüller schnaubte und wollte zu einer neuen Tirade ansetzen. Reitmeyer schlug kurz mit der flachen Hand auf die Tischplatte, worauf sie zurückwich, das Kinn aber gleich wieder reckte und seinen scharfen Blick ungerührt erwiderte. Doch zumindest klappte ihr Mund zu.
»Die Eheleute Bittner befinden sich keineswegs unberechtigt in Ihrer Wohnung. Sie wurden vom Wohnungsamt bei Ihnen einquartiert, da Herr Bittner, der als Eisenbahner im Ruhrgebiet beschäftigt war, von den französischen Behörden ausgewiesen wurde.« Reitmeyer blickte über den Rand der Akte auf die vor ihm sitzende Frau, die ungeduldig ihre Tasche auf den Knien wippte. »Weil er passiven Widerstand geleistet hat. Und zwar auf Anordnung der Reichsregierung, die damit gegen die unrechtmäßige Besatzung protestieren will.«
»Das Wohnungsamt!«, fauchte Frau Waldmüller. »Unser Mieterverein sagt, dass die Franzosen im besetzten Gebiet nicht so gemein mit der Bevölkerung umgehen wie das Wohnungsamt bei uns hier.«
»Hat das Wohnungsamt schon Bürger erschossen?«, rief Reitmeyers Kollege Steiger von seinem Schreibtisch herüber. »Wie’s die Franzosen im Rheinland tun? Das ist ja wohl ein starkes Stück von diesem Mieterverein.«
»Dann nehmen Sie doch wildfremde Leut’ bei sich auf«, rief Frau Waldmüller zurück.
»Wir sind schon zu fünft in drei Zimmern.«
»Sie verfügen über eine Vierzimmerwohnung, entnehme ich der Akte«, sagte Reitmeyer. »Allein.«
»Ja, meinen Sie, das bin ich gern? Letztes Jahr hab ich meinen Mann beerdigt. Und mein Sohn hat im Krieg sein Augenlicht verloren. Jetzt sitzt er im Blindenheim und lernt Bürsten binden. Obwohl er studiert hat.« Sie griff in ihre Tasche und warf ein Bündel Orden auf den Tisch. »Die hat man ihm verliehen wegen Tapferkeit. Der hat auch Widerstand geleistet! Und was kann er sich jetzt dafür kaufen?«
»Ich kann mir auch nix kaufen für meine Prothese«, rief Steiger und hob seine Lederhand.
»Schluss jetzt!«, rief Reitmeyer. »Wir verhandeln hier weder die Kriegsfolgen noch das Vorgehen des Wohnungsamts. Für die Polizei geht es ausschließlich um die Vorkommnisse in Ihrer Wohnung, Frau Waldmüller. Herr Bittner hat ausgesagt, dass es nach einem Essen, zu dem er ein paar Freunde eingeladen hatte, zu Angriffen auf ihn, seine Frau und seine Gäste gekommen sei. Diese Angriffe, bei denen seine Frau eine Platzwunde am Kopf erlitten hat, seien von Ihnen und zwei Leuten ausgegangen, die Sie als Verstärkung aus dem Haus geholt hätten. Erklären Sie mir doch einmal, um wen es sich bei dieser ›Verstärkung‹ gehandelt hat.«
»Diese Bittners ham einen furchtbaren Saustall veranstaltet in meiner Küche. Und wie ich g’sagt hab, sie sollen aufräumen und verschwinden, da sind sie frech g’worden. Da hab ich den Hausmeister und seinen Sohn g’holt.«
»Und was haben die gemacht?«
Sie zuckte die Achseln. »Ja, nix.«
»Meines Wissens ist bei einer Einquartierung die Küchenbenutzung erlaubt.«
»Trotzdem fragt man vorher. Aber die sind gleich pampig und unverschämt g’worden.«
»Worauf der Hausmeister Frau Bittner so angerempelt hat, dass sie gestolpert und gegen das Büffet gestürzt ist.«
»Das hab ich nicht sehen können. Weil sich sofort die Gäste von den Bittners eing’mischt haben.«
»Und dann kam es zu einem Handgemenge, oder besser gesagt, zu einer wüsten Rauferei …«
»Ja, die ham wir nicht ang’fangen!«, schrie Frau Waldmüller. »Ich lass mir doch in meiner eigenen Wohnung von so einem herg’laufenen G’sindel nicht vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen hab! Wenn ihnen das nicht passt, dann sollen’s doch abhauen! Ich brauch die nicht!«
Reitmeyer legte die Akte auf den Tisch. »Frau Waldmüller, so kommen wir nicht weiter.« Er trank einen Schluck Wasser und sah zu Steiger hinüber, der ihm mit einer Handbewegung bedeutete, die Frau rauszuschmeißen. Trotzdem machte er noch einen Versuch und schlug einen versöhnlichen Tonfall an. »Es mag ja sein, dass sich Vorkommnisse, die in sehr aufgebrachter Stimmung stattgefunden haben, schwer rekonstruieren lassen. Und wahrscheinlich ist es auch nicht einfach, wenn sich zwei Parteien plötzlich zwangsweise einen Haushalt teilen müssen …«
»Sehr richtig«, fiel ihm die Frau ins Wort. »Zwangsweise. Ich hab mir mein Leben lang nix zuschulden kommen lassen. Und jetzt soll ich plötzlich …«
»Frau Waldmüller, das hatten wir schon! Wenn Sie sich gegen die Einquartierung wehren wollen, sind Sie bei mir an der falschen Stelle. Ich bearbeite nur die Anzeige, die gegen Sie erstattet wurde.«
»Dann zeig ich die Bittners eben auch an.«
»Und warum? Weil Ihre Küche eingesaut war?« Reitmeyer warf die Akte auf den Tisch. »Da hätten Sie wahrscheinlich schlechte Karten, wenn der Fall vor einem Richter landet.«
»Wieso?«
»Weil diesen Leuten, die von den Besatzern ausgewiesen wurden und ihre Heimat binnen vierundzwanzig Stunden verlassen mussten, viel Mitgefühl und Hochachtung entgegengebracht wird. Während die Art und Weise, wie Sie über das Ehepaar reden, zu Ihren Ungunsten ausschlagen könnte.«
Frau Waldmüller sah ihn mit aufgerissenen Augen an.
Reitmeyer schwieg einen Moment. Hatte er ihr wirklich den Wind aus den Segeln genommen? Jedenfalls keifte sie nicht wieder los. »Aber ich hätte einen Vorschlag«, begann er wieder. »Ich meine, bevor ich jetzt den Hausmeister und seinen Sohn und alle Gäste der Bittners vorlade, was die Sache nur unnötig in die Länge ziehen und vielleicht noch weiter eskalieren lassen würde, gäb’s eine andere Möglichkeit.«
»Die wäre?«
»Es gäbe doch die Möglichkeit, die ganze Angelegenheit vernünftig zu bereinigen. Ich meine, alle Beteiligten könnten sich bei der jeweils anderen Partei entschuldigen und vielleicht ein Prozedere aushandeln, wie man in Zukunft miteinander umgehen will. Auf halbwegs zivilisierte Art, wenn Sie so wollen. Herr Bittner jedenfalls hat seine Bereitschaft dafür signalisiert und würde seine Anzeige zurückziehen. Und wenn Sie sich dazu durchringen könnten …«
»Ich soll mich bei dem Kerl entschuldigen?«, fragte Frau Waldmüller ungläubig.
»Das würde ich Ihnen sehr anraten. Wie gesagt, ich möchte dem Urteil eines Richters nicht vorgreifen, aber ich glaube, es wäre tatsächlich besser für Sie.«
»So, so, das ham Sie sich gedacht?«, sagte sie gefährlich ruhig. Sie raffte die Orden auf dem Tisch zusammen und ließ sie klappernd in ihre Tasche gleiten. Ein überlegenes Grinsen huschte über ihr Gesicht. »Dass ich so blöd bin und klein beigeb, bloß weil Sie sich die Arbeit sparen wollen.« Ihr Stuhl fuhr scharrend über den Boden, als sie abrupt aufstand. »Aber mich seifen Sie nicht ein. Mich nicht!« Sie warf Reitmeyer einen vernichtenden Blick zu, bevor sie durchs Büro marschierte, die Tür aufriss und sperrangelweit offenstehen ließ, nachdem sie hinausgestürmt war.
Steiger stand auf und machte die Tür zu. »Wieso setzt man den Drachen nicht im Ruhrkampf ein?«, sagte er. »Die könnt’ die Besatzer noch das Fürchten lehren.«
»Ach«, sagte Reitmeyer ärgerlich und winkte ab. Seit Monaten ging das nun schon so. Ständig fühlte sich jemand ungerecht behandelt, und die Polizei sollte richten, was die Politik nicht mehr zustande brachte. Jeden Tag schwappte mehr von dem Chaos in die Amtsstuben, und sie sollten Ordnung schaffen, obwohl längst alles aus den Fugen geraten war. Sie sollten Geschäftsleute schützen, denen die Scheiben eingeschmissen wurden, weil die Kunden glaubten, die irrwitzigen Preise verdankten sich der Gier der Händler. Gleichzeitig verlangten Kontrolleure von der Wucherabwehrstelle Schutz vor Geschäftsleuten, die rabiat reagierten, weil man ihnen Preise vorschreiben wollte, die sich irgendjemand am Schreibtisch ausgedacht hatte. Die Politiker redeten gerne von »Wucher« und erließen Verordnungen gegen »Preistreiberei«, um den Anschein zu erwecken, sie seien handlungsfähig und könnten die Misere aufhalten. Aber solange die Regierung den passiven Widerstand im Ruhrgebiet nicht aufgab und zwei Millionen Arbeiter finanzierte, die nicht für die Besatzer arbeiten sollten, mussten die Drucker in den Notenpressen Überstunden machen. Mit dem Ergebnis, dass nun alle gegen alle kämpften. Und jeder meinte, er habe inzwischen genug bezahlt. Wie diese Waldmüller, die glaubte, mit einem kriegsblinden Sohn habe sie ihr Soll entrichtet und müsste nicht auch noch eine Einquartierung ertragen.
»Tja«, sagte Steiger. »Dein Versuch, dem Gericht Arbeit zu sparen, war wohl ein Schuss in den Ofen.« Er setzte sich wieder an seinen Schreibtisch. »Und übrigens, der Oberinspektor will wissen, wie die Ermittlungen in der Spielclubsache laufen. Der Fall hat absolute Priorität, soll ich dir sagen. Es sei schon wieder ein Artikel in der Presse …«
»Der soll mich bloß in Ruh lassen mit seiner Presse«, fuhr Reitmeyer auf und warf seinen Bleistift auf den Tisch. »Dass er jeden Tag die Blätter durchfilzt und Artikel anstreicht, hilft uns auch nicht weiter!«
»Da brauchst du mich doch nicht so anfahren!«, erwiderte Steiger. »Ich kann doch da nix dafür!«
»Ja, ja, entschuldige«, murmelte Reitmeyer. Er stand auf, ging zum Fenster und sah in den Hof hinab. »Tut mir leid … aber du weißt ja selber …« Der Fall zehrte inzwischen an den Nerven. Die Polizei sollte endlich gegen die überhandnehmende Spiel- und Wettsucht vorgehen, plärrten die Zeitungen, und der »Verwilderung der Sitten« Einhalt gebieten. Das war natürlich leichter gefordert als getan. Seit Wochen nun versuchten sie, an handfeste Informationen über diese Bar zu kommen, doch zu den Spielerrunden wurden offenbar nur handverlesene Leute zugelassen. Jemanden aus ihren Reihen dort einzuschleusen war nicht möglich, weil die Vertreter der höheren Dienstgrade zu bekannt waren und jemand aus den unteren Chargen weder über das Auftreten noch über die Kleidung verfügte, um nicht sofort aufzufallen. Dass gleichzeitig der Druck von »oben« ständig zunahm, das Nest des illegalen Glücksspiels endlich auszuheben, machte die Arbeit auch nicht leichter. Vor allem wenn man in erster Linie gegenüber der Presse mit Erfolgen punkten wollte. Er zuckte zusammen, als die Tür aufflog.
»Herr Kommissär«, rief Rattler. »Ich hab gerad den Anruf von einer Frau entgegengenommen. Sie befürchtet, dass in ihrem Haus in der Pflugstraße eingebrochen worden ist. Das Fenster der Wohnung im Erdgeschoss steht offen, aber niemand meldet sich, wenn sie klingelt oder ruft.«
»Ja, dann schick halt einen Streifenbeamten vorbei«, sagte Steiger.
»Ja, verstehen S’ …«, sagte Rattler und machte eine kreiselnde Geste, als wollte er seinen Kollegen auf die Sprünge helfen. »Die Frau hat sich beklagt, dass sie sich alle so unsicher fühlen … wegen der Favorit-Bar am Eck und weil da immer so undurchsichtige Gestalten rumschleichen … Und da hat der Herr Oberinspektor gemeint, dass wir Präsenz zeigen sollen … weil uns die Presse immer angreift, dass wir nix tun …«
»Soll das heißen, dass in Zukunft die Kriminalpolizei ausrückt, wenn irgendwo ein Fensterladen offensteht?«, fragte Steiger.
Reitmeyer ging mit schnellem Schritt zur Tür. »Ist der Oberinspektor an seinem Platz?«
»Nein, der ist zu einer Besprechung …«
»Also so geht das nicht weiter.« Reitmeyer ging zu seinem Schreibtisch zurück und riss seine Jacke vom Stuhl. »Aber heut Nachmittag werd ich das klären. Was die Aufgaben der Kriminalpolizei sind. Oder ob wir jetzt unsere Befehle von den rechten Schmierblättern kriegen.«
Während Rattler sein Rad holte, blieb er einen Moment vor dem Haupteingang stehen und sah in den grauen Himmel hinauf, der kurz aufriss und ein paar fahle Sonnenstrahlen durchließ. Aber wenigstens hatte das ewige Nieseln aufgehört. Reitmeyer knöpfte seine Jacke zu. Wegen des vielen Regens war es ziemlich frisch für Anfang Juli. Das hatte heute Morgen schon der Oberinspektor beklagt. Er friere wie ein Schneider an seinem Schreibtisch und wolle sich gar nicht vorstellen, wie das im Winter werden würde ohne Kohlen. Wenn die Besatzer bis dahin nicht abzögen, würde man wahrscheinlich erfrieren, wenn man nicht vorher schon verhungert wäre. Reitmeyer schob sein Rad bis zur Löwengrube und folgte dann Rattler, der ein rasantes Tempo vorlegte. Die schnelle Fahrt dämpfte seinen Ärger nicht. Die ewigen Schwarzmalereien und Untergangsfantasien seines Vorgesetzten gingen ihm inzwischen derart auf die Nerven, dass er manchmal an sich halten musste, um nicht loszubrüllen oder mit Akten zu schmeißen. Aber das war nicht das einzige Problem, das er mit ihm hatte.
In der Westenriederstraße trat Rattler scharf auf die Bremse und stieg keuchend ab. »Da is es«, presste er heraus und deutete auf die schmale Gasse. »Das is die Pflug…«
»Herrschaftszeiten!«, sagte Reitmeyer ärgerlich. »Wieso musst’n du durch die Stadt brettern wie ein Irrer? Hast du vergessen, was mit deiner Lunge ist?«
Rattler stützte die Arme auf die Knie und japste nach Luft. »Nein«, stieß er hevor. »Das vergess ich nie.«
Reitmeyer schüttelte nur den Kopf und marschierte zu der Gasse. Seit Jahren nun ermahnte man den Jungen, auf seine Lunge zu achten, nachdem er im Krieg eine schwere Gasvergiftung erlitten hatte, aber er hörte einfach nicht. Die Standardeinleitung zu jedem Gespräch mit dem Sturkopf hieß inzwischen: »Verschnauf dich erst mal.«
»Es ist gleich das zweite Haus rechts«, rief Rattler von hinten, bevor er schweratmend angelaufen kam. Reitmeyer blickte auf die Hausfront, wo der Putz abblätterte, und auf den morschen Rahmen des offenen Fensters. Dann ging er nach drinnen. An der Wohnungstür im Erdgeschoss stand M. Löffler. Er klingelte. Als sich nichts rührte, ging er wieder hinaus und rief durchs Fenster. »Hallo? Ist jemand da?« Keine Antwort.
»Ich steig jetzt hier rein«, sagte Rattler, »und mach Ihnen von drinnen auf.«
Reitmeyer ging wieder zur Wohnungstür. Da Rattler nicht gleich öffnete, klingelte er noch einmal. »Was brauchst denn so lang?«, fragte er ungeduldig, als die Tür aufging.
Rattler sah ihn mit aufgerissenen Augen an. »Das … das müssen Sie sich anschauen«, sagte er und lief durch den Gang voraus. »Im Schlafzimmer.«
Reitmeyer folgte ihm und blieb stehen, als Rattler die angelehnte Tür aufstieß. Ihm stockte der Atem. Quer über dem Bett lag eine Frau auf dem Rücken. Ihr Kopf hing über die Kante des Rahmens, an ihrem Hals klaffte eine breite Wunde. Reitmeyer starrte auf das Blut, das sich über die Vorderseite ihres Kleids ergossen hatte. Ein paar schwarze Fliegen krochen darauf herum. Die Bettdecke lag auf dem Boden, aber sonst schien alles an seinem Platz zu sein. Ein Kampf hatte offenbar nicht stattgefunden.
»Die liegt schon eine Weile so da«, sagte Rattler. »Das seh ich an den Schmeißfliegen. Frisches Blut übt einen starken Reiz auf die aus, das riechen die schon auf hunderte Meter, weil sie ihre Eier ablegen wollen. Und wenn dann ein Fenster offensteht …«
»Wir müssen die Spurensicherung verständigen«, unterbrach ihn Reitmeyer.
»Ich lauf schnell vor zum Tal, zu dem Gasthaus am Eck, und ruf den Kofler an.«
Als Rattler fort war, eilte Reitmeyer in das Zimmer nebenan und sog an dem offenen Fenster die Luft von draußen ein. Mit dem Geruch von Blut hatte er schon immer Schwierigkeiten gehabt. Und wenn sich Rattler dann noch über sein Lieblingsthema verbreitete, hatte er Mühe, dass sich sein Magen nicht umdrehte. Er blieb eine Weile stehen, bevor er sich abwandte und den Blick durch den Raum schweifen ließ. Es war ein Wohnzimmer. Die Möbel waren alt und abgeschabt, die Polsterbezüge fadenscheinig, was mit Überwürfen und Kissen kaschiert werden sollte. Aber alles wirkte sehr ordentlich und sauber. In der Ecke gab es sogar eine Palme. Auf der Kommode stand eine Flasche Wein. Liebfrauenmilch. Daneben Gläser, die unbenutzt aussahen. Hatte sie einen Gast erwartet? Er ging in den Flur hinaus und öffnete die Tür neben dem Eingang. Es war die Küche. Auch hier herrschte peinliche Ordnung. Nirgendwo schmutziges Geschirr. An einem Brett neben dem Ausguss aus weißer Emaille hing ein Tuch mit einem gestickten Spruch. Schönheit vergeht, Tugend besteht. Dahinter standen auf einer Ablage eine Seifenschale und ein Becher mit einer Zahnbürste. Also wohnte sie allein hier. An der Wand neben dem Büffet hing ein weiterer gestickter Spruch. Diesmal gerahmt und hinter Glas. Arbeit hat bittere Wurzel aber süße Frucht. Offenbar hatte sie einen Hang zu abgedroschen Weisheiten.
Er ging wieder in den Flur hinaus und lauschte auf die Geräusche im Haus. Polterndes Getrampel, schimpfende Frauen- und quengelnde Kinderstimmen. Alles hörte sich nach den qualvoll überbelegten Unterkünften an, in denen man verarmte Familien zusammengepfercht hatte. Aber sie hatte die Wohnung für sich allein gehabt. Und offenbar war ihr daran gelegen gewesen, sich von ihrer Umgebung abzuheben und eine gewisse Bürgerlichkeit zu wahren. Was hatte diese brave Stickerin getan, dass sie so bestialisch ermordet wurde? Für einen Raubmord gab es keine Anzeichen. Kannte sie ihren Mörder? Vorsichtig ging er zum Schlafzimmer zurück, drückte sein Taschentuch auf die Nase und warf noch einmal einen Blick auf die Frau. Es war schwer, ihr Alter zu schätzen in dem Zustand, aber er hielt sie für mindestens Ende dreißig oder Anfang vierzig. Eine Handtasche, die vielleicht einen Ausweis enthalten hätte, hatte er nicht gesehen, und die Schränke wollte er nicht öffnen, bevor die Spurensicherung Fingerabdrücke abgenommen hatte.
Es klingelte. Rattler war wieder zurück. »Der Herr Kofler macht sich sofort auf den Weg mit seinen Leuten.«
»Sag mal, wie heißt die Frau, die bei uns angerufen hat?«
»Zausinger. Die Hausmeisterin. Die wohnt im ersten Stock.«
»Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Hausbewohner was mitkriegen, bevor wir hier fertig sind. Sonst versammelt sich gleich ein Haufen zeternder Weiber, und als Nächstes steht das ganze Viertel vor der Tür. Ich geh jetzt raus auf die Westenrieder und seh zu, dass der Kofler und seine Leute möglichst unauffällig reinkommen, und du bleibst hier und machst ihnen auf.«
Es dauerte nur kurze Zeit, bis der Wagen der Spurensicherung auf ihn zu kam. Kofler, der Leiter der Spurensicherung, war sofort einverstanden, dass man nicht vor dem Haus parkte, und der Fotograf verzichtete darauf, seine Leiter mitzunehmen, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. »Aber irgendwann wird die Leiche abtransportiert«, meinte Kofler. »Und Sie wissen ja, die Lage ist ziemlich aufgeheizt im Moment.«
Reitmeyer nickte. »Das ist mir klar.«
Nachdem die Männer der Spurensicherung in die Wohnung gegangen waren, folgte Reitmeyer der Truppe und atmete auf, als er die Tür hinter sich geschlossen hatte. Während Kofler, der Fotograf und Rattler sich das Schlafzimmer vornahmen, ging Reitmeyer ins Wohnzimmer und wartete, bis einer von Koflers Männern die Fingerabdrücke von den Möbeln genommen hatte, dann ließ er sich Handschuhe geben und untersuchte das Büffet und die Kommode. In den Schubladen war nichts Besonderes außer Besteck und Servietten. Doch als er die Türen des Büffets öffnete, fiel ihm ein Schwall Papiere entgegen. Hier hatte also doch jemand etwas gesucht und anschließend alles hastig zurückgestopft. Soweit er sehen konnte, handelte es sich hauptsächlich um alte Filmprogramme. Etwa heftgroße, in der Mitte gefaltete Seiten mit Fotos und Inhaltsangaben von Filmen, wie sie an den Kassen der Lichtspieltheater verkauft wurden. Es gab auch ein paar Illustrierte darunter, ebenfalls mit Schauspielern auf dem Titelblatt. Die Frau war offenbar eine Filmnärrin gewesen. Als er die Kommode öffnete, ergab sich ein ähnliches Bild. Tischdecken und Zierdeckchen waren nachlässig zusammengeknüllt in die Schubladen geworfen worden.
»An dem Fenster kann ich keine Fingerabdrücke nehmen«, sagte der Mann von der Spurensicherung. »Dafür ist der Lack zu zersplittert.«
»Ja, schade«, erwiderte Reitmeyer. »Weil der Einbrecher vermutlich dort reingekommen ist.«
Der Mann zuckte die Achseln. »Der Rahmen ist ziemlich morsch, das Fenster hat sich leicht aufdrücken lassen. Und überhaupt. Heutzutag tragen die Einbrecher Handschuhe. Zumindest die erfahrenen.«
»Herr Kommissär!«, rief Rattler durch die Tür. »Ich hab eine Handtasche gefunden.« Er schwenkte eine braune Ledertasche. »Die war unter einem Mantel an der Garderobe. Da ist auch ein Ausweis drin. Maria Löffler, geboren am 17.5.1880 in München. Aber kein Geldbeutel.«
»Ja, gut. Den Ausweis nehmen wir mit.«
»Ah, die hat Filmprogramme gesammelt. Wie meine Kusine.« Rattler ging in die Hocke und griff nach einem der Programme. »Die hat sogar eines von Monna Vanna«, rief er und hielt es hoch. »Dafür würd meine Kusine ihren kleinen Finger geben.«
Reitmeyer wühlte kurz durch den Papierhaufen. »Falls hier Geld versteckt gewesen sein sollte, ist es jetzt weg. Ist dir irgendein Hinweis auf einen Arbeitsplatz untergekommen?«
Rattler schüttelte den Kopf. »Im Schlafzimmer sind bloß ein paar Bücher. Liebesromane. Und ein Foto von einem jungen Mann in Uniform auf dem Nachttisch. In der Schublade weitere Fotos von diesem Mann. Die sehen aber aus, als wären sie vor dem Krieg aufgenommen worden. Und dann gibt’s ein paar Postkarten mit Grüßen vom Tegernsee. Nur mit Vornamen unterschrieben. Weiblichen. Aber keine Briefe. Die hat ein ziemlich einsames Leben geführt, wie’s aussieht.« Er richtete sich auf. »Aber Sie sollen zum Herrn Kofler rüberkommen. Die Leichenstarre ist voll ausgebildet, meint er. Also liegt sie seit mindestens zehn Stunden da. Und uns ist was aufgefallen. Im Gesicht der Frau.«
Reitmeyer schnaufte genervt. Das war natürlich typisch für Kofler, dass er etwas fand, um dem Befund der Gerichtsmedizin vorzugreifen. Wahrscheinlich hätte er die Obduktion am liebsten selbst vorgenommen, unterstützt von Rattler, der inzwischen glaubte, sich genügend Wissen angelesen zu haben. Die beiden verstanden sich. »Der Bub ist ein heller Kopf«, war Koflers stehende Rede, bevor er Hymnen über die vielfältigen Interessen des jungen Kriminalisten anstimmte und dessen scharfen Intellekt lobte. Dabei war Rattler längst kein Bub mehr, auch wenn er mehr oder weniger immer noch aussah wie der Polizeischüler, den sie vor dem Krieg aufgenommen hatten.
»Schauen S’ mal her, Herr Kollege«, sagte Kofler, als sie ins Schlafzimmer kamen. »Sehen S’ die Punkte um die Augen der Frau?«
Reitmeyer musste sich notgedrungen näher zu ihr hin beugen und hielt die Luft an, um den widerlichen Blutgeruch nicht einzuatmen.
»Das sind Petechien«, sagte Rattler. »Die entstehen, wenn jemand gewürgt worden ist.«
Kofler nickte. »Die Frau ist stark gewürgt worden, bevor man ihr den Hals aufgeschlitzt hat. Mit einem Rasiermesser nehm ich an.«
»Ah … wirklich …« Reitmeyer trat einen Schritt zurück.
»Das würde doch bedeuten«, fuhr Kofler fort, »dass der Mörder unbedingt sicherstellen wollte, dass sie wirklich tot ist. Sie war sicher schon bewusstlos, und dann hat er das Rasiermesser eingesetzt, damit sie bestimmt nicht mehr aufwacht.«
»Genau«, sagte Rattler. »Das ist ein Hinweis auf die Motivlage des Mörders. Nach einer Tat im Affekt sieht das jedenfalls nicht aus.«
»Sehr interessant«, sagte Reitmeyer. »Wenn die Gerichtsmedizin das ebenfalls bestätigt … Sind Sie dann fertig, Herr Kofler?«
»Wir sind fertig. Ich kann vom Präsidium aus gleich den Wagen losschicken, der die Leiche abtransportiert.«
»Das machen Sie bitte. Und du«, wandte sich Reitmeyer an Rattler, »du gehst zu der Hausmeisterin rauf und sagst, dass ich sie sprechen will. Vielleicht kannst du sie dazu bewegen, nicht gleich das ganze Haus in Aufruhr zu versetzen.«
»Klar, Herr Kommissär. Ich sag ihr einfach, dass die Hausmeister eigentlich auch Vertreter der Ordnungsmacht sind. Also was ganz Ähnliches wie die Polizei. Und dass wir auf ihre Vernunft und Mithilfe zählen. Das hat schon ein paarmal funktioniert.«
Kofler grinste. »Der Bub ist halt ein heller Kopf.«
Wie sich herausstellte, funktionierte Rattlers Trick ganz hervorragend. Die Hausmeisterin sah zu, dass die Bewohner in ihren Wohnungen blieben, während der Sarg hinausgeschafft wurde. Bei der anschließenden Befragung musste sich Reitmeyer auch nicht mit dem von ihm befürchteten Haufen keifender Frauen herumschlagen, die in erster Linie die Polizei für das Verbrechen verantwortlich machten, weil die nicht für die Sicherheit der Bürger sorgte. Im Gegenteil, Frau Zausinger, unterstützt von einer weiteren »vernünftigen Person«, übernahm die Sprecherrolle und gab betont sachlich Auskunft.
Sie erklärte, dass Fräulein Löffler keinerlei Kontakt mit ihren Nachbarn pflegte. Sie habe sich für etwas »Besseres« gehalten, weil sie Buchhalterin gewesen sei. In der Funktion habe sie früher im Kaufhaus Tietz gearbeitet, aber seit einiger Zeit bei einer Firma in der Baaderstraße, die irgendwas mit »Isar« im Namen trage. Das wisse sie aus ein paar nur sehr kurzen Unterhaltungen mit ihr, weil sich Fräulein Löffler immer sehr zugeknöpft gegeben habe. Über ihre Kontakte wisse man nichts. Sie sei eigentlich immer allein gewesen, eine »alte Jungfer« halt, wie sich Frau Zausinger ausdrückte. Besucher habe sie keine gesehen. Das wäre ihr nicht entgangen. Ein oder zwei Mal allerdings habe sie beobachtet, wie Fräulein Löffler in der Westenriederstraße in ein Auto gestiegen sei, das von einem jüngeren Mann gesteuert wurde.
Die beiden Frauen waren sich uneins, ob das ihr »Galan« gewesen sein könnte. Die Hausmeisterin wollte sich dabei nicht festlegen, die »vernünftige Person« schloss es rundweg aus, weil Fräulein Löffler schon ein »älteres Mädchen« gewesen sei und für einen jüngeren Mann nicht in Frage gekommen wäre. Wer sie ermordet haben könnte, war ihnen unerklärlich. Sie könnten sich nur vorstellen, dass es jemand von dem »Gschwerl« gewesen sei, das sich nachts immer vor der Favorit-Bar herumtreibe.
Bevor die beiden nun doch noch anfingen, über die schlechte Sicherheitslage herzuziehen, bedankte sich Reitmeyer schnell und ging mit Rattler in die Wohnung zurück. Dort schlossen sie die Fensterläden, damit niemand mehr einsteigen konnte, und sperrten mit dem Schlüssel, der sich in der Handtasche gefunden hatte, die Wohnungstür ab.
»Das hat uns jetzt gerad noch gefehlt«, sagte Rattler auf dem Rückweg zum Präsidium. »Die Spielclubsache ist noch nicht aufgeklärt, und dann gibt’s einen Mord in der unmittelbaren Nachbarschaft.«
»Tja, wem sagst du das.«
»Aber wissen S’«, fuhr Rattler fort. »Wenn man bedenkt, dass in solchen Lokalen auch immer Frauen sind, so Damen, mein ich natürlich, dann müsst man jemand hinschicken, der’s mit der Sorte kann. Dann würd man sicher was auskriegen. Und ich wüsst auch schon jemand, den man dort hinschicken könnt.«
»Du meinst aber nicht Kommissär Sänger von der Sitte?«
Rattler lachte. »Nein, den Sittensänger mein ich nicht. Sondern meinen Freund Lothar. Auf den fliegen die Frauen. Der könnt das reiche, verdorbene Söhnchen geben, das sein Geld beim Spielen verjubelt.«
»Das ist nicht ungefährlich. Die müssten mit saftigen Strafen rechnen, wenn ihr Club auffliegt. Und wenn er als Spitzel entlarvt werden sollte …«
»Ach, der passt schon auf. Der Lothar ist zwar schön, aber nicht blöd.«
»Da reden wir später nochmal drüber. Du suchst jetzt als Erstes die Firma, in der die Frau gearbeitet hat, und dann gehen wir dorthin. Und ich mach mal Druck bei Professor Riedl in der Gerichtsmedizin, damit wir schnell einen möglichst genauen Todeszeitpunkt kriegen.«
»Das kann ich doch übernehmen. Ich hab einen sehr guten Draht zum Professor.«
Rattler legte wieder ein rasantes Tempo vor und warf sein Rad gegen den Eisenzaun des Präsidiums, bevor er die Treppe hinaufrannte. Reitmeyer sah ihm nach. Dass sich Rattler die Gelegenheit für eine Fachsimpelei mit dem berühmten Forensiker nicht entgehen lassen wollte, konnte er sich gut vorstellen. Aber den Spaß sollte er haben.
Reitmeyer hatte kaum die Tür zu seinem Büro geöffnet, als Oberinspektor Klotz hinter ihm hereindrängte. »Was habe ich da soeben von Kofler erfahren? Ein Mord in der Westenriederstraße?«
»In der Pflugstraße.«
Klotz machte eine ärgerliche Geste. »Das ist doch praktisch dasselbe. Jedenfalls in unmittelbarer Nähe zu dieser Bar!«
»Es ist noch keineswegs geklärt, ob die Besucher der Bar …«
»Ja geht Ihnen denn nicht auf, was die Presse daraus machen wird? Seit Wochen nun stehen wir unter Beschuss und können immer noch keine Ergebnisse vorweisen!«
»Wir arbeiten doch daran«, sagte Steiger. »Ich überprüf gerade nochmal alle Angestellten, von denen wir die Namen haben, ob …«
»Ja und?«, fragte Klotz ungeduldig. »Sind Sie denn auch nur einen Schritt weiter?«
»Tja, offenbar achten die darauf, nur Leute mit absolut weißer Weste anzustellen.«
Klotz zupfte unsichtbare Fusseln von seinem Jackett und ging nervös auf und ab. »Und wer war diese Frau?«
»Eine zweiundvierzigjährige Buchhalterin«, sagte Reitmeyer. »Bis jetzt konnten wir keine Verbindung zwischen ihr und der Bar herstellen.«
Der Oberinspektor ließ sich auf einen Stuhl sinken und nahm die Brille ab. »Und sonst wissen Sie nichts? Ich muss einen Bericht für die Presseabteilung vor…« Er brach ab, als Rattler mit einem Zettel in der Hand ins Büro stürmte.
»Isaria Handelskontor«, rief er. »Ich hab bloß ins Telefonbuch schauen müssen.«
»Das war ihre Arbeitsstelle«, erklärte Reitmeyer.
»Ja, dann gehen Sie auf schnellstem Weg dorthin. Die wissen doch sicher mehr über ihre Kontakte.« Bei der scheuchenden Bewegung, die er dabei machte, packte Reitmeyer wieder solche Wut, dass er sich abwenden musste.
»Das Opfer, Maria Löffler«, sprang Rattler in die Bresche, »hat nach Aussage der Hausbewohner ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Außer dass sie ein paarmal von einem Mann in einem Auto abgeholt wurde, sind keine anderen Kontakte bekannt.«
»Die ist abgeholt worden?«, fragte Klotz interessiert.
»Ja, ja«, erwiderte Rattler. »Die Nachbarin schließt zwar aus, dass sie mit dem Mann ein Verhältnis gehabt haben könnte, aber ich bin mir da nicht so sicher.«
»Und warum?« Klotz beugte sich gespannt vor.
»Weil oft gerade alleinstehende, einsame Frauen für die Avancen von irgendwelchen Hallodris empfänglich sind. Die säuseln ihnen was von Liebe vor, und die alten Jungfern fallen drauf rein. Bei dem Männermangel nach dem Krieg ham diese Kerle natürlich leichtes Spiel und können ihre gutgläubigen Opfer nach Strich und Faden einseifen.«
»Ja, ja«, sagte Steiger. »Unser Rattler kennt sich aus mit den Frauen.«
»Also in dem Fall«, erwiderte Klotz, »muss ich Ihrem jungen Kollegen ausnahmsweise mal recht geben. Die Zeitungen sind doch voll von solchen Geschichten, von Heiratsschwindlern und dergleichen.«
»Im Moment sind das alles nur Spekulationen«, unterbrach Reitmeyer seinen Vorgesetzten. »Wir sollten erst mal sehen, was unsere Ermittlungen …«
»Nein, nein«, sagte Klotz, »das scheint mir ein sehr vielversprechender Ansatz zu sein. Den dürfen wir keineswegs aus den Augen lassen.« Er stand auf. »Wenn Sie von der Befragung in diesem Kontor zurück sind, wünsche ich Ihren sofortigen Bericht.«
Reitmeyer sah dem Oberinspektor nach, der mit raschem Schritt das Büro verließ. Ihm war schon klar, was Klotz so »vielversprechend« fand. Er wollte den Mord als Beziehungstat hinstellen. Das war eine bewährte Methode in ihrer Behörde, wenn brisante Verwicklungen vertuscht werden sollten. Als man vor zwei Jahren eine junge Frau, die ein geheimes Waffenlager anzeigen wollte, erdrosselt aufgefunden hatte, fahndete man lange nach einem eifersüchtigen Verlobten. Das Schild um ihren Hals, »Verräterin des Vaterlands«, wurde als Ablenkungsmanöver abgetan, mit dem der Täter einen politischen Hintergrund vortäuschen wollte. Und jetzt würde man wieder einen gewissenlosen Liebhaber aus dem Hut zaubern, um den Furien der Presse den Wind aus den Segeln zu nehmen, wenn sie versuchten, Verbindungen zu der Spielhölle herzustellen. Es brauchte nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie die Pressemeldung aussehen würde.
»Also«, sagte Reitmeyer. »Du hast die Adresse? Dann los.«
»Ich muss noch in der Gerichtsmedizin anrufen und …«
»Aber nur ganz kurz.«
Das Haus in der Baaderstraße, in dem die Isaria ihr Büro hatte, war der Sitz einer ganzen Reihe von Firmen. Das Handelskontor befand sich im ersten Stock und nahm die ganze Etage ein, wie sie feststellten, nachdem sie eine glänzende Eichentreppe hinaufgestiegen waren. Eine junge, sehr adrett gekleidete Sekretärin öffnete auf ihr Klingeln. Reitmeyer zeigte seine Marke und sagte, dass er ihren Chef sprechen wolle. Es gebe zwei Chefs, Herrn König und Herrn Stadler, erklärte die Sekretärin und führte sie in ein Vorzimmer.
»Dann alle beide«, erwiderte Reitmeyer.
»Die Herren sind noch in einer Besprechung. Wenn Sie sich einen Augenblick gedulden würden.« Sie ging hinaus und kam kurz darauf wieder zurück. »Bitte nehmen Sie doch im Büro von Herrn König Platz. Er muss nur noch einen Kunden verabschieden, dann steht er sofort zu Ihrer Verfügung.« Sie öffnete die Tür zu dem angrenzenden Raum und deutete auf zwei Stühle vor einem großen Schreibtisch.
Reitmeyer setzte sich und sah sich um. Die Geschäfte der Isaria schienen nicht schlecht zu gehen, gemessen an der Einrichtung des Raums. Alles wirkte sehr hell und luftig, die Möbel waren betont schlicht und sachlich, dennoch edel und elegant. Auch der einfarbige Teppich auf dem glänzenden Fußboden passte zu der Komposition und nahm den Farbton der Vorhänge auf. Hier residierte ein Chef, der ganz bewusst auf die Moderne setzte und jenseits von Plüsch und Pomp eine nüchterne, aber qualitätvolle Einfachheit favorisierte. Das sah man nicht oft.
Rattler hatte sich nicht gesetzt, sondern wanderte durch den Raum und studierte die Architekturzeichnungen an den Wänden. »Die bauen und renovieren offenbar Häuser. Da ist ein Projekt in Pasing und eines in Sendling. Recht schöne Wohnungen, wie’s aussieht.«
Fast im gleichen Moment ging die Tür auf, und Herr König trat ein. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ«, sagte er höflich, bevor er den beiden Besuchern die Hand schüttelte. »Was kann ich für Sie tun?«
Reitmeyer wartete, bis der Mann, den er auf Ende dreißig schätzte, hinter seinem Schreibtisch Platz genommen hatte. Seine Züge waren ein wenig schwammig und sein Körper etwas füllig. Aber in seinem gutgeschnittenen grauen Anzug und dem tadellos gebügelten weißen Hemd fügte er sich perfekt in die Umgebung ein. Seine rotschwarz gestreifte Krawatte bildete einen angenehmen Farbtupfer in der monochromen Palette.
»Bei Ihnen arbeitet ein Fräulein Maria Löffler?«, begann Reitmeyer.
»Richtig. Sie ist leider heute nicht erschienen. Ich wollte schon unsere Sekretärin vorbeischicken, um nachzusehen, ob sie krank ist.«
»Nun, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Fräulein Löffler tot ist.«
König starrte ihn ungläubig an. »Tot …? Ein Unfall?«
»Nein, kein Unfall. Wie es aussieht, ist sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Sie wurde ermordet.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Verzeihen Sie … das verstehe ich nicht …«
Reitmeyer beobachtete ihn. Auf seinem Gesicht zeichnete sich ehrliche Erschütterung ab. »Wie ist sie … ich meine auf welche Weise …?«
Reitmeyer gab nur die nötigsten Fakten preis, die sein Gegenüber offenbar bereits schwer erträglich fand. »Ich … ich hole meinen Kompagnon«, stammelte er und ging hinaus.
»Die Sache scheint ihm tatsächlich nahzugehen«, sagte Rattler.
Ein paar Minuten später kam König mit einem Mann zurück, den er als Erwin Stadler vorstellte. »Wir führen die Firma gemeinsam.«
Reitmeyer begrüßte den Kompagnon, den er um einiges jünger schätzte als König. Im Gegensatz zu diesem war Stadler schlank und drahtig, mit markanten Zügen und verblüffend blauen Augen, deren Farbe durch das dunkle Haar noch stärker hervorgehoben wurde. Ein Frauenschwarm, dachte Reitmeyer. Typ Herzensbrecher.
»Was habe ich da gehört?«, stieß Stadler hervor. »Das ist ja … unfassbar.« Er griff in seine Jackentasche, zog ein silbernes Etui heraus und zündete sich eine Zigarette an. Dann ließ er sich neben König auf einen Stuhl fallen.
»Im Haus von Fräulein Löffler wurde gesagt, dass sie hier als Buchhalterin gearbeitet hat. Seit wann war sie denn bei Ihnen?«, fragte Reitmeyer.
»Seit etwa einem Jahr«, erwiderte König. »Sie war sehr tüchtig und absolut zuverlässig.« Er hielt inne und holte tief Luft. »Ob wir noch einmal eine solche Kraft …?«
»Was ist Ihnen über ihr Privatleben bekannt, ich meine, mit wem hat sie verkehrt? Wissen Sie von irgendwelchen Freunden oder Verwandten?«
König machte eine bedauernde Geste und sah Stadler an, der wie abwesend zu Boden starrte und paffte. »Soweit ich weiß, hat sie sehr zurückgezogen gelebt. Ich glaube, sie hat keine Verwandten mehr gehabt, nachdem ihre Eltern gestorben waren.«
Stadler richtete sich seufzend auf. »Sie war ziemlich allein, glaub ich. Ich hab sie ein oder zwei Mal ins Kino eingeladen. Als kleines Dankeschön für ihre Arbeit, verstehen Sie.« Seine Stimme klang gepresst, als hätte er Mühe, die Fassung zu wahren. »Sie war wirklich unermüdlich in ihrem Einsatz, nie war ihr etwas zu viel, nie hat sie sich beklagt, wenn’s mal wieder spät geworden ist … Erst letzte Woche, als wir kurzfristig ein paar Angebote fertigstellen mussten, ist sie fast bis Mitternacht geblieben …«
»Und zu diesen Kinobesuchen haben Sie Fräulein Löffler mit dem Auto abgeholt?«
Stadler kniff die Augen zusammen, als hätte er nicht richtig verstanden. »Ich … ich weiß nicht mehr … wahrscheinlich … Ist das wichtig?«
»Die Hausmeisterin hat beobachtet, dass Fräulein Löffler von einem Herrn im Auto abgeholt wurde.«
Stadler zuckte die Achseln. »Ich hab sie vielleicht ein oder zwei Mal abgeholt.«
»Sie wissen also nichts von Bekannten, oder was sie in ihrer Freizeit gemacht hat?«
König machte erneut bedauernde Gesten. »Wir hatten ein sehr gutes Arbeitsverhältnis, wie gesagt, aber was ihr Privatleben angeht, da bin ich wirklich überfragt. Obwohl ich nicht den Eindruck hatte, dass sie über einen größeren Freundeskreis verfügt hat.«
»Und einen kleineren?«
Stadler lächelte ein bisschen. »Ich hab wirklich keine Ahnung.«
»Vielleicht weiß unsere Sekretärin irgendetwas«, sagte König und griff zum Telefonhörer, um sie hereinzubitten. »Sie ist auch vollkommen geschockt«, fügte er hinzu.
Die junge Frau trat zögernd ein. König erklärte ihr, dass die Kriminalbeamten wissen möchten, ob ihr etwas über Fräulein Löfflers Privatleben bekannt sei.
»Nein, nein … gar nichts. Einmal hat sie was von ehemaligen Kolleginnen erzählt. Aus dem Kaufhaus, wo sie früher war. Dass sie einen Ausflug gemacht hätten. Aber das ist mindestens ein paar Monate her. Sie hat nicht viel erzählt.«
»Können wir ihren Arbeitsplatz sehen?«, fragte Rattler.
Stadler runzelte die Stirn. »Sagen Sie, kennen wir uns nicht?«
»Kennen wäre zu viel gesagt«, erwiderte Rattler. »Wir haben uns einmal am Gärtnerplatz gesehen, vor dem Blumenladen. Sie scheinen die Leni zu kennen. Das kleine Mädchen, das dort arbeitet.«
»Ah ja«, sagte Stadler. »Leni heißt die Kleine? Ich red manchmal mit den Kindern und geb ihnen was, wenn sie mich anbetteln.«
König stand auf. »Wenn Sie mir folgen wollen. Ich führe Sie zu ihrem Arbeitsplatz.« Er trat in den Gang hinaus und öffnete eine Tür. Sie blickten in ein Büro, das keineswegs so schick eingerichtet war wie das ihres Chefs. Es wirkte kahl und wurde von einem dunklen Schreibtisch und mit Ordnern gefüllten Regalen fast ganz ausgefüllt. Auf der Fensterbank kümmerten ein paar Grünpflanzen vor sich hin, die nicht genügend Licht aus dem Hinterhof bekamen. Reitmeyer zog die Schubladen auf. Auch hier herrschte peinliche Ordnung. Außer ein paar Süßigkeiten in der mittleren Lade gab es nur Schreibmaterial, Papier und Akten mit Rechnungen. Zum Schluss hob er noch die grüne Schreibunterlage an und stellte zu seinem Erstaunen fest, dass ein Blatt darunter lag. Ein Flugblatt. Vom Bund Reichskriegsflagge. »Was hatte Fräulein Löffler mit diesem vaterländischen Verband zu tun?«, fragte er und hielt das Blatt hoch.
König und Stadler sahen sich an. »Keine Ahnung«, sagte Stadler. König schüttelte verständnislos den Kopf.
Reitmeyer steckte das Flugblatt ein. »Sie haben doch nichts dagegen?«
Stadler zuckte die Achseln.
»Wir wären dann fertig«, sagte Reitmeyer und ging zum Ausgang. »Vielen Dank für Ihre Mühe.«
König begleitete die Kriminaler zur Tür und versicherte, dass man ihnen jederzeit zu Verfügung stehe, wenn es noch Fragen gebe oder sie sonst irgendwie behilflich sein könnten.
Reitmeyer und Rattler liefen die Treppe hinunter und schoben die Fahrräder bis zur Ecke Zweibrückenstraße, wo sich Rattler umdrehte und auf das Haus der Isaria zurückblickte. »Ah, da schau her, die zwei Chefs gehen gerad weg. Wenn Sie einen Moment warten, Herr Kommissär, lauf ich schnell nochmal in das Büro rauf. Die Sekretärinnen reden meist offener, wenn kein Chef dabei ist. Ich tu so, als würd ich mich nochmal nach Verwandten erkundigen.«
Reitmeyer nickte. »Ich vertief mich solange in die Lektüre von diesem Flugblatt. Obwohl ich jetzt schon weiß, was drinsteht.«
»So ein Blatt hab ich übrigens auch auf dem Schreibtisch vom König gesehen. Vielleicht sind die Mitglieder in dem Verein?«
»Schon möglich. Aber geh jetzt, und bleib nicht so lang.«
Reitmeyer faltete das Blatt auf. Es stand tatsächlich nichts Neues drin, auch wenn ihm der Tonfall noch aggressiver vorkam als in den sonstigen Verlautbarungen der rechten Presse. Die »Schande von Versailles«, das »bolschewistische Berlin« und die »Judenherrschaft« wurden nicht bloß gegeißelt, es wurde dringend zum Marsch auf die Hauptstadt geblasen. Aber letztlich war auch das nichts Neues. Schon seit Anfang des Jahres war nicht mehr zu übersehen, dass konkrete Vorbereitungen liefen, mit dem Sturz des verhassten Weimarer »Systems« endlich Ernst zu machen. Jedenfalls fragte sich keiner mehr, ob die Rechten zuschlagen würden, sondern bloß noch, wann.
Aber was hatte Fräulein Löffler mit diesen Radikalen zu tun? Wollte sie sich bei ihren Chefs andienen, wenn sie Interesse für den Verein zeigte? Er sah in den Himmel hinauf, der sich immer mehr aufhellte und lehnte sich an eine Hauswand.
Etwa zehn Minuten später kam Rattler atemlos angerannt. »Herr Kommissär«, stieß er hervor. »Ich hab’s mir doch gedacht.«
»Was?«
»Die Löffler war in den Stadler verschossen. Die Sekretärin sagt, sie sei furchtbar sauer gewesen, weil sie ihn mit einer Frau gesehen hat. Der Stadler sei eigentlich recht nett zu der Löffler gewesen, aber sie hat sich offenbar mehr erhofft.«
»Ja und?«
»Dann ist die Arbeitsatmosphäre doch nicht so problemlos gewesen, wie die uns weismachen wollen.«
Reitmeyer zuckte die Achseln. »Dass sich Buchhalterinnen in ihren Chef verlieben, kommt wahrscheinlich öfter vor. Und für den Stadler war’s sicher nicht das erste Mal, dass ihm so was widerfährt.«
»Wollen Sie damit sagen, der hat Erfahrung damit, sich lästige Verehrerinnen vom Leib zu halten?«
»Meinst du, die setzen ihm so zu, dass er sie alle umbringen muss?« Reitmeyer lachte. »Dann müsste er ja Serienmörder sein.«
2
»Ich soll dir vom Oberinspektor ausrichten, dass er erst am Nachmittag Zeit hat, weil er jetzt bei einer Lagebesprechung ist«, sagte Steiger, als Reitmeyer ins Büro kam.
»Gibt’s was Besonderes?«
»Im Moment herrscht ziemlicher Aufruhr, weil uns die Einsatzkräfte ausgehen, wenn gleichzeitig eine große Kundgebung und mehrere nicht angemeldete Demonstrationen stattfinden.« Steiger lachte unfroh. »Das Schwierigste ist wahrscheinlich, dass sich vor dem Innenministerium eine Schar Hausfrauen versammelt hat. Das soll nicht wieder werden wie letztes Jahr auf dem Marienplatz, wo die Polizei auf wehrlose Frauen eingeprügelt hat.«
»Ja, das war kein Ruhmesblatt für unsere Behörde.«
»Und in Giesing steht eine Horde Kommunisten vor einem Gasthaus, die auf die Söhne von dem Wirt losgehen wollen, weil die angeblich Nazi-Anhänger sind.«
»Tja, Giesing ist ein gefährliches Pflaster für Nazis«, sagte Rattler. »Da kommt’s wahrscheinlich zu einer Riesenschlägerei.«
»Mach dir keine Hoffnungen«, erwiderte Steiger. »Deine Einsätze im Außendienst sind ein für alle Mal vorbei. Bei deiner Lunge.«
»Muss mich eigentlich jeder ständig an meine Gasvergiftung erinnern?«
»Ja, wenn du durch die Stadt jagst wie Thaddäus Robl, der Radweltmeister, dann vielleicht schon«, sagte Reitmeyer genervt. »Im Übrigen hast du jetzt was anderes zu tun. Krieg mal raus, ob die ehemaligen Kolleginnen von Fräulein Löffler noch beim Kaufhaus Tietz arbeiten. Das machst du drüben in Brunners Büro. Und die Namen von diesen Frauen wären auch nicht schlecht.«
»Der Robl ist übrigens Flieger geworden«, sagte Rattler im Hinausgehen. »Ich sollt mich vielleicht auch in die Lüfte erheben.« Nach einem scharfen Blick seines Kommissärs machte er schnell die Tür hinter sich zu.
»Habt ihr in dem Handelskontor nix erfahren?«, fragte Steiger.
Reitmeyer schüttelte den Kopf. »Praktisch gar nix.« Er nahm das Flugblatt aus der Tasche und breitete es auf dem Schreibtisch aus. »Kennst du einen Bund Reichskriegsflagge?«
»Ich erinner mich an einen Wehrverband Reichsflagge. Vielleicht eine Abspaltung. Diese Radaubrüder spalten sich doch ständig. Da blickt kein Mensch mehr durch. Aber wieso fragst du?«
»Das hab ich auf dem Schreibtisch vom Mordopfer gefunden?«
»Komisch. Frauen werden doch gar nicht zugelassen bei diesen Krawallmachern. Aber vielleicht hat sie einen Galant, der Mitglied ist?« Er stand auf. »Hoffentlich nicht wieder so ein Fememord. Da hätten wir schlechte Karten.«
Reitmeyer seufzte. »Wem sagst du das.«
Steiger ging zur Tür. »Ich mach jetzt erst mal Mittag.«
Als er fort war, griff Reitmeyer zum Telefon. Möglicherweise wusste sein alter Freund Sepp Genaueres über diesen Verband. Er schrieb noch immer Kolumnen für die Münchner Post, das SPD-Blatt, das die Rechte seit Jahren bekämpfte. Jedenfalls konnte man davon ausgehen, dass die Journalisten ihre Gegner kannten. Aber die Sekretärin teilte ihm mit, dass der Herr Rechtsanwalt noch bei Gericht sei und sicher nicht vor vier Uhr zurückkomme.
Reitmeyer griff seine Jacke und rief in Brunners Büro, dass er auch Mittag mache und in einer Stunde wieder zurück sei.
Der Gedanke, dass Maria Löffler mit einem Mitglied dieses Verbands zu tun gehabt haben könnte, war ihm natürlich auch gekommen. Doch diese Möglichkeit hatte er eigentlich verworfen. Es kam ihm unwahrscheinlich vor, dass sie mit einem dieser Kerle in Verbindung gestanden haben könnte. Dafür wirkte alles, was er bislang von ihrer Umgebung gesehen hatte, einfach zu brav. Und sie war zu alt. Aber vielleicht graute ihm auch bloß vor der Vorstellung, wieder in rechtsradikalen Kreisen ermitteln zu müssen. Dass sie dort schlechte Karten hätten, wie Steiger meinte, war ja noch vorsichtig ausgedrückt.
Schnell überquerte er den Karlsplatz und stellte sich am Kiosk hinter ein paar Kunden an. Während er wartete, fiel sein Blick auf eine Manoli-Reklame. Darauf blies ein eleganter Mann im Smoking den Rauch seiner Zigarette in die Luft, während er lässig an einer Bar lehnte. Derlei Genüsse gehörten für Reitmeyer der Vergangenheit an. Selbst eine kleine Schachtel mit sechs Glimmstengeln dieser Sorte kostete wahrscheinlich ein Vermögen. Er musste sich mit der Marke Eigenbau begnügen, die seine Tante von ihren Verwandten aus Freising mitbrachte. Er wandte sich ab und las die Schlagzeilen der Zeitungen. München nimmt am internationalen Flugverkehr teil.
»Da bin ich aber froh«, sagte der Mann vor ihm, »dass ich jetzt problemlos vom Oberwiesenfeld nach London, Zürich und auf den Balkan fliegen kann.«
»Den Balkan kenn ich schon«, erwiderte ein anderer. »Von meinem Ausflug mit unserer Armee.« Sie lachten.
»Ah, Herr Kommissär«, sagte die Kioskbesitzerin, als er an der Reihe war. »Eine Schachtel Zigarillos?«
»Nein, Frau Brugger, bloß eine Zeitung. Leider.« Er legte 450 Mark auf die Ablage.
Sie steckte den Kopf durchs Fenster und überzeugte sich, dass niemand in der Nähe war. »Ich hätt da was für Sie.« Sie lächelte ihn verschwörerisch an, öffnete eine Schublade unter der Ablage und zog eine Virginia heraus. »Eine Villiger«, sagte sie flüsternd. »Das Feinste, was es gibt.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber die ist zu teuer für mich.«
»Ach, wissen S’.« Sie beugte sich näher. »Mein Mann hat in unserem Lager noch eine Kiste gefunden. Und die geb ich jetzt einzeln an unsere langjährigen Kunden ab.« Sie legte den Zeigefinger auf den Mund. »Aber das bleibt unter uns.«
»Ja, aber trotzdem …«
»Über den Preis werden wir uns schon einig, wenn Sie das nächste Mal kommen«, sagte sie schnell und drückte ihm den Zigarillo in die Hand, als sich ein anderer Kunde näherte.
Reitmeyer trat ein Stück zur Seite und sah auf die Villiger in seiner Hand. Eine Kaiserliche hatte man sie genannt, weil sie von Franz Joseph, dem österreichischen Monarchen, bevorzugt wurde. Die sollte er an einem angemessenen Ort rauchen, dachte er. Im Hofgarten. Vielleicht im Tambosi. Doch auf dem Weg zum Odeonsplatz verwarf er den Gedanken wieder. Wahrscheinlich reichte seine Barschaft für das Tambosi nicht aus. Seit letztem Monat hatten er und seine Tante beschlossen, ihre Rente und sein Gehalt sofort für haltbare Lebensmittel auszugeben, anstatt zuzusehen, wie die Preise immer weiterstiegen. Also lebte er jetzt wieder wie ein Schüler, der mit Taschengeld auskommen musste. Zuweilen war er sogar darauf angewiesen, dass seine Tante ihm etwas zusteckte, wenn sie mit ein paar Naturalien vom Bauernhof ihrer Verwandten geschickte Tauschgeschäfte gemacht hatte. Letztes Jahr hatten ihn noch Gewissenbisse geplagt, weil er von ihrem Schwarzhandel profitierte, aber wenn er sich vorstellte, dass er am Morgen statt Bohnenkaffee ein Gebräu aus gerösteten Rübenschnitzeln trinken sollte, verflogen seine Bedenken merklich. Überhaupt war seine Moral inzwischen genauso geschmeidig wie die aller Leute. Man musste schließlich überleben.
Er schlenderte weiter durch die Theatinerstraße. Im Vorbeigehen fiel ihm auf, dass einige Geschäfte geschlossen waren. Wegen »Warenbeschaffung« stand auf den Schildern im Schaufenster. Was wohl nicht ganz der Wahrheit entsprach. Viele Geschäfte öffneten bloß noch sporadisch und horteten ihre Waren lieber, als sie gegen zunehmend wertloses Papiergeld abzugeben, mit dem sie keine neue kaufen konnten. Wo das noch enden solle, fragten sich die Kollegen in seiner Behörde. Der Einzige, der darauf eine Antwort wusste, war Rattler, der Oberschlaumeier. Schon letztes Jahr hatte er verkündet, dass es so lange weitergehen würde, bis der Staat die 150 Milliarden weginflationiert habe, die er seinen Bürgern für die Kriegsanleihen schuldete. Derlei Einsichten stammten natürlich von seinem Freund Lothar, dem Ökonomiestudenten, und wurden keineswegs dankbar aufgenommen. Steiger fuhr ihm sofort übers Maul, wenn er einen Satz mit »mein Freund Lothar« begann, und ähnlich ablehnend reagierte er auf seine Börsentipps. Genau wie der Oberinspektor, der zum Kauf von Aktien bloß sagte: »Ein bayerischer Beamter spekuliert nicht.«
Am Tambosi vorbei ging Reitmeyer durchs Tor in den Hofgarten. Nachdem er eine Weile herumgeschlendert war, setzte er sich auf eine Bank und zündete die Kaiserliche an. Tief zog er den würzigen Rauch ein und warf einen Blick in die Zeitung, die er gekauft hatte. Er suchte allerdings nur die Anzeigen der Lichtspieltheater, weil seine Tante unbedingt Lukrezia Borgia sehen wollte. Wieder so ein schrecklicher Historienschinken, dachte er. Aber es half nichts. Er musste sich für ihre Sorge erkenntlich zeigen und hatte versprochen, sie auszuführen. Nach einer Viertelstunde stand er auf und machte sich auf den Rückweg. Er brauchte unbedingt noch einen Kaffee, bevor es wieder ins Büro ging. In dem Lokal gegenüber vom Präsidium würde er einen bekommen. Und wenn sein Geld nicht reichte, konnte er anschreiben lassen.
Der ganze Nachmittag verging mit fieberhafter Arbeit. Gemeinsam mit Steiger nahm er sich nochmal die Angestellten der Favorit-Bar vor und durchforstete die Registratur, ob einer schon mal wegen Glücksspiel oder anderer Delikte in Schwierigkeiten gekommen war oder sogar unter Bewährung stand. So jemanden könnte man unter Druck setzen, und in der Hoffnung, das Strafmaß zu begrenzen, würde er vielleicht auspacken. Aber sie fanden nichts.
»Es ist doch wie verhext«, sagte Steiger. »Jetzt ham wir buchstäblich alles auf den Kopf gestellt, aber null und nix.«
»Das ist schon auffällig. Ein anständiger Münchner Kellner ist doch wenigstens mal wegen Körperverletzung verfolgt worden.«
»Wo rekrutieren die ihr Personal? Beim katholischen Männerverein? Trotzdem.« Steiger stand auf. »Heut will ich pünktlich Schluss machen. Ich treff mich mit ein paar Bekannten am Nockherberg. Und endlich ist das Wetter auch mal besser geworden.«
Reitmeyer sah aus dem Fenster. »Da könnt ihr wahrscheinlich sogar draußen sitzen.« Er ging zu seinem Schreibtisch zurück. »Ich bin eigentlich zum Abendessen eingeladen … Aber mir fällt da noch was ein. Wir sollten uns mal an die Fotografen wenden, die immer Bilder machen in den Lokalen. Vielleicht auch in der Favorit-Bar. Die werden uns wahrscheinlich keine Fotos von den Spielerrunden liefern, aber wenn wir sehen könnten, welche Gäste dort versammelt sind …«
»Herr Kommissär«, rief Brunner von gegenüber. Gleich darauf kam der Polizeiassistent ins Büro gehumpelt und wedelte mit einem Zettel. »Da ruft der Rohrmoser vom Revier Rumfordstraße an. Er sagt, dass alle seine Leut’ nach Giesing rauf beordert worden sind. Und im Moment sind auch keine anderen Kräfte verfügbar, weil die bei einer Kundgebung in Haidhausen eingesetzt sind.«
»Und was geht das uns an?«, fragte Reitmeyer.
»Ja, weil er in einem Laden in der Klenzestraß’ steht, wo der Inhaber bedroht wird.«
»Ein Geschäftsinhaber wird bedroht?«, fragte Steiger. »Das ist ja ganz was Neues.«
»Wieso?«, fragte Brunner. »Das kommt doch ständig …«
»Schon gut, Brunner«, sagte Reitmeyer. »Was ist da los?«
»Vor dem Geschäft ham sich Kerle versammelt, die sich trotz Aufforderung nicht entfernen.« Er sah auf den Zettel. »Klenze 27. Der Inhaber heißt Levinsohn.«
»Den Laden kenn ich«, rief Rattler, der hinter Brunner eingetreten war. »Der ist ganz in der Nähe von meinem Sportverein.«
»Seit wann kannst du Sport machen mit deiner Lunge?«, fragte Steiger.
»Seitdem ich was gefunden hab, wo man nicht mit der eigenen, sondern mit der Kraft des Gegners arbeitet. Asiatische Kraftkunst. Jiu Jitsu.«
»Und so was lernt man in der Isarvorstadt?«
»Bei Bar Kochba in der Klenzestraße.«
»In einer Bar?«, fragte Brunner.