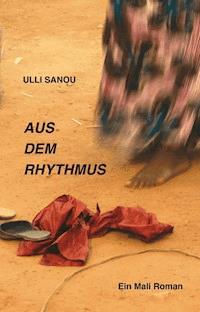
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein Trommelworkshop in einem Seminarhof am Rande Bamakos, der Hauptstadt Malis: Das illustre Grüppchen europäischer Musikbegeisterter nimmt Unterricht bei Seydu, dem malischen Djembemeister und Ma, der Tänzerin. Man wird von einer Anzahl afrikanischer Küchenfrauen bekocht, ist Gast traditioneller Feste, erlebt Geistheilungszeremonien und lernt afrikanisches Alltagsleben sowie einander kennen. Werner, ein Seminarteilnehmer, macht sich alleine auf den Weg zum Markt und kommt nicht mehr zurück. Die anfängliche Besorgnis weicht bald der Befürchtung, von einem Verbrechen ausgehen zu müssen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Ein Trommelworkshop in einem Seminarhof am Rande Bamakos, der Hauptstadt Malis: Das illustre Grüppchen europäischer Musikbegeisterter nimmt Unterricht bei Seydu, dem malischen Djembemeister und Ma, der Tänzerin. Man wird von einer Anzahl afrikanischer Küchenfrauen bekocht, ist Gast traditioneller Feste, erlebt Geistheilungszeremonien und lernt afrikanisches Alltagsleben sowie einander kennen.
Werner, ein Seminarteilnehmer, macht sich alleine auf den Weg zum Markt und kommt nicht mehr zurück. Die anfängliche Besorgnis weicht bald der Befürchtung, von einem Verbrechen ausgehen zu müssen.
Ulli Sanouist Percussionistin und hat viel Lebenszeit in Mali verbracht. Ihre Erfahrungen in diesem Land und in der Trommlerszene hat sie in den vorliegenden Roman verpackt.
Trommelkurse und mehr:www.djembe.at
Impressum
Copyright: © 2015 by Ulli Sanou
Moosweg 6/2
A-3123 Neustift
Coverfoto: © Ulli Sanou
Grafische Gestaltung: Ulli Sanou
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme oder Anlagen vervielfältigt oder verarbeitet werden.
Ulli Sanou
Aus dem Rhythmus
Ein Mali Roman
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Glossar
Danksagung
1
Befriedigt und entspannt zündete sich Madou Dembele eine Marlboro an. Eigentlich konnte er sich diese Zigaretten nicht leisten, aber heute hatte er sich vier Stück seiner Lieblingssorte gekauft, weil er einen Touristen mit dem Taxi durch Bamako gefahren und so ein wenig Geld verdient hatte. Einen Amerikaner. Madou hatte seine Kindheit und Jugend in Sierra Leone verbracht und sprach Englisch. Darauf war er stolz und er freute sich über jede Gelegenheit, seine Sprachkenntnisse an den Mann bringen zu können.
„Rauch nicht so viel”, sagte seine Frau Fatu mitten in sein genussvolles Inhalieren hinein, was ihn sofort ärgerte. Frauen sollten ihren Männern nicht sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben.
Es war heiß in diesem Zimmer. Das winzige Fenster war mit einem zerschlissenen Stück Stoff notdürftig verhängt, ein schmaler Lichtstreifen zwängte sich durch. An der Wand rechts neben dem Bett stand ein Turm gestapelter Blechkisten. Die Wände waren schon lange nicht mehr frisch gestrichen worden, überall war Farbe abgeblättert und unterhalb des Blechdachs, das ebenfalls den einen oder anderen Lichtstrahl durchließ, hingen Spinnweben. Gleich neben der Tür stand der Canari, ein bauchiges Tongefäß, das Trinkwasser enthielt.
Madous Gedanken schweiften zurück zu diesem Amerikaner. Ein freundlicher Typ. Sogar Trinkgeld hatte er ihm gegeben. Amerika! Da müsste man hin. Da könnte man Geld verdienen! Da hätte man ein besseres Leben und eine Zukunft, nicht wie hier in dieser elenden Großstadt. Jetzt übertrieb er ein wenig - tatsächlich hatte er es nicht so schlecht getroffen. Im vorderen Teil der Hütte, die er mit der schönen Fatu bewohnte, befand sich immerhin eine kleine Mechanikerwerkstatt, die ihnen, zusammen mit den gelegentlichen Taxifahrten, zumindest das tägliche Überleben sicherte.
„Was wirst du machen die drei Wochen ohne mich?“ Ließ sich Fatu vernehmen.
„Ich werde zurecht kommen. Und mit dem Geld, das du verdienst, können wir das Dach ausbessern. So eine Regenzeit wie die letzte möchte ich nicht noch einmal erleben.“
Während der vergangenen Regenperiode hatte es in die Hütte und sogar in das Ehebett geregnet. Es war kein Geld für Reparaturen da gewesen, Madou hatte mehr recht als schlecht versucht, die schlimmsten Löcher mit Blechresten, die er irgendwo aufgelesen hatte, zu stopfen.
„Bitte doch deine Mutter herzukommen. Sie könnte für dich kochen.“
„Vielleicht.“
„Du wirst dir doch keine Freundin nehmen?“ Das schien ihre größte Angst zu sein. Dabei hätte er das Recht, sich nicht nur Freundinnen zuzulegen, sondern auch noch drei weitere Ehefrauen, was bisher allerdings am Mangel an materiellen Mitteln gescheitert war, selbst wenn er es gewollt hätte. So einfach war das nämlich nicht. Heiraten, ja, das ginge gerade noch, aber dann: Eine Hütte für jede Frau, bekommt eine einen Stoff, müssen die anderen gleichermaßen beschenkt werden. Gut, man könnte mit vier Frauen Sex haben, aber wozu? Fatu war willig, sie hatte sich bisher noch kein einziges Mal verweigert.
Das war darauf zurückzuführen, dass Fatu gar nicht auf die Idee gekommen wäre, sich zu verweigern. Sex gehörte nun mal zum Eheleben und war eine Einrichtung, die hauptsächlich den Männern zugute kam, denn Fatu war beschnitten. Ihr und allen anderen Frauen aus ihrem Bekanntenkreis war im Alter von 6 Jahren die Klitoris entfernt worden, um sie zu richtigen Frauen zu machen.
Sie erinnerte sich noch gut an den Tag ihrer Beschneidung und an die Schmerzen. Noch jetzt, viele Jahre danach - wieviele? 13? - kroch die Panik in ihr hoch, so wie damals, als diese Frau auf sie zukam - nein, nicht dran denken! - es ist vorbei, Vergangenheit. Vor ihr lagen drei Wochen Zukunft: Sie hatte Arbeit gefunden, bei Tubabs, am anderen Ende der Stadt. Für Weiße zu arbeiten brachte Geld, Weiße waren reich und zahlten gut, das wusste sie von anderen, die diese Chance schon gehabt hatten.
Drei Wochen lang würde sie für viele Tubabs kochen. Nicht allein, das wäre gar nicht zu schaffen! Sie würden ein Küchenteam bilden, sie und ihre Freundinnen. Jetzt war sie froh, dass sie Maimona kannte, obwohl sie sie gar nicht so gerne mochte. Maimona war um einiges älter als Fatu und Fatus Empfinden nach eine Angeberin. Immer musste sie Recht haben, ließ keine andere Meinung zu und konnte mit ihrer lauten Stimme jede Erwiderung niederschreien. Da musste sie noch gar nicht brüllen, da reichte schon ihre normale Lautstärke. Weil Fatu eher schüchtern und harmoniebedürftig war, hatte sie sich von Maimona alles gefallen lassen, eine kluge Taktik, wie sich jetzt herausstellte. Falls man überhaupt von Taktik sprechen konnte, das würde ja eine Wahlmöglichkeit voraussetzen, und davon konnte bei Fatu keine Rede sein.
Lärm vor der Hütte. Madou sprang auf, zog sich schnell seine Hose an und riss die Tür weit auf, während Fatu hektisch das Leintuch über ihren nackten Körper zog. Sie dachte: Das macht er nur, damit alle Bescheid wissen. Dass er ein Mann ist und eine Frau zum Vögeln hat. Aber so sind die Männer nun mal. Vielleicht nicht alle. Aber alle, die sie kannte. Was sind das für Gedanken, Fatu? Es war nicht gut, so zu denken, das wusste sie wohl. Trotzdem.
Sie schob das Moskitonetz zur Seite und während sie aufstand, spürte sie, wie Madous Sperma aus ihr rausrann. Hoffentlich hat es diesmal geklappt. Seit einem Jahr war sie mit ihm verheiratet und noch immer nicht schwanger. Irgend etwas stimmte mit ihr nicht. Erst letzte Woche war sie bei der alten Fatim in Jikoroni gewesen, schon zum dritten Mal. Jedes Mal musste sie ihr ein schwarzes Huhn bringen, das die Alte dann unter Beschwörungen köpfte und danach selber aß. Der einzige Bauch, der dabei anschwoll, war der von Fatim. Fatu wickelte sich ein Tuch um ihren Körper und ging nach draußen in die brütende Hitze.
Madou und zwei ihr unbekannte Männer beugten sich über den Motorraum eines alten und ziemlich verrosteten Autos und fachsimpelten.
„Aw ni wula”, murmelte sie, „here klena”, antworteten die Männer. „Nse here tron”, antwortete Fatu, „mbah”, die Männer.
Madou ging in die spärlich ausgestattete Werkstatt und kam mit einigen Schraubenschlüsseln zurück, hantierte im Motorraum herum, nickte zufrieden, setzte sich hinter das Lenkrad und ließ den Motor an, der prompt zu brummen begann.
Fatu gähnte. Träge musterte sie die Szene.
In der Nähe pickten ein paar Hühner im verdorrten Gras herum auf der Suche nach Essbarem, einige Ziegen etwas weiter entfernt verfolgten das gleiche Ziel. Müll, soweit das Auge reichte. Die ganze flache Landschaft, in der kaum ein Baum Schatten spendete, war mit rosafarbenen, hellblauen oder weißen Plastiksäcken übersät. Die nächste Hütte war mindestens hundert Meter entfernt. Um in die Stadt zu kommen, musste man ein Duruduruni nehmen, in welches man sich gerade noch zwischen die auf einer mit seitlich angebrachten Sitzbänken versehenen Ladefläche eng aneinander gepressten Fahrgäste quetschen konnte, falls es überhaupt möglich war, über die in der Mitte angehäuften Hühner, Getreidesäcke und Riesenschüsseln mit Gemüse aller Art zu klettern.
Dasselbe Dilemma retour. Nicht nur einmal war es Fatu passiert, dass sie die Erste am Duruduruni gewesen war und trotzdem keinen Platz mehr bekommen hatte, weil Andere, im beinharten Konkurrenzkampf Geübtere, sie einfach vom Einstieg weggestoßen hatten.
Die Männer zahlten, schüttelten Madou die Hand, stiegen in ihre klapprige Kiste, fuhren auf die Ausfallstraße Richtung Segu und ließen Madou und Fatu in eine Staubwolke gehüllt zurück.
Fatu betrachtete ihren Mann. Wieder einmal stellte sie fest, dass er ihr gefiel, trotz der wulstigen Narbe, die sich von der Mitte seiner Stirn bis unter das Jochbein zog - ein Arbeitsunfall, der ihn das linke Auge hätte kosten können, eine zufallende Motorhaube, ein Moment der Unaufmerksamkeit, noch einmal zumindest so gut ausgegangen, dass die Sehkraft erhalten blieb, wenngleich er das Auge nicht mehr ganz öffnen konnte. Sie mochte seinen muskulösen Körper, seine glänzende schwarze Haut, den warmen Geruch seiner Haare. Wenn er nur nicht so verschlossen wäre. Manchmal hatte sie das Gefühl, mit einem Fremden zusammen zu leben. Sie wusste, dass er schon einmal verheiratet gewesen und seine erste Frau gestorben war, aber er sprach nie darüber. Zaghafte Fragen ihrerseits wimmelte er unwirsch ab. Das ist Vergangenheit, sagte er.
„Wann musst du dort sein?“ Er setzte sich neben sie.
„Heute Abend.“
„Wirst du abgeholt?“
„Wir treffen uns alle bei Maimona, von dort holt uns ein Bus ab.“
Madou, der sich nicht für Fatus Freundinnen interessierte, kannte weder Maimona noch die anderen persönlich, nur aus Fatus Erzählungen, die ihm bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus gingen.
„Ah. Gut.“
Sie legte die Arme um ihn. „Du wirst mir fehlen....“
Geistesabwesend streichelte er ihren Rücken.
Zum wiederholten Mal fragte sie sich, welche Gefühle ihr dieser Mann entgegenbrachte. Er hat sie schließlich geheiratet, aber liebte er sie? Sie konnte die unsichtbare Mauer, die er um sich errichtet hatte, nicht durchdringen.
„Frag doch deine Mutter, ob sie zu dir zieht für die drei Wochen”, schlug sie noch einmal vor.
„Geh mir nicht auf die Nerven”, sagte er und stand auf. „Ich muss weg. Wahrscheinlich komme ich erst nachts nach Hause. Wir treffen uns in einer Woche auf dem Markt, dann kannst du mir das Geld geben. Wenn du schon früher bezahlt wirst, ruf mich an.“
Er hatte ihr für diesen Job ein altes Handy und eine Simkarte besorgt - beides wollte er danach wieder verkaufen.
Er streckte sich, ging zum Taxi, als dessen Besitzer er sich während der Fahrten fühlte, obwohl es ihm nicht gehörte. Es war alt und rostig, aber dank seiner Pflege zumindest sauber.
„Das Taxi ist ihm wichtiger als ich”, dachte Fatu traurig, als er wegfuhr.
Sie ging zurück in die Hütte, um ihre Sachen zu packen. Viel war es nicht, was sie aus der Metalltruhe im hinteren Zimmer nahm und auf ein ausgebreitetes Tuch legte: Drei T-Shirts, einige Tücher, die je nach Bedarf um die Hüften oder den Kopf gewickelt wurden, Unterwäsche, ein paar billige Armreifen, die wenigen Kosmetika, die sie besaß, ein Paar Sandalen mit Absätzen und - sie zögerte, war sich nicht sicher, ob sie ihren schönen türkisen Bubu aus Baumwolldamast, ihr einziges festliches Kleidungsstück, mitnehmen sollte, befürchtete, dass Madou damit nicht einverstanden wäre, möglicherweise würde er ihr vorwerfen, damit den weißen Männern gefallen zu wollen...... fast trotzig legte sie ihn dazu. Warum sollte sie sich nicht hübsch machen bei den Weißen? Und überhaupt - wer wusste denn schon, was Madou währenddessen trieb? Nicht einmal seine Mutter wollte er zu sich holen, obwohl die jeden Tag für ihn kochen würde.
Fatu wanderte mit ihrem Bündel zu der fast einen Kilometer weit entfernten Bushaltestelle, setzte sich dort in den Schatten des einzigen Baums weit und breit und wartete auf das Duruduruni.
2
Das dichte, fast waagrechte Schneetreiben vor dem Fenster sah aus, als hätte jemand den Himmel um neunzig Grad gedreht. Viel Schnee für Mitte November, dachte David und setzte die Kaffeetasse ab, um den Computer hochzufahren und seine Emails abzurufen.
Eine weitere Anmeldung für den Workshop in Mali, ein gewisser Werner Koczik. David erinnerte sich vage an den Mann: ein schon etwas älterer Typ, Pensionist vielleicht. Dieser Koczik wird in einem von Maithes Kursen sein, vermutete er und wählte ihre Nummer.
Er hatte Maithe vor sechs Jahren zufällig bei Dreharbeiten kennengelernt - ein gut bezahlter Statistenjob in einem Kriegsfilm, der es nie in die Programmkinos geschafft hatte. In einer der Drehpausen setzte sich eine junge Frau neben ihn, zog einige Blätter Papier aus ihrer Tasche und als er aus den Augenwinkeln einen Blick darauf warf, las er zu seiner Überraschung das Wort „Djansa“. Dann begann sie auch noch auf den Tisch zu trommeln, und ohne ein Wort klopfte er die passende Basslinie dazu. Jetzt war es an ihr, überrascht zu sein, aber sie hörte nicht auf und so ging es eine ganze Weile dahin, bis er das Duett mit dem branchenüblichen Signal beendete.
„Gestatten: David.“
„Sehr erfreut: Maithe.“
„Maithe?“
„Mein Vater ist Spanier, deshalb.“
In diesem Moment läutete die Glocke zum Antreten und sie mussten sich beeilen, um den Zeitplan der Filmschaffenden nicht zu gefährden.
Nach dem Ende der Dreharbeiten gingen sie gemeinsam auf ein Bier und stellten fest, dass sie eine Leidenschaft teilten: Die zur percussiven Musik der Maninka in Westafrika, und, dass sie einander mochten. Im Weiteren fanden sie heraus, dass sie auch musikalisch harmonierten und am Ende einer relativ kurzen Kennenlernphase fragte David Maithe, ob sie sich vorstellen könne, den einen oder anderen seiner Kurse zu substituieren. Sie war begeistert. Er stellte fest, dass sie nicht nur sehr musikalisch, sondern auch ein didaktisches Talent war. Bald übernahm sie die Anfängerkurse. David bezahlte sie pro Kurseinheit, konnte sich aber nicht dazu durchringen, sie als gleichwertige Partnerin an der Trommelschule zu beteiligen. Er pflegte seine Entscheidungen im Alleingang zu treffen und hatte keine Lust, sich mit jemandem abzusprechen. Er kannte sich gut genug um zu wissen, dass eine berufliche Partnerschaft, so viele Vorteile sie auch zu bieten gehabt hätte, auf Dauer mit ihm nicht funktionieren würde.
„Hallo?“
„Hi! Sag, ist ein Werner Kozcik in einem deiner Kurse?“
„Level 2. Du hast den, glaub ich, noch nicht gehabt. Letztes Semester war er bei mir im Anfängerkurs.“
„Wie ist der so?“
„Unauffällig. Sicher schon über 60, wahrscheinlich Pensionist. Tut sich ein bisschen schwer, aber übt offensichtlich ziemlich viel. Hat sich kürzlich eine Djembe gekauft.“
„Der hat sich gerade für Afrika angemeldet. Glaubst du, er passt dazu?“
„Ich denke schon. Er scheint ganz nett zu sein. Wieviele sind es denn jetzt?“
„Dreizehn.“
„Dann machst du´s also?“
„Ja. Ab zwölf Teilnehmern macht es Sinn für mich. Und du?“
„Was, ich?“
„Ja du! Kommst du mit?“
„David! Ich kann mir das nicht leisten!“
„Du müsstest nur den Flug zahlen. Ich könnte Unterstützung brauchen.“
Die erste organisierte Reise nach Bamako hatte er alleine durchgezogen, aber es war anstrengend gewesen. Er hätte diesmal gerne Maithe als Assistentin mitgenommen, um einige der täglich anfallenden Aufgaben delegieren zu können.
„Ich denk darüber nach.“
„Okay. Wann schätzt du, wirst du zu einem Ergebnis gekommen sein?“
„Wann musst du es wissen?
„In einer Woche.“
„Ich sag dir in einer Woche Bescheid.“
„Gut. Und Maithe: Er wird dir in den drei Wochen schon nicht untreu werden.“
„Sehr witzig. Diese Angst hab ich nicht! Aber ich hab wenig Lust, gerade jetzt weg zu fahren.“
„Wo bleibt dein musikalischer Ehrgeiz? Weiterbildung und so? Immerhin unterrichtest du im Djembestudio!“
„Ja, aber ich bin schwer verliebt! Kannst du das nicht nachvollziehen?“
Ehrlich gesagt: nein, dachte David.
„Ehrlich gesagt: nein”, sagte er.
„Da bist du eben anders als ich. Ich werde gründlich nachdenken und eine Entscheidung treffen. Okay?“
„Na dann bis heute Abend.“
Es stimmt, sinnierte David, ich bin anders. Anders als die meisten, die ich kenne. Für mich steht die Musik an erster Stelle. Ich kann mir keine Frau vorstellen, die mich von einer Afrikareise abhalten könnte.
Er wandte sich Werner Kozciks Anmeldung zu und schickte ihm eine Antwort mit allen relevanten Informationen über Mali, Impfempfehlungen, den Formularen für Visaansuchen, Tipps allgemeiner Natur bis hin zu verschiedenen Flugbuchungsmöglichkeiten.
Dann lehnte er sich zurück und überlegte die nächsten Schritte. Als erstes mussten die Afrikaner informiert werden. In zwei Monaten würde der Workshop starten und es mussten einige Vorbereitungen getroffen werden. Also Seydu anrufen.
„Hallo?“
„Seydu! Wie geht´s? Alles in Ordnung? Familie okay?“
„David! Ja, alles in Ordnung, und bei dir?“
„Bestens! Seydu, es gibt genügend Anmeldungen, wir machen den Workshop.“
„Gut.“
Falls Seydu zu Luftsprüngen neigte, waren sie weder zu sehen noch zu hören. Er nahm die Tatsache, dass sein minimales Budget ab Mitte Jänner enorm aufgebessert werden würde, mit demselben Gleichmut zur Kenntnis wie er eine Absage akzeptiert hätte.
„Du musst 20 Djemben vorbereiten.“
„Okay.“
„Und sag Bakary Bescheid.“
„Okay.“
Bakary, der Dundunspieler, mit dem Seydu fast alle Festaufträge bestritt, war ein lustiger, stets zu Scherzen aufgelegter Familienvater mit sechs Söhnen und einer kleinen zarten Frau, der man diesen Kinderreichtum niemals zugetraut hätte. Im Gegensatz zu Seydu, auf den man sich weitgehend, aber nicht immer verlassen konnte, war Bakary die Zuverlässigkeit in Person: pünktlich auf die Minute, umsichtig, immer da, wenn man ihn brauchte und überaus hilfsbereit. Musikalisch solide, aber nicht genial. Seydu hingegen....
Davids Gedanken schweiften Jahre zurück: Carrefour des Jeunes - eine Art Kulturzentrum in Bamako. Hier probten jeden Nachmittag lokale Gruppen, sogenannte „Ballets“. Bis in die 90-er Jahre hatte Mali eine gut organisierte Kulturpolitik. Im Zuge der Unabhängigkeit von den Kolonialländern waren in mehreren westafrikanischen Ländern Nationalballets entstanden, riesige Ensembles aus Musikern und Tänzerinnen, die opulente Bühnenstücke mit meist traditionell magischen Inhalten, rasanter Musik, feurigen Tänzen und Akrobatikeinlagen aufführten. Die Besten des Landes wurden geholt und in allen Städten und Dörfern wurde fleißig geprobt in der Hoffnung, Ensemblemitglied des Nationalballets zu werden, was nur wenigen vergönnt und überdies schlecht bezahlt, aber mit der Möglichkeit verbunden war, an Tourneen ins benachbarte Ausland und sogar nach Europa oder Amerika teilzunehmen.
In diesem Carrefour des Jeunes saß David Tag für Tag mit seinem damaligen Lehrer und ließ sich in der Kunst des Djembespiels unterweisen. Es war sein erster Afrikaaufenthalt und er war noch in den Anfängen, aber er lernte schnell. Nachmittags übte er auf derselben Parkbank, auf der er vormittags seinen Unterricht gehabt hatte. An Publikum fehlte es nicht. Stets war er umringt von Kindern mit von Rotz verschmierten Gesichtern, kichernden Frauen, die auf ihren Köpfen große Schüsseln balancierten, deren Inhalt von Bananen bis zu Zahnbürsten reichte, arbeitslosen Männern und Jugendlichen, die ihn um Zigaretten anschnorrten und Omas, die vor Erstaunen über den sich abmühenden Tubab, wie sie die Weißen nannten, in die Hände klatschten und zum Gaudium aller ein paar Tanzschritte vom Stapel ließen. Das brachte ihn jedes Mal in Verlegenheit, denn er wusste, wie ein Trommler für Tänzerinnen zu spielen hatte, war allerdings noch weit entfernt davon, das auch umsetzen zu können. Aber die Frauen erwarteten von einem Weißen natürlich nichts und hatten auch so ihren Spaß. Irgendwann gewöhnte sich David an diese Szenerie und konnte sie auch bis zu einem gewissen Grad genießen, zumal die Leute durchaus wohlwollend um ihn herumstanden.
Die ersten Male war die Situation für ihn allerdings so unangenehm gewesen, dass er zu den Umstehenden sagte: “Bitte lasst mich allein, ich muss mich konzentrieren und kann das nicht, wenn ihr alle zuseht.“ Noch heute erheitert ihn diese Erinnerung. Wahrscheinlich war er den Afrikanern vorgekommen wie jemand von einem anderen Stern. Allein sein zu wollen war für sie ein vollkommen absurdes Bedürfnis. Aber sie akzeptierten es und gingen. Fünf Minuten später waren jede Menge Andere da.
Am Nachmittag aller Nachmittage sehen wir David auf eben dieser Parkbank sitzen, neben ihm ein anderer Tubab, der ebenfalls eine Djembe zwischen den Beinen hält und nicht besonders erfolgreich versucht, einen durchgehenden Basisrhythmus zu halten, während David sich abmüht, seine vor einigen Stunden gelernten Solophrasen dazu zu spielen, was durch die Unfähigkeit des Basisspielers regelmäßig vereitelt wird. Die Rettung naht in Form eines vorbeiflanierenden Djembespielers, der die Situation sofort erfasst, den Basisspieler ersucht, ihm die Trommel zu überlassen, und mit David spielt - eine Erleichterung. Aber das Vergnügen ist von kurzer Dauer und das mühsame Spiel beginnt von vorne. Ein weiterer Djembespieler kommt vorbei, das gleiche Szenario läuft ab. Und dann - Vorhang auf! Tusch! - kommt ein dritter.
„Wie in den Märchen“, dachte David im Rückblick, „da sind es auch immer drei.“
Der dritte war ebenso jung und arm wie alle anderen vorher. Seine Hose sah aus, als wäre sie seine einzige, und allzu viele T-shirts zum Wechseln schien er auch nicht zu besitzen. Er sagte nicht viel, nahm sich die zweite Djembe und begann mit David zu spielen. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah, empfand plötzlich einen Sog, der ihn beflügelte, sodass er sofort nachspielen konnte, was ihm dieser Musiker vorspielte. Was vorher Arbeit gewesen war, wurde auf einmal ganz leicht. Ihm war, als hätte er sich in einen Energiestrom eingeklinkt, der eindeutig von diesem Trommler ausging. Der Aufenthalt im siebten Trommlerhimmel dauerte eine ganze Weile, bis der junge Djembespieler aufstand und nach einem kurzen Grußwort gehen wollte.
„Warte!“ Rief David, aus einer Art Trance erwachend, „wie heißt du?“
„Seydu.“
„Ich bin David. Ich will mit dir lernen.“
Damals wie heute ohne groß Emotionen zu zeigen, willigte Seydu ein. Sie vereinbarten einen Zeitpunkt am nächsten Tag und somit stand David vor der schwierigen Aufgabe, seinem Noch-Djembelehrer zu kündigen, was, von außen betrachtet, einfach war - er sagte es ihm mit ein paar beschönigenden Worten („Ich möchte auch mit anderen Lehrern arbeiten, andere Stile kennenlernen“, usw) und sein nunmehr bereits Ex-Lehrer nickte, Akzeptanz vorspielend - aber beide wussten, dass es sich um einen Gesichtsverlust handelte und dazu noch um eine finanzielle Einbuße, was dem Mann zusetzte, aber nie offen ausgesprochen wurde. Hinter vorgehaltener Hand wurde David zugetragen, wie gekränkt sein Ex-Lehrer sei und dass er beabsichtige, ihn aus seiner Hütte, die er für ihn organisiert hatte, zu werfen, wenn er nicht zu ihm zurückkäme. David stellte sich dumm und blieb bis zu seiner Abreise zwei Monate später in ebendieser Hütte.
Seydu war in jeder Hinsicht ein Gewinn. David war damals noch ziemlich unerfahren, aber er konnte einen guten Spieler von einem schlechten unterscheiden. Hier jedoch hatte er einen außergewöhnlichen Trommler vor sich, wie er nach ein paar Unterrichtsstunden feststellte. Er begleitete Seydu auf traditionelle Feste, für die er mit seiner Truppe engagiert war und wurde jedes Mal von einem beinahe heiligen Schauer ergriffen, wenn dieser zu spielen begann, denn plötzlich war eine unbeschreibliche Intensität auf dem Festplatz zu spüren, es war, als würden die einzelnen Individuen zu einem Körper werden und Zeit und Raum auf diesem staubigen Flecken im Universum zusammenfließen.
Im darauffolgenden Jahr holte er Seydu nach Europa, was sich in Hinblick auf die damit einhergehende Bürokratie als zeitraubendes, nervenaufreibendes und geldfressendes, aber am Ende sehr erfolgreiches Unternehmen herausstellte. Für die Konzerte, die sie spielten, wurde eine Tänzerin benötigt - die in Wien ansässigen Afrikanerinnen, die tanzten, erwiesen sich als kompliziert, hatten nie Zeit, dafür aber kleine Kinder, für die bei jedem Konzert ein Babysitter engagiert werden musste, kurz, es musste eine Professionelle her - und Seydu brachte Ma mit, die mit ihrem Feuer und ihrer Eleganz alles überbot, was David bis dahin zu Gesicht bekommen hatte.
Alle Schwierigkeiten, die eine Zusammenarbeit von Menschen aus völlig verschiedenen Kulturkreisen zwangsläufig in sich birgt, konnten sie kurz- oder mittelfristig aus dem Weg räumen, weil sie ein gemeinsames Ziel verband: eine mitreißende Show mit hochqualitativer Musik auf die Bühne zu stellen und - natürlich - damit Geld zu verdienen.
Mehrere Saisonen hindurch gab ihnen der Erfolg Recht. Dann kam es zu einem Einbruch. Die Engagements wurden rarer, die Gagen kleiner, das Interesse an dieser Art von Musik flaute ab und Seydu und Ma flogen mit deutlich weniger Geld zurück nach Bamako.
David war klar, dass es keinen Sinn mehr hatte, sie zu holen. So kam es zu einer Pause und man hörte ein paar Jahre nichts von einander.
Schließlich reifte in ihm die Idee, einen Workshop in Bamako zu organisieren. Er kontaktierte die beiden und es war, als hätten sie sich vor nicht mehr als zwei Wochen getrennt. Große Freude und noch größere Begeisterung, als er ihnen von seinen Plänen erzählte. Seydu und Ma machten sich auf die Suche nach einem Ort, der die Vorgaben Wohnen, Trommeln und Tanzen vereinen sollte und wurden fündig. Ein Hof außerhalb der Stadt mit zehn Zimmern, unbewohnt, aber eingerichtet, mit einer Küche und einem großen Raum für gemeinsame Mahlzeiten, rundherum praktisch nichts, mit dem Bus zu erreichen - ideal. Weniger ideal gestalteten sich die Verhandlungen mit dem Hausbesitzer Ousmane, der einen horrenden Mietpreis verlangte.
Die Erinnerung an diese zähen Gespräche holte David in die Gegenwart zurück: Ousmane anrufen! Er hatte mit ihm ausgemacht, sich zu melden, sobald feststand, dass der Workshop wieder stattfinden würde.
Ousmane meldete sich sofort und nach der traditionellen malischen Begrüßung - Wie geht es dir? Wie geht es der Familie? Alle gesund? Wie laufen die Geschäfte? - und der Mitteilung, dass man den Hof wieder mieten wolle, sagte Ousmane:
„Der Preis war zu niedrig, du musst mir mehr geben.“
„Das geht nicht, ich habe diesmal nicht so viele Leute.“
„Ich habe mehr ausgeben müssen als geplant, ihr habt viel Strom verbraucht. Benzin für den Generator ist teuer. Außerdem habe ich einen Interessenten, der den Hof mieten will”, erwiderte Ousmane.
„Aber wir haben uns doch schon geeinigt, Ousmane. Du kannst nicht jetzt plötzlich mehr verlangen. Das ist nicht seriös.“
Ousmane blieb stur. David seufzte. Jetzt ging das schon wieder los! Er war kein leidenschaftlicher Verhandler, aber nach vielen Jahren Westafrika wusste er, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb als zu sagen: „Gut, dann eben nicht. Ich bin nicht bereit, mehr zu zahlen. Es war schon das letzte Mal zuviel. Denk darüber nach, ich ruf in ein paar Tagen wieder an.“
Er war sich ziemlich sicher, dass Ousmane nachgeben würde. Der Hof war unbewohnt und fraß Geld. Ousmane hatte ihn gebaut in der Hoffnung, seine umfangreiche Familie dort unterzubringen, die aber das Leben in der Stadt trotz schlechter Luft, extremer Lärmbelastung und räumlicher Enge vorzog. Das Anwesen an Afrikaner zu vermieten, war ihm bisher nicht gelungen und der Interessent, den er erwähnt hatte, war vermutlich fiktiv.
Ich werde Ma auf ihn ansetzen, überlegte David, die soll mit ihm reden.
Ma….. er ließ ihr Bild vor seinem inneren Auge entstehen und ihm wurde warm ums Herz. Abgesehen von ihren tänzerischen waren es vor allem ihre menschlichen Qualitäten, die er schätzte. Sie war eine in keiner Weise berechnende Person, korrekt im Umgang mit Geld, überaus nett, sehr emotional, was besonders bei Abschieden regelmäßig zu Tränenausbrüchen führte, und in ihrem Beruf von wohltuender Professionalität. Als geborene Frontfrau vermochte sie das Publikum sofort in ihren Bann zu ziehen, im Gegensatz zu Seydu vergaß sie die Arrangements nur sehr selten, auch didaktisch hatte sie in den Jahren der gemeinsamen Arbeit einiges dazugelernt und ihre Tanzkurse wurden immer besser.
Das Telefongespräch mit Ma verlief herzlich, sie freute sich hörbar auf den Workshop und versprach, mit Ousmane zu reden und sich überdies um das Küchenpersonal und die Putzbrigade zu kümmern.
Mit Schaudern dachte David an den ersten Workshop zurück, als er vier Tage vor Beginn nach Bamako flog, um die letzten Reinigungsarbeiten im Hof zu kontrollieren, Lebensmittel und Getränke einzukaufen, die Trommeln zu organisieren, kurz, alles so vorzubereiten, dass sich eine Horde Europäer, von denen die meisten noch nie in diesem Teil der Erde gewesen waren, wohlfühlen konnte. Natürlich hatte er die Teilnehmer gewarnt:
„Wenn ich sage, der Hof, in dem ihr wohnen werdet, hat fast europäischen Standard, dann meine ich: Für afrikanische Verhältnisse, liebe Leute. Also erwartet euch bitte nicht zu viel. Mali ist ein sehr armes Land, und so gut, wie es uns gehen wird, geht es dort nur Wenigen.“
Aber gewisse hygienische Grundvoraussetzungen mussten einfach gegeben sein, und als er zum ersten Mal durch die Zimmer ging, war ihm sofort klar: Das war ganz und gar nicht der Fall. Er fand ein derartiges Chaos vor, dass er richtig nach Luft schnappen musste, bevor er sich imstande fühlte, die anstehenden Maßnahmen zu ergreifen, die darin bestanden, jede Minute der folgenden Tage wie ein Baustellenpolier die Reinigungsarbeiten zu überwachen. Hätte er zur Hysterie geneigt, wäre diese Situation der ideale Nährboden dafür gewesen. Jetzt hatte er Stress und den gab er weiter, indem er ein bisschen herumschrie und sich wie der Patron aufführte, der zu sein von ihm erwartet wurde. Das wirkte, und kurz bevor die Teilnehmer müde vom Flug aus dem Bus stiegen, um ihre Unterkünfte zu beziehen, war alles annähernd so, wie David es sich vorgestellt hatte.
Auch diesmal würde er einige Tage früher fliegen, aber es würde einfacher werden, da seine afrikanischen Mitarbeiter nun schon wissen sollten, was zu tun war. Das hoffte er zumindest.
3
Und es entstieg als erste dem Flugzeug: Vera. Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, das die Aufschrift trug: Trommeln ist geil. Diesen Eindruck versuchte auch der Rest von Vera zu erwecken - hautenge schwarze Jeans, dazu passend tiefschwarze lange Haare, die von jahrelangen Farbbehandlungen malträtiert vom Kopf abstanden oder strähnig bis auf die Schultern hinunter hingen. Ebenfalls schwarze High-Heel-Stiefletten rundeten das Gesamtbild ab. Ihr kräftig bemaltes Gesicht war nicht mehr ganz jung - sie war sicher schon über 40 - aber apart. Veras Lebensmotto: Hauptsache, es ist was los und ein paar nette Jungs sind in Sichtweite. Alles in allem eine Person, von der man nach dem ersten Eindruck annahm, dass mit ihr gut Kirschen - bzw. in den kommenden drei Wochen eher Mangos - essen ist.
Vor einem Jahr war sie von einer Freundin zu einem Steinbruchfest mitgenommen worden. Während dieses Fests waren pausenlos Trommeln zu hören gewesen. Einige Leute hatten Instrumente mit und es entstand etwas abseits ein sich stets vergrößernder Kreis von Trommelnden, die einen ununterbrochenen Strom von Musik produzierten, der nach und nach die restlichen Festgäste anzog. Das Fest verlagerte seinen Mittelpunkt und es wurde die ganze Nacht getanzt. Für Vera war es das erste Erlebnis dieser Art und prägend.
Am nächsten Tag schon saß sie am Computer und googelte „trommeln“, kam auf die Djembestudio-Site und buchte nach einem kurzen und netten Telefongespräch mit dem Leiter der Percussionschule einen Trommelkurs, der tatsächlich - und das interpretierte sie als untrügliches Zeichen dafür, die richtige Entscheidung getroffen zu haben - noch in derselben Woche beginnen würde.
David, der Kursleiter, entpuppte sich als die Personifizierung des netten Telefongesprächs, und von da an pilgerte Vera jeden Dienstag zu ihrem Trommelkurs, genoss die eineinhalb Stunden, die für sie aufgrund ihres ausgeprägten Rhythmusgefühls nicht mit übermäßiger Konzentration belastet, sondern reines Vergnügen waren. Als die Reise nach Bamako ausgeschrieben wurde, entschloss sie sich sehr schnell, daran teilzunehmen. Ihr Chef genehmigte den Urlaub und so fand sie sich mit den restlichen Teilnehmern an einem kalten Jännermorgen erwartungsvoll am Flughafen ein.
Der Zufall wollte es, dass sie den achtstündigen Flug neben Markus absolvierte, was ihr ganz recht war. Ihr gefiel der Mann, der, abgesehen von seinem attraktiven Beruf - er war Arzt - auch noch gut aussah und nett war. Diese Nettigkeit bedenkenlos überstrapazierend, bombardierte sie ihn, kaum dass sie neben ihm saß, mit Fragen: Wann er denn zu trommeln begonnen hätte? Vor einigen Jahren mit Unterbrechungen. Ob er schon in Afrika gewesen sei? Ja, mit Ärzte ohne Grenzen in Mocambique. Ob er verheiratet sei? Nein, bis jetzt hätte sich das mit seinem Beruf und seinen vielen Reisen nicht vereinbaren lassen. Ob er auf seinen Reisen schon mal krank geworden sei? Öfter. Wie viele Rhythmen er spielen könne? Er habe noch nicht nachgezählt. Er trommle zur Entspannung und habe keinen Ehrgeiz. Wie die Afrikaner so seien? Und so weiter. Markus wurde bald von Müdigkeit überwältigt und nickte ein.
Ein wenig enttäuscht, weil das Gespräch zu Ende war, bevor es sich in Richtung Flirt hatte entwickeln können - andererseits war ja noch nicht aller Tage Abend, schließlich hatte man noch drei Wochen gemeinsamen Aufenthalts vor sich - wandte sie sich ihrer rechten Sitznachbarin zu, einer kleinen, drahtigen Frau mit sehr kurzen blonden Haaren, einem scharf geschnittenen Gesicht und einem noch schärferen Verstand - was Vera hätte bemerken können, wenn das eine Kategorie gewesen wäre, die in ihrer Wahrnehmung eine Rolle gespielt hätte. Für Vera war Pia - so hieß die Frau - einfach eine weitere Möglichkeit, die Langeweile, die sich bei diesen Flügen unweigerlich für sie einstellte, ein wenig zu zerstreuen.
„Wie lange trommelst du schon?“ Eröffnete sie das Gespräch.
„Drei Jahre”, kam die dreisilbige Antwort, unter anderem deshalb, weil Pia in ein Buch vertieft war, was von Vera beinhart ignoriert oder - wahrscheinlicher - nicht einmal registriert worden war.
„Drei Jahre! Da kannst du sicher schon viel, oder? Warst du schon einmal in Afrika?“
„Wie man´s nimmt und nein.“
Veras leicht verwirrtem Gesichtsausdruck war zu entnehmen, dass sie von dieser knappen Aussage einigermaßen überfordert war, was Pia ebenso belustigte wie nervte. So hatte sie diese Frau schon am Gate eingeschätzt und gleich beschlossen, sie nicht unter die näheren Reisebekanntschaften einreihen zu wollen, bis sie dann resignierend feststellen musste, dass ausgerechnet diese etwas nuttig aussehende Person den Platz neben ihr besetzte. Wie zu erwarten und zu Pias Erleichterung hatte Vera sich aber sofort mit dem männlichen Sitznachbarn beschäftigt, der nun leider eingeschlafen war. Deshalb war sie jetzt dran und beschloss, es hinter sich zu bringen.
„Wie man´s nimmt bezieht sich auf deine Frage nach meinem Können: Was verstehst du unter „viel“? Gemessen woran? Und nein heißt: Nein, ich war noch nicht in Afrika.“
Sollte Vera irritiert gewesen sein angesichts dieser nicht besonders gutmütigen Antwort, so ließ sie es sich nicht anmerken.
„Naja”, sagte sie, „mehr als ich wirst du schon können. Ich trommle ja erst seit einem Jahr.“
„Also gemessen an dir. Ja, das ist anzunehmen.“
„Wenn alle anderen auch schon so viel getrommelt haben wie du, dann werde ich ja gar nicht mitkommen!“
„Da würd ich mir keine Sorgen machen. David regelt das sicher, wahrscheinlich macht er zwei Gruppen.“
„Kennst du den afrikanischen Trommellehrer?“
„Seydu? Ja, bei dem hab ich schon einen Workshop gemacht.“
„Und? Wie ist der so?“
„Damals war er sehr nett. Fachlich kompetent und ein guter Lehrer. Sehr aufbauend und tolerant.“
„Kann der überhaupt deutsch?“
„Kaum. Muss er aber nicht können. Er spielt vor und du spielst nach. Wenn es Verständigungsschwierigkeiten gibt, hilft David.“
„Kannst du französisch?“
„Geht so - ich kann mich verständigen.“
„Was glaubst du, wie die Zimmer dort sind? Angeblich europäischer Standard.“
„Woher soll ich das wissen? Ich war ja noch nicht dort.“
Du quasselst, um die Zeit totzuschlagen, dachte Pia und versuchte, indem sie sich wieder ihrer Lektüre zuwandte, durch unmissverständliche Körpersprache zu verdeutlichen, dass sie an einer Weiterführung der Fragestunde nicht interessiert war. An Vera indes war dieser Wink mit dem Zaunpfahl vergeudet. An ihre Adresse musste schon ein klares und kräftiges „Aus!“ und „Sitz!“ gesendet werden - soweit war Pia noch nicht. Nicht gleich am Anfang das ganze Pulver verschießen. Obwohl....vielleicht wäre das doch die bessere Strategie, damit die Positionen sofort klar sind. Aber da ließ Vera schon die nächste Frage vom Stapel:
„Und du bist allein unterwegs?“
„Nein.“
Vera schaute zu der Frau, die schlafend neben Pia saß, den Kopf an deren Schulter gelehnt.





























