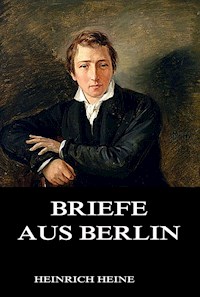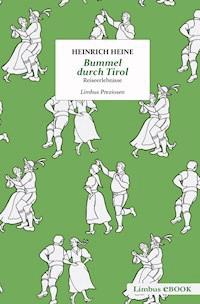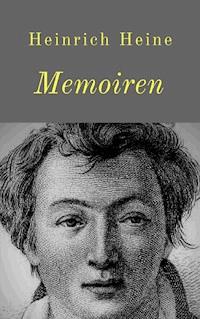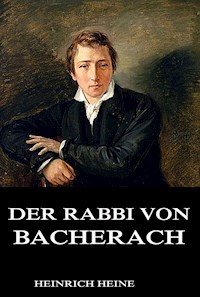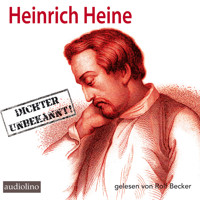0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ich rate Euch, Gevatter, lasst mich auf Eu’r Schild keinen goldenen Engel, sondern einen roten Löwen malen; ich bin mal dran gewöhnt, und Ihr werdet sehen, wenn ich Euch auch einen goldenen Engel male, so wird er doch wie ein roter Löwe aussehn.“
Diese Worte eines ehrsamen Kunstgenossen soll gegenwärtiges Buch an der Stirne tragen, da sie jedem Vorwurf, der sich dagegen auffinden ließe, im Voraus und ganz eingeständig begegnen. Damit alles gesagt sei, erwähne ich zugleich, dass dieses Buch, mit geringen Ausnahmen, im Sommer und Herbst 1831 geschrieben worden, zu einer Zeit, wo ich mich meistens mit den Kartons zu künftigen roten Löwen beschäftigte. Um mich her war damals viel Gebrülle und Störnis jeder Art ...
Coverbild: YanzStudio / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch + Vorrede
Zum Buch:
Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski
Heinrich Heine
Coverbild: YanzStudio / Shutterstock.com
Vorrede
„Ich rate Euch, Gevatter, lasst mich auf Eu’r Schild keinen goldenen Engel, sondern einen roten Löwen malen; ich bin mal dran gewöhnt, und Ihr werdet sehen, wenn ich Euch auch einen goldenen Engel male, so wird er doch wie ein roter Löwe aussehn.“
Diese Worte eines ehrsamen Kunstgenossen soll gegenwärtiges Buch an der Stirne tragen, da sie jedem Vorwurf, der sich dagegen auffinden ließe, im Voraus und ganz eingeständig begegnen. Damit alles gesagt sei, erwähne ich zugleich, dass dieses Buch, mit geringen Ausnahmen, im Sommer und Herbst 1831 geschrieben worden, zu einer Zeit, wo ich mich meistens mit den Kartons zu künftigen roten Löwen beschäftigte. Um mich her war damals viel Gebrülle und Störnis jeder Art.
Bin ich nicht heute sehr bescheiden?
Ihr könnt Euch darauf verlassen, die Bescheidenheit der Leute hat immer ihre guten Gründe. Der liebe Gott hat gewöhnlich die Ausübung der Bescheidenheit und ähnlicher Tugenden den Seinen sehr erleichtert. Es ist z.B. leicht, dass man seinen Feinden verzeiht, wenn man zufällig nicht so viel Geist besitzt, um ihnen schaden zu können, so wie es auch leicht ist, keine Weiber zu verführen, wenn man mit einer allzu schäbigen Nase gesegnet ist.
Die Scheinheiligen von allen Farben werden über manches Gedicht in diesem Buche wieder sehr tief seufzen – aber es kann ihnen nichts mehr helfen. Ein zweites „nachwachsendes Geschlecht“ hat eingesehen, dass all mein Wort und Lied aus einer großen, gottfreudigen Frühlingsidee emporblühte, die wo nicht besser, doch wenigstens ebenso respektabel ist, wie jene triste, modrige Aschermittwochsidee, die unser schönes Europa trübselig entblumt und mit Gespenstern und Tartüffen bevölkert hat. Wogegen ich einst mit leichten Waffen frondierte, wird jetzt ein offener ernster Krieg geführt – ich stehe sogar nicht mehr in den ersten Reihen.
Gottlob! Die Revolution des Julius hat die Zungen gelöst, die so lange stumm geschienen; ja, da die plötzlich Erweckten alles, was sie bis dahin verschwiegen, auf einmal offenbaren wollten, so entstand viel Geschrei, welches mir mitunter gar unerfreulich die Ohren betäubte. Ich hatte manchmal nicht übel Lust, das ganze Sprechamt aufzugeben; doch das ist nicht so leicht tunlich wie etwa das Aufgeben einer geheimen Staatsratstelle, obgleich Letztere mehr einbringt als das beste öffentliche Tribunat. Die Leute glauben, unser Tun und Schaffen sei eitel Wahl; aus dem Vorrat der neuen Ideen griffen wir eine heraus, für die wir sprechen und wirken, streiten und leiden wollten, wie etwa sonst ein Philolog sich seinen Klassiker auswählte, mit dessen Kommentierung er sich sein ganzes Leben hindurch beschäftigte – nein, wir ergreifen keine Idee, sondern die Idee ergreift uns und knechtet uns und peitscht uns in die Arena hinein, dass wir, wie gezwungene Gladiatoren, für sie kämpfen. So ist es mit jedem echten Tribunat oder Apostolat. Es war ein wehmütiges Geständnis, wenn Amos sprach zu König Amazia: „Ich bin kein Prophet, noch keines Propheten Sohn, sondern ich bin ein Kuhhirt, der Maulbeeren ablieset; aber der Herr nahm mich von der Schafherde und sprach zu mir, gehe hin und weissage.“ Es war ein wehmütiges Geständnis, wenn der arme Mönch, der, vor Kaiser und Reich, zu Worms, angeklagt stand, ob seiner Lehre, dennoch trotz aller Demut seines Herzens jeden Widerruf für unmöglich erklärte und mit den Worten schloss: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen!“
Wenn Ihr diese heilige Zwingnis kenntet, Ihr würdet uns nicht mehr schelten, nicht mehr schmähen, nicht mehr verleumden – wahrlich, wir sind nicht die Herren, sondern die Diener des Wortes. Es war ein wehmütiges Geständnis, wenn Maximilian Robespierre sprach: „Ich bin ein Sklave der Freiheit.“
Und auch ich will jetzt Geständnisse machen. Es war nicht eitel Lust meines Herzens, dass ich alles verließ, was mir Teures im Vaterland blühte und lächelte – mancher liebte mich dort, z.B. meine Mutter – aber ich ging, ohne zu wissen warum; ich ging, weil ich musste. Nachher ward mir sehr müde zumute; so lange vor den Juliustagen hatte ich das Prophetenamt getrieben, dass das innere Feuer mich schier verzehrt, dass mein Herz von den gewaltigen Worten, die daraus hervorgebrochen, so matt geworden wie der Leib einer Gebärerin –
Ich dachte – habt meiner nicht mehr nötig, will auch einmal für mich selber leben, und schöne Gedichte schreiben, Komödien und Novellen, zärtliche und heitere Gedankenspiele, die sich in meinem Hirnkasten angesammelt, und will mich wieder ruhig zurückschleichen in das Land der Poesie, wo ich als Knabe so glücklich gelebt.
Und keinen Ort hätte ich wählen können, wo ich besser imstande war, diesen Vorsatz in Ausführung zu bringen. Es war auf einer kleinen Villa dicht am Meer, nahe bei Havre de Grace, in der Normandie. Wunderbar schöne Aussicht auf die große Nordsee; ein ewig wechselnder und doch einfacher Anblick; heute grimmer Sturm, morgen schmeichelnde Stille; und drüberhin die weißen Wolkenzüge, riesenhaft und abenteuerlich, als wären es die spukenden Schatten jener Normannen' die einst auf diesen Gewässern ihr wildes Wesen getrieben. Unter meinem Fenster aber blühten die lieblichsten Blumen und Pflanzen: Rosen, die liebesüchtig mich anblickten, rote Nelken mit verschämt bittenden Düften, und Lorbeeren, die an die Mauer zu mir heraufrankten, fast bis in mein Zimmer hereinwuchsen, wie jener Ruhm, der mich verfolgt. Ja, einst lief ich schmachtend hinter Daphne einher, jetzt läuft Daphne nach mir, wie eine Metze, und drängt sich in mein Schlafgemach. Was ich einst begehrte, ist mir jetzt unbequem, ich möchte Ruhe haben und wünschte, dass kein Mensch von mir spräche, wenigstens in Deutschland. Und stille Lieder wollte ich dichten, und nur für mich, oder allenfalls um sie irgendeiner verborgenen Nachtigall vorzulesen. Es ging auch im Anfang, mein Gemüt ward wieder umfriedet von dem Geiste der Dichtkunst, wohlbekannte edle Gestalten und goldne Bilder dämmerten wieder empor in meinem Gedächtnisse, ich ward wieder so traumselig, so märchentrunken, so verzaubert wie ehemals, und ich brauchte nur mit ruhiger Feder alles aufzuschreiben, was ich eben fühlte und dachte – ich begann.
Nun aber weiß jeder, dass man bei solcher Stimmung nicht immer ruhig im Zimmer sitzen bleibt und manchmal mit begeistertem Herzen und glühenden Wangen ins freie Feld läuft, ohne auf Weg und Steg zu achten. So erging’s auch mir, und ohne zu wissen wie, befand ich mich plötzlich auf der Landstraße von Havre, und vor mir her zogen, hoch und langsam, mehre große Bauerwagen, bepackt mit allerlei ärmlichen Kisten und Kasten, altfränkischem Hausgeräte, Weibern und Kindern. Nebenher gingen die Männer, und nicht gering war meine Überraschung, als ich sie sprechen hörte – sie sprachen deutsch, in schwäbischer Mundart. Leicht begriff ich, dass diese Leute Auswanderer waren, und als ich sie näher betrachtete, durchzuckte mich ein jähes Gefühl, wie ich es noch nie in meinem Leben empfunden, alles Blut stieg mir plötzlich in die Herzkammern und klopfte gegen die Rippen, als müsse es heraus aus der Brust, als müsse es so schnell wie möglich heraus, und der Atem stockte mir in der Kehle. Ja, es war das Vaterland selbst, das mir begegnete, auf jenen Wagen saß das blonde Deutschland, mit seinen ernstblauen Augen, seinen traulichen, allzu bedächtigen Gesichtern, in den Mundwinkeln noch jene kümmerliche Beschränktheit, über die ich mich einst so sehr gelangweilt und geärgert, die mich aber jetzt gar wehmütig rührte – denn hatte ich einst, in der blühenden Lust der Jugend, gar oft die heimatlichen Verkehrtheiten und Philistereien verdrießlich durchgehechelt, hatte ich einst mit dem glücklichen, bürgermeisterlich gehäbigen, schneckenhaft trägen Vaterlande manchmal einen kleinen Haushader zu bestehen, wie er in großen Familienwohl vorfallen kann: so war doch all dergleichen Erinnerung in meiner Seele erloschen, als ich das Vaterland im Elend erblickte, in der Fremde, im Elend; selbst seine Gebrechen wurden mir plötzlich teuer und wert, selbst mit seinen Krähwinkeleien war ich ausgesöhnt, und ich drückte ihm die Hand, ich drückte die Hand jener deutschen Auswanderer, als gäbe ich dem Vaterland selber den Handschlag eines erneuten Bündnisses der Liebe, und wir sprachen deutsch. Die Menschen waren ebenfalls sehr froh, auf einer fremden Landstraße diese Laute zu vernehmen; die besorglichen Schatten schwanden von ihren Gesichtern, und sie lächelten beinahe. Auch die Frauen, worunter manche recht hübsch, riefen mir ihr gemütliches „Griesch di Gott!“ vom Wagen herab, und die jungen Bübli grüßten errötend höflich, und die ganz kleinen Kinder jauchzten mich an, mit ihren zahnlosen lieben Mündchen. „Und warum habt Ihr denn Deutschland verlassen?“, fragte ich diese armen Leute. „Das Land ist gut, und wären gern dageblieben“, antworteten sie, „aber wir konnten’s nicht länger aushalten –“
Nein, ich gehöre nicht zu den Demagogen, die nur die Leidenschaften aufregen wollen, und ich will nicht alles wiedererzählen, was ich auf jener Landstraße, bei Havre, unter freiem Himmel, gehört habe über den Unfug der hochnobelen und allerhöchst nobelen Sippschaften in der Heimat – auch lag die größere Klage nicht im Wort selbst, sondern im Ton, womit es schlicht und grad gesprochen oder vielmehr geseufzt wurde. Auch jene armen Leute waren keine Demagogen; die Schlussrede ihrer Klage war immer: „Was sollten wir tun? Sollten wir eine Revolution anfangen?“
Ich schwöre es bei allen Göttern des Himmels und der Erde, der zehnte Teil von dem, was jene Leute in Deutschland erduldet haben, hätte in Frankreich sechsunddreißig Revolutionen hervorgebracht und sechsunddreißig Königen die Krone mitsamt dem Kopf gekostet.
„Und wir hätten es doch noch ausgehalten und wären nicht fortgegangen“, bemerkte ein achtzigjähriger, also doppeltvernünftiger Schwabe, „aber wir taten es wegen der Kinder. Die sind noch nicht so stark wie wir an Deutschland gewöhnt, und können vielleicht in der Fremde glücklich werden; freilich, in Afrika werden sie auch manches ausstehen müssen.“
Diese Leute gingen nämlich nach Algier, wo man ihnen, unter günstigen Bedingungen, eine Strecke Landes zur Kolonisierung versprochen hatte. „Das Land soll gut sein“, sagten sie, „aber wie wir hören, gibt es dort viel giftige Schlangen, die sehr gefährlich, und man hat dort viel auszustehen von den Affen, die die Früchte vom Felde naschen oder gar die Kinder stehlen und mit sich in die Wälder schleppen. Das ist grausam. Aber zu Hause ist der Amtmann auch giftig, wenn man die Steuer nicht bezahlt, und das Feld wird einem von Wildschaden und Jagd noch weit mehr ruiniert, und unsere Kinder wurden unter die Soldaten gesteckt – was sollten wir tun? Sollten wir eine Revolution anfangen?“