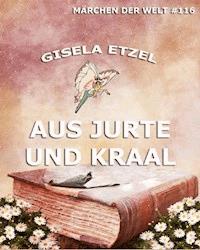
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung beinhaltet viele volkstümliche Erzählungen aus Asien und Afrika, zusammen getragen von Gisela Etzel. Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Inhalt: Aus Asien König Fuchs Noah und der Teufel Der Graubart Eine Türe im Verhör Der Betrüger und der Helfershelfer Der Vielfraß Die zwei Teufel Der übertragbare Tiger Der schlaue Betrüger Die beiden Frösche Der dumme Tempo Der Spiegel Das Kamel und die Ratte Wie Lull Luftschlösser baute Die Abenteuer des Guru Gimpel Erste Geschichte Zweite Geschichte Dritte Geschichte Vierte Geschichte Fünfte Geschichte Sechste Geschichte Siebente Geschichte Achte Geschichte Aus Afrika Der Nachträuber und der Tagräuber Dschuhas Schatz Die Geschichte vom Wolf, dem Igel und dem Herrn des Gartens Eine Lügengeschichte Der Löwe, die Hyäne und der Fuchs Alibeg Kaschkaschi Der Betrüger Der Elefant und der Hahn Der Schakal und der Leopard Das listige Mädchen Hasenlist Der Leopard und der Widder Der Ursprung des Todes Der kranke Löwe Der Fischdiebstahl Der bemooste Zauberstein Herr Tragmichnicht und Herr Sagmirnicht Wie Kotofetsy und Mahaka einen reichen Mann betrogen Kotofetsy und Mahaka und die Frau des Andriambahoaka Der Hase und der Couroupas Der Affe und die Schildkröte Der Elefant und der Hase Der Hase und die Schildkröte Der Affe und die Schwalbe Der Hase und der König Elefant Vom Hasen. Elefanten und Walfisch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Jurte und Kraal
Gisela Etzel
Inhalt:
Geschichte des Märchens
Aus Jurte und Kraal
Vorwort
Aus Asien
König Fuchs
Noah und der Teufel
Der Graubart
Eine Türe im Verhör
Der Betrüger und der Helfershelfer
Der Vielfraß
Die zwei Teufel
Der übertragbare Tiger
Der schlaue Betrüger
Die beiden Frösche
Der dumme Tempo
Der Spiegel
Das Kamel und die Ratte
Wie Lull Luftschlösser baute
Die Abenteuer des Guru Gimpel
Erste Geschichte
Zweite Geschichte
Dritte Geschichte
Vierte Geschichte
Fünfte Geschichte
Sechste Geschichte
Siebente Geschichte
Achte Geschichte
Aus Afrika
Der Nachträuber und der Tagräuber
Dschuhas Schatz
Die Geschichte vom Wolf, dem Igel und dem Herrn des Gartens
Eine Lügengeschichte
Der Löwe, die Hyäne und der Fuchs
Alibeg Kaschkaschi
Der Betrüger
Der Elefant und der Hahn
Der Schakal und der Leopard
Das listige Mädchen
Hasenlist
Der Leopard und der Widder
Der Ursprung des Todes
Der kranke Löwe
Der Fischdiebstahl
Der bemooste Zauberstein
Herr Tragmichnicht und Herr Sagmirnicht
Wie Kotofetsy und Mahaka einen reichen Mann betrogen
Kotofetsy und Mahaka und die Frau des Andriambahoaka
Der Hase und der Couroupas
Der Affe und die Schildkröte
Der Elefant und der Hase
Der Hase und die Schildkröte
Der Affe und die Schwalbe
Der Hase und der König Elefant
Vom Hasen. Elefanten und Walfisch
Aus Jurte und Kraal, Gisela Etzel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849603496
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Sweet Angel - Fotolia.com
Geschichte des Märchens
Ein Märchenist diejenige Art der erzählenden Dichtung, in der sich die Überlebnisse des mythologischen Denkens in einer der Bewußtseinsstufe des Kindes angepaßten Form erhalten haben. Wenn die primitiven Vorstellungen des Dämonenglaubens und des Naturmythus einer gereiftern Anschauung haben weichen müssen, kann sich doch das menschliche Gemüt noch nicht ganz von ihnen trennen; der alte Glaube ist erloschen, aber er übt doch noch eine starke ästhetische Gefühlswirkung aus. Sie wird ausgekostet von dem erwachsenen Erzähler, der sich mit Bewußtsein in das Dunkel phantastischer Vorstellungen zurückversetzt und sich, vielfach anknüpfend an altüberlieferte Mythen, an launenhafter Übertreibung des Wunderbaren ergötzt. So ist das Volksmärchen (und dieses ist das echte und eigentliche M.) das Produkt einer bestimmten Bewußtseinsstufe, das sich anlehnt an den Mythus und von Erwachsenen für das Kindergemüt mit übertreibender Betonung des Wunderbaren gepflegt und fortgebildet wird. Es ist dabei, wie in seinem Ursprung, so in seiner Weiterbildung durchaus ein Erzeugnis des Gesamtbewußtseins und ist nicht auf einzelne Schöpfer zurückzuführen: das M. gehört dem großen Kreis einer Volksgemeinschaft an, pflanzt sich von Mund zu Munde fort, wandert auch von Volk zu Volk und erfährt dabei mannigfache Veränderungen; aber es entspringt niemals der individuellen Erfindungskraft eines Einzelnen. Dies ist dagegen der Fall bei dem Kunstmärchen, das sich aber auch zumeist eben wegen dieses Ursprungs sowohl in den konkreten Zügen der Darstellung als auch durch allerlei abstrakte Nebengedanken nicht vorteilhaft von dem Volksmärchen unterscheidet. Das Wort M. stammt von dem altdeutschen maere, das zuerst die gewöhnlichste Benennung für erzählende Poesien überhaupt war, während der Begriff unsers Märchens im Mittelalter gewöhnlich mit dem Ausdruck spel bezeichnet wurde. Als die Heimat der M. kann man den Orient ansehen; Volkscharakter und Lebensweise der Völker im Osten bringen es mit sich, daß das M. bei ihnen noch heute besonders gepflegt wird. Irrtümlich hat man lange gemeint, ins Abendland sei das M. erst durch die Kreuzzüge gelangt; vielmehr treffen wir Spuren von ihm im Okzident in weit früherer Zeit. Das klassische Altertum besaß, was sich bei dem mythologischen Ursprung des Märchens von selbst versteht, Anklänge an das M. in Hülle und Fülle, aber noch nicht das M. selbst als Kunstgattung. Dagegen taucht in der Zeit des Neuplatonismus, der als ein Übergang des antiken Bewußtseins zur Romantik bezeichnet werden kann, eine Dichtung des Altertums auf, die technisch ein M. genannt werden kann, die reizvolle Episode von »Amor und Psyche« in Apulejus' »Goldenem Esel«. Gleicherweise hat sich auch an die deutsche Heldensage frühzeitig das M. angeschlossen. Gesammelt begegnen uns M. am frühesten in den »Tredeci piacevoli notti« des Straparola (Vened. 1550), im »Pentamerone« des Giambattista Basile (gest. um 1637 in Neapel), in den »Gesta Romanorum« (Mitte des 14. Jahrh.) etc. In Frankreich beginnen die eigentlichen Märchensammlungen erst zu Ende des 17. Jahrh.; Perrault eröffnete sie mit den als echte Volksmärchen zu betrachtenden »Contes de ma mère l'Oye«; 1704 folgte Gallands gute Übersetzung von »Tausendundeiner Nacht«, jener berühmten, in der Mitte des 16. Jahrh. im Orient zusammengestellten Sammlung arabischer M. Besondern Märchenreichtum haben England, Schottland und Irland aufzuweisen, vorzüglich die dortigen Nachkommen der keltischen Urbewohner. Die M. der skandinavischen Reiche zeigen nahe Verwandtschaft mit den deutschen. Reiche Fülle von M. findet sich bei den Slawen. In Deutschland treten Sammlungen von M. seit der Mitte des 18. Jahrh. auf. Die »Volksmärchen« von Musäus (1782) und Benedikte Naubert sind allerdings nur novellistisch und romantisch verarbeitete Volkssagen. Die erste wahrhaft bedeutende, in Darstellung und Fassung vollkommen echte Sammlung deutscher M. sind die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm (zuerst 1812–13, 2 Bde.; ein 3. Band, 1822, enthält literarische Nachweise bezüglich der M.). Unter den sonstigen deutschen Sammlungen steht der Grimmschen am nächsten die von L. Bechstein (zuerst 1845); außerdem sind als die bessern zu nennen: die von E. M. Arndt (1818), Löhr (1818), J. W. Wolf (1845 u. 1851), Zingerle (1852–54), E. Meier (1852), H. Pröhle (1853) u. a. Mit M. des Auslandes machten uns durch Übertragungen bekannt: die Brüder Grimm (Irland, 1826), Graf Mailath (Ungarn, 1825), Vogl (Slawonien, 1837), Schott (Walachei, 1845), Asbjörnson (Norwegen), Bade (Bretagne, 1847), Iken (Persien, 1847), Gaal (Ungarn, 1858), Schleicher (Litauen, 1857), Waldau (Böhmen, 1860), Hahn (Griechenland u. Albanien, 1863), Schneller (Welschtirol, 1867), Kreutzwald (Esthland, 1869), Wenzig (Westslawen, 1869), Knortz (Indianermärchen, 1870, 1879, 1887), Gonzenbach (Sizilien, 1870), Österley (Orient, 1873), Carmen Sylva (Rumänien, 1882), Leskien und Brugman (Litauen, 1882), Goldschmidt (Rußland, 1882), Veckenstedt (Litauen, 1883), Krauß (Südslawen, 1883–84), Brauns (Japan, 1884), Poestion (Island, 1884; Lappland, 1885), Schreck (Finnland, 1887), Chalatanz (Armenien, 1887), Jannsen (Esthen, 1888), Mitsotakis (Griechenland, 1889), Kallas (Esthen, 1900) u. a. Unter den Kunstpoeten haben sich im M. mit dem meisten Glück versucht: Goethe, L. Tieck, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Fouqué, Kl. Brentano, der Däne Andersen, R. Leander (Volkmann) u. a. Vgl. Maaß, Das deutsche M. (Hamb. 1887); Pauls »Grundriß der germanischen Philologie«, 2. Bd., 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901); Benfey, Kleinere Schriften zu Märchenforschung (Berl. 1890); Reinh. Köhler, Aufsätze über M. und Volkslieder (das. 1894) und Kleine Schriften, Bd. 1: Zur Märchenforschung (hrsg. von Bolte, das. 1898); R. Petsch, Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen (das. 1900).
Aus Jurte und Kraal
Geschichten der Eingeborenen aus Asien und Afrika
Vorwort
Diese Sammlung von Erzählungen aus Asien und Afrika will in erster Linie ein Unterhaltungsbuch sein. Sie ist eine bunte Auslese aus Werken deutscher, französischer, englischer und italienischer Forscher, Missionare und Folkloristen, aus Büchern also, die einem größeren Leserkreis unbekannt bleiben. Es gibt in Deutschland selbst unter den Gebildeten heute noch viele Leute, die da meinen, die Kunst der Erzählung sei eine Kulturerrungenschaft, von welcher wilde Völker wenig Ahnung hätten; sie wissen nichts davon, daß Poesie auch in Steppe und Urwald lebt und webt, daß sie am Wärmfeuer des sibirischen Nomadenzeltes, der Jurte, ebenso heimisch ist wie im Hottentottendorf, dem heckenumzäunten Kraal, und daß, wie auf dem ganzen Erdball, auch in den weiten Gebieten zwischen Sibirien und Südafrika keine menschliche Ansiedelung liegt, in der Lieder, Mythen, Märchen, Fabeln und andere poesievolle Äußerungen des "Volksmundes" unbekannt wären.
Aus der Tatsache, daß Engländer und Franzosen eine stattliche Reihe populärer Geschichtensammlungen aller Völker besitzen, während unsere derartigen Bücher fast an den Fingern einer Hand abzuzählen sind, könnte man schließen, daß in Deutschland weniger Interesse herrsche für fremde Volksliteratur. Aber gewiß wäre das ein Trugschluß. Engländer und Franzosen sind alte Kolonisten; als solche kamen sie schon vor Jahrhunderten mit den Völkern aller Erdgegenden in engere Fühlung und lernten deren Geistesschätze schon kennen, als in Deutschland noch niemand an Kolonialbesitz dachte. Jetzt aber hat sich auch der deutsche Adler in fernen Ländern Nistplätze gesichert und schwarze und gelbe Menschen untertänig gemacht; unsere zivilisatorischen und volkswirtschaftlichen Aufgaben machen es uns zur ernsten Pflicht, immer mehr und besser die fremden und fernen Mitmenschen kennen und verstehen zu lernen, und allein darum schon tut es not, daß auch das deutsche Volk – vor allem die Jugend, die dereinst reiche Erbschaft zu verwalten und zu erhalten haben wird – sich mit dem Gefühls- und Geistesleben fremder Völker mehr und mehr vertraut macht. Möge dieses Buch mit dazu anregen und beitragen!
Aber nicht nur in dieser Absicht sind die hier vereinigten Erzählungen herausgegeben; sie sind inmitten unserer einheimischen Erzählungskunst durchaus daseinsberechtigt durch ihren oft erstaunlich hohen poetischen Wert und brauchen sich vor Europäeraugen wahrlich nicht zu schämen. Es ist wundersam, wie diese in Stoff und Aufbau eigenartigen Geschichten, Märchen, Fabeln, Mythen und Schwänke unsere einheimische Volksdichtung an phantastischem Flug und schalkhaftem Humor oft übertreffen. Auch wenn man den besonderen Reiz in Abzug bringt, den das Fremdländische in Ort, Personen und Handlung auf uns ausübt, bleibt z. B. eine Erzählung wie das aus Kleinasien kommende armenische Märchen "König Fuchs" eine poetische Leistung, die der Volksliteratur jeder europäischen Kulturnation zur Zierde gereichen würde. Allerdings blicken die Armenier ja auch auf eine alte Kultur zurück, so daß man an ihre Volkserzählungen, ebenso wie an die der Inder, Chinesen, Japaner und Araber berechtigte höhere Anforderungen stellen darf. Auch in den Erzählungen anderer asiatischer Volksstämme sind Einflüsse benachbarter oder europäischer Kulturvölker so deutlich erkennbar, daß es oft recht schwer fällt, zu entscheiden, was von den Ahnen ererbt und was später von außen hinzugenommen worden ist. Durchaus europäisch beeinflußt erscheint uns z. B. die prächtige humorvolle Tamulen-Erzählung von den "Abenteuern des Guru-Gimpel"; tatsächlich verdankt diese in der Fassung, wie sie uns vorliegt, einem Europäer ihr Dasein. Vor zwei oder drei Jahrhunderten wirkte unter den Tamulen, einem verhältnismäßig kultivierten Volksstamm Vorderindiens und Ceylons, ein gelehrter und dichterisch begabter italienischer Missionar, der alte tamulische Geschichten mit Fabel- und Schwankstoffen seiner europäischen Heimat zu jenem Guru-Gimpel-Buch verarbeitete, das seinen Missionsbrüdern als Übungsbuch zum Erlernen der tamulischen Sprache dienen sollte. Hier also sind die europäischen Eingriffe in alte Eingeborenen-Erzählungen nachgewiesen. Unverfälschte Phantasieprodukte primitiver asiatischer Völker sind dagegen wohl die beiden Betrügergeschichten der Aino auf der nordjapanischen Insel Yezo und der sibirischen Tataren, sowie die Mongolen-Erzählung "Der Vielfraß" aus den hochasiatischen Steppen; letztere ist einem umfangreichen mongolischen Erzählungskreis, den sog. Siddhi-Kür-Geschichten, entnommen.
Weit mehr wirklich "Eingeborenes" als die asiatischen Geschichten bieten die afrikanischen, vor allem die aus Mittel- und Südafrika (Nr. 23 bis 34 des Inhaltsverzeichnisses), während die nord- und ostafrikanischen Erzählungen (Nr. 16 bis 22) arabischen Einfluß zeigen und die Mauritius-Geschichten (Nr. 35 bis 41) zumeist solche der dortigen Kreolen sind, also der Nachkommen eingewanderter weißer Kolonisten; diese Kreolen arbeiten sogar schon mit der Satire, wofür Nr. 40 ein hervorragend gelungenes Beispiel ist.
Eine merkwürdige Erscheinung ist es, daß eine große Reihe von Erzählungsstoffen weit voneinander getrennten Völkern gemeinsam sind. Dieses Buch, das möglichst vielseitig sein will, war nicht der geeignete Platz, um viele einander auffallend ähnliche Geschichten zur Vergleichung zu vereinigen. Immerhin hat sich auch hier, ohne daß die Absicht vorlag, manches Ähnliche zusammengefunden. Man vergleiche nur, was die Aino in ihrem Geschichtchen Nr. 9 erzählen, mit dem Schelmenstück Nr. 34 aus Madagaskar und beide Erzählungen mit Andersens bekanntem Märchen vom großen Klaus und vom kleinen Klaus; die Tunisier haben ein ähnliches, hier nicht vorgeführtes Geschichtchen. Oder man vergleiche den ersten Streich in vorerwähnter Madagaskar-Erzählung mit dem Tataren-Stückchen Nr. 5; der gleiche Gaunerkniff findet sich auch in alten deutschen Volksschwänken. Der aufmerksame Leser und Literaturkenner wird noch manche andere Stoffe finden, die ihn an Bekanntes erinnern. So wird er bei einigen Negerfabeln (Nr. 20, 29, 30) an "Reineke Fuchs", bei der hindostanischen Lull-Geschichte (Nr. 14) an ähnliche französische und deutsche Fabeln, bei einer Erzählung der Schilcha-Berber (Nr. 18) an Rabelais' Pantagruel-Schwank von den Papifeigen und dem Teufel denken.
Was den inneren Kern der asiatischen und afrikanischen Volkserzählungen betrifft, so fällt vor allem auf, daß der Begriff der Moral in dem Sinne, wie wir ihn haben, fast gänzlich fehlt. Die Idee der Pflicht, der objektiven Gerechtigkeit, der Ehre spielt keine Rolle. Vorherrschend dagegen ist der Triumph der List über die brutale Kraft; gegen die Gewalttätigkeit der Starken bedient sich der Schwache rücksichtslos der Lüge als der einzig erfolgreichen Waffe. Bei Völkern, bei denen Recht und Gerechtigkeit auf schwachen Füßen stehen, ist das Hochstellen der Schlauheit und Schelmerei durchaus begreiflich. In Deutschland war das einmal ebenso, das beweisen uns die alten Volksbücher. Im selben Maße aber, wie man die List feiert, verspottet man natürlich die Dummheit. So begegnet man, wie in allen Volksliteraturen, auch bei Asiaten und Afrikanern immer wieder typischen Vertretern der List wie auch der Einfalt. Eulenspiegel, Schildbürger und Genossen sind auf dem ganzen Erdball zu Hause. So haben die Japaner ihren dummen Tempo (Nr. 11), die Hindu ihren Lull (Nr. 14), die Tamulen ihren Guru-Gimpel (Nr. 16), die Tunisier ihren Dschuha (Nr. 17), die Suaheli ihren Abunawas, die Basuto ihren Hubeana, die Nama-Hottentotten ihren unverbesserlichen Hirtenjungen. Von allen diesen Typen gibt es zahlreiche Schwänke. Auch Kotofetsy und Mahaka von Madagaskar (Nr. 33 und 34) gehören hierhin; ihre Namen bedeuten in der Sprache der Hovas, der Bewohner der Ostküste Madagaskars, "listiger Mann" und "Einer der täuscht"; sie waren zwei gewöhnliche Räuber, manchmal witzig, immer aber faul und boshaft und ohne die ritterliche Seite, die uns so häufig unsere europäischen sagenhaften Banditen so sympathisch macht.
Auch in den zahlreichen Tiergeschichten der Afrikaner treten solche immer wiederkehrende Typen auf. Der listigste ist meistens der Hase, der in Nr. 26 "das allerboshafteste Geschöpf auf Erden" genannt wird. Wer aber mit ihm um die Palme der Verschlagenheit wetteifert, das ist die Schildkröte; sie besiegt sogar den Hasen (Nr. 38) und den gleichfalls nicht wenig schlauen Affen (Nr. 36). An den Küsten Guineas ist die Spinne die Vertreterin der List. Der Elefant spielt dagegen die blöde Rolle des Löwen und sogar des Isegrim in unserer Historie vom Reineke Fuchs. Er wird das Opfer des Hasen (Nr. 37, 40 und 41) und der Schildkröte, sogar des Hahnes (Nr. 22). Das Tier aber, das am meisten Widerwillen erregt und am meisten hereinfällt, ist die Hyäne (Nr. 20, 29 und 30).
Erstaunlich ist es, wie vollkommen in den afrikanischen Geschichten die Tiere den Platz des Menschen einnehmen. Erklärlich wird dies durch die von Prof. v. d. Steinen bei den Eingeborenen Zentralbrasiliens nachgewiesene Tatsache, daß Naturvölker nicht in unserem Sinne Mensch und Tier als weit voneinander getrennte Wesen anschauen, sondern, unter Verneinung eines Wesensunterschiedes, in beiden nur verschieden ausgestattete Personen erblicken. Diese Wilden sind fest davon überzeugt, daß sich alles einmal genau so zugetragen habe, wie es in den altererbten Geschichten berichtet wird. Zweifelsohne darf man solche Anschauungsweise auch bei den Tiergeschichten afrikanischer Naturvölker zugrundelegen; die Anmerkungen zu Nr. 23 und 28 liefern dafür den Beweis.
Der Inhalt dieses Sammelwerkchens besteht zum größten Teil aus eigenen Übersetzungen nach älteren französischen und englischen Werken; einiges andere ist aus älteren deutschen Büchern entnommen, die wohl längst nicht mehr im Buchhandel sind. Außerdem sind noch folgende Quellen benutzt worden: "Anthologie aus der asiatischen Volksliteratur" von A. Seidel, Verlag Emil Felder, Weimar 1898; "Japanische Märchen und Sagen" von P. Brauns, Verlag Wilhelm Friedrich, Leipzig 1885; "Globus", Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, Band 69, Verlag Friedrich Vieweg Sohn, Braunschweig 1896; "Geschichten und Lieder der Afrikaner" von A. Seidel, Verlag Schall Grand, Berlin 1896; "Die Somalisprache" von A. W. Schleicher, Berlin 1892; "Lieder und Geschichten der Suaheli" von C. G. Büttner, Verlag Emil Felder, Berlin 1894; "Märchen der Schluh von Tázerwalt" und "Tunisische Märchen und Geschichten", beides von Dr. Hans Stumme, Verlag J. C. Hinrichs, Leipzig 1893 und 1895; "Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha" von Casati (übersetzt von Reinhardstoettner); "Reineke Fuchs in Afrika" von Bleek, Verlag Hermann Böhlau, Weimar 1870.
München, den 31. März 1911.
Gisela Etzel
Aus Asien
König Fuchs
Armenisch
Eine Witwe hatte zwei Kinder, einen Knaben und ein Mädchen. Die Witwe war arm, sie hatte weder Felder in der Sonne noch goldgefüllte Börsen in der Truhe; sie war das armseligste Wesen im Lande, und sie konnte ihre lieben Kleinen nur dadurch ernähren, daß sie zu den Reichen auf Arbeit ging und oft genug auf Wegen und an den Türen der Häuser die Hand aufhalten mußte.
Die arme Witwe war traurig, und ihr Sohn war es nicht weniger, denn er dachte immer nur an das Glück. Er wäre gerne reich geworden, um seiner guten Mutter zu helfen und seine geliebte kleine Schwester glücklich zu machen.
Eines Abends, als der Jüngling weinend schlafen gegangen war, so schwarz war das Elend in der armseligen Hütte, hatte er einen Traum.
Ein Mann in seltsamer Kleidung erschien vor seinem Lager.
"Warum bist du traurig?" sagte er.
"Ach, meine Mutter und meine Schwester sind im Elend, und ich bin arm! Es macht mir großen Kummer, meine arme kleine Mutter vor Müdigkeit erschöpft zu sehen und dennoch selbst nicht einmal meine vielgeliebte Schwester ernähren zu können."
"Junger Mann, laß die Trauer, steh auf und geh ins Land; unter einem alten Nußbaum ist dein Glück verborgen."
Nachdem er so gesprochen, verschwand der Unbekannte.
Der Knabe erwachte.
"Was bin ich unglücklich," rief er, "dies ist nichts als ein Traum, als ein trügerischer Traum!"
Und von neuem ergab er sich seiner Trauer, und er fluchte seinem Unstern, dem es Spaß machte, ihn selbst noch im Schlaf zu quälen.
Als er wieder eingeschlafen war, sah er von neuem im Traume den Unbekannten.
"Warum grämst du dich noch? Geh hinaus ins Land, und du wirst das Glück finden."
"Fremder, wer bist du?"
"Was besagt mein Name. – Steh auf!"
Der Knabe erwachte von neuem und begann von neuem zu weinen.
"Ach," sagte er, "wie wahr ist doch das türkische Sprichwort: Ein hungriges Huhn sieht sich im Traum auf dem Gerstenspeicher! –Ich bin elend und arm, und natürlich träume ich von nichts anderem als von plötzlichem Glück!"
Und er schlief wieder ein.
Der Fremde zeigte sich zum dritten Male. Aber sein Gesicht war streng, und er rief mit befehlender Stimme:
"Unvernünftiger, siehst du nicht, daß ich dein guter Geist bin, er, der dich beschützte vom Tage, da du die Augen dem Sonnenlichte öffnetest! Steh auf, ich gebiete es dir! Draußen im Feld ist der alte Nußbaum, und unter den Zweigen dieses Baumes erwartet dich das Glück. Leb wohl, Knabe, denn du wirst mich nicht mehr wiedersehen!"
Der Sohn der Witwe erhob sich.
"Was mir auch widerfahren mag," rief er aus, "ich werde gehen, wohin mein guter Geist mich schickt."
Nachdem er sich mit seinen armseligen, alten Lumpen bekleidet hatte, weckte der Knabe die Mutter.
"Meine arme, liebe kleine Mutter," sagte er, "laß mich deine Hand küssen und empfiehl mich der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, denn ich werde von dir gehen."
"Von mir gehen? Was sagst du da, mein lieber Kleiner?"
"Während ich schlief, ist mein guter Geist zu mir gekommen und hat mir dreimal befohlen aufzustehen und ins Feld zu gehen, um das Glück zu suchen, das mich unter einem Nußbaum erwartet."
"Ach, mein Kind, glaube nicht diesem trügerischen Traum, bleib bei deiner armen Mutter! Wohl sind wir unglücklich, aber unsere Liebe stützt uns im Elend."
"Nein, meine liebe kleine Mutter, ich will fort. Ich will das Glück suchen, und dann wirst du reich und glücklich werden und ein zufriedenes Alter haben."
Dann weckte der Knabe seine Schwester. "Meine arme, liebe kleine Schwester," sagte er, "laß mich dich auf Mund und Augen küssen. Ich gehe das Glück suchen, das mein guter Geist mir dreimal im Schlaf gezeigt hat. Vielleicht bin ich morgen noch nicht zurück, vielleicht sehe ich dich überhaupt nie mehr wieder. Lebe wohl, geliebte kleine Schwester l"
Der Bruder küßte die Schwester innig auf Mund und Augen; dann schritt er hinaus aus der armseligen Hütte.
Die Nacht war noch ganz schwarz; kaum daß hie und da neben dicken Wolken ein paar Sterne blitzten. Der Wind heulte; aber der Jüngling, das Herz voll Hoffnung, durchschritt das Dorf, nahm bald diesen Fußsteig, bald jenen und wanderte hin durchs Feld zu dem Nußbaume, den sein guter Geist ihm bezeichnet hatte.
Nachdem er lange Zeit gegangen war, kam er zu Füßen des Baumes an. Der Mond stand am Himmel und beleuchtete das Tal; unter dem alten Nußbaume war nichts und niemand zu sehen.
Der Knabe setzte sich und weinte.
"Warum," rief er, "warum habe ich nicht auf meine gute kleine Mutter gehört? warum nicht ihre weisen Ratschläge befolgt? Dann wäre ich jetzt bei ihr, um sie in ihrem Elend zu trösten, während ich nun einsam und verlassen in der großen Wüste bin. Wie bin ich unglücklich!"
Ermattet von der Enttäuschung und dem Kummer schlief der Knabe ein.
Er hatte einen neuen Traum.
Ein vollständig bewaffneter Ritter auf einem feurigen, grauen Pferd erschien plötzlich an seiner Seite. Eine Wolke von Rauch entfuhr den Nüstern des Pferdes, und von seinem Leibe troff der Schweiß, als hätte es einen langen Lauf getan.
"Knabe," rief der Ritter, "steig zu mir in den Sattel auf das graue Pferd!"
Der Knabe zögerte.
"Steig auf, sag' ich dir, oder dieser Dolch wird dir das Herz durchbohren!"
Erschrocken gehorchte der Jüngling und schwang sich auf das graue Pferd.
Der Tag begann zu dämmern.
"Vorwärts," sagte der Unbekannte, "vorwärts, mein gutes Pferd! Wir müssen noch galoppieren, wenn wir vor Sonnenuntergang ankommen wollen."
Und das graue Pferd schwang sich wie ein Pfeil über Busch und Hecken, über Wiesen und Täler, über Hügel und Berge. Ach, wie es vorwärts eilte, und wie unter seinen Hufschlägen der Staub flog und Feuerblitze aufflammten!
Plötzlich hielt das graue Pferd an. Man war auf einer grasbewachsenen und blumendurchblühten Hochebene; ein murmelnder Bach bewässerte diesen wundersamen, wonnigen Ort, und Scharen von Vögeln in Purpur- und Goldgefieder sangen um die Wette in den vollen Büschen.
"Steig ab!" befahl der Ritter.
Der Knabe ließ sich auf den Rasen gleiten, und der Fremde fuhr fort:
"Also höre! Dein Glück befindet sich hier." Und er gab ihm Bogen und Pfeile und einen Feuerbrand. "Siehst du den großen Vogel auf dem Strauch dort? Der wird heute deine Nahrung sein. Schick ihm deine Pfeile!"
Der Knabe spannte den Bogen, zielte auf den Vogel und schoß ab. Ach, er hatte nicht gut gezielt, und als er sich umwandte, war der Ritter verschwunden.
Verzweifelter als je wanderte der Sohn der armen Witwe den ganzen Tag, durchlief die Hochebene nach allen Richtungen, sah tausend und tausend Vögel und konnte doch nicht einen töten. Endlich gegen Sonnenuntergang sah er einen kleinen gelben Vogel, schoß seine Pfeile auf ihn ab und tötete ihn.
Der Knabe kehrte auf den Platz zurück, wo er sein Feuer angemacht hatte, und nachdem er seine Beute gerupft, briet er sie, aß sie und gedachte nun zu schlafen. Er mußte sich unter freiem Sternenhimmel niederlegen und hatte nur ein Taschentuch, um sich das Gesicht gegen den Nachtfrost zu schützen.
Am Morgen des zweiten Tages nahm der Knabe wieder seine Pfeile und begab sich auf die Jagd. Bei Sonnenuntergang kam er mit zwei Vögeln zurück, die er getötet hatte.
Er saß vor dem Feuer, auf dem die beiden Tiere brieten, als man ihn anrief:
"Gegrüßt seist du, o Fremdling!"
Er wandte sich um und sah einen halbverhungerten, abgemagerten, fast sterbenden Fuchs, der sich kaum auf seinen schwankenden Beinen halten konnte.
"Sei willkommen, mein Bruder!" erwiderte der Knabe.
Der Fuchs näherte sich und ließ sich beim Feuer nieder.
"Sieh," sagte er, "ich sterbe vor Hunger; seit acht Tagen habe ich nichts zu essen gefunden."
"Du sollst mein Gast sein, mein lieber Bruder!"
Und als die Vögel gebraten waren, gab der junge Mann einen dem Fuchs und behielt den andern für sich.
Der arme Fuchs fraß das ihm von dem Fremden so großmütig gebotene Wildbret und erwachte wieder zum Leben.
"Sei recht bedankt, guter junger Mann!" sagte er, "wenn du es gerne willst, so will ich dein Gast und Hüter sein; ich werde während deines Schlafes für dich wachen."
Der Knabe legte sich hin und schlief ein, und der Fuchs bewachte seinen Schlaf.
Als der Morgen gekommen war, begab sich der Sohn der armen Witwe auf die Jagd. Bei Sonnenuntergang kam er mit drei Vögeln zurück, die er geschossen hatte.
Der Fuchs saß vor dem Feuer, als ein halbverhungerter Wolf daherkam.
"Warum vorüberlaufen?" sagte der Fuchs. "Komm her zu mir; ich habe einen sehr guten und mitleidigen Herrn, der mich mit seinem Wildbret nährt und auch für dich sorgen wird."
Da näherte sich der Wolf dem Knaben und sagte:
"Gegrüßt seist du, o Fremdling!"
"Sei willkommen, mein Bruder!" erwiderte der junge Mann.
"Sieh, ich sterbe vor Hunger; seit acht Tagen habe ich nichts zu essen gefunden."
"So sei mein Gast, lieber Bruder!"
Und als die Vögel gebraten waren, verteilte sie der junge Mann; er gab einen dem Fuchs, einen andern dem Wolf, und den dritten behielt er für sich selbst.





























