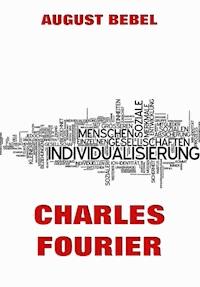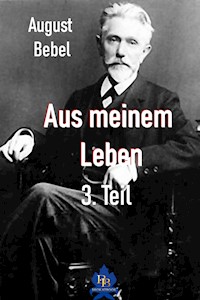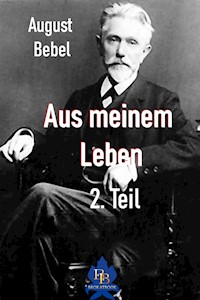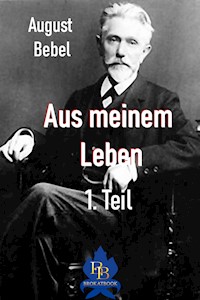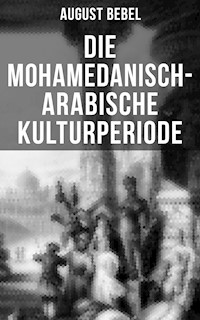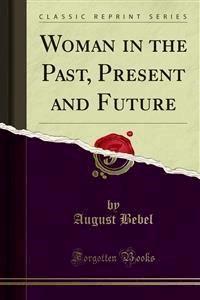Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
August Bebel war einer der Begründer der organisierten sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in Deutschland und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). August Bebel hatte bereits 1870 sein berühmtestes Werk: »Die Frau und der Sozialismus« veröffentlicht. Seine Autobiographie »Aus meinem Leben«, mit deren Niederschrift er sechs Jahre vor seinem Tode begonnen hatte, erschien zwischen 1910 und 1914 in drei Bänden. Der dritte und letzte Teil, der die Ereignisse bis zur Aufhebung des Gesetzes im Jahre 1890 zum Inhalt haben sollte, den Bebel jedoch bis zu seinem Tod nicht über das Jahr 1883 hinaus schreiben konnte, wurde erst 1914, also im Jahr nach seinem Tod, veröffentlicht. Bebel wirkte als einer der bedeutendsten Parlamentarier in der Zeit des Deutschen Kaiserreichs und trat auch als einflussreicher Autor hervor. Seine Popularität spiegelte sich in den volkstümlichen Bezeichnungen "Kaiser Bebel", "Gegenkaiser" oder "Arbeiterkaiser" wider. Seine politischen Anfänge wurzelten im liberal-demokratischen Vereinswesen von Arbeitern und Handwerkern, ehe er sich dem Marxismus zuwandte. Über Jahrzehnte arbeitete August Bebel mit Wilhelm Liebknecht zusammen. Mit ihm gründete er 1869 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP). Im Jahr 1875 war er an der Vereinigung mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) beteiligt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
August Bebel
Aus meinem Leben
3. Teil
Aus meinem Leben
August Bebel
3. Teil
Impressum
Texte: © Copyright by August Bebel
Umschlag:© Copyright by Walter Brendel
Verlag:Das historische Buch, 2022
Mail: [email protected]
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH,
Berlin
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Die Beratung des Sozialistengesetzes
Die nächsten Wirkungen des Gesetzes
Die ersten öffentlichen Lebenszeichen der Partei
Die Gründung der illegalen Parteipresse
Das Richtersche Jahrbuch
Die Verbreitung des »Sozialdemokrat« und der rote Postmeister
Die Reichstagssession von 1879
Eine verlorene Erbschaft
Kämpfe mit der deutschen Polizei
Die Reichstagssession von 1880
Vor, während und nach dem Wydener Kongreß
Die erste Session des Reichstags im Jahre 1881
Die allgemeinen Reichstagswahlen im Herbst 1881
Totgesagt
Der erste Hochverratsprozeß vor dem Reichstag vom 10. bis 21. Oktober 1881
Die Züricher August-Konferenz
Vorwort des Herausgebers
Am 21. Juli des vorigen Jahres schrieb mir Bebel einen Brief aus Zürich, in dem er zunächst sein lebhaftes Interesse für eine Polemik bekundete, die ich damals führte, und dann fortfuhr:
»Ich habe eine letztwillige Verfügung getroffen und hoffe, Du bist damit einverstanden, daß, wenn ich zur großen Armee abberufen werden sollte, bevor der dritte Band »Aus meinem Leben« fertig geworden ist, Du die Herausgabe übernimmst, soweit das Manuskript druckfertig vorliegt. Ich habe noch wenig zu tun, so ist der Band bis mit 1882 abgeschlossen. Nachher geht's rascher.
Voraussetzung ist, daß an dem Manuskript keine anderen als nur stilistische Änderungen vorgenommen werden. Tatsächliche nur dann, wenn sich herausstellt, daß eine von mir angegebene Tatsache eine irrtümliche ist, die ich berichtigen müßte. Insbesondere sollen auch keine Namen noch lebender Personen, die ich nenne, unterdrückt oder abgekürzt wiedergegeben werden, soweit ich dieses nicht selbst im Manuskript getan habe. ... Da ich mit Wissen niemand unrecht getan habe und die historische Wahrheit erfordert, daß nicht gefärbt wird, so liegt kein Grund vor, an dem Niedergeschriebenen zu ändern.
Eine Weiterarbeit an dem Bande, falls er bei meinem Tode noch nicht fertiggestellt ist, durch Dich oder einen anderen halte ich für ausgeschlossen. ... Ich bitte Dich, diesen Brief besonders sorgfältig aufheben zu wollen, zwecks Deiner Legitimation.«
Nach diesen Anordnungen ging Bebel in dem Briefe auf Sommerpläne und Familiensachen über, nannte sein Befinden zufriedenstellend, äußerte sich über einige Personalia aus der Reichstagsfraktion und schloß mit der Bemerkung:
»Ich arbeite jetzt am dritten Bande so, daß ich jeden Abschnitt druckfertig mache und dem übrigen Manuskript hinzufüge.«
Der ganze Charakter des Briefes deutete darauf hin, daß er doch noch hoffte, seine Erinnerungen selbst fertigzustellen, woran ihm ungemein viel gelegen war, und daß meine Bestimmung zum Herausgeber nur eine Vorsichtsmaßregel darstellte. Auch der nächste Brief an mich vom 29. Juli war voll von Interesse für die Gegenwart und ihre Polemiken, namentlich wegen der Haltung der Fraktion gegenüber den Steuervorlagen. Er äußerte sich da ähnlich wie in dem Brief, den Molkenbuhr auf dem Jenaer Parteitag verlas. Wohl beklagte er seine »Arbeitsunfähigkeit«, doch bezeichnete er als solche den »scheußlichen Zustand, eingreifen zu wollen und doch vor dem Kampf zurückschrecken zu müssen«. Es war seine Kampfunfähigkeit, die ihn bedrückte und die er der Arbeitsunfähigkeit gleichsetzte. Kämpfen und Arbeiten war ihm gleichbedeutend. Gleich darauf schrieb er aber in demselben Brief von seiner Arbeit für den dritten Band, die er nur für einige Wochen unterbreche. Auf eine Ausgrabung aus dem Jahre 1876, auf die ich ihn aufmerksam machte, antwortete er: »Was Du über die Erklärungen und Angriffe in der »Berliner Freien Presse« schreibst, war mir unbekannt oder ich werde es, wie so vieles andere, gänzlich verschwitzt haben. Wieviel ich verschwitzte, erfahre ich täglich bei dem Studium der Papiere für den dritten Band.«
Das waren Bebels letzte Äußerungen an mich über den letzten Band seiner Erinnerungen. Sie zeigten ihn mitten in der Arbeit für dessen Vollendung. Zwei Wochen später weilte er nicht mehr unter uns, war er jeder Arbeit, jedem Kampfe entrückt. Sanft entschlief er, die Schmerzen eines langen Todeskampfes blieben ihm erspart: der einzige Trost in dem ungeheuren Schmerz des Abschieds für immer, der jeden von uns niederdrückte, auch wenn er nicht das Glück gehabt, Bebels persönlicher Freund zu sein; jeden, dessen Herz an unserer großen Sache hängt, die in Bebel ihren gewaltigsten und treuesten Vorkämpfer verloren hatte.
Sobald das Material aus Bebels schriftlichem Nachlasse in meinen Händen war, machte ich mich sofort daran, das Vermächtnis meines toten Freundes zur Ausführung zu bringen.
Meine Arbeit war, wie schon Bebel selbst angedeutet hatte, keine große; wesentlich nur die eines feilenden Redakteurs. Stilistische Unebenheiten wurden geglättet, wobei ich die Eigenart des Autors möglichst zu wahren suchte. Zitate und Daten wurden nach Möglichkeit mit den Originalen verglichen. In den zum Abdruck gebrachten Briefen waren aus Bequemlichkeit viele Personen nur mit dem Anfangsbuchstaben ihres Namens bezeichnet. Wo die Namen sich von selbst verstanden, habe ich sie ausgeschrieben. Wo nur große Wahrscheinlichkeit bestand, habe ich den Namen in einer Fußnote genannt. In einigen wenigen Fällen war es mir unmöglich, den Namen mit einiger Sicherheit festzustellen. Da blieb es bei den Anfangsbuchstaben.
Ebenso natürlich dort, wo Bebel absichtlich den vollen Namen verschwiegen hatte.
Nie dagegen kam ich in die Lage, einen voll ausgeschriebenen Namen nur andeuten oder gar verschweigen zu wollen.
Bebels strenge Vorschrift in diesem Punkte hatte mich stutzig gemacht. Sie sah so aus, als fühle er sich in rücksichtsloser Wahrheitsliebe gedrängt, Enthüllungen zu machen, die manchen angesehenen Genossen kompromittierten. Zu meinem Erstaunen fand ich nichts, das auch nur im entferntesten in dieser Weise wirken konnte. Vielleicht sollten die für einige Namen peinlichen Wahrheiten erst in den kommenden Ausführungen vorgebracht werden, die nun für immer begraben sind.
Zur Veröffentlichung habe ich nur gebracht, was an druckfertigem Manuskript vorlag. Für die Arbeit darüber hinaus hatte Bebel ein umfangreiches Material zusammengetragen. Briefe, Dokumente, Zeitungsausschnitte, Exzerpte, Flugschriften und dergleichen mehr. Das Material reicht bis zum Jahre 1890 und wird den Geschichtschreibern der Partei manchen wertvollen Fingerzeig liefern.
Ich erlaube mir, hier schon einen Passus aus einem Brief an Schlüter zu zitieren. Er behandelt den Elberfelder Prozeß. In meiner Besprechung der Wendelschen Bebelbiographie hatte ich bemerkt, der Prozeß und Bebels Rolle dabei scheine ziemlich vergessen zu sein. Wendel hatte ihn nicht erwähnt. In einer späteren Auflage hat er allerdings das Versäumte nachgetragen. Trotzdem dürfte es von Interesse sein, zu erfahren, was Bebel noch während des Prozesses selbst am 1. Dezember 1889 schrieb:
»Der Prozeß ist ein Skandal, wie noch keiner da war, eine Schmach und Schande für die Staatsanwaltschaft und Polizei.
Das ließen sich beide nicht träumen, daß das Hereinziehen meiner Person unter die Anklage ihnen dieses furchtbare Fiasko bereitete. Der Staatsanwalt hat schon am zweiten Tage sich privatim geäußert: Dieser Mensch verpfuscht mir den ganzen Prozeß, und die nächsten Tage wurde es noch schlimmer. Ich hoffe, daß der Prozeß für die allermeisten Angeklagten glücklich verläuft. Ein Teil fällt auf lokale Geschichten und wegen seiner Beziehungen zu Z. (Zürich) beziehungsweise Ld. (London) herein.
Ärgerlich ist nur die Masse Zeit, die er erfordert. Aber wenn ich überlege, daß die Angeklagten höchstwahrscheinlich wie Hammel abgeschlachtet wurden, wenn ich nicht dabei war, weil sie das Material nicht beherrschten, dann soll mich das Opfer nicht reuen.
Ich denke, es ist der letzte große Geheimbundprozeß, den sie in Deutschland aufspielen.«
Es war der letzte Prozeß dieser Art. Bald darauf fiel das Sozialistengesetz.
Daneben fand ich auch eine Reihe kurzer, handschriftlicher Notizen, die aber über die bloße Feststellung von Daten in wenigen Worten nicht hinausgehen. Ausführungen einzelner Partien sind nicht vorhanden, auch nicht solche in fragmentarischer Form. Außer dem hier veröffentlichten Manuskript vermochte ich nichts zu entdecken, das man als »Erinnerungen« Bebels hätte veröffentlichen können. Jede Hinzufügung zu dem druckfertig vorliegenden Manuskript wäre die Weiterarbeit eines andern an dem Bande gewesen, die sich der Autor, und mit Recht, verbeten hatte, denn alle derartigen Hinzufügungen konnten, auch wenn sie noch so einwandfrei waren, nicht als Erinnerungen Bebels gelten. Deren Weiterführung durch mich war ausgeschlossen. Ich habe mir nur erlaubt, da sie ganz unvermittelt abbrechen, ein abschließendes Nachwort anzufügen, in dem ich einige Briefe aus dem Briefwechsel zwischen Bebel und Engels mitteile, die sich zeitlich an die letzten Ausführungen des unterlassenen Manuskripts anschließen.
Meine Arbeit als Herausgeber war also nicht sehr groß. Weit größer der Genuß, den sie mir bot, schon dadurch, daß sie mir erlaubte, jene Zeiten nochmals zu durchleben, die das Heldenzeitalter unserer Partei bedeuten. Keiner, dem es vergönnt war, sie mitzumachen, kann ihrer anders gedenken als mit Stolz. Die jüngere Generation aber vermag aus der Erinnerung an jene siegreich bestandenen schweren Prüfungen Mut und Kraft zu schöpfen für die großen Kämpfe, die ihr bevorstehen. Denn das Schwerste liegt noch vor uns: die Eroberung der politischen Macht.
Bebels heißester Wunsch, uns dabei vorangehen zu können, ist unerfüllt geblieben. Aber was unsterblich war an unserem großen Vorkämpfer, das lebt in uns weiter und wird uns führen zu Sieg und Triumph!
Januar 1914K. Kautsky
Die Beratung des Sozialistengesetzes
Die Eröffnung des neugewählten Reichstags wurde im Weißen Saale des königlichen Schlosses vollzogen. Man hatte erwartet, es werde an Stelle des immer noch leidenden Kaisers der Kronprinz die Thronrede verlesen. Aber es erschien weder dieser noch der Reichskanzler. Dieses Amt übernahm vielmehr der Stellvertreter des Reichskanzlers, der Graf Otto zu Stolberg-Wernigerode.
Dieser Vorgang gab zu lebhaften öffentlichen Erörterungen Veranlassung. Man schloß daraus, der Kronprinz sei mit dem Ausnahmegesetz nicht einverstanden und habe sich deshalb geweigert, den Reichstag zu eröffnen. Bismarck hingegen habe wieder aus Ärger über diese Weigerung auf die Eröffnung verzichtet, so sei sein Stellvertreter zu dieser Ehre gekommen.
Dieser Froschmäusekrieg in den höchsten Regionen war ja immerhin interessant, aber an der Sache änderte er nichts; denn daß der Ausnahmegesetzentwurf in der einen oder anderen Form Annahme finden werde, daran konnte nach dem Ausfall der Wahlen und der Stimmung in einem großen Teile der Presse nicht gezweifelt werden.
Die Vorlage hatte vor ihrer Vorgängerin vom Mai voraus, daß sie weit gründlicher als diese durchgearbeitet war. Dagegen war ihre Begründung eine äußerst dürftige. Die verbündeten Regierungen, hieß es unter anderem in ihr, seien durch die Attentate und die vielen denselben folgenden Majestätsbeleidigungen davon überzeugt worden, daß in weiten Kreisen eine jedes sittliche und rechtliche Gebot verachtende Gesinnung herrsche, die Staat und Gesellschaft mit großen Gefahren bedrohe. Es bedürfe also gesetzlicher Vorschriften, die sich gegen die sozialdemokratische Bewegung, als die Trägerin jener Gefahren, richteten.
Es folgte alsdann eine kurze und recht oberflächliche Darstellung der sozialistischen Bewegung seit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (1863) und der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation (1864). Dieser kärglichen geschichtlichen Darstellung folgte der Abdruck der Statuten der Internationale und des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, des Eisenacher und Gothaer Programms und das Genter Manifest vom Jahre 1877. Das Statut der Internationale enthielt den Satz:
»Der erste internationale Arbeiterkongreß erklärt: daß die Internationale Arbeiterassoziation und alle ihr angehörigen Gesellschaften und Individuen Wahrheit, Recht und Sitte als die Grundlage ihres Betragens untereinander und gegen alle ihre Mitmenschen ohne Rücksicht auf Farbe, Bekenntnis oder Nationalität anerkennen.«
Dieser schöne unanfechtbare und nur zu lobende Satz wurde jetzt mit zur Begründung eines Ausnahmegesetzes verwendet. Weiter folgten Auszüge aus den Rechenschaftsberichten der Partei auf den Kongressen zu Gotha in den Jahren 1876 und 1877. Es waren alles Aktenstücke, die öffentlich erschienen und jedem bekannt waren, der sich mit der Arbeiterbewegung beschäftigte. Diese mußten jetzt als Material für den Scheiterhaufen dienen, auf dem man die sozialdemokratische Partei zu verbrennen hoffte.
Die Verhandlungen über die Vorlage begannen am 16. September unter dem Präsidium v. Forckenbecks. Der Stellvertreter des Reichskanzlers eröffnete die Debatte mit einer äußerst dürftigen Rede, die kaum fünf Minuten in Anspruch nahm. Der Reichskanzler blieb den Verhandlungen fern. Wozu sollte er sich in rednerische Unkosten stürzen bei einer Reichstagsmehrheit, die den festen Willen hatte, ihm ein annehmbares Gesetz zu apportieren?
Der erste Redner aus dem Hause war der Vertreter des Zentrums, der Abgeordnete Peter Reichensperger-Olpe. In jenen Tagen spürte das Zentrum den Kulturkampf, wenn er auch schon im Abbröckeln war, noch in allen Knochen. Ein Ausnahmegesetz, wenn auch gegen eine ihm verhaßte Partei, erschien ihm schon wegen der Konsequenzen bedenklich. Auch hätten seine Anhänger eine solche Haltung nicht verstanden, nachdem man selbst unter Ausnahmegesetzen stand. So erklärte sich Herr Reichensperger »einstweilen« gegen Annahme und Amendierung des Gesetzentwurfes.
Anders der Abgeordnete v. Helldorf-Bedra, einer der Heißsporne der konservativen Partei. Er sprach sich mit erfrischender Deutlichkeit für den Gesetzentwurf aus und warf die Frage auf, ob es mit dem Ausnahmegesetz genug sei, ob es sich nicht auch empfehle, eine Änderung des Reichstagswahlrechtes in dem Sinne vorzunehmen, daß Garantien für ein gereifteres Alter und größere Seßhaftigkeit geschaffen werden, und ob es nicht ratsam sei, die Legislaturperioden des Reichstags zu verlängern, um der zunehmenden Unruhe des politischen Lebens ein Ende zu machen.
Der letztere Herzenswunsch fand neun Jahre später seine Erfüllung.
Nach Helldorf kam ich als erster Redner der Fraktion zum Wort. Die Fraktion war übereingekommen, das Gesetz sowohl im ganzen wie in seinen Einzelheiten nachdrücklich zu bekämpfen, und hatte zu diesem Zweck die Redner für die verschiedenen Materien bestimmt. Vahlteich und Kayser konnten sich an den Verhandlungen nicht beteiligen, sie genossen um jene Zeit Staatsquartier.
Meinem Grundsatz entsprechend, der Hieb sei die beste Deckung, ging ich der Vorlage und den Vorrednern in zweistündiger Rede zu Leibe. Zunächst gab ich eine Vorgeschichte des Gesetzentwurfes, wobei ich nachwies, daß die amtliche Darstellung mehrfach mit der Wahrheit in Widerspruch stehe. Des weiteren griff ich das willkürliche Verhalten der Polizeibehörden und die barbarischen Urteile der Gerichte in der Attentatsperiode an, Vorkommnisse, die zu den traurigsten und beschämendsten Vorgängen der neueren deutschen Geschichte gehörten und eine Schmach und Schande für das Deutsche Reich seien. (Ordnungsruf.) Alsdann behandelte ich die Geschichte der Partei. Ich wies auf die Versuche Bismarcks hin, unmittelbar nach seinem Eintritt in das preußische Ministerium, September 1862, durch seine Agenten Einfluß auf die Bewegung zu gewinnen, auf seine Verhandlungen mit Lassalle, auf die Bemühungen seines Geheimrats Lothar Bucher, Karl Marx zum Mitarbeiter am »Staatsanzeiger« zu werben, auf die Rolle Schweitzers im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein usw., Vorkommnisse, die deutlich zeigten, daß Bismarck von nichts weniger beseelt sei als von Abscheu gegen die Sozialdemokratie. Ihn treibe vielmehr der Ärger, daß die Partei sich seinen Plänen unzugänglich erwies und der heftigste Gegner seiner Politik wurde, was ihn bewogen habe, die Attentate, die anständigerweise niemand uns an die Rockschöße hängen könne, für ein Ausnahmegesetz gegen uns auszunutzen.
Mit dem Gesetz, so führte ich weiter aus, werde man aber den beabsichtigten Zweck nicht erreichen. Die Sozialdemokratie werde unter ihm und durch es erst recht an Anhang gewinnen. Das Interesse für sie werde zunehmen, und nicht wir, sondern unsere Gegner würden die Besiegten sein. Man solle also den Entwurf dahin verweisen, wohin er gehöre, in den Papierkorb, im Kampfe gegen uns sich aber nicht auf leere Beschuldigungen und Redensarten, sondern auf Tatsachen und Beweise stützen, die bisher nicht erbracht worden seien.
Des weiteren entwickelte ich, wie wir aller Voraussicht nach unter dem Sozialistengesetz für die Verbreitung unserer Ideen arbeiten würden, ohne daß die Polizei uns an den Leib könne, und wie die Verbreitung der verbotenen Literatur einen Umfang annehmen werde, wie wir ihn bisher nicht gekannt. Die Zukunft werde zeigen, daß das Gesetz seinen Zweck verfehle.
Meine Rede hatte, wie die Ausführungen der nachfolgenden Redner bewiesen, die gewünschte Wirkung erzielt, auch die Presse aller Parteien im In- und Ausland beschäftigte sich mit ihr. Der preußische Minister des Innern Graf zu Eulenburg, der nach mir das Wort ergriff, machte es wie sein Kollege Graf zu Stolberg-Wernigerode, er faßte sich kurz. Er begnügte sich, aus einer meiner Schriften einige Zitate vorzutragen, die beweisen sollten, daß die Partei eine Anhängerin des gewaltsamen Umsturzes sei. Im übrigen bestritt er, daß Beziehungen zwischen der Sozialdemokratie und Vertretern der Regierung bestanden hätten, oder doch nur zu einer Zeit, in der die Partei eine andere gewesen sei. Ihm sei von Vereinbarungen oder Verbindungen wie den von mir geschilderten nichts bekannt; er müsse, bis Tatsachen angeführt würden, auf die er im einzelnen antworten könne, solche Anknüpfungsversuche auf das bestimmteste in Abrede stellen. Anders der nationalliberale Abgeordnete Dr. Bamberger, der in kurzer Rede die Gefährlichkeit der sozialistischen Lehren darzulegen versuchte, aber auch mit Unbehagen konstatierte, daß man in maßgebenden Kreisen nicht allezeit der Sozialdemokratie abweisend gegenübergestanden habe, das bezeugten schon Bismarcks Beziehungen zu Lassalle. Was ich darüber gesagt, sei zum Teil schon bekannt gewesen, zum Teil aber neu. Aber auch im »Staatssozialist«, den Stöcker, Pastor Todt und Genossen gegründet hatten, seien Anschauungen vertreten worden, die sich mit den unserigen deckten, dort aber viel gefährlicher wirkten. Er beantragte, eine Kommission von 21 Mitgliedern einzusetzen. Das Gesetz bedürfe einer eingehenden und aufmerksamen Prüfung, denn meine Rede habe ihn überzeugt, daß kein Versuch unterlassen werden dürfe, um die Gesellschaft vor den Gefahren zu schützen, die ich ihnen vorgeführt. Bamberger, der fast zwei Jahrzehnte als politischer Flüchtling in Paris gelebt hatte, tat, als erfahre er erst durch meine Rede, was der Sozialismus sei.
Am nächsten Tage erschien Bismarck, um gegen mich zu polemisieren. Er entschuldigte sich mit seinem Gesundheitszustand, der ihn bisher genötigt habe, den Verhandlungen fernzubleiben. Aber er sei nunmehr erschienen, um der Legendenbildung, zu deren Organ ich mich gemacht, entgegenzutreten, damit sie nicht Geschichte werde. Ich habe das Wesentliche der Ausführungen Bismarcks gegen mich schon im ersten Bande (erste Auflage Seite 63 ff., zweite Auflage Seite 65ff.) angeführt. Ich verweise hier darauf. Zum Schlusse seiner Rede versicherte er: Er habe erst durch meine Kommunerede (Mai 1871) die wahre Natur der Sozialdemokratie erkannt und sei von da ab unser ausgesprochener Feind geworden. Er habe auch wiederholt, wie das Haus wisse, Versuche gemacht, uns als Feinde von Staat und Gesellschaft durch gesetzgeberische Maßnahmen in die Schranken zu weisen, er sei aber damit bei dem Hause nicht durchgedrungen. Die sozialistische Presse habe gedroht und gerufen »discite moniti«. »Ihr seid gewarnt. Wovor denn gewarnt? Doch vor nichts anderem als vor dem nihilistischen Messer und der Nobilingschen Schrotflinte. Ja, meine Herren, wenn wir in einer solchen Weise unter der Tyrannei einer Gesellschaft von Banditen existieren sollen, dann verliert jede Existenz ihren Wert.« (Beifall rechts.) Jetzt gelte es den Kaiser zu schützen. »Daß bei der Gelegenheit vielleicht einige Opfer des Meuchelmords unter uns fallen werden, das ist ja sehr wohl möglich; aber jeder, dem das geschehen könnte, mag eingedenk sein, daß er zum Nutzen, zum großen Nutzen seines Vaterlandes auf dem Schlachtfeld der Ehre bleibt.« Die Rechte brach nach diesen Worten in einen Beifallssturm aus, wir protestierten und ich verlangte das Wort zur Geschäftsordnung, um gegen den Kanzler wegen der uns zugefügten Beleidigungen den Ordnungsruf zu fordern. Aber bereits hatte der Präsident dem alten Feuerbrand der Konservativen, Herrn v. Kleist-Retzow das Wort erteilt. Dieser wetterte gegen uns mit dem ganzen Fanatismus eines christlich-preußischen orthodoxen Junkers, der für die Vorrechte seiner Klasse kämpft. Unsere ganze Tätigkeit in Presse und Versammlungen falle unter die Vorbereitung zum Hochverrat. Unsere Gesänge seien Schlachtgesänge, unsere ganze Tätigkeit eine Vorbereitung zum Kriege. Wir raubten dem Volke die Religion, was zur Folge habe, daß das Volk schon im Diesseits nicht bloß die gleichen Rechte, sondern auch die gleichen Genüsse fordere. Er schloß seine Philippika mit einer Klage über die steigende Unzufriedenheit und mangelnde Dankbarkeit und die Verderbtheit großer Massen, die das Christentum gefährde.
Ich erhielt nunmehr das Wort zur Geschäftsordnung und forderte den Ordnungsruf sowohl gegen den Reichskanzler wie gegen Herrn v. Kleist-Retzow, der uns der Vorbereitung des Hochverrats beschuldigt habe. Der Präsident bestritt, daß die Äußerungen der Vorredner den von mir behaupteten Sinn gehabt hätten. Er müsse jeden Versuch, in seine Geschäftsführung einzugreifen, zurückweisen.
Bracke, der alsdann das Wort erhielt, sprach im Gegensatz zu dem leidenschaftlichen Charakter, den die Debatte angenommen hatte, sehr ruhig. Auf die Zitate, die der Minister des Innern und Herr v. Kleist-Retzow aus Schriften von uns vorgetragen hatten, antwortete er mit Zitaten aus den Schriften bürgerlicher Schriftsteller, die zum Teil aus der Kulturkampfzeit stammten und an Schärfe alles übertrafen, was man gegen uns anführen konnte. Auf die liberalwirtschaftlichen Theorien Bambergs antwortete er mit der sozialistischen Auffassung von Staat und Gesellschaft. Auch er erklärte, daß unsere Gegner mit der Ausnahmegesetzgebung uns nicht überwinden würden.
Nach Bracke suchte der Elsässer Fabrikant Dollfuß nachzuweisen, daß sie mit ihren sogenannten Wohlfahrtseinrichtungen in Mülhausen ein Arkanum gegen die Sozialdemokratie besäßen. Aber noch vor Ablauf des Sozialistengesetzes wurde Mülhausen durch einen Sozialdemokraten im Reichstag vertreten. Dem Elsässer folgte ein polnischer Redner, der die preußische Ausnahmegesetzgebung gegen die Polen am eigenen Leibe kennengelernt hatte. Er sprach sich scharf gegen die Vorlage aus. Das veranlaßte den ihm folgenden Herrn v. Kardorff, sich um so eifriger für sie einzusetzen. Nach einer längeren Rede Eugen Richters, worin dieser sich namentlich mit dem Reichskanzler auseinandersetzte, beschloß die Mehrheit den Schluß der Generaldebatte, wodurch mir das Wort zu einer Entgegnung auf die Rede des Reichskanzlers abgeschnitten wurde. Ich konnte ihm nur in einer persönlichen Bemerkung eine Anzahl seiner gegen mich gerichteten falschen Behauptungen und Irrtümer zurückweisen.
Das Haus beschloß entsprechend dem Antrag Bamberger, die Vorlage einer Kommission von 21 Mitgliedern zu überweisen. Es wäre eine Anstandssache, ja eine Pflicht des Hauses gewesen, in diese Kommission auch ein Mitglied der angeklagten Partei, über die entschieden werden sollte, aufzunehmen, damit dieses Rede und Antwort stehe und die unzweifelhaft notwendig werdenden Richtigstellungen vornehmen konnte. Ein Teil des Hauses war auch geneigt dazu. Auf Anfrage an die Fraktion, wen sie in die Kommission gewählt sehen wollte, wurde ich vorgeschlagen. Aber sofort setzte die Intrige gegen mich ein, und so fiel ich bei der Wahl durch.
In der Kommission kam es zu lebhaften Auseinandersetzungen. Der linke Flügel der Nationalliberalen unter der Führung Laskers versuchte wieder einmal die Quadratur des Zirkels zu entdecken. Handelte es sich auch um ein Ausnahmegesetz, so suchten sie doch nach Möglichkeit die Willkür der Polizei einzuengen. Sie wollten daher verhüten, daß die sogenannten legitimen Forderungen der Sozialdemokratie, die man später den »berechtigten Kern« unserer Bestrebungen nannte, durch das Gesetz getroffen würden. Auch sollten andere den sozialistischen Reformbestrebungen verwandte Bestrebungen in bürgerlichen Kreisen nicht getroffen werden können. Dagegen war die rechte Seite der Kommission der Meinung, man müsse ganze Arbeit machen; man müsse der Sozialdemokratie jede Möglichkeit nehmen, ihre gefährlichen Bestrebungen unter harmlosen Formen zu verfolgen, und da müsse man zu den Verwaltungsbehörden Vertrauen haben und ihnen nicht durch unklare und zweideutige Gesetzesbestimmungen in die Arme fallen. Mit Hilfe der Gegner der Vorlage, die für alle Abschwächungsanträge stimmten, siegten Lasker und Genossen. Die Erfahrung lehrte allerdings, daß die beschlossenen Halbheiten nur Zwirnsfäden waren, durch die sich die Verwaltungsbehörden nicht einengen ließen; sie legten eben das Gesetz nach ihrem Gutdünken aus.
Die Hauptänderungen, die die Kommission und ihr folgend das Plenum annahm, waren nachfolgende: Im Gesetzentwurf hieß es, daß Vereine, Verbindungen jeder Art, auch genossenschaftliche Kassen, Versammlungen, Preßerzeugnisse, Geldsammlungen verboten, beziehungsweise unterdrückt werden sollten, sobald sich herausstellte, daß sie Bestrebungen dienten, die auf Untergrabung der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtet waren. Nach den Beschlüssen der Kommission beziehungsweise des Plenums lautete der Satz dahin, daß das Verbot oder die Unterdrückung eintreten sollte, sobald sozialistische, sozialdemokratische oder kommunistische, auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdeten Weise zutage treten.
Ein Streit um Worte. Dem Aal kann es gleichgültig sein, ob er gebraten oder geschmort werden soll.
Weiter sollte nach dem Entwurf ein Ausschuß aus sieben Mitgliedern eingesetzt werden, den der Bundesrat aus seiner Mitte wählte, an den letztinstanzlich die Beschwerden über getroffene Maßregeln der unteren Behörde zu richten seien. Kommission und Reichstag beschlossen, eine Kommission von neun Mitgliedern niederzusetzen, von denen der Bundesrat vier aus seiner Mitte wählte. Die fünf anderen sollten aus der Zahl der Mitglieder der höchsten Gerichte des Reiches oder der einzelnen Bundesstaaten entnommen werden. Der Reichstag glaubte damit eine größere Garantie gegen allzu kühne Auslegung des Gesetzes zu schaffen. Die Praxis ergab, daß er sich auch hier irrte. Die Urteile dieser Beschwerdekommission waren so reaktionär, daß wir im Jahre 1880 in Leipzig in der Parteileitung beschlossen, weil zwecklos, keine Beschwerden mehr bei ihr einzureichen.
Im § 20 des Entwurfes, später § 28 des Gesetzes, betreffend den sogenannten kleinen Belagerungszustand, war vorgeschrieben, daß in Bezirken, in denen durch die sozialistischen Bestrebungen die öffentliche Sicherheit bedroht war, sämtliche Versammlungen der polizeilichen Genehmigung unterworfen werden könnten. Kommission und Reichstag beschlossen, daß eine Ausnahme von dieser Bestimmung für die Wahlen zum Reichstag oder zu einer Landesvertretung eintreten solle. Der Senat zu Hamburg umging aber diese Vorschrift dadurch, daß er, gestützt auf eine landesgesetzliche Bestimmung, auch solche Versammlungen verbot. So konnte während der ganzen Dauer des Sozialistengesetzes, ausgenommen für die Reichstagswahl im Februar 1890, als bereits feststand, daß das Gesetz Ende September fallen würde, die Sozialdemokratie dort keine einzige Wahlversammlung abhalten. Genützt hat diese Maßregel des Hamburger Senats nichts; denn unter der Herrschaft des Gesetzes fielen sämtliche drei Wahlkreise in die Hände der Sozialdemokratie und verblieben ihr.
Eine andere Änderung und auch Verbesserung des § 20 beziehungsweise 28 bestand darin, daß über jede auf Grund des erwähnten Paragraphen getroffene Anordnung dem Reichstag sofort beziehungsweise bei seinem nächsten Zusammentritt, Rechenschaft gegeben werden müsse über die Gründe, die zu ihrem Erlaß geführt. Durch diesen Beschluß wurde zwar nirgends die Verhängung des kleinen Belagerungszustandes verhindert, aber er gab uns die Möglichkeit, Jahr für Jahr bei Besprechung solcher Maßregeln die Handhabung des Gesetzes zu kritisieren. Die Sozialistengesetzdebatten wurden damit Regel. Die zweite Beratung des Entwurfs begann im Plenum am 9. Oktober. Das Zentrum gab durch den Mund seines Vorsitzenden die Erklärung ab, es werde gegen den Gesetzentwurf stimmen. Obgleich entschiedener Gegner der Sozialdemokratie, hieß es in der Erklärung, könne es nicht einem Ausnahmegesetz zustimmen, das die Rechtssicherheit der Staatsbürger in Frage stelle, mit den verwerflichen auch berechtigte Bestrebungen treffe und das polizeiliche Ermessen an Stelle des richterlichen Urteils setze. Für ein allgemeines Rechtsgesetz, das gegenüber den immer stärker hervortretenden Gefahren im Reich eine Erweiterung des Strafgesetzes in bezug auf Ausschreitungen der Presse, der Vereine und Versammlungen herbeiführe, sei es zu haben. Auch erwarte es, daß nunmehr positive Maßregeln ergriffen würden, um den unleugbar vorhandenen und weit verbreiteten Mißständen im wirtschaftlichen und sozialen Leben, namentlich dem des Arbeiterstandes, abzuhelfen, »damit Gerechtigkeit, Gottesfurcht und Friede, insbesondere auch Friede auf dem staatlich-kirchlichen Gebiet im Reich zur vollen Herrschaft gelangen.«
Im Grunde genommen wollte also das Zentrum noch mehr, als das Sozialistengesetz ihm bot; es wollte die allgemeine Verschärfung der Gesetze, die allgemeine Reaktion.
Der erste Redner für die Vorlage war der Abgeordnete Freiherr Marschall v. Bieberstein, der spätere Staatssekretär des Auswärtigen Amtes und zuletzt Gesandter in Konstantinopel und London. Marschall, eine große, stattliche Persönlichkeit, war zu jener Zeit Staatsanwalt in Mannheim, wo er als öffentlicher Ankläger auch wiederholt gegen Parteigenossen auftrat, so unter anderem gegen Franz Joseph Ehrhart. Diese Anklage gab Veranlassung zu einer heiteren Episode. Ehrhart war angeklagt, ein Plakat verfaßt zu haben, auf dem ich als Kandidat der Mannheimer Parteigenossen den Wählern des Mannheimer Wahlkreises mit den Worten empfohlen wurde, ich sei ein tapferer Volksmann, der wegen seines Kampfes für Volksfreiheit und Volksrecht zu zwei Jahren Festung verurteilt worden sei. Es handelte sich um die Reichstagswahl im Januar 1877. Herr v. Marschall sah als Staatsanwalt in dieser Behauptung eine entstellte Tatsache, wodurch eine Anordnung der Obrigkeit wider besseres Wissen verächtlich gemacht werde. Er klagte Ehrhart auf Grund des § 131 des deutschen Reichsstrafgesetzbuchs an und beantragte gegen den blutjungen Sünder eine exemplarische Gefängnisstrafe. Denn ich sei nicht wegen meines Kampfes für politische Freiheit, sondern wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt worden. Schon wollte der Gerichtsvorsitzende die Verhandlung schließen, als Ehrhart sich mit der Bemerkung das Wort erbat, daß er als Angeklagter doch auch etwas zu sagen habe. Er erhielt es, worauf er seine kurze, im reinsten Pfälzer Dialekt gehaltene Verteidigungsrede mit den Worten schloß: »Meine Herren Richter, glauben Sie dem da oben (dem Staatsanwalt) nichts, der macht aus einem Läusle einen Elefanten«. Marschall griff rasch nach der Zeitung, die er vor das Gesicht hielt, um das Lachen zu verbergen. Der Gerichtshof aber glaubte dem Staatsanwalt und schickte Ehrhart auf drei Monate ins Gefängnis. Sein späteres Verhalten sprach dagegen, daß die Strafe eine erzieherische Wirkung auf ihn ausgeübt hatte. Im Gegensatz zu seinen scharfmacherischen Parteigenossen war Herr v. Marschall ein Gemäßigter. Er sprach sich für ein Gesetz von kurzer Dauer aus, mit dem man den beabsichtigten Zweck wohl erreiche, Ihm folgte Sonnemann, der sich gegen das Gesetz erklärte. Bismarck, der noch aus der Zeit des Krieges von 1866 einen Span auf Sonnemann hatte, antwortete diesem.
Ich bin im Zweifel, wen Bismarck persönlich mehr haßte, ob Eugen Richter oder Sonnemann. Ich glaube den letzteren, denn Eugen Richter war trotz aller Opposition immer ein guter Preuße, aber in Sonnemann haßte er den süddeutschen Antipreußen, den »Republikaner«, von dessen Organ der »Frankfurter Zeitung«, er behauptete, daß es mehr mit der französischen Republik als mit dem Deutschen Reich sympathisiere. So kam es denn, daß, als bei der Reichstagswahl im Jahre 1884 Sonnemann mit unserem Kandidaten Sabor in die Stichwahl kam, Bismarck auf eine Anfrage der Frankfurter Nationalliberalen, wen sie wählen sollten, antworten ließ: »Fürst wünscht Sabor.« Und Sabor wurde gewählt.
Bismarck hatte, wenn er einmal in Kampfstimmung war – und an jenem Tage besaß er sie –, die Gepflogenheit, sich wenig an den zur Beratung stehenden Gegenstand zu halten. Um seinem Herzen Luft zu machen, sprang er alsdann von einem Gegenstand zum anderen und schlug auf den Gegner los, der ihm im Wege stand. Oftmals zur Verzweiflung des Präsidenten, der nicht wagte, ihn zu unterbrechen, dann aber auch nicht verhindern konnte, daß die Angegriffenen sich wehrten und so eine Debatte entstand, die weit über den Rahmen des zu verhandelnden Gegenstandes hinausging. So auch diesmal. Nachdem er sich mit Sonnemann auseinandergesetzt, rückte er uns zu Leibe. Ehemals sei Frankreich das Versuchsfeld für den Sozialismus gewesen; nach dem Niederschlagen der Kommune sei es Deutschland geworden. Dann klagte er: die Deutschen seien geborene Kritiker, die an der Diskreditierung der Behörden und Institutionen ihre helle Freude hätten. Das treffe namentlich auf die Fortschrittspartei zu, die in den großen Städten den Boden für uns gelockert habe; sie sei die »Vorfrucht der Sozialdemokratie«. Dann fiel er aufs neue über uns her, verurteilte die Art unserer Agitation und wie wir die Massen in unser Garn lockten. Weiter klagte er über die Milde unserer Strafgesetzgebung, die Gutmütigkeit der Richter, über die Freizügigkeit, die Verführung der Massen durch die Vergnügungen in den großen Städten. Seine Rede war eine Jeremiade, die den Junkern und Junkergenossen aus der Seele kam. Aber sie enthielt keine Spur von staatsmännischer Einsicht in das Wesen und Getriebe der bürgerlichen Welt, in dem doch die Wurzeln liegen für all das, was er beklagte, und das die Sozialdemokratie zu einer naturnotwendigen Erscheinung des öffentlichen Lebens machte, mit der er rechnen mußte.
Des weiteren klagte er über die Spaltungen in den bürgerlichen Parteien, über den Mangel an Vertrauen und Entgegenkommen von jener Seite. Seine Rede klang in die Aufforderung aus, sich zu einer Phalanx zusammenzuschließen, die sich in allen Teilen gegenseitig vertraue, so daß das Reich allen Stürmen gewachsen sei und ihnen einen wirksamen Widerstand entgegenzusetzen vermöge. Diese Aufforderung war nach alledem, was sich Bismarck selbst im gegenseitigen Ausspielen der Parteien geleistet und sich selbst noch in dieser Rede zur Erreichung seiner Zwecke geleistet hatte, dem Hause doch ein zu starkes Stück. Er schloß seine Rede ohne das geringste Zeichen von Beifall.
Den nächsten Tag erhielt Hasselmann Gelegenheit, auf die Angriffe und Provokationen Bismarcks zu antworten. Er tat dies in einem großen Teil seiner Rede mit unleugbarem Geschick. Zum Schlusse verfiel er aber selbst in eine Provokation. Auf den Angriff Bismarcks in seiner vorletzten Rede gegen mich antwortete Hasselmann: Wir schleifen keine Dolche für den Fürsten Bismarck, wir verachten den Dolch, der von hinten trifft; wenn wir kämpfen, kämpfen wir Brust an Brust, aber wenn man für uns Kugeln gießt und Bajonette schleift, dann sagen auch wir: »Wenn wir in einer solchen Weise unter der Tyrannei einer Gesellschaft von Banditen existieren sollen ...« Darauf großer Sturm in der Versammlung. Der Präsident rief Hasselmann zur Ordnung wegen angeblicher Provokation zum Aufruhr. Hasselmann fuhr fort: »Nicht ich bin es, der provoziert; ich habe zur Genüge gesagt, daß ich den Weg des Friedens vorziehe (Lachen), ja ich ziehe ihn vor; ich bin aber auch bereit, mein Leben zu lassen. Fürst Bismarck möge auch einmal an den 18. März denken.«
Löwe-Kalbe, der Hasselmann als Redner folgte, äußerte: Ich danke dem Herrn Redner, daß er das System Bebel in der Verteidigung seiner Sache verlassen hat und offen mit der Sprache herausgegangen ist. Herr v. Bennigsen, der jetzt ebenfalls das Wort ergriff, suchte durch lange Ausführungen den vernünftigen Standpunkt, den er bei der ersten Ausnahmegesetzvorlage nach dem Hödel-Attentat eingenommen hatte, zu verwischen. Er sagte jetzt: Vater, verzeihe mir.
Im Verlauf der zweiten Lesung wurden die Debatten immer erregter. Die gesamten bürgerlichen Parteien schickten ihre besten Kräfte vor, um ihren Standpunkt zu verteidigen. Von unserer Seite nahmen Bracke, Fritzsche, Hasselmann, Liebknecht, Reinders und ich, die meisten von uns mehreremal das Wort. Ein lebhafte Szene rief Bracke hervor bei Beratung des § 4 der Vorlage, der später § 8 des Gesetzes wurde, der von der Auflösung der Vereine handelte und die Bestimmung enthielt, daß die Beschwerde gegen ein Verbot eines Vereins keine aufschiebende Wirkung habe. Gegen diese Bestimmung sprach sich Bracke in seiner kurzen Rede besonders scharf aus. Dann plötzlich aus der Konstruktion der Rede fallend, rief er in den Saal hinein: »Meine Herren, ich will Ihnen sagen, wir pfeifen auf das ganze Gesetz!«
Wir brachen in stürmischen Beifall aus, der größte Teil des Hauses tobte vor Entrüstung, und der Präsident erteilte Bracke einen Ordnungsruf; draußen aber im Lande jubelte die Partei über diese drastische Kennzeichnung unserer Stellung zum Gesetz.
Am 18. Oktober begann die dritte Lesung des Gesetzentwurfs. Der Abgeordnete v. Schorlemer Alst erklärte sich namens des Zentrums noch einmal scharf gegen den Entwurf: Wer wie wir unter solchen Ausnahmegesetzen gestanden hat, kann nun und nimmermehr für ein Ausnahmegesetz stimmen. Das war schön gesagt. Es kam aber bei späteren Beratungen über die Verlängerung des Gesetzes anders; auch im Zentrum fanden sich immer mehr Stimmen für dasselbe, oder man blieb der entscheidenden Sitzung fern, um eine Mehrheit für die Verlängerung zu sichern. Von unserer Seite nahm noch einmal Liebknecht das Wort, um in nachdrücklichster Weise das Gesetz zu bekämpfen, wohl wissend, wie er gleich bei Eingang seiner Rede bemerkte, daß die Würfel der Entscheidung bereits gefallen seien. Er rede nur, um seine Pflicht zu tun. Er schloß mit den Worten: »Der Tag wird kommen, wo das deutsche Volk Rechenschaft fordern wird für dieses Attentat an seiner Wohlfahrt, an seiner Freiheit, an seiner Ehre«. Den 19. Oktober fanden zwei Sitzungen statt; die Mitglieder drängten, nach Hause zu kommen. Die erste wurde um 10 Uhr 30 Minuten, die zweite um 2 Uhr 15 Minuten eröffnet. Die letztere diente ausschließlich der namentlichen Abstimmung. Während derselben herrschte atemlose Stille. Alsdann verkündete der Präsident das Resultat. Es hatten an der Sitzung 370 Abgeordnete teilgenommen – das Haus zählt 397 –, von denen 221 mit Ja, 149 mit Nein stimmten. Das Mehr betrug also 72 Stimmen. Alsdann erhob sich Bismarck und verlas die kaiserliche Botschaft, durch die die Session geschlossen wurde. Aber er begnügte sich nicht damit; er richtete an das Haus noch eine Ansprache. Er gebe der Befriedigung Ausdruck, äußerte er, daß ungeachtet großer Meinungsverschiedenheiten, die sich, zu Anfang der Beratung herausgestellt hätten, eine für alle zustimmenden Teile befriedigende Lösung gefunden worden sei. Sollte das Gesetz im Verlauf seiner Wirksamkeit ergeben, daß es seinen Zweck nicht erreiche, so würden sich die verbündeten Regierungen wieder vertrauensvoll an den Reichstag wenden, um entweder eine Verschärfung des Gesetzes oder eine Reform der Allgemeingesetzgebung, die er für den besseren Weg halte, zu erreichen. Die verbündeten Regierungen hegten alsdann die Hoffnung, daß, nachdem sie durch loyale Handhabung des Gesetzes das Vertrauen des Reichstags gerechtfertigt hätten, die Hilfe und der Beistand des Reichstags ihnen nach Maßgabe der Bedürfnisse nicht fehlen werden.
Die Versicherung, man werde das Gesetz loyal handhaben, klang wie Ironie. Ein Gesetz, das dem Ermessen der Behörden alle Tore und Türen öffnete, war ein Freischein für die Willkür. Das sollte sich bald genug zeigen. Und Bismarck war der erste, der jede Willkürmaßregel, sobald sie sich gegen uns richtete, verteidigte und rechtfertigte.
Nachdem er alsdann die Sitzungen des Reichstags für geschlossen erklärt hatte, brachte der Präsident das übliche Hoch auf den Kaiser aus. Wir hatten uns mittlerweile aus dem Saal entfernt und verließen, wenn auch als Geschlagene, guten Mutes das Haus, hoffend, der Tag werde kommen, wenn auch erst nach schwerer Zeit, an dem wir als Sieger zurückkehrten. Ich leugne nicht, mich packte der Ingrimm, als ich nach Hause fuhr. Ich nahm mir in jener Stunde vor, soweit es an mir läge, alles aufzubieten, um die Wirksamkeit des Gesetzes zu durchkreuzen, und ich habe mein mir gegebenes Wort redlich gehalten.
Unsere Feinde hatten es eilig. Am nächstfolgenden Tage wurde bereits das Gesetz verkündet. Es trat den 21. Oktober in Kraft.
Die nächsten Wirkungen des Gesetzes
Sobald der Reichstag am 17. September die erste Lesung beendet hatte und der Entwurf in die Kommissionsberatung ging, fuhr die Fraktion nach Hamburg, um dort mit dem Parteiausschuß zu beraten, welche Maßnahmen nach Inkrafttreten des Gesetzes ergriffen werden sollten. Im Ausschuß herrschte keineswegs eine gehobene Stimmung. Seit Auer von Hamburg nach Berlin übergesiedelt war, um in die Redaktion der »Freien Presse« einzutreten, war August Geib die einzige Person von Bedeutung in dem fünfgliedrigen Ausschuß. Geib fühlte sich infolgedessen isoliert und ohne eigentliche Stütze in einem Kampfe, wie er jetzt zu erwarten war. Auch war Geib, obgleich ein Mann von hoher Intelligenz, untadeliger Rechtschaffenheit und großer Sachkunde, der die Geschäfte mit Kaltblütigkeit und Ruhe erledigte, keine eigentliche Kampfnatur. Dem Feinde die Zähne zu zeigen und jedes Mittel anzuwenden, das ihm eine Niederlage beibringen konnte, das lag nicht in seinem Wesen. Dazu kamen noch zwei Umstände, die uns damals nicht bekannt waren, aber sein Verhalten erklärlich machten. Geib war herzkrank, wie sein baldiger Tod uns zeigte und ich gelegentlich einer Haussuchung bei ihm wahrnahm, der ich als unfreiwilliger Zeuge beiwohnte.
Dann aber stellte sich auch zu unserer aller Überraschung nach seinem Tode heraus, daß seine materielle Lage nicht so war, wie man sie einschätzte. Er schien mäßig wohlhabend zu sein und ein Geschäft (Leihbibliothek) zu besitzen, das seinen Mann gut nährte. Das gemütliche Heim, das er sich mit Hilfe seiner Frau zu schaffen wußte, und die Gastfreundschaft, die er übte, unterstützten diese Auffassungen. Das war aber ein Irrtum. Hätte er zum Beispiel noch die Zeit der Verhängung des kleinen Belagerungszustandes über Hamburg-Altona erlebt und wäre er dann als erster mit ausgewiesen worden, er wäre finanziell zusammengebrochen, und was dieses für den außerordentlich feinfühlenden Mann bedeutete, kann man sich vorstellen. Geib hätte also auch die Arbeitslast nicht leisten können, die ihm unter dem Gesetz, wenn auch nicht mehr als offiziellem Ausschußmitglied, erwuchs. An Gehalt war ebenfalls nicht zu denken.
Das alles mochte sich Geib sagen, und so erklärte er zu unserer unangenehmen Überraschung, daß er unter allen Umständen sein Amt niederlege und die Meinung habe, man solle die Partei auflösen, noch bevor das Gesetz in Kraft getreten sei, damit sie von der Polizei nicht aufgelöst werde. Mit Geibs Rücktritt war aber Hamburg als künftige Zentralstelle unmöglich.
Es gab zwischen uns und Geib eine lebhafte Auseinandersetzung. Es wurden die verschiedensten Vorschläge gemacht, wie man ihm seine Tätigkeit erleichtern könne. Er blieb aber bei seinem Vorsatz. Darauf erklärte ich, es sei doch ein Ding der Unmöglichkeit, daß die Partei keinen Zentralpunkt mehr habe, an den sich die Genossen in ihren Nöten um Rat und Hilfe wenden könnten. Lehne Hamburg ab, so schlüge ich Leipzig vor, und ich sei bereit, die Stelle Geibs als Kassierer von Mitteln, die zu schaffen angesichts der kommenden Opfer mir jetzt die wichtigste Tätigkeit zu sein schiene, zu übernehmen. Dementsprechend wurde beschlossen. Darauf händigte mir Geib die letzten 1000 Mark ein, die er noch in der Kasse hatte. Das war der Grundstock für meine künftige Tätigkeit als Finanzminister unter dem Sozialistengesetz. Auch dem Drängen Geibs, sofort die Partei für aufgelöst zu erklären, da er nicht mehr sein Amt verwalten wolle, mußten wir nachgeben; denn es wäre eine Lächerlichkeit gewesen, für eine Galgenfrist von wenig Wochen noch einen provisorischen Ausschuß einzusetzen, bis die polizeiliche Auflösung erfolgte. So wurde denn beschlossen, mit einer Proklamation an die Partei heranzutreten und sie für aufgelöst zu erklären. Aber die Art, wie dies geschah, erregte Unzufriedenheit. Statt daß der Ausschuß oder das Zentralwahlkomitee, wie der Ausschuß genannt wurde, seitdem Tessendorf das Verbot der Parteiorganisation für Preußen durchgesetzt hatte, sich selbst in einer Proklamation an die Partei wendete, die Organisation für aufgelöst erklärte, ihre Ratschläge für ferneres Wirken machte und ihr Mut zusprach, erschien im »Vorwärts« eine Bekanntmachung des Sekretärs Derossi, die an Trockenheit des Tones und Schwächlichkeit des Inhalts kaum übertroffen werden konnte. Erst auf unsere Einsprache, daß die Bekanntmachung des Sekretärs nicht genüge und der Ausschuß mit der Namensunterschrift seiner Mitglieder die Parteiorganisation für aufgelöst erklären möge, erschien eine solche, datiert vom 15. Oktober, im »Vorwärts« vom 21. Oktober. Aber diese Proklamation verbesserte die Stimmung nicht. Das Komitee erklärte, daß es seine Auflösung der Polizeibehörde angezeigt habe, es also von jetzt ab eine zentralistische Organisation der Partei nicht mehr gebe, sonach auch keine planmäßige Organisation mehr. Damit sei es vorüber. Auch für Geldsendungen habe man keine Verwendung mehr. Man solle solche nicht mehr an Geib adressieren. Man ging noch weiter und forderte, daß, wenn noch irgendwo eine Parteimitgliedschaft bestehe, diese sich sofort auflösen sollte. Der Aufruf schloß: Einig in der Taktik, auch zur Zeit der Bedrängnis, sei die Gewähr für eine bessere Zukunft.
In der Hamburger Zusammenkunft war man einmütig der Ansicht, die Schläge abzuwarten, die nach Verkündung des Gesetzes gegen die Partei geführt würden, und danach seine Maßnahmen zu treffen. Unter keinen Umständen dürfe das Feld freiwillig geräumt werden. Es sei vorauszusehen, daß in erster Linie die Partei- und Gewerkschaftsorgane der Unterdrückung verfallen würden. Es bestanden zu jener Zeit 23 politische Organe, von denen 8 sechsmal wöchentlich, 8 dreimal, 4 zweimal und 3 einmal erschienen. Daneben bestand die »Neue Welt« als Unterhaltungsblatt. Weiter erschienen 14 Gewerkschaftsblätter. Die Mehrheit dieser Blätter wurde in 16 Genossenschaftsdruckereien hergestellt.
Mit der Unterdrückung dieser Preßorgane, erwartete man, würden sofort eine Menge Personen, als Redakteure, Expediteure, Kolporteure, Verwaltungsbeamte, Schriftsetzer, Hilfspersonen aller Art, brotlos. Um für alle diese brotlos gewordenen Personen nach Möglichkeit Hilfe zu schaffen, müßte man versuchen, an Stelle der unterdrückten neue Blätter zu gründen, die sich dem Gesetz anzubequemen versuchten. Hatten doch Lasker wie der Berichterstatter der Kommission bei der Beratung des Gesetzes erklärt, daß Blätter, die ihre Haltung änderten, nicht unterdrückt werden sollten. Aber respekiert wurden diese Zusagen nicht. Neben der Neugründung von Blättern solle man sich auf die Herstellung allgemein bildender Literatur werfen. Die Gründung von Blättern sei auch geboten, weil sie die bequemste und unverfänglichste Art bilde, die Verbindung unter den Parteigenossen aufrechtzuerhalten. Gelänge es nicht, in der einen oder anderen Form Hilfe zu schaffen, dann würde eine große Zahl der führenden Personen genötigt, ins Ausland zu wandern, was ein großer Verlust für die Partei sei. Als Sozialisten stigmatisiert, fänden sie angesichts der Stimmung in den Unternehmerkreisen keine Stellung, die überdies infolge der Krise Arbeitskräfte in Mengen zur Verfügung hätten.
Daß man sehr bald auch mit einer für die Parteiverhältnisse großen Zahl Ausgewiesener und deren dadurch in Not geratenen Familien werde rechnen müssen, daran dachten wir zunächst nicht. Auf Grund der Erklärungen, die während der Beratungen über den kleinen Belagerungszustand aus kompetentem Munde abgegeben wurden, hielten wir zunächst die Verhängung desselben für unwahrscheinlich. Wir täuschten uns. Noch ehe der Monat November zu Ende ging, wurde der kleine Belagerungszustand über Berlin verhängt. Ihm folgte im Jahre 1880 derjenige über Hamburg-AItona und Umgegend, dann über Harburg, Ende Juni 1881 über Stadt und Amtshauptmannschaft Leipzig usw. Wenn bei irgendeiner unter dem Sozialistengesetz getroffenen Maßregel, so erwies sich bei der Verhängung des kleinen Belagerungszustandes die »loyale« Behandlung des Gesetzes als Lüge.