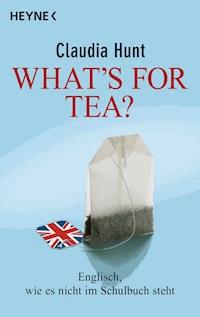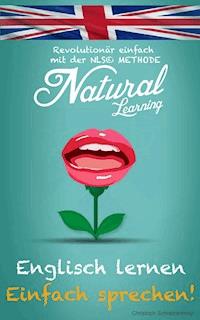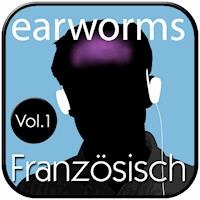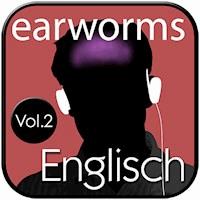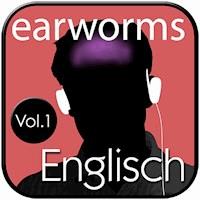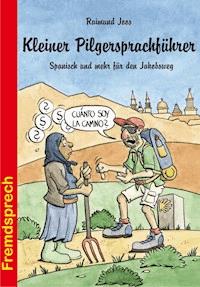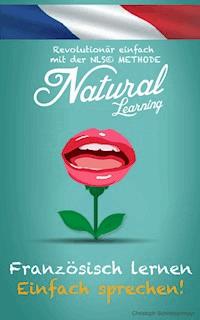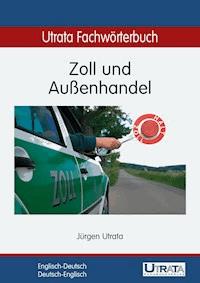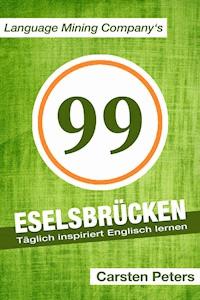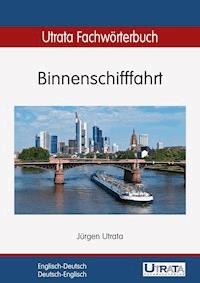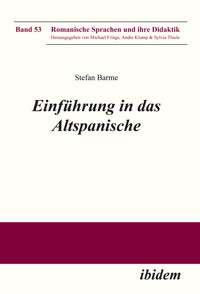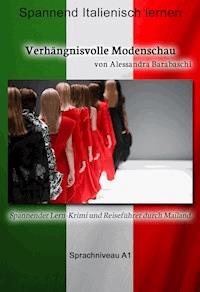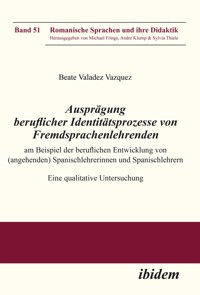
Ausprägung beruflicher Identitätsprozesse von Fremdsprachenlehrenden am Beispiel der beruflichen Entwicklung von (angehenden) Spanischlehrerinnen und Spanischlehrern E-Book
Beate Valadez_Vazquez
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Romanische Sprachen und ihre Didaktik
- Sprache: Deutsch
Zu den Tendenzen der fremdsprachendidaktischen Forschung zählt in besonderem Maße die zugehörige Lehrerforschung, die auch zentraler Bestandteil der Forschung zur Didaktik der Romanischen Sprachen ist. Im aktuellen Forschungsdiskurs wird die Population der (angehenden) Spanischlehrenden der Sekundarstufe II deutscher Gymnasien bisher nur marginal berücksichtigt. Beate Valadez Vazquez wendet sich in ihrer vorliegenden qualitativen Studie dieser Thematik zu. Valadez Vazquez zeigt die veränderte Position des Fachs Spanisch als einer fest institutionalisierten Schulfremdsprache an deutschen Gymnasien auf, die ihrerseits Auswirkungen auf die berufliche Entwicklung der Spanischlehrenden hat. Dieses Spannungsfeld erschließt die Autorin mithilfe der beruflichen Identitätsprozesse, die sie erstmals für die fremdsprachendidaktische Forschung prägt. Abschließend beleuchtet Valadez Vazquez das Potenzial beruflicher Identitätsprozesse für Forschung und Praxis, die sowohl einen Ansatz für die Lehrerbildung als auch methodisch-didaktische Konsequenzen für den Spanischunterricht implizieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 911
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Danksagung
Für die Fertigstellung dieser Arbeit waren mehrere Faktoren notwendig: einerseits viel Disziplin und kontinuierliche Arbeit, andererseits ein herzliches Umfeld. Für Letzteres möchte ich mich in aller Form insbesondere bei folgenden Menschen bedanken:
·Zunächst danke ich von Herzen meinen beiden Betreuern und Gutachtern, Frau Prof. Dr. Christiane Fäcke und Herrn Prof. Dr. Engelbert Thaler. Durch ihre beständige, kompetente und herzliche Art bekam ich stets den nötigen Beistand und die Motivation, um diese Arbeit zum Abschluss zu bringen.
Des Weiteren möchte ich mich herzlich bei meinem Drittprüfer Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhold Werner für das entgegengebrachte Interesse an meiner Forschungsarbeit bedanken.
·Im Übrigen danke ich den Forscherinnen und Forschern des fachdidaktischen Forschungskolloquiums an der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg für ihre konstruktiven Beiträge. Insbesondere sei meiner lieben Kollegin Dr. Sylvie Méron-Minuth für die langen, ertragreichen Gespräche in unserem Büro meist bei einem ‚petit café‘ gedankt.
·Außerdem möchte ich mich bei den Befragten dieser Studie für ihre Mitarbeit bedanken.
·Nun folgen Personen, die mich im privaten Umfeld stets in meinem Forschungsvorhaben unterstützten:
oZunächst meinen Eltern, Dr. rer. nat. Ingrid Lammert und Dr. rer. nat. Roland Lammert, sei für ihr Vertrauen, ihre bedingungslose Liebe und ihre Geduld gedankt. Dies gilt auch für die konstruktiven Diskussionen mit ihnen, die Denkanstöße aus der Logik einer anderen Fachrichtung gaben.
oDarüber hinaus bedanke ich mich bei meinem Onkel, Dr.-ing. habil. Lothar Helm und meiner Tante, Dipl.-Chem. Anne Helm, die mir wie meine zweiten Eltern sind.
oMeinem jüngeren Bruder Constantin Lammert danke ich für seine Liebe und seine verständnisvolle Art. Immer mein kleiner Bruder! Ebenso danke ich meinem guten Freund Uwe, der mir wie ein Bruder ist.
oDarüber hinaus bedanke ich mich bei meinen vielen lieben Freundinnen, die mir lieb und teuer sind: zuallererst danke ich meiner besten Freundin Ute für die wundervolle Freundschaft seit unserer Grundschulzeit. Weiteren langjährigen Freundinnen sei gedankt, insbesondere Janine, Vanessa, Line, Simone und Ivi. Meiner neu hinzugewonnenen Freundin Kirsten sei für ihre Unterstützung und ihre liebevolle Art herzlich gedankt.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Mann Ricardo bedanken, der mir in unermüdlicher Geduld und endlosem Vertrauen zur Seite stand und der mir die treffende Bedeutung des spanischen Sprichworts „Quien quiere azul celeste, que le cueste“ nahebrachte.
All diesen Menschen gilt mein aufrichtiger Dank.
Beate Valadez Vazquez, Augsburg, den 17.12.2013
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Erster Teil – von der diachronenEntwicklung beruflicher Identität von Spanischlehrenden und des Spanischunterrichts zu aktuellen beruflichen Identitäten
1 Berufsbiographische und geschichtliche Entwicklungen Spanischlehrender und ihres Spanischunterrichts auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands
1.1Berufliche Identitätenausgewählter Spanischlehrer und die Geschichte des Spanischunterrichts
1.1.1 Geschichte des Spanischunterrichts als Bindeglied zwischen Spanischlehrenden und ihrenberuflichen Identitäten
1.1.2Gegenstand des Spanischunterrichts: Spanisch und seine Sprachnorm sowie Vermittlung durch Metasprachen
1.1.3 Zweihistorischeberufliche Identitäten: H. Doergang(k) und Zumarán
1.2 Aktuelle Rolle des Spanischunterrichts
1.2.1 Spanischlehrende: ihre Mehrsprachigkeit und Kompetenzen
1.2.2Spanisch in der Schul-/Erwachsenenbildung im heutigen Deutschland
1.2.2.1 Spanisch als Fach in der Sekundarstufe
1.2.2.2 Spanisch in der Erwachsenenbildung
1.3Heutige Spanischlehrende und berufliche Identität(sprozesse)
2Methodik und Plan der Studie: berufliche Identitätsprozesse von (angehenden) Spanischlehrenden
2.1 Selbstanalytisches Bild der Forscherin/Situierung im Forschungsprozess
2.2Begründung des Themas:Erfassung beruflicher Identitätvon (ange- henden) Spanischlehrenden – Forschungsabsicht
2.2.1 ‚Vorwissen‘ 1 über ‚berufliche Identität‘ aus Nachbardisziplinen
2.2.2 Abgrenzung zum „beruflichen Selbstverständnis“ (Caspari 2003)
2.2.3 ‚Vorwissen‘ 2 für Interviewleitfaden zur ‚beruflichen Identität‘
2.2.3.1 Berufswahlmotive versus Studienfachwahlmotive
2.2.3.2 Motive – Motivation – Einstellungsforschung
2.2.3.3 Berufsbiographische Zugänge – Professionalisierung
2.3 Methodentriangulation: ‚Subjektive Theorien‘, ‚Grounded Theory‘ und ‚autobiographisch-narratives Interview‘
2.3.1 Relevanz ‚Subjektiver Theorien‘ von Spanischlehrenden
2.3.2 Durch ‚Grounded Theory‘ zur Berufsbiographie der Befragten
2.3.3 Methodenverzahnung bei Interviewauswertung
2.3.4 Erkenntnisse aus einem qualitativen Probeinterview
2.3.5 Das‚Sample‘derInterviewpartner/innen
2.3.6 ‚Kommentierte Transkription‘ zur Interviewdatenaufbereitung
2.3.7 Einzelfallanalyse
2.3.8 Entwicklung des Interviewleitfadens
2.3.9 Fragestellung der Studie: Wie sehenberufliche Identitätsprozessebei (künftigen) Spanischlehrenden aus?
Zweiter Teil – Verlauf beruflicher Identitätsprozesse bei (künftigen) Spanischlehrenden – Durchführung und Auswertung der Studie
3Durchführung der qualitativen Studie zu beruflichen Identi- tätsprozessen von (angehenden) Spanischlehrenden
3.1. Tatsächliche Erhebungssituation: Rahmenbedingungen zum ‚Gespräch‘
3.1.1 Vom Interview zum ‚Gespräch‘: der instrumentelle ‚gatekeeper‘
3.1.2 Interaktion und Verhältnis zu den Gesprächspartner/inne/n
3.1.3 Äußerer Gesprächskontext: Gesprächsort und Gesprächsbereitschaft
3.2 Umsetzung der Gesprächsaufbereitung: ‚kommentierte Transkription‘
3.2.1 Gesprächsauswahl
3.2.2 Selektion der kodierten Redeanteile
3.3 Tatsächliche Auswertungssituation
3.3.1 Umgang mit Triangulation: Triangulationskon-/divergenzen
3.3.2 ‚Offenes Kodieren‘ und‚Axiales Kodieren‘ im ‚Kodier-Paradigma‘
3.3.3 ‚Selektives Kodieren‘ – Bestimmung einer ‚Kernkategorie‘
3.3.4 Beispiel aus dem Kodierleitfaden
3.4 Auswertungsmethodik: ‚autobiographisch-narratives Interview‘(Schütze 1983),‚Grounded Theory‘(Strauss/Corbin 1996) und ‚Subjektive Theorien‘(Groeben et al. 1988)
3.4.1 Integration von fachdidaktischem und pädagogischem Wissen zu Beginn der Studie
3.4.2 Fachdidaktische Fragestellungen zu beruflichen Identitätsprozessen
4Auswertung: Entwicklung beruflicher Identität von Spanischlehrenden
4.1 Auswertungsgruppe (1) - Spanischstudierende: Profil von L. Langer
4.1.1 Vor dem Studium: Großes persönliches Interesse an Sprachen
4.1.2 Während des Studiums: Mitten im „Spanischboom“ u. Spanischinteresse
4.1.3 ‚Berufliche Identität‘nach dem Studium: Spanisch als (zu) beliebtes Fach?
4.1.4 ‚Biographische Gesamtformung‘: Studentin Lisa Langer
4.1.5 Komm. Validierung der beruflichen Identitätsprozesse von Lisa Langer
4.1.6 Komm. validierte Kurzprofile weiterer befragter Spanischstudierender
4.1.6.1Sabine Sommer (a): Von Spanisch ‚Ja, warum nicht?‘ zur Spanischliebe
4.1.6.2 Carina Lichtenstein (b): Reiselust und Verbindung zu Spanien
4.1.6.3 Michael Wagner (c): Als Spanischlehrer erst Pädagoge sein
4.1.7 Zwischenauswertung/Fallvergleich (1): Gruppe Spanischstudierender
4.2 Auswertungsgruppe (2) - Spanischreferendare: Profil von M. Prengler (d)
4.2.1 Vor dem Studium: Über Französisch den Spanischzugang erhalten
4.2.2 Während des Studiums: Kulturelles Bewusstsein erweitern
4.2.3 Im Referendariat: Selbst Spanisch lernen und Spanisch unterrichten
4.2.4 Komm. Validierung beruflicher Identitätsprozesse von M. Prengler(d)
4.2.5 Komm. validierte Kurzprofile weiterer befragter Spanischreferendare
4.2.5.1Reiner Teckert (e): ‚Spanischlernen ist kein mühsamer Lernprozess!‘
4.2.5.2 Timo Reinhardt (f): Im Spanischunterricht auch schauspielern
4.2.6 Zwischenauswertung (2): Gruppe der Spanischreferendare
4.3 Auswertungsgruppe (3) – Spanischjunglehrende: Profil von R. Müller (g)
4.3.1 Vor dem Studium: Spanisch als VHS-Kurs, nicht als Regelschulfach
4.3.2 Während des Studiums: ‚Altspanisch hilft mir im Spanischunterricht‘
4.3.3 Nach dem Studium: als Spanischlehrer für Lateinamerika sein
4.3.4 Komm. Validierung der beruflichen Identitätsprozesse von R. Müller(g)
4.3.5 Komm. validierte Kurzprofile weiterer befragter Spanischjunglehrender
4.3.5.1 Helena Keller (h): Spanischunterricht fordert Sprachsicherheit
4.3.5.2 Juliane Schneider (i): Spanisch aus vielprachigem Sprachinteresse
4.3.6 Zwischenauswertung/Fallvergleich (3): Gruppe Spanischjunglehrende
4.4 Auswertungsgruppe (4)-Spanischlehrende: Profil von M. Tuhle (j)
4.4.1 Vor dem Studium: Spanisch im Sommerkurs lernen
4.4.2 Während des Studiums: ‚Spanisch gibt es nicht an der Schule?‘
4.4.3 Referendariat und erste Berufsjahre: Spanisch wird wichtiger
4.4.4 Martina Tuhle heute: Spanischlehrerin und Referendarbetreuerin
4.4.5Komm. Validierung der beruflichen Identitätsprozesse von M. Tuhle (j)
4.4.6 Komm. validierte Kurzprofile weiterer befragter Spanischlehrender
4.4.6.1 Doris Lohmann (k): ‚Spanischschüler schätzen meine Pragmatik‘
4.4.6.2 Bettina Jäger (l): ‚Spanisch und Englisch ergänzen sich prima!‘
4.4.7 Zwischenauswertung/Fallvergleich (4): Gruppe der Spanischlehrenden
4.5 Fallvergleich der Gespräche mit den (angehenden) Spanischlehrenden
4.5.1 Maximale Fallkontrastierung 1: Michael Wagner – Robert Müller
4.5.2 Maximale Fallkontrastierung 2: Lisa Langer – Martina Tuhle
4.5.3 Fallkontrastierung A: Studierende (1) mit Referendaren (2)
4.5.4 Fallkontrastierung B: Referendare (2) mit Junglehrenden (3)
4.5.5 Fallkontrastierung C: Junglehrende (3) mit Spanischlehrerinnen (4)
4.5.6 Fallkontrastierung D: Spanischlehrerinnen (4) mit Studierenden (1)
4.6 Konzept des heutigen Spanischunterrichts und seiner Repräsentanten
Dritter Teil – Nutzen dieser qualitativen Studie über berufliche Identitätsprozesse
5 Nachhaltigkeit der qualitativen Studie zu beruflichen Identitätsprozessen
5.1 Theorem:Berufliche Identitätsprozessevon (künftigen) Spanischlehrenden
5.1.1 Soziokulturelle Ebene des Theorems: Bild heutigen Spanischunterrichts
5.1.2 Sprachenpolitische Theorem-Ebene: Spanisch als Fach im Wandel
5.1.3 Ebene der Berufsabschnittszufriedenheit: Entwicklung einer Spanischlehrerpersönlichkeit
5.1.4 Tragweite des empirisch gewonnenen Theoremsberufliche Identi-tätsprozesse
5.1.4.1 Aufbaufaktoren beruflicher Identitätsprozesse
5.1.4.2 Ausbaufaktoren beruflicher Identitätsprozesse
5.1.4.3 Stagnations- und Abbaufaktoren beruflicher Identitätsprozesse
5.1.5 Synergetische und divergente „Prozeßstruktur[en]“ von (angehen-den) Spanischlehrenden
5.2 Bewertung der Methodologie der qualitativen Studie in der Rückschau
5.2.1Beurteilung zu Methodentriangulation aus ‚Subjektiven Theorien‘, ‚Grounded Theory‘ und ‚autobiographisch-narrativem Interview‘
5.2.2 Intention der Studie zu beruflichen Identitätsprozessen
5.2.3 Methodenspezifische ‚Relevanz‘ für die Fremdsprachenforschung
5.3 Inhaltliche Relevanz für die fremdsprachendidaktische Forschung
5.3.1 Nutzen für Fort- und Weiterbildungen
5.3.2 Grenzen der Studie in Forschungsdesign, Methodologie, Begriffen
5.3.3 Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen
5.3.4 Sprachenpolitische Entwicklung von Spanisch: Blick auf Spanisch-lehrende
5.4Zusammenschau inhaltlicher, methodischer und fachdidaktischer Re- levanz zur Bestimmung der Gesamtrelevanz der Studie
6Resümee der Studie und Ausblick für die Fremdsprachendidak- tik/-methodik und die fremdsprachendidaktische Forschung
Literaturverzeichnis
Anhang
Einleitung
CL: Also mit Spanien oder generell mit dem Spanischen verbindet mich eigentlich schon seitdem ich auf der Welt bin Einiges, weil meine Eltern ein Appartement an der Costa Brava haben, in der Nähe von Barcelona. Und da fahren meine Eltern hin, seitdem mein Vater 10 Jahre alt ist und ich seitdem ich auf der Welt bin, das heißt jede Sommerferien wurde dann an diesem gleichen Ort verbracht. Und dadurch, dass meine Eltern auch selber fließend Spanisch sprechen, haben dann immer auch viel Kontakt mit Einheimischen gehabt mit den Kellnern und den Restaurantbesitzern […]. Und dadurch kam das, dass Spanien für mich von vornherein so was wie‘ne zweite Heimat war. Und ich das Spanische schon immer gut im Ohr hatte und schon ganz früh angefangen habe, auch mein Essen selber schon auf Spanisch zu bestellen. Und dann fragt man als Kind natürlich nach: wie sag ich das auf Spanisch? Und so kam es, dass ich schon mit ein bisschen Vorkenntnissen Spanisch an die Schule gegangen bin und Lehrerin stellte sich eigentlich auch relativ früh raus, dass ich das machen möchte.(Carina Lichtenstein,1/33-44)
Die Verbindung aus persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen und dem Berufswunsch Spanischlehrer/in wird allein an den ersten Passagen des Gesprächs mitCarina Lichtenstein, einer angehenden Spanischlehrerin kurz nach ihrem Ersten Staatsexamen, deutlich.Frau Lichtensteinverbindet das Land Spanien und die spanische Sprache mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte, die sie letztlichauch beruflich prägen sollen.Da dieZufriedenheitals(künftige/r)Lehrer/in nicht nur ein wichtiges privates Thema, sondern auch von akademischemundim engeren Sinnevon professionsdidaktischem Interesse ist, wird sich die vorliegende Dissertation näher mit der VeränderungderEinstellungenvonSpanischlehrenden[1]verschiedener Dienstaltersstufen befassen.
Der Einstieg in das Berufslebendes/derSpanischlehrers/-inhat an verschiedenen Stellen miteinerEntscheidung füroder auch gegendiesenspeziellenBerufswegzu tun. DieEntscheidung für den Spanischlehrberuf wirktsich auf ein ganzes Geflecht weiterer Lebenskontexte des jeweiligen Individuumslebenslangaus.Bei der Auseinandersetzung mit dem Berufswunschund der Berufszufriedenheit alsSpanischlwehrer/in kommt es zur Ausbildung einer individuellen beruflichen Identität.
Dieseist eine wichtige Voraussetzung für eine langfristige Berufszufriedenheit als Spanischlehrer/in. Jedoch bleibt offen, aus welchen Faktoren sich diesebei den (angehenden) Spanischlehrkräftenzusammensetzt und wie sichdieEinstellungen zum Spanischlehrberuf in der Entwicklung zur Spanischlehrpersonverändern.
Grundsätzlichstellt sich für diesequalitativeForschungsarbeit folgende Ausgangsfrage:Wie sieht dersubjektiveEntwicklungsprozess beruflicher Identität von (angehenden)SpanischlehrendenimschulischenKontext des Spanischen als modernerTertiärsprachevon wachsender Bedeutungaus?
Thema dieserqualitativenUntersuchung wirdeseinerseitssein, die „vocational identity“(Holland 1966) von Spanischlehrkräfteninhaltlichzu erfassen, wobei sich dieseeinerseitsvon„d[em]berufliche[n]Selbstverständnis von Fremdsprachenlehrer/inne/n“unterscheidet(Caspari 2003,80),andererseitssollhierbeideridentitätsstiftendeFaktor Berufallgemein(z.B.vgl. Özkul 2011,9)ebenso wie die Prägung durch Alter, Geschlecht und Herkunft (2.2.2.2)aufden BerufSpanischlehrer/inübertragenwerden.Dieberufsbiographische Perspektive (vgl.Caspari 2003; Terhart et al. 1994)wird über berufliche Identität desSubjektsinhalbstrukturierten, „autobiographisch-narrativenInterviews“(Schütze 1983,285)mitje vier angehendenoder bereits ausgebildetenSpanischlehrkräftenaus jeweils vier verschiedenen Etappen der beruflichen Entwicklung zum/zur Spanischlehrer/inerschlossen werden. Dies ermöglicht der fremdsprachendidaktischen Forschung Einblicke in eine Berufsgruppe, die bisher nur punktuellauf die Berufsanfänger/innen hinanalysiert wurde (vgl. Esteve 2011;Frevel 2011).
In dieser Forschungsarbeitwird eszumeinenum die Erforschung der zentralen Frage gehen, wie angehendeSpanischlehrendeihrenBerufswunschsehenund wie die Entwicklung ihrer „beruflichen Identität“ als (angehende) Spanischlehrkräfte inhaltlich aussieht.Mit der Entscheidung,Spanisch lehren zu wollen,ist noch nicht die Frage geklärt, wie diezukünftigenSpanischlehrenden sich selbst undihren Berufswunschund ihre jetzige Berufsabschnittszufriedenheitwahrnehmen.
Dabei solldavon ausgegangen werden, dasssichdas Thema der Berufswahl anviermarkanten Stellen im Berufsleben einer angehenden Spanischlehrpersonstellt, wobei diehierin Klammern genannten Untersuchungen nur die Thematik des Berufswunsches„Lehrer/inwerden“(vgl. Mayr 1994)allgemeinheranziehen,aberinhaltlichnichtdie Gruppe der (angehenden) Spanischlehrkräftethematisieren:
1. Zu Beginn des Studiums (vgl. Nowak 1978;Oesterreich1987;Özkul 2011; Ulich 2004),
2.Nach dem ersten Staatsexamen und während des zweiten Ausbildungsabschnittes (vglz.B.Caspari 2003;Lersch 2003),
3. Als Junglehrer/in (vgl.Terhart et al. 1994).
4.wird es neben diesen dreiInterviewgruppenin der Ausbildung und am Anfang des Berufslebensum die4.Gruppe derbereits im Berufsleben stehenden Spanischlehrkräftegehen, indemspeziellihreBerufszufriedenheit erfasst werden soll. Somit können Aussagenüber dasSelbstbild der angehenden und bereits ausgebildeten Spanischlehrkräfte gemacht werden, wobeibei den bereits ausgebildeten Spanischlehrkräftenan die Stelle des Berufswunsches der Faktor derEinstellungengegenüberdem Berufder/-s Spanischlehrendenrückt.
Das Vorgehen dieser Studie „Ausprägungberuflicher Identitätsprozessevon Fremdsprachenlehrendenam Beispiel der beruflichen Entwicklung von Spanischlehrerinnen und Spanischlehrern – eine qualitative Untersuchung“istqualitativ orientiert. Die Notwendigkeit, qualitativ zu forschen, ergibt sich aus dem Forschungsgegenstand, welcher sich in diesem Fall als „Forschungssubjekt“ (Mayring 2002,19)darstellt – aus den angehenden und bereitsausgebildetenSpanischlehrkräften selbst.Des Weiterendefiniere ichbei einer näheren Klassifikation der vorliegenden UntersuchungalseinequalitativeGesprächsstudie,wiesiein der romanischen fremdsprachendidaktischen Forschungin jüngeren Forschungsarbeiten häufig als „Erhebungsverfahren“ (Mayring 2002,66)gewählt wird (vgl. Caspari 2003;Schädlich 2009).
Dievorliegende Dissertationgliedert sich in dreigroße Blöcke, welche jeweilsdie thematischen Hauptaspekte der Arbeit wiedergeben:
1.Teil–Historische Hinführung (1), Methodik und Konzeptionder Arbeit (2),
2. Teil–Durchführung der Studie (3) und Auswertung der Studie (4) und
3. Teil–Relevanz und Nachhaltigkeit der Studie (5/6).
DerersteTeilder Arbeitstelltzweigeteilthinführende und methodische Aspekte der Forschungsarbeit dar.Im ersten Kapitelwerden zwei Faktoren der Spanischlehrforschung analysiert: die Geschichteund der aktuelle Standdes Spanischunterrichts im Gebiet des heutigen Deutschlands (1.1/1.2) als zentraler GegenstandderVermittlung des Spanischen einerseits und die Geschichte der Spanischlehrkräfte (1.3) alskonstituierendes Element zur Sicherung des Spanischunterrichtsandererseits.
AlsEinstiegfürKapitel 1wurde einRückblick auf die Geschichte desSpanischunterrichtsim Gebiet des heutigen Deutschlands gewählt (1.1), welcherin einer Darstellung mündet, die sich mit dem aktuellen Spanischunterricht und seinen Konzepten befasst (1.2).Exemplarisch werdenim Kontext des Spanischunterrichts auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands ab dem 16. Jahrhundert (1.1.1) und der Problematik der vermittelten Sprachnorm des Spanischen (1.1.2)zwei historischeberufliche Identitäten dargestellt, da das untersuchte Phänomen bereits in der Geschichte der Spanischlehrenden historische Relevanz zeigt, die bis in die Gegenwart fortwirkt(1.1.3).
BesonderefremdsprachendidaktischeFelder wie die Rolle der Mehrsprachigkeit (1.2.1) und dasAuftretendes Spanischunterrichtsin Primar- und Sekundarstufe, bis hin zum Spanischunterricht in der Erwachsenenbildungauf dem Gebiet desheutigen Deutschlands werden thematisiert(1.2.2).Das Kapitel 1schließt mit einem Rückblick auf früheBiographien von Spanischlehrkräften, die bereitsinteressanteHinweise darauf liefern,wiesich Spanischlehrendeschon vor Jahrhunderten Gedanken zu ihrem Beruf und ihrem Selbstbild gemacht haben und Aussagenteilweisebis in dieGegenwarthinein Gültigkeitfür heutige Spanischlehrkräfte besitzen(1.3).Diese historische Komponente soll die gegenwärtige Entwicklung des Berufs der Spanischlehrenden auf besondere Weise erhellen.Kapitel 2befasst sichmitderDarstellungmeinerForschungsmethode und des thematischen Forschungsvorhabens der geplanten Studie.Da es sich bei meinem Forschungsansatz um einen qualitativen Ansatz handelt,behandleichdie zu Befragenden als„Forschungssubjekte“(Mayring 2002,19)und fungiere in diesem Zusammenhang selbst in der subjektiven Rolle der Forscherin, was sich im Abschnitt zum selbstanalytischen Bild derForscherin niederschlagen soll(2.1).Nachdem dieser Aspektderqualitativen Studie erklärt ist, soll eine Begründung zur Wahl des Themas –eine Studie zuSpanischlehrkräftenin der Fremdsprachendidaktikderromanischen Sprachen– folgen (2.2).
Dieser Punkt 2.2 gibt einen umfangreichen Überblick über die bisherigen Forschungsergebnissezur (beruflichen) Identitätsforschung aus den der Fremdsprachenforschung verwandten Disziplinen (2.2.1) undzueinzelnen Aspekten der fremdsprachendidaktischen Forschung in Bezug auf den/dieFremdsprachenlehrer/inwiedasberuflicheSelbstverständnis (2.2.2)als „Hintergrundwissen“ (Strauss/Corbin 1996,31). Dies gilt auch für dieBerufs- und Studienfachwahlmotiveunter Einbezug der Motivations-und Einstellungsforschung (2.2.3)sowiefür dieberufsbiographischenZugänge(2.2.4). Neu wird in dieserDiskussionder Begriff der „beruflichen Identität“von(angehenden)Spanischlehrkräftensein (2.2.1/2.2.2), der erst durch die Studie erschlossen werden muss.In der Darstellung der Studien zu denBerufswahl- und Studienfachwahlmotiven(2.2.3, besonders:2.2.3.3)solleninsbesondereStudien näher betrachtet werden, die die Faktoren Geschlecht, Alter und Ethnie von Probanden in ihreStudieintegrierthaben (2.2.3.2), da diese Kriterienvermutlich auch für die vorliegendeStudieeine Rollespielen (vgl. „Vorannahmen“ inStrauss/Corbin 1996,56).
Darüber hinaus beschreibt2.3 die Vorgehensweise der Studie als eine Verzahnung aus„Subjektive[n]Theorien“ nach Groeben et al.(1988),„Grounded Theory“ nachStrauss/Corbin(1996) und des „autobiographisch-narrativen Interviews“nach Schütze (1983,285), die einander aufgrundder Anlageder Studie besonders im Hinblick auf ihre Analyseverfahren der Lehreraussagenergänzen.
IndieserStudie wird davon ausgegangen, dass zwei Perspektiven eine Rolle spielen. Zunächstwirddie berufsbiographische Perspektiveanalysiert, die sowohl angehende als auch bereitsausgebildeteSpanischlehrkräfte betrifft, daAngehörigebeiderGruppen jeweils einen individuellen Weg durchlaufenhaben, um zu ihrem Berufswunsch beziehungsweise der Ausübung des Berufs der Spanischlehrpersonzu gelangen.Die Perspektive der Einstellungen derbereitsausgebildeten Spanischlehrkräftewirdinsbesonderedurch„[d]as Forschungsprogramm Subjektive Theorien“ (Groebenet al.1988,1)erschlossenwerden,da die Einstellung zu einem Beruferst bei dessen Ausübungbegründet entwickeltwird, womit die Spanischlehrendenein differenzierteres BildvonihremBeruf aufgrundihrerPraxiserfahrungen als dieBerufsanfänger/innen oder Studierendenaufweisen.Die Einstellungender angehenden Spanischlehrkräfte zu ihrem Berufswunsch können eingeschränkt im Hinblick auf Erwartungen an ihren Lehrberuf ebenfalls durch die „Subjektive[n]Theorien“(Groeben et al.1988)erfasstwerden, wobei vor allem die motivationalen und diedasStudienfach betreffenden Komponenten(2.2)in die Untersuchung der angehenden Spanischlehrkräfte mit einfließen sollen.Besondere Berücksichtigung soll dadurch„[d]as Forschungsprogramm SubjektiveTheorien“ (Groeben et al. 1988,1)finden, dasvon Lechler (1982) den Vorgang der „[k]ommunikative[n]Validierung“ (Lechler 1982,243 ff.) übernommen hat[2],daseine Verifizierung derAussagender Befragtenin dialogischer Perspektivebegünstigensoll.Durchdie‚Grounded Theory‘werden ergänzend neue Aspekte der Datenerhebung gleichzeitig in die Auswertung übertragen,indem währendder Auswertung der Interviews auch ein Verfahren von „Stop and Memo!“ (vgl.Strauss/Corbin 1996;Mayring 2002,106)eingeleitet wird.Dadurch erfolgteinesystematischeKategorisierungder Einzelaussagen der Interviewtenunter Zuhilfenahme der„Prozeßstrukturen des Lebensablaufs“ (Schütze 1981,67). Ziel dieser Kategorisierung wird die Erfassung der „Innenperspektive“ (Kallenbach 1996,17)derBefragten sein.Durchden Ansatz der zu Befragenden als„Forschungssubjekte“(Mayring 2002,19)(2.2.2)handeltmeine Untersuchung vorrangigauchvonMenschen mitihrenindividuellenLebensplänen, die zum Berufder Spanischlehrpersonführ(t)en.Begründung undRahmenbedingungen zurAuswahl der Interviewpartner/innenerfolgenauf der Basis eines ersten Probeinterviews(2.3.4).Neben der bereits erläuterten Methodentriangulation[3]muss das ‚Sample‘offengelegt werden (2.3.5):Es handelt sich in meiner Untersuchung aufgrund des Themas umhalbstrukturierte, autobiographisch-narrative Interviewsvoninsgesamt 13Einzelfällen, wobei die Problematik desEinzelfallsebenfalls erläutert wird(2.3.7).Die Aufbereitung der Erhebungsdatenwird als„kommentierte[]Transkription“ (Mayring 2002,94)durchgeführt (2.3.6).Darüber hinaus soll die Erstellung des Interviewleitfadens auf der Basis von „Hintergrundwissen“ (Strauss/Corbin 1996,31)transparent gemacht werden(2.3.8).Nach dem Prinzip der „Grounded Theory“ (Strauss/Corbin1996)wird nach derKonzeption meines Interviewleitfadensfür die Hauptstudieeine Forschungsfrage formuliert, die den Ausgangspunkt für die Forschung im ‚Feld‘ darstellt (2.3.9).
ImzweitenTeilder ArbeitbefasseichmichinKapitel 3mit der Durchführung der Hauptuntersuchung underläuteredie transparente Umsetzung desMethoden- und Konzeptkapitels 2.Eine übergeordnete Rolle nimmt imZweite[n]TeilKapitel 4ein, das sichmitder Auswertung der Gesprächsaussagen der Gesprächspartner/innenaus den vier verschiedenen Spanischstudenten˗/lehrergruppenbeschäftigt.Dabei wird je ein Einzelfall aus der Gruppeder Studienanfänger/innen, der Referendare, der Junglehrendenund derSpanischlehrendenexemplarischmit den Auswertungskriterien der oben beschriebenen Theorietriangulation aus„Struktur-Lege-Technik“(Groeben/Scheele 1988,1)der„Subjektive[n]Theorien“ (Groeben et al. 1988,1),der Kategorienbildung ausGrounded TheorynachStrauss/Corbin(1996)unddem „autobiographisch-narrativen Interview[]“(Schütze 1981,285)ausgewertet(4.1˗4.4).IndenAbschnitten 4.1 bis 4.4wird exemplarisch ein Einzelfall aus der jeweiligen Gruppenach dem „autobiographisch-narrativen Interview[]“von Schütze (1983,285)analysiert, weitere Gespräche werden in einem Kurzprofildargestellt.ZwischenauswertungenweitererEinzelaspekte jeder Gruppewerdenin einem abschließenden Schritt am Ende jedes Unterkapitels zusammengefasst (4.1.7, 4.2.6, 4.3.6, 4.4.7) undalsAusgangsbasis für zusammenfassende Erkenntnissedes „kontrastiven Fallvergleichs“(Schütze 1983,286)betrachtet.Diese stellendie Kernaussagen derbefragten(angehenden) Spanischlehrkräftein ihrer Gesamtschauin der maximalen Fallkontrastierung (vgl. Schütze 1983,292f.)dar(4.5).
Alsdritter Teilder Arbeitwird abschließend das Großkapitel„zur Konstruktion eines theoretischen Modells“ (Schütze1983,288,Hervorhebungim Original) undzur Relevanz derStudie für die fremdsprachendidaktischeForschung,insbesondere derDidaktik desSpanischen als Fremdsprachein Deutschland,zur Illustration derNachhaltigkeit des Forschungsvorhabens(Kapitel 5) und als Resümee (Kapitel 6)behandelt.
Zunächst wird das Theorem berufliche Identitätsprozesse (5.1) in seiner soziokulturellen (5.1.1), seiner sprachenpolitischen (5.1.2) und seiner Ebene der Berufsabschnittszufriedenheit (5.1.3), darunter in seinen Ausprägungen (5.1.4) des Aufbaus (5.1.4.1), Ausbaus (5.1.4.2) und seiner Abbau-/Stagnationsprozesse (5.1.4.3) vor dem Hintergrund von synergetischen und divergierenden Identitätsprozessen (5.1.5) behandelt.Zweiverschiedene Arten der Relevanztreten weiterhin auf: Einerseitsdie Bewertung der Methodologie der Studie in der Rückschau (5.2), wie die Triangulation in Bezug auf die Erhebungstechniken (5.2.1),die Stoßrichtung der Studie(5.2.2) sowie methodenspezifische Relevanz in der fremdsprachendidaktischen Forschung (5.2.3).Die methodenspezifische Relevanz (5.2.3) ist ebenso wiedie allgemeine Relevanz für die fremdsprachendidaktische Forschung in Deutschland (5.3.1) von Bedeutung. DerNutzen für Fort- und Weiterbildungen (5.3.1),aber auch die Grenzen der dargestellten Studie (5.3.2), die Anknüpfungspunktefür weitere Forschungen (5.3.3) und derBlick aufdie Spanischlehrkräfte (5.3.4)sollen abschließend illustriert werden.Diese Betrachtung mündet in eineZusammenschau der allgemeinen und methodischen Relevanz, die zu einer Gesamtrelevanz der Studie führt (5.4).DerDritte Teilendet miteinem Resümee undeinemAusblick in Bezug aufdiequalitativeStudie, die die Forschung in einen größeren Kontextvon Fremdsprachenforschung und Identitätsforschungstellt (Kapitel 6).
Die Orthographie dieser Arbeit folgt der neuen deutschen Rechtsschreibung, folgt jedoch, was Zitate betrifft, dem jeweiligen Stand der Orthographie der Zeit.
Als häufige Abkürzungen werden folgendeeinzelneKürzel verwendet: „B.V.V.“ für „Beate Valadez Vazquez“, „bzw.“ für „beziehungsweise“,„ebd.“ für „ebenda“,„FN“ für Fußnote,„S.“ für „Seite“,„u.a.“ für „und andere“,„vgl.“ zur „vergleiche“,„z.B.“ für „zum Beispiel“,„Z.“ für „Zeile“. Da diese Liste von geringem Umfang ist, wird auf ein separates Abkürzungsverzeichnis für diese Arbeit verzichtet.
Erster Teil –von der diachronenEntwicklung beruflicher Identität von Spanischlehrendenund des Spanischunterrichts zu aktuellen beruflichen Identitäten
1 Berufsbiographische und geschichtlicheEntwicklungen Spanischlehrender und ihres Spanischunterrichts auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands
Zunächst wirddie GeschichtedesSpanischunterrichtsauf demGebietdes heutigen Deutschlandsvoncirca 1600 bis in die heutige Zeitanalysiert,wobei dieberufliche Identität[4]ausgewählter Spanischlehrenderbesondere Berücksichtigung in dieser Darstellung findet. Anschließend sollen aktuelle Konzeptedes Spanischunterrichts wie das Konzept derMehrsprachigkeit unddie Bedeutung des Spanischen in der Schul- und Erwachsenenbildung betrachtet werden,umeinen aktuellen Einblick in die gegenwärtige Situation des Spanischunterrichtszugeben. Dies dient als Ausgangspunkt für dieBeschäftigung mit aktuellen beruflichen Identitätskonstruktionen imZweitenundDritten Teildieser Studie.
Um die Thematik derberuflichen Identität(sieheKapitel2.2)derSpanischlehrendenin einen geschichtlichenZusammenhang zu bringen,wirdein geschichtlicher Rückblick auf Zeugnisse von Spanischlehrenden, die im Gebiet des heutigen Deutschland unterrichteten,eine diachrone Sicht auf dieberuflicheIdentitätvonSpanischlehrendenvergangener Jahrhundertegeben. Zugleichsolleine gewisse Dauerhaftigkeit von„Subjektiven Theorien“ (Schlee 1988b,28)trotz zeitlichen Wandels dargestellt werden. Bestimme Teile derberuflichen Identitätdieser ausgewählten historischen Spanischlehrer, über die uns Zeugnisse erhalten geblieben sind, sind(‚Methode des ständigen Vergleichens‘ in Glaser/Strauss32010,115)mit den Aussagenheutiger Spanischlehrkräftevergleichbar. Damit wird eine gewisse„Historizität“ (Mayring 2002,34)desTheoremsderberuflichen Identitätsprozesseaufgezeigt.
1.1Berufliche Identitätenausgewählter Spanischlehrerund dieGeschichte desSpanischunterrichts
Die Relevanz dieses historischen Bezuges wird legitimiert durch die„theoretische Sensibilität“(Strauss/Corbin 1996,25)der‚Grounded Theory‘ nach Strauss/Corbin (1996), dem sorgsamen Umgang mit Daten. Welcher Art diese Daten für das Forschungsvorhaben sind, erfährt der Forscher aus der Dreiteilung von Strauss/Corbin (1996,25-26, Hervorhebung im Original) aus der„Literatur“,der„[b]erufliche[n]Erfahrung“undder „[p]ersönliche[n]Erfahrung“. Diese Aspekte sollen auch meine Arbeit gliedern: In diesem Kapitel wird die historische Perspektive auf die berufliche Identitätder Spanischlehrer skizziert. Die Informationen zu denSpanischlehrern,bei denen es sich bis ins 19. Jahrhhundert meist aussschließlich um Männer handelte, lassen sich logischerweise nicht aus persönlichen Interviews ableiten, da uns derart authentische Zeugnisse aus der damaligen Zeit fehlen. Notwendigerweise muss ich mich daher auf die Metaliteratur über die Berufsbiographien und die Lernerbiographien der Spanischlehrenden berufen, um indirekt ein Bild von der beruflichen Identität der Spanischlehrenden der frühen Neuzeit bis ins 19.Jahrhundert zu erhalten. Allerdings kann aufgrund derfehlenden Möglichkeit der Überprüfung mit dem Feld kaumAnspruch auf Vollständigkeit für die Darstellung des Portraits der hier vorgestellten Spanischlehrenden erhoben werden. Daneben wird meineBerufsbiographiein 2.1 diskutiert und analysiert, wonach Aspekte aus den fachdidaktischen Bezugswissenschaften, der Psychologie, der Pädagogik und der Soziologie, bezogen werden, um die Fragestellung zu konkretisieren (vgl. Meinefeld 2012,270). Unter diesen Aspekten der„theoretische[n]Sensibilität“(Strauss/Corbin 1996,25)wird ab Kapitel 3 die Generierung einerGrounded Theoryzu Spanischlehrenden in Deutschland erfolgen. Als Voraussetzung für diesemethodischeVorgehensweise isteinreflektierterUmgang mitdieser Sensibilisierung über die verschiedenenArten von (Vor˗)Wissen erforderlich:„Zugegeben, es ist nichtleicht, das eigene Wissen und die eigene Erfahrung kreativ anzuwenden, während man gleichzeitigan der Wirklichkeit desPhänomensfesthält, anstatt ausschließlichkreativdarübernachzudenken.“ (Strauss/Corbin 1996,27)
Idealerweise sollte der Forscher für ein „[…]Wechselspiel zwischen Kreativität und den durch Übung und Ausbildung erworbenen Fertigkeiten[arbeiten].“ (Strauss/Corbin 1996,30)Zur Vereinfachung dieser Forderunghelfen so genannte „sensitizing concepts“ (Blumer 1954,7)deneigenenForschungsprozesszu strukturieren, ohne dabei eine zu starke Beeinflussung durch die Fachliteratur zu erfahren, was vielfach als Gefahr des„Vorwissen[s]“angesehen wird (vgl. Glaser/Strauss32010,19;Meinefeld 2012,247).
·Geschichte derSpanischlehrenden
Eine separate Darstellung der Geschichte des Spanischunterrichts wird notwendig,umdie einander bedingende Beziehungzwischen den ParameternSpanischunterrichtund Spanischlehrpersonauf historischer Ebenezu skizzieren.Dies entspricht der Prämisse, qualitativ auch historisch zu forschen: „Die Gegenstandsauffassung im qualitativen Denken muss immer primär historisch sein, da humanwissenschaftliche Gegenstände immer eine Geschichte haben, sich immer verändern können.“ (Mayring 2002,34)
Dabei stellt sich die berufliche Identität der Spanischlehrenden im Kontext ihres Spanischunterrichts und der historischen Rahmenbedingungender Zeit dar.Die Darstellung des Spanischunterrichtsin Deutschland war bereits Thema in denForschungszweigenderFremdsprachendidaktik undderSprachlehrforschungin Deutschland(vgl.Helle 1993; Hüllen 2005; Lehberger 2003; Niederehe 1992;Steinhilb 1985;Szyska 2008;Voigt 1991; Voigt 1998;in der externen SprachgeschichteSpanischauch Franzbach 1975). Dabei sollenim Folgendenhistorische Ereignisse nur thematisiert werden, wenn sie unmittelbar von Belang für dieberuflicheEntwicklung der Spanischlehrenden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlandssind.
Grundsätzlich findenberuflicheTätigkeiten,die zwar eine Form der Institutionalisierung einer fremdsprachlichen Lehr˗Lern˗Tätigkeit des Spanischen darstellen, jedoch nicht direkt auf die Ausbildung späterer Spanischlehrkräfte im Gebiet des heutigen Deutschlands abzielen, hier nur kurze Erwähnung.
Die Tradition der Übersetzerausbildung istdurch historisch gewachsene Institutionen wiedieÜbersetzerschule von Toledoim13. Jahrhundert(vgl. Voigt 1998,23) für das Spanische zwarvorhanden, über die Abläufeder Übersetzertätigkeitenin Deutschland istallerdingswenig bekannt.Voigt (1998,30˗31) nennt an dieser Stelle viele Einzelbeispiele von Übersetzern zumeist literarischer und religiöser Texte, jedoch keine Übersetzerschule direkt. Voraussetzung war auch hierfürdie Übersetzer die Doppelrolle vonperfekten Spanischkenntnissen(vgl. ebd.,30) undder Rezeption der übersetzten Literatur andererseits, die viele deutschsprachige Leser zur Lektüre spanischsprachiger Autoren anregte (vgl. ebd.,30). Die Verquickung der Tätigkeitsbereiche in Bezug auf die spanische Sprache wird auch an den Zeugnissen deutlich, die in dieser Zeit durch die Spanisch˗Deutsch˗Übersetzer entstanden: „In den vierziger bis sechziger Jahren[des 16. Jahrhunderts] erschienen in verschiedenen deutschen Städten etwa ein Dutzend Bücher in spanischer Sprache, meist mit humanistischer oder religiöser Thematik.“ (Voigt 1998,30)Ein weiteres Merkmal für die Klientel, die diese übersetzte Literatur bezog, war in der vor allem im Mittelalter nicht nur in den Klöstern als Bildungssprache dominierenden Übersetzung ins Lateinische zu sehen (vgl.Glücket al. 2013,248; Voigt 1998,31). Der Berufsstand des/der Übersetzer/in vom Spanischen ins Deutsche existiert noch bis heute und wird an Beispielen wie den in Deutschland vereidigten Dolmetschern/innen für die spanische Sprache deutlich.
Die Institutionalisierung dieser Disziplin schlägt sich imheutigenHochschulbereich in den Bereichen der „Translationsdidaktik“ (Fleischmann1997,1) sowie der „Übersetzer- und Dolmetscherausbildung“ (Lauterbach 1997,168) nieder. Der Lehr-Lern-Kontext bezieht sich hierbei jedoch auf die Weitergabe von Übersetzungsmethoden, sodass die Zielrichtung dieser Disziplin nicht zu vergleichen ist mit dem Anspruch, den die Institution Schule in Bezug auf das Erlernen von Spanisch als Fremdsprache hat.[5]
1.1.1 Geschichte des Spanischunterrichts als Bindeglied zwischen Spanischlehrendenund ihrenberuflichen Identitäten
Die folgende Darstellung der beruflichen Identität der Spanischlehrerbeginnt mit dem 16. Jahrhundert, denn„[e]rst als Spanien im 16. Jahrhundert zu einer politischen und militärischen Führungsmacht in Europa erstarkt, kommt es in der Folge auch zu einer verstärkten Beschäftigung mit der spanischen Sprache in Deutschland.“ (Voigt1991,126)Ob bereits schon vor dem 16. Jahrhundert Spanischunterricht auf dem Gebiet des heutigen Deutschlandsstattgefunden hat, ist nicht genau bekannt: „Möglicherweise ist schon im 16. Jahrhundert der Erwerb des Französischen, Niederländischen, Englischen und Spanischen in Hamburg –stets als Privatinitiative und durch Privatunterricht – so selbstverständlich, dass die Quellen sich darüber ausschweigen.“ (Schröder 1989,12)
Dabeiverhält sich ein Teil dieserberuflichen Identitätder Spanischlehrerbis ins 19./20. Jahrhundertkonstant:die„Geschlechtsidentität“(Fuhrer/Trautner 2005,393).Es existieren keine konkreten Hinweise darauf, dass es neben den fast ausschließlich männlichen Spanischlehrenden auch weibliche Spanischlehrende gab.Die Tätigkeiten vonSpanischlehrerinnen, beispielsweise Nonnen in Klöstern,wurden wenigdokumentiert.Die Klöster galten als die Orte, an denen das Spanische durch Bücherbestände gepflegt wurde (vgl. Voigt 1998,26). Auch die Lehrpersonen, neben Mönchen auch Nonnen, beherrschten auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands die spanische Sprache. Hier das Beispiel einerKölner Karmeliterinnenschwester aus dem 17. Jahrhundert (vgl. Hennes 1850,30): „Diese Priorin, Schwester Klara vom Kreuz, war berühmt dafür, dass sie ein so schönes reines seelenvolles Spanisch schrieb.“ (ebd.,30)DieberuflicheIdentität dieser Schwester war zusätzlich durch ihre Sprachfertigkeiten bestimmt.Insgesamt kann im 16. Jahrhundert eine starke Bindung zur Religiosität bei dem Erlernen des Spanischen verzeichnet werden, sei es bei Wall- oder Pilgerfahrten (vgl. Voigt 1991,124; vgl.Voigt 1998,24) oderin Klöstern(vgl.ebd.,24).Diese Tendenz bestimmt auch noch weitgehend dieberufliche Identität der Spanischlehrenden des 17. Jahrhunderts, wie es bei HeinrichDoergang(k) der Fall war (vgl.Briesemeister 1992,38).
Ein doppeltes Berufsbild ergibt sich aus den Lehrbuchautorenzur spanischen Sprache, die oft gleichzeitig auch Spanischlehrende waren (vgl. Voigt 1998,31). Auffällig ist,dass dieseLehrbuchautorenim deutschsprachigen Raumdes16. Jahrhundertsnoch anonymwaren(vgl. Voigt 1998,27). Gründe dafür könnten im Prestige des Spanischen im 16. Jahrhundert liegen, das erst langsam anstieg (vgl. Voigt 1998,26). Diese Anonymität lässt die berufliche Identität der damaligen Spanischlehrenden nur indirekt über ihren Schreib- und Methodenstil in ihren verfassten Lehrbüchern sichtbar werden. Niederehe(vgl.1992,135)beschreibt die Notwendigkeit des indirekten Zugriffs auf denSpanischunterricht über die darin verwendetenLehrbücher. Ein ähnlicher Zusammenhang besteht zwischen den historischen Spanischlehrbüchern und ihren Autoren, die gleichzeitig häufig auch das Spanische vermittelten.AusbestimmtenInformationen in denvon ihnen verfassten Spanischlehrbüchern lassen sich InformationenüberdieberuflicheIdentitätihrer Verfasserableiten.Voigt(1998)weist darauf hin, dass die Zeugnisse, die wir über dieSpanischlehrendender frühen Neuzeitbesitzen, „[…] spärliche Hinweise […]“ (Voigt 1998,23) seien.Fürdieberufliche Identität der Spanischlehrendenist es daher sinnvoll, die einzelnen TätigkeitsbereichedieserSpanischlehrendendarzustellen (vgl. ebd.,24 ff.),wobeiEinzelpersonenkeine namentliche Erwähnung finden. Wenige Darstellungen liegen zu individuellen Berufsbiographien von Spanischlehrenden vor, da die verschiedenen Tätigkeitsbereiche ein Kollektiv von Spanischlehrenden erfassen,dasdie Einzelberufsbiographie nicht näher in den Vordergrund treten lässt.
Im 17. Jahrhundert verändertsich der Typus des Lehrbuchverfassers:er wirdjetzt mit Namen genannt, vereintweiterhin die Doppelrolle desVerfassers von Lehrbüchern und des Lehrersder spanischen Sprache in sich. Dies istbei dem „[…] ersten namentlich bekannten Sprachlehrer [ ] Heinrich Doergang […]“ (Voigt 1998,31) der Fall. So kennt dieserdie Theorie wie auch dieLehrpraxis, die einander bedingen: „[…] Doergang […] warlinguarum gallicae, italicae et hispanicae Professorin Köln und unterrichtete selbst, 1614 gab er ein Lehrbuch für das Spanische heraus,dieInstitutiones in linguam hispanicam[…].“(Voigt 1998,31, Hervorhebungim Original)In Kapitel1.1.2 wirdauf die berufliche Identität von Heinrich Doergang(k) noch näher eingegangen.Mit Spanischlehrenden wie Doergang(k)entwickelt sicheine Berufsgruppe von institutionalisierten Lehrkräften, die entweder an der Universität (vgl. Voigt 1991,127)oder ab dem 17. Jahrhundert erstmals in derInstitution Schule unterrichten: „Der Beginn für den ersten institutionell erteilten, nicht universitären Spanischunterricht läßt sich gegenwärtig auf das Jahr 1618 datieren.“ (ebd.,127)Damit ist der beruflichen Identität der Spanischlehrenden erstmals, wiein der Moderne auch, eininstitutionell spezifisches Berufsprofil zugeschrieben. Bei denMotivendes Erlernens des Spanischen bleibt im 17. Jahrhundert der pädagogische Aspektjedochnoch unerwähnt: „Es sind vielmehr aktuelle politische, wirtschaftliche, kulturhistorische und persönliche Erwägungen, die zum Studium des Spanischen führen.“ (Franzbach 1975,26)
Seit dem 15. Jahrhundert (vgl. Voigt 1998,28) bis zur Institutionalisierung des Unterrichts durch Handels- und Berufsakademien im 18. Jahrhundert (vgl. Voigt 1991,127) existiertebenfalls eine berufliche Identität: die des Hofmeistersals Spanischlehrender oder auch Sprachmeister. Der Berufsbereich des „so genannten Sprachmeister[s]“ (Voigt 1998,28) gleicht dem Berufdes „Hofmeisters“ (Fertig 1979,3). Mit diesem Beruf ist eine besondere Art von Hauslehrer gemeint, der „[…] Privatunterricht in wohlhabenden Bürgerhäusern oder den Residenzen des Adels, aber auch an Universitäten, Ritterakademien[6]undillustrenGymnasien [erteilte].“(Voigt 1998,28, Hervorhebungim Original) Spanisch war an den Ritterakademien obligatorisch: „Auf dem Lehrplan der Ritterakademien stehen neben ‚praktischen‘ Fächern wie Geographie, Technologie oder Fechten insbesondere neuere Sprachen, primär Französisch, aber auch Italienisch und Spanisch sowie später Englisch.“ (Lehberger 2003,610) Somit unterrichtetederSpanischlehrende frühervor allem eine bestimmte Klientel an Schülern. Dieses Berufsbild geht laut Fertig(1979)auch auf die Tradition der Privaterziehung des 17. und 18. Jahrhunderts zurück, in der
Schulen üblicherweise als Institution begriffen wurden, deren man sich bedienen konnte, nicht mußte. […] Man schickte die Kinder zur Schule – oder ließ es bleiben, wenn es nicht opportun erschien. Sie war eben noch keine Bildungsbehörde mit übermächtigerVerfügungsgewalt. (Fertig 1979,5)
Hofmeisterwerden als Lehrpersonen im 18. Jahrhundert weiterhin benötigt(vgl. Fertig1979,62), „als die Verschulung der Gesellschaft schon beträchtliche Fortschritte gemacht hatte“ (ebd.,3).DieAnstellung eines Hofmeisterswird wie folgt beschrieben: „[Ein] solcher Mensch kostet etwan einhundert und funffzig Thaler oder zweyhundert Thaler das Jahr/ und diese bringet er / wenn es ein recht honetter und gescheueter Mann ist / dreymalwiederum ein […].“ (Bohse 1706,49) Wie sah also das Profil eines „Hofmeister[s]“ (Fertig 1979,3) aus? „Elegant muss der Lehrer sein, redlich, gelehrt, sprachgewandt, in jeder Hinsicht tugendhaft, kurz: Ein Universalgenie ist gerade recht.“ (Fertig 1979,46) Ein exaktes Berufsprofil war dennoch nicht mit diesen Erwartungen in der Realität vermacht: „[Das] Dasein als Hauslehrer hatte selten einen Eigenwert und wurde oft nicht im Sinne eines irgendwie gearteten Berufsethos aufgefaßt. Die Grenzen zu anderen Tätigkeiten waren fast immer fließend […].“ (Fertig 1979,4) Dennoch wurde „[…] Fremdsprachenunterricht […] für sie zu einer möglichen Erwerbsquelle. Hier und da begannen sog. Sprachmeister ihre Dienste anzubieten […].“ (Voigt 1998,28) Die Ausbildung derHofmeister oder Hauslehrervariiert im Einzelfall. Dadurch wurdendie Kinder des Haushalts durchihn auch nicht motiviert, denn
[…] [sie] [ließen] [sich] nur ungern von dem dahergelaufenen Habenichts dreinreden […]. Ihr Lerneifer wurde durch die Tatsache ja nicht gerade beflügelt, dass sie aufgrund ihrer sozialen Lage keinen Zusammenhang zwischen Lernerfolg und späterer Karriere erkennen konnten, da sie wussten, dass sie auch ungebildet herrschen würden. (Fertig1979,66)
Was die Sprachkenntnisse des Hofmeisters betraf, so sollte dieser möglichst viele Sprachen vorweisen können: „Das neunte Kapitel hält die Erlernung der Sprachen/ als der Teutschen/ Lateinischen/ Französischen/ Italienischen/ Englischen/Griechischen/ und sofort in sich/ welche unter denenselben und wie weit eine jedwede Jungen von Adel oder einem Bürgerlichen Nutzen bringe." (Bohse 1706,7) In dieser Einleitung zur Anleitung des Lebens als Hofmeister mit seinen Pflichten von Bohse(1706)fehlt die Auflistung des Spanischen,wasjedoch im neunten Kapitel erwähnt wird:
§. 36. Die Spanische Sprache hat mit der Italienischen grosse Verwandtschaft/ wer also erst Italienisch kan/ und so dann selbige zu begreiffen einige Zeit daran wenden wil/kan bald dazu gelangen/ solche verstehen zu lernen. Sie ist zwar wenig in Übung bey uns Teutschen/ es müßte in etwas am Käuferlichen Hofe seyn. Aus ihren Schrifften aber ist viel gutes zu nehmen; zumal was die Staats-Maximen und politische Anmerckungen betrifft/wie davon Savedra, Gracian und Mariana in ihren herausgegebenen Büchern genugsam darlegen.(Bohse 1706,365˗366)
Dieser Abschnitt zeigt, dass das Spanische als Fremdspracheauf dem Gebiet des heutigen Deutschlandim 18. Jahrhundertzwar eine gewisse Vermittlungstradition besitzt, diesejedoch weitaus kleiner ausfälltals die Beschäftigung mit dem Französischen alsFremdsprache (vgl. Voigt 1998,34). Dennoch gehört das Spanische als Fremdspracheals Teil der beruflichen Identitätin das Profil des Hofmeisters im Gebiet des heutigen Deutschlands. Bohse(1706)begründet die Ähnlichkeiten zwischen dem Spanischen und Italienischen, wobei das Italienische von allen romanischen Sprachen zur damaligen Zeit die beliebteste war,"[...] da anjezo an die vielen Höfen die Italienische Sprache weit höher als die Französische geachtet wird [...]" (Bohse1706,362). Vielleicht wird deswegen und zur Lernerleichterung auf die Parallelen zwischen den beiden Sprachen verwiesen.[7]
Eine weitere Notwendigkeitbestehtin der Vermittlung derspanischen Sprache durch HofmeisteralsWissenserwerb für kaufmännische Tätigkeiten (vgl.Bohse 1706,365).Gerade dieser Bildungszweigersetztschrittweise den Hauslehrer, insbesondere die Hofmeister:„Mit den öffentlichen Bürgerschulen bildete sich allmählich eine ernsthafte Alternative für den privaten Hausunterricht heraus, die sichschließlich durchsetzen und demPrivatunterricht seine beherrschende Rolle streitig machen sollte.“ (Voigt 1998,35) Diesistder Beginn der Institutionalisierung des Spanischen als Fremdsprache, die später flächendeckend für ganz Deutschland ab dem 19. Jahrhundertvorherrschen sollte (vgl. ebd.,36).Sprachliche Bildung stelltdamit kein Zufallsprodukt mehr dar, das vom Kenntnisstand des jeweiligen Hofmeisters abhängig war, sondern orientierte sich auch an dem Ausbildungsniveau der Spanischlehrkräfte, was jedoch durch eine Unterrepräsentation des Spanischen als Fremdsprache sowohl in der Lehrerbildung als auch in der Schule selbst nicht ausreichend gefördert wird(vgl. Voigt1998,41˗42).
Im 18. Jahrhundert erfolgt im Nordenund im Südendes heutigen Deutschlands eine Institutionalisierung der Vermittlung der Spanischen Sprache “[…] in der Hansestadt Hamburg, die neben Sachsen und den süddeutschen Handelszentren Nürnberg und Augsburg, einen der Schwerpunkte für diese Sprache darstellte.”(Voigt 1998,35) Daraus leiten sich Berufsbilderund ihre spezifischen beruflichen Identitätenab, die sich an dieser Vermittlung des Spanischen als Fremdsprache beteiligten:„die „Handelsakademie Büsch[…] Ihr Initiator und Betreiber war der Gymnasialprofessor Georg Büsch […].“ (ebd.,35) Zusammen mit „[e]ine[m] der Lehrer an der Akademie […] Christoph Daniel Ebeling, ein enger Mitarbeiter und Freund von Büsch […]“ (ebd.,35) wurde derSpanischunterricht in Hamburg institutionalisiert und war damit an Lehrpersonen gebunden.
Ein berühmter Schüler dieser Handelsakademie, die in ihrem Sprachangebot auch das Spanische enthielt (vgl. Voigt 1998,35), war Alexandervon Humboldt (vgl. Kletke 1805,546).Durch Alexander von Humboldts Aufenthalt an der Handelsakademie Büsch wird ihm auch Gelegenheit gegeben, moderne Sprachen wie das Spanische zu erlernen (vgl. ebd.,546),dieer später auch für seine Süd˗und Mittelamerika˗Expeditionen benötigen sollte (vgl.Humboldt 1807,226).Vor dem Aufbrechen nach „Spanisch-Amerika“(vgl. ebd.,117), wie Humboldt es nannte, eignete er sich erweiterte Spanischkenntnisse in Spanien selbst an,während er auf die Erlaubnis des spanischen Königs zur Ausreise nach Mittel˗und Süd˗Amerika wartete (vgl. ebd.,226).DieseLernerfahrung inSpanien, dieaus heutiger didaktischer Sicht als interkulturell bezeichnet werden könnte(vgl. KMK 2004,3),beeinflusst auch Humboldts Südamerika-Aufenthalt, so dass ersich zu Forschungszwecken lieber selbst auf Spanisch oder in der jeweiligen Indígena-Sprache mit den Einwohnern des Landes unterhält als einen Dolmetscher zu Rate zu ziehen (vgl. ebd.,87).Das Unterrichten bleibt Angelegenheit der Missionare, die in der Vermittlung des Spanischen unterschiedlich großen Erfolg verzeichneten:
In den Augen der Eingeborenen ist jeder Weiße ein Mönch, ein Pater; denn in den Millionen zeichnet sich der Geistliche mehr durch die Hautfarbe als durch die Farbe des Gewandes aus. Wie wir auch den Indianern mit Fragen, wie weit es noch sei, zusetzten, sie erwiderten offenbar aufs Geratewohl si oder no (ja oder nein), und wir konnten aus ihren Antworten nicht klugwerden.(Humboldt/Bonpland 1911,67)
Allerdings wird aus Angaben Alexander von Humboldtsdeutlich, dasszur Vereinfachung weiterhin Schriftstücke in der damaligen Hofsprache Französischabgefasst wurden: „Da der König nicht genug Deutsch, Humboldt aber nicht genug Spanisch verstand, so vereinigte man sich auf das beiden wohlbekannte Französisch als Sprache der Abfassung.“ (Humboldt 1807,223)Dennoch kann dieberufliche IdentitäteinesAlexander von Humboldtnicht mit der eines Spanischlehrers gleichgesetzt werden, da Alexander von Humboldteher Naturforscher (vgl. ebd.,121)und nicht wie seinBruder Wilhelm von HumboldtSprachforscher war:
Dieletzten fünfzehn Lebensjahre […]waren hauptsächlich der Sprachforschung und Sprachphilosophie gewidmet. […] Dank seiner enormen sprachlichen Begabung erwarb er [, Wilhelm von Humboldt,] sich umfassende Sprachkenntnisse in Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Latein, Baskisch, Provenzialisch (sic: Provenzalisch), Ungarisch, Tschechisch und Litauisch. (Wang 1996,35)
AußerderNotwendigkeit zur Vermittlungder Spanischen Sprache in Wirtschafts- und Handelszentren an Interessierte wie Alexander von Humboldt sind weitereBeschäftigungen mit dem Spanischen inHandel und Schifffahrthistorisch gewachsen.Parallel dazuschreitetdie Institutionalisierung des Spanischendurch dieEinbindung in den schulischen Lehrplan erst mit der „Reform des höheren Schulwesensund der Gymnasien“ (Voigt 1998,36) voran. Dadurch verändertsich auch die Rolle der Spanischlehrer, wobei hier wiederum nur Männer gemeint sind, da Frauen bis dato noch nichtals Vertreterinnenderinstitutionell unterrichtendenSpanischlehrendenvorkommen. Durch die Bildungsreformen des 19. Jahrhunderts wirdauch indirekt die Rolle der Spanischlehrendenverändert, womit sich auch deren berufliche Identitätneudefinierte.Der Bezug zu einer Schulform war stärker,was alsMerkmalfürdieheutigen Spanischlehrenden erhalten gebliebenist. Es bildete sichnach dem 19. Jahrhundertein Lehrertypus heraus, der vorwiegend am Gymnasium oder an der Realschule/Realgymnasiumunterrichtete (vgl. Voigt 1998,36).Parallel definierte sich die Rolle des Spanischlehrenden im damaligen Mitteleuropa durch die Einführung von tertiären Bildungsinstitutionen neu, die erstmals eine Ausbildung zum Spanischlehrer/zur Spanischlehrerin für Gymnasien anboten:
Parallel zu diesen Entwicklungen veränderte sich das Berufsbild des Fremdsprachenlehrers. […] Mit dem Neuhumanismus erfolgte, parallel zu einer Rephilologisierung, ihre neuerliche Verdrängung durch Philologen mit wissenschaftlicher Ausbildung und akademischem Anspruch. Seit ca. 1850 bestanden in Deutschland Lehrstühle für Romanistik, Anglistik und Slawistik, die bald in eine gewisse Konkurrenz zur Altphilologie traten. […] Sprach- und Literaturstudium in den modernen Fremdsprachen sollten zunächst philologisch-historisch ausgerichtet sein, im Anschluss daran war ein Auslandsjahr für die Sprachpraxis sowie ein Probejahr am pädagogischen Seminar für den Erwerb didaktischer und methodischer Erfahrungen vorgesehen. Erstmals erhob sich die Forderung nach einer Fachdidaktik („Schulwissenschaften“).(Badstübner˗Kizik 2007,4)
Es darf nicht vergessen werden, dass im 19. und 20. Jahrhundert erst die administrativen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, damit Spanischlehrende überhaupt imregulärenSchulunterricht tätig werden konnten.Die Spanischlehrenden erhalten nun erstmals Vorgaben, wie ihr Spanischunterricht konkret auszusehen hat, anhand von verbindlichen Lehrplänen (vgl. Schmoldt 1980).Aussagen darüber, wie sie selbst sein sollten, blieben in diesen Lehrplänen unerwähnt. Jedoch wird zu selbstreflexiven Prozessen im Unterricht angeregt als„Selbstbesinnung auf die erzieherische Erfahrung“(Schmoldt 1980,80).
Dieberufliche IdentitätderSpanischlehrenden, ab Mitte des 19. Jahrhunderts sind auch Frauen darunter (vgl. Wedel 2000,272),definiertsich auch durch den Einfluss von veränderten Unterrichtsmethoden neu.Ob die SpanischlehrendengleichzeitigauchLehrbuchautorenwarenund umgekehrt, wie es im 17. Jahrhundert noch der Fallist(vgl. Voigt1998,31), kann für die Allgemeinheit der damaligen Lehrendennichtbestätigt werden, da dieInstitutionalisierungder öffentlichen Schulen denUnterricht und nicht den Unterrichtendenin den Mittelpunktdes beruflichen Interesses rückte.So wurden aus dem Doppelberuf Lehrbuchautor˗Spanischlehrender nunmehr zwei unterschiedliche Berufssparten, welche sich noch heute im Verlagswesen und in der Arbeit als Lehrer/inan einer öffentlichen oder privaten Schule niederschlagen.Hierbei muss angemerkt werden, dass Lehrwerkautoren heutiger Schulbüchervorher meist selbst Lehrendedes jeweiligen Fachs oder Forscher/innen der jeweiligen Disziplin sind, sodass auch diese beide Berufe auch heutztage in der genannten Reihenfolge nacheinander ergriffen werden.Die Konzentration auf den Unterrichthatteim 19. Jahrhundertzur Folge, dass die Methoden in den Mittelpunkt traten und die Lehrpersonnamenlos und ein Stück weitbeliebig wurde. Dieseveränderten Unterrichtsmethodensprachen für die liberalen Veränderungen der Zeit der Reformen wie auch der Reformpädagogik, die ein verändertes Verhältnis zu den Sprachen anstrebte:
Was wir wollen und innerhalb der natürlichen Grenzen erreichen, ist die B e l e b u n g des gesamten Stoffes, den der fremdsprachliche Unterricht zu vermitteln hat, von den Wänden und Fenstern des Schulzimmers, […] wieder bis zu dem, was das Frankreich und das Englisch von heute bewegt. […] – die Hoffnung auf mehr. (Viëtor31905,52)
Nicht nur derSpanischunterricht,sondern auchdieSpanischlehrbücherändern sich, wie bereits vor zwei Jahrzehnten für den modernen Spanischunterricht ausgeführt wird: „Für das Spanische sah das 19. Jahrhundert den Niedergang der klassischen Autoren, deren Werke jetzt doch weitgehend als veraltet empfunden wurden.“ (Voigt 1998,36)Der Zugang zur Sprache erfolgt damit nicht länger über das Lesen authentischer Texte, sondernin Form vonkommunikativen Ansätzen, denen handlungsorientierteVermittlungsmethoden zugrunde lagen.Noch heute stehtim Lehrplan für die Qualifikationsphase 12 in der Oberstufe am Gymnasium in Bayernfür Spanischder Lektürekanon den kommunikativen Fertigkeiten gegenüber (vgl.Bayerisches Ministerium für Unterricht und Kultus 2004,1˗2).An dieStelle der Autorengebundenheit undderklassischenWerkederspanischen Literaturtritt dieBindung anpragmatischeVermittlungsmethodender spanischen Sprache, für die jeweils der Name eines Lehrbuchautors steht. Dies war und ist bei der „Método Berlitz“ (Berlitz 1890) der Fall. Die Möglichkeiten, die sich hierbei auch wirtschaftlich für die Autoren dieser Methodik-Bücher,im Vergleich zu den Einzelveröffentlichungen als Grammatiken und einzelnen kontrastiven Lehrbücherneröffnen,waren offensichtlich: „Die zugehörigen Lehrbücher erlebten zahlreiche Neuauflagen und werden z.T. noch heute im Unterricht der Berlitz-Schulen verwendet.“ (Voigt 1998,41) Über die Methodik des Spanischlernens hinaus wurde eine Bindung an einen Autorennamen wie Berlitz geschaffen, der sich bis in die heutige Zeit als „Berlitz Methode“ (Berlitz 1904,4) erhalten hat. Mit der Abkehr von der Lehrperson hin zudem Konzept vonLangenscheidt (vgl. Voigt 1998,39)traten auch im 20. JahrhundertdieNamen berühmter Spanischlehrender in den Hintergrund.Ein Novum gilt jedoch für die Person des Spanischlehrers/der Spanischlehrerinab der Mitte des19. Jahrhunderts: durch die Institutionalisierung derSpanischlehrkräfte wurde die Möglichkeit eröffnet, dass erstmals auch Frauenein Lehramt für höhere Schulen studierenund damit auch moderne Fremdsprachen in Deutschland unterrichten konnten.Was die Vermittlung des Spanischen betraf, so konnte diese nur in beschränktemRahmen außerhalb des regulären Fächerangebots stattfinden (vgl. Voigt 1998,41).Auch ZeugnissevonGymnasiallehrerinnen aus dem deutschsprachigen Raum des 19. Jahrhunderts(vgl. Wedel 2000)bieten einenZugriffaufAutobiographien, um die Lebensgeschichte und den beruflichen Werdegang dieser Lehrerinnen nachzuvollziehen. Allein am Beispiel der Lehrerin„Bertha Buchwald“ (Wedel 2000,272) lässt sich erkennen, dassdie Möglichkeit der Berufsausübing, die BilderungeinerberuflichenIdentität bei dieser Lehrerinnach sich zieht:
Bertha Buchwald […] arbeitete 6 Jahre als Erzieherin und Lehrerin in einer Familie mit 12 Kindern. […] von 1855 bis 1861 als Erzieherin in Chile, betreibt zeitweise eine eigene Schule in Valparaiso; 1861 Rückkehr nach Deutschland; gründet in Braunschweig […] eine Privatschule; gibt daneben Privatstunden in Englisch,Französisch und Spanisch. […].(Wedel 2000,272˗273)
Diese Lehrerin verlässtDeutschlandin einer Zeit, in derFrauen im Lehrberufnicht üblichsind, und beginnt,in ChileSpanischzulernen und diese Sprache in Deutschland, wenn auch in außerinstitutioneller Form, weiterzugeben. Im späteren Verlauf der Arbeit wird ersichtlich, dass es noch heute einen Teil der beruflichen Identität gibt, der diesen Wunsch nach dem Kontakt mit der Zielkultur und dem ZiellandzurBasis hat.Lehrerinnen wie Bertha Buchwalderhieltenerstmalsdie Möglichkeit, sich eineberufliche Identitätaufzubauen. Ihre„Geschlechtsidentität“(Fuhrer/Trautner 2005,393), das Frausein, wird erstmals verbunden mit der Möglichkeit, dass auch Frauen über eineberufliche Identitätverfügen können.
Durch eineInstitutionalisierung von Schule im Zuge der Bildungsreformen des 19. Jahrhundertstrittauch die Institutionalisierung der Fremdsprachen ein (vgl. Voigt 1998,36). Diese sorgteinerseits dafür, dass Bildung leichter zugänglich gemacht wird. Andererseitsoffenbarendie Reformengleichzeitig den höheren Stellenwert des Spanischen im jungen Deutschland von 1871, das in seiner Bildungsreform die modernen Fremdsprachen weiter förderte (vgl. Voigt 1998,36). Ab diesem Zeitpunkt wird die Zahl der Spanischlehrenden in Deutschland mit Schwankungen durch die zwei Weltkriegeim 20. Jahrhundert (vgl. ebd.,45) so groß, dass diese Gruppe wie zu Beginndes 16. Jahrhunderts (vgl. ebd.,27) auchzu einer anonymen Größe wird.Während der zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert schwankt die Stellung des Spanischen an den Schulen, je nach politischer Lage und Beziehung Deutschlands zu Spanien und Lateinamerika.[8]Die Zeitzeugenaussage des Gymnasialprofessors Gustav Haack aus Hamburg von 1937, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg,(vgl. ebd.,42) lässt den Unmut der Spanischlehrenden selbst über ihre Situation deutlich werden, die er allerdings logisch zu begründen versucht:„Für ein wirkliches Gedeihen des spanischen Unterrichts fehlte die Vorbedingung: die Gleichstellung des Spanischen mit dem Unterricht im Englischen und Französischen.“ (Haack 1937,71)
Insgesamtkannüber die Situation des Spanischunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten Weltkriegfestgehalten werden, dass insbesondere die Beziehung zwischen Spanien und dem Deutschlandwährendder NS-Zeit starke Auswirkungen auf den Spanischunterricht der Nachkriegszeit bis in die 1980-er Jahre hat: „Die internationale Isolierung Spaniens hatte in Deutschland einen dramatischen Rückgang des Spanischunterrichts zur Folge. Fast überall wurde der Unterricht nun wieder auf den Stand zurückgeworfen, den er in etwa vor1900 gehabt hatte.“ (Voigt 1998,45) Es ist logisch, dass uns aus dieser für den Spanischunterricht problematischen Zeit wenige Zeugnisse zu seinen Lehrenden in Deutschland überliefert sind.Während der schulische Spanischunterricht weitgehend zurückgedrängt war, erfreutsich das Spanische in der Nachkriegszeit bis in die 1990er Jahre als Urlaubssprachesteigender Beliebtheit, weshalb esvorrangigan Volkshochschulenmit dem Lehrwerk „¡Eso Es!“ (Masoliver 1978)unterrichtet wird.So wird mit Spanisch per se Spanien als beliebtes Reisezielverbunden, ein Klischee und eine Praxis, die die ehemaligen Lehrbücher abdecken:
Aus den Lehrbuchgeschichten ist nur zu ersehen, daß deutsche Urlauber im allgemeinen zufrieden sind, sich im Ferienland wohlfühlen und von den Spaniern zuvorkommend behandelt werden, so daß sich ein insgesamt positives, aber undifferenziertes Bild des Tourismus ergibt.(Neuroth-Hartmann 1986,37-38)
Dieses dialektische Sprachprestige des Spanischen, das einerseits aus Spanisch als Urlaubssprache in der BRD besteht, wird andererseits durch die Benutzung von Lehrwerken wie „¡Eso Es!“ (Masoliver 1978) geprägt, die es laut Kritikern schaffen, auch politische Äußerungen gegen das ehemalige Franco-Regime hervorzubringen (vgl. Neuroth-Hartmann 1986,115).
Die Arbeit von Neuroth-Hartmann (1986) über „[d]as Bild der Spanier in bundesdeutschen Spanischlehrbüchern (1960-1984) […]“ kritisiert die Beliebtheit klischeehafter Spanischlehrwerkenoch bis in die 1980-er Jahre hinein:
Die Spanischlehrbücher der letzten Jahre bieten mehr und bessere Möglichkeiten, vorab einen ersten wirklichkeitsnahen Eindruck des Landes zu gewinnen. Umso erstaunlicher ist es daher, daß die längst veralteten und überholten Spanischlehrbücher der 60er und sogar frührerer Jahre immer noch in neuen, nahezu unveränderten Auflagen auf dem bundesdeutschen Markt erscheinen.(Neuroth-Hartmann 1986,199)
Die Teilung von Ost- und Westdeutschland nach dem 2. Weltkrieg wirkte sich auch auf denSpanischunterrichtund in vielfacher Hinsichtauf die Ansichten der Spanischlehrenden über ihr Fach aus.Die berufliche Identität eines Spanischlehrenden in Westdeutschland unterschied sich in zahlreichen Aspekten von der beruflichen Identität eines Spanischlehrenden in der ehemaligen DDR. Der Hauptunterschiedliegtin der politischen Färbung derUnterrichtsinhalte,sodass die Parteizugehörigkeit zu einer sozialistischen Partei und das Leben in diktatorischen Verhältnissenauch die Lehrwerkskonzeption beeinflusste.Ein Beispiel für die Politisierung von Lehrwerksinhaltenist das in der ehemaligen DDR verwendete Lehrbuch„Estudiamos español“ (Domke/Baumbach 1972). Esbefasst sich hauptsächlich mit dem sozialistisch als gleichwertig angesehenen Land Kuba und stellt in propagandistischer Weise die Auseinandersetzung mit dem Land der ehemaligen DDR als fortschrittliches Industrieland dar (vgl. Helle 1993,59).In‚Estudiamos Español‘wird den Schüler/inne/n der ehemaligen DDR auch das Bild einespolitisch aktivenSozialisten gezeichnet, der sich HerrBurder nennt (vgl. ebd.,64).Über sich selbst sagt die Person in dem Lehrbuch:
Sí, soy miembro del Partido Socialista Unificado de Alemania y, claro está, de la Federación de Sindicatos Libres Alemanes. De joven formé parte de la organización de la juventud, la Juventud Libre Alemana. Fui también poco tiempo guía de pioneros y durante mis estudios en la Escuela Superior de Economía trabajé en la organización universitaria del PSUA.(Domke/Baumbach 1972/ausEstudiamos Español6,29)
Wie die Spanischlehrenden solche Texte empfanden und ob sie sich darin wiederfanden, kann nicht für die Allgemeinheit der Spanischlehrenden in der ehemaligen DDR gesagt werden.VieleFunktionäre, darunter auch Lehrende,aus der Zeit der ehemaligen DDRgehörten der SED anund dementsprechend war ihr Spanischunterricht sozialistisch gefärbt (vgl. Niermann 1973).DieFeststellung derReflexionendes Spanischunterrichts aus Sicht der Lehrenden wird zusätzlich dadurch erschwert, dasssichdie Zahl der Spanischlehrenden in der ehemaligen DDR auf wenigeausgebildete Spanischlehrendebeschränkte: „Spanischlehrer wurden am Lateinamerika-Institut der Universität Rostock ausgebildet […], wobei insgesamt offenbar nicht mehr als vierzig Spanischlehrer ausgebildet wurden.“ (Helle 1993,49)Damit ist die Möglichkeit, Spanischlehrende aus dieser Zeit anzutreffen merklich gering.Szyska (2008,108) stellt fest, dasssichder Spanischunterrichtnoch heutein den neuen Bundesländern weiter schwierig gestaltet, wie sie am Beispiel Thüringens belegt:
Die eingangs aufgestellte These, dass die Ursachen des geringen Angebots von Spanischunterricht nicht in der fehlenden Nachfrage von Seiten der Schüler, sondern in einem Lehrermangel infolge fehlender Ausbildungsmöglichkeiten vermutet werden, kann an dieser Stelle für den betrachteten Ausschnitt der Thüringer Schullandschaft durch die Untersuchungsergebnisse unterstützt werden.(Szyska 2008,108)
Die Situation der Spanischlehrenden in den alten und neuen Bundesländernhat sichaktuell von den theoretischen Voraussetzungen her nivelliert:„Heute ist die Situation insoweit geklärt, als alle Länder Lehrbefähigungen für Spanisch anerkennen und eine Ausbildung anbieten.“ (Bernecker 2006,157) Wie die Praxis des Spanischunterrichts in den einzelnen Bundesländern aussieht, wird in Kapitel 1.2.2 dargestellt werden.
Im heutigen Deutschlandbildetdas Wertesystem der Demokratieden Rahmen der modernen beruflichen Identität.Dieser Grundsatz wirdrespektiert, indem„[zu] d[en] gesellschaftlichen Funktionen der Schule […]Sozialisation durch die Akzeptanz und Weiterentwicklung der soziokulturellen Ordnungen und Maßstäbe/Normen derdemokratischen Gesellschaft [gezähltwird