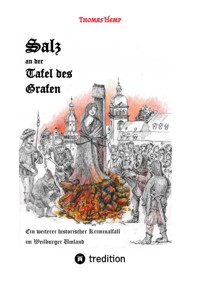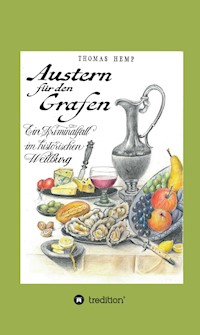
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sophie Gamier macht sich auf den Weg in die pittoreske Residenzstadt Weilburg an der Lahn. Mit im Gepäck hat sie ein Rätsel aus der Vergangenheit ihrer Familie von vor über 300 Jahren, von dem sie nicht weiß, ob sie es in Weilburg überhaupt lösen kann. In dieser Zeit lebte und arbeitete Nolan Gamier am Hofe des absolutistischen Grafen Johann-Ernst von Nassau-Weilburg. Nolan wird in die Intrigen und Machenschaften des höfischen Alltages verstrickt, weil er einem Geheimnis auf der Spur ist... Detailreich und profunde recherchiert, schafft es der Autor, das höfische Leben in der Barockzeit von Weilburg zu zeichnen und den Leser mit auf eine geheimnisvolle Zeitreise einzuladen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
♦ ♦ ♦
© 2020 Thomas Hemp
Umschlaggestaltung und Illustration: Dieter Boger Kalligraphie: Boris Juric
Verlag und Druck: Tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7482-5466-9
ISBN Hardcover: 978-3-7482-5467-6
ISBN e-Book: 978-3-7482-5468-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Prolog
In einer Zeit voll Üppigkeit, Fülle und scheinbar überschäumender Lebensfreude, dem Barock, spielt unsere Geschichte.
Barock ist Lebensfreude und Sinnesgenuss pur. Der düsteren Zeit des 30jährigen Krieges mit Tod, Hungersnöten und Epidemien gerade entflohen, könnte man meinen, der Mensch bemüht sich, in dieser Epoche seinem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen und sich in Lust und Lebensfreude zu stürzen.
Große Vorbilder hierfür sind die Hofhaltungen des Franzosenkönigs Ludwig des XIV. in Versailles oder Friedrich des Großen im Neuen Palais und Sanssouci in Potsdam. Diese setzen Epochen überdauernde Meilensteine in der Baukunst, Hofhaltung und Kochkunst, sowie auch in ihrem absoluten Machtanspruch zur Ausbeutung der Bevölkerung.
Diesen Vorbildern nacheifernd, haben es auch kleine, politisch fast unbedeutende Residenzgrafen vollbracht, eindrucksvolle Zeugnisse ihres absolutistischen Machtanspruches zu schaffen.
Die kleine Residenzstadt Weilburg erfährt gerade in dieser Zeit von 1703 bis 1713 unter ihrem Grafen Johann Ernst zu Nassau ihre radikalste Umgestaltung im wahrsten Sinn des barocken Zeitgeistes.
Durch den frühen Tod seines Vaters ist ihm ein Vormund vorgestellt. Doch im April 1683 heiratet er im Alter von 19 Jahren Maria Polyxenia Gräfin von Leiningen- Dachsburg-Hartenburg und übernimmt fortan die Regentschaft in Nassau. Aus der Verbindung mit der Gräfin entstehen 8 Kinder, 4 Jungen und 4 Mädchen.
Johann Ernst schafft es nicht, mit der eher ärmlichen Bevölkerung die Gelder für eine solche Umstrukturierung seiner Residenzstadt Weilburg zu erwirtschaften. Damals ist die Bevölkerung eher landwirtschaftlich geprägt und Bodenschätze der Region, wie das wertvolle Eisenerz, sind in dieser Zeit auch noch nicht entdeckt.
Das Kirchenspiel Weilburg mit den umliegenden Gemeinden besteht ohnehin aus nur knapp 6000 Seelen, wovon etwa 500 direkt am Hofe in Weilburg in Lohn und Brot stehen.
So verdingt sich Johann Ernst als Offizier mit einer erfolgreichen Militärlaufbahn und übernimmt Verwaltungsaufgaben, wie beispielsweise als Statthalter von Düsseldorf. Die hohen Einkünfte aus diesen Tätigkeiten steckt er sofort wieder in die Umbauarbeiten seiner Residenz.
Große Bauvorhaben werden in dieser Zeit von ihm realisiert: Das Schloss wird in eine barocke Vierflügelanlage mit prachtvollen Gärten und Orangerien umgestaltet. Eine großartige Ingenieursleistung seiner Zeit ist die innovative Wasserversorgung des Schlosses, seiner Brunnen und Gärten. Große Wasserbassins oberhalb der Stadt in Richtung Odersbach versorgen sowohl das Weilburger Schloss, als auch, als Nebenprodukt, die wenigen Brunnen der Bevölkerung. Damit die Rohre nicht das Lahnwasser durchqueren müssen, hängen sie an den Ketten einer Brücke über dem Fluss in der Nähe der Hainallee.
Auf dem Marktplatz entsteht eine Kuppelkirche nach den Entwürfen des Baumeisters Julius Ludwig Rothweil mit einer solchen barocken Ausgestaltung, dass jeder Stuckengel an der Decke die barocke Lebensfreude seinem Betrachter nur so entgegenstrahlt. Heute gehört sie, neben dem Michel in Hamburg, zu den größten Kuppelkirchen Deutschlands.
Man kann sagen, dass Weilburg in diesen Jahren ein völlig neues Gesicht bekommt.
Durch sein unermüdliches Streben schafft es Johann Ernst, die Bedeutung seiner Grafschaft Nassau so zu steigern, dass der Kaiser ihm das Prägen von Münzen in Weilburg erlaubt. Ein hohes und verantwortungsvolles Privileg, bedenkt man, dass
zu dieser Zeit der Gehalt an Edelmetall, meist Silber, der tatsächlichen Kaufkraft des Münzwertes entspricht.
In den Händen und der Verantwortung des Münzmeisters und den Kippern und Wippern, die eine ebenso wichtige Rolle im Prägen von Münzen spielen, entstehen die wichtigsten Zahlungsmittel, auf die sich ein Wirtschaftssystem stützt und in allen Herzogtümern und Grafschafen die gleiche Wertigkeit darstellen.
In dieser Zeit tritt Nolan, der Sohn des Meyers vom Hof Wehrholz, gerade der Verfolgung als Hugenotte in Frankreich mit seinem Vater entflohen, seine Kochlehre in der Schlossküche unter dem französischen Küchenmeister Dupois an. Er lernt die neue, aufstrebende Kochkunst kennen, die auch am Hof in der kleinen Residenz Weilburg dem Hunger nach Genuss und Überfluss nur der Obrigkeit ständig Rechnung tragen will. Im Laufe der Zeit erhält er faszinierende Einblicke in eine höfische Welt voller Prunk und Überfluss, aber auch voller Intrigen und Machtkämpfe, in der jeder seine Position am Hof für sich selbst absichern und verbessern will.
Sophie steht am schmiedeeisernen Gitter, das den verschlossenen Eingang zu einer Gruft bildet. Über den Friedhof in der Nähe von Naumburg in Sachsen weht ein erster, kalter Herbstwind und vertrocknete Blätter der Linden sammeln sich vor den Grabsteinen. Sophie zieht den Kragen ihres Mantels ein klein wenig mehr nach oben, um dem kühlen Wind etwas entgegenzuwirken.
Gebannt starrt sie schweigend auf die Inschrift über dem Eingang der Gruft. „Gamier 1745“ steht dort in frisch restaurierten Buchstaben geschrieben. Dies ist der Mädchenname von Sophie.
Sie kann immer noch kaum glauben hier zu stehen, vor einer Gruft, die ihren Vorfahren von vor über 250 Jahren zugeschrieben wird. Vor einigen Monaten hatte das Landesdenkmalamt von Sachsen bei der Restaurierung des Kirchenareales und des dazugehörigen Friedhofs die Auflage gemacht, die kleine Kapelle, die eine Gruft unter sich birgt, zu erhalten. In den Zeiten der DDR wurden solche Bauten vernachlässigt. So wurde die Tür der Kapelle zugemauert und das kleine Gebäude geriet in Vergessenheit, bis Pfarrer Jakobsen, nach scheinbar endlosen Jahren, 2009 endlich die Gelder bekam, um mit der Restaurierung seines kleinen Kirchengeländes zu beginnen. Mit dem Geldsegen flatterte aber auch ein Stapel Auflagen des Denkmalschutzes ins Haus, die auch noch die gegenwärtig anstehenden Arbeiten nicht immer erleichterten. Im Falle der Gruftkapelle stellt das für Sophie ein großes Glück dar. Durch die Instandsetzungsarbeiten öffnet sich für sie nun ein Fenster in ihre Vergangenheit, von dem sie bis vor wenigen Wochen nicht das Geringste geahnt hatte.
„Welch ein Zufall gerade jetzt“, denkt sie. Im vorigen Jahr hätte sie nur schwer Zeit gefunden, sich ihrer Familiengeschichte zu widmen. Stand da die Scheidung von ihrem Mann an, mit der ihre Ehe vor zwei Monaten ein nicht gerade rühmliches Ende gefunden hatte. Zu ihrem Glück war ihre Tochter schon in dem Alter, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie hatte vor etwa einem halben Jahr eine Anstellung als Aupair in Frankreich begonnen und war nun dabei, die Welt für sich zu entdecken.
Nach ihrer Scheidung ist Sophie selbstbewusster geworden. Sie hat ihren Mädchennamen Gamier wieder angenommen und beginnt es zu genießen, auf eigenen Beinen stehen zu können. Die schlanke, sportlich wirkende Frau, der man ihre 45 Lebensjahre kaum ansieht, trägt seit ein paar Monaten auch ihre Haare wieder kurz. Einige gegelte Strähnen hängen ihr ins Gesicht und unterstreichen ihr sportlich-freches Aussehen, genau wie ihr schmales, vom letzten Sommer noch leicht gebräuntes Gesicht mit den hohen Wangenknochen.
Schmale Lippen geben ihr eine gewisse Strenge, die aber bei einem jetzt wieder öfter auftauchenden Lächeln völlig verschwindet. Dass sie ab und zu eine Zigarette raucht, ist das einzige Laster, das aus dem letzten, stressreichen Jahr zurückgeblieben ist.
„Um 14 Uhr wollte er hier sein“, hatte Pfarrer Jakobson zu ihr am Telefon gesagt und sie schaut ungeduldig auf ihre Armbanduhr, die viertel nach zwei zeigt. Sie kann ihre Aufregung kaum unterdrücken und nestelt eine Zigarette aus einem Päckchen, zündet sie mit einem tiefen Zug an, wahrscheinlich um sich zu beruhigen, kann aber ihre Aufregung auch damit nicht dämpfen.
Sophies Blick gleitet durch das Gitter in das quadratische Innere der Kapelle. Sie nimmt das nachtblaue mit goldenen Sternen in frischem Glanz erstrahlende Deckengewölbe wahr. An der hinteren Wand befinden sich vier Holztafeln mit goldener Inschrift. Auf der ersten steht:
Francois Gamier 1672 – 1748.
Auf der zweiten:
Agnes Gamier, geb. Schelmen vom Berg 1678 – 1745.
Auf der dritten:
Elisabeth Gamier, geb. Behringer 1693 - 1768
und auf der vierten schließlich:
Nolan Gamier 1689 – 1769.
In der Mitte des steinernen Bodens ist eine Öffnung zu erkennen. Vier schwarz gestrichene geschmiedete Pfosten, an jeder Ecke mit Eisenketten dazwischen, grenzen die Öffnung ab.
„Kaum zu glauben, dass ich Vorfahren hatte, die sich eine solche Begräbnisstätte leisten konnten, von der Mutter und ich keine Ahnung hatten“, denkt Sophie gerade, als sie eine atemlose Stimme vernimmt.
„Entschuldigen Sie bitte vielmals.“
Sophie dreht ihren Kopf der Stimme entgegen. Eilig drückt sie ihre Zigarette in einem kleinen Klappaschenbecher aus, den sie immer bei sich hat. Ein Mann Mitte fünfzig kommt ihr eilig entgegen. Der Pastorenkragen am schwarzen Anzug lässt ihn Sophie als Pfarrer Manfred Jakobsen erkennen, bevor er sich vorgestellt hat.
„Verzeihen Sie meine Verspätung“, beginnt Jakobsen, als er Sophie erreicht hat, „ich hatte ein Traugespräch, welches sich etwas in die Länge gezogen hat.“ Er reicht Sophie die Hand und kommt wieder zu Atem.
„Nicht schlimm“, entgegnet Sophie, „ich habe nicht lange gewartet und nun sind Sie ja da. Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mich ausfindig zu machen.“
„Kein Problem, das war nicht so schwer“, antwortet Jakobsen lächelnd. „Die Kirchenbücher unserer Gemeinde sind nicht dem Sozialismus zum Opfer gefallen.“
Sophies Mutter war vor drei Jahren gestorben und Sophie hatte sich um die Beerdigung gekümmert.
Sophie war mit ihr 1989 direkt nach dem Mauerfall in den Westen gegangen. Ihr Vater war schon 10 Jahre zuvor mit dem festen Versprechen, die Familie nachzuholen, geflohen. Ihre Mutter hatte daraufhin alles, was nicht in zwei Koffer passte, verkauft. Jahre saßen sie und ihre Mutter auf gepackten Koffern und erduldeten das Martyrium von Stasiverhören und Drangsalierungen. Ihre Mutter hörte nie wieder etwas von ihrem Mann. Als Sophie schließlich in den Westen kam, fand sie heraus, dass ihr Vater kurz nach seiner Flucht eine neue Beziehung begonnen hatte und seine alte Familie schlichtweg vergessen hatte. Vor zwei Jahren war er dann, wie sie erst später erfahren hatten, verstorben.
„Ich schließe Ihnen die Kapelle auf“, sagt Jakobsen und kramt einen großen, verrosteten Schlüssel aus seiner Anzugtasche hervor, der erstaunlich gut in das Schloss des schmiedeeisernen Gitters passt. Mit metallischem Quietschen schiebt der Pfarrer den rechten Flügel des Gitters auf, tritt einen Schritt zur Seite und fordert mit einer Handbewegung Sophie zum Eintreten auf. Die Blicke von Sophie und Pfarrer Jakobson kreuzen sich kurz. Schließlich tritt Sophie hinter ihm in das Innere der Kapelle. Sie nimmt den Geruch von frischem Putz und Farbe wahr. Als sie an die Öffnung im Boden in der Mitte, abgesperrt durch die Ketten, herantritt, kann sie vier Särge aus schwarz gefärbtem Holz erkennen, die auf einem vom Boden erhöhten Podest stehen und nicht, wie der Rest der Kapelle, gerade frisch restauriert scheinen. Eher machen sie einen desolaten Eindruck, als seien sie von den Restaurierungsarbeiten bisher ausgespart geblieben.
Sophie wird es etwas mulmig. Dort in den Särgen liegen ihre leiblichen Vorfahren. Der Seelsorger erkennt die Situation und ergreift das Wort.
„Das schwierigste Unterfangen bei der Restaurierung unseres Kirchenareals war die Instandsetzung dieser Gruftkapelle“, beginnt er.
„Als wir den zugemauerten Torbogen der Kapelle öffneten, war alles ziemlich verfallen. Die Holztafeln waren verwittert und die Farben abgeblättert, hatten aber glücklicherweise geschnitzte Inschriften, sonst wäre der Text verloren gewesen. Wir wollen aber sicher sein, wer in welchen Särgen liegt. So beschloss das Denkmalamt, die Särge öffnen zu lassen, um anhand der sterblichen Überreste eine Zuordnung möglich zu machen. Es war jedoch klar, dass zunächst nach Nachfahren gesucht werden sollte, was mir durch Eintragungen in Kirchenbücher gut gelungen ist. Wie ich Ihnen angekündigt habe, wird das Team der Konservatoren des Denkmalamtes morgen eintreffen und mit ihrer Arbeit beginnen. Nehmen Sie sich also heute genügend Zeit, Ihre „neue Vergangenheit“ kennen zu lernen. Soll ich Sie einen Moment alleine lassen?“
Die Worte des Pastors beruhigen Sophie tatsächlich etwas, dennoch will sie jetzt nicht alleine sein und schüttelt nur kurz den Kopf.
Eine Stunde später sitzt Sophie bei Pastor Jakobsen vor einer dampfenden Tasse Kaffee, die sie mit beiden Händen fest umschließt und so die angenehme Wärme spürt, die in ihre kalt gewordenen Hände kriecht. Der Pastor hatte sie in sein Haus eingeladen, um den Ablauf des morgigen Tages mit ihr zu besprechen. Sophie fühlt sich ohnehin von den Ereignissen überrollt und war daher der Einladung gerne gefolgt.
„Das Team der Konservatoren wird morgen gegen 10 Uhr auf dem Friedhof eintreffen“, beginnt Jakobsen das Gespräch.
„Nach der Vorbesichtigung und den Gesprächen, die ich mit dem Team führen konnte, werden sie sehr schnell mit der Öffnung der Särge beginnen können. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie wahrscheinlich kein schöner Anblick erwarten wird. Vielleicht warten Sie abseits und kommen dann dazu…?“ schlägt der Pastor vor.
Sophie ist froh, dass sich jemand um die Planung kümmert. Von ihrem Beruf als selbständige Steuerberaterin hat sie sich ein paar Tage frei genommen, um sich dem neuen und ungewohnten Einblick in ihre Familiengeschichte widmen zu können.
„Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich möchte mich aber morgen entscheiden“, entgegnet sie. Zu erfahren, dass es eine Gruftkapelle von Vorfahren ihrer Familie gibt und dann noch die Aussicht, in den Särgen ihrer sterblichen Überreste sehen zu können, steigert nicht gerade ihre Entscheidungsfreudigkeit und sie ist froh, dass sie sich zunächst in die Sicherheit ihres Hotelzimmers zurückziehen kann.
Gegen 09.30 Uhr am nächsten Morgen holt Jakobsen sie im Hotel ab, um gemeinsam auf den Friedhof zu fahren. Die Nacht brachte ein wenig Ruhe für Sophie und sie fühlt sich nun etwas sicherer für die folgenden Ereignisse des Tages.
Am Friedhof angekommen bemerken beide zwei Fahrzeuge. Es sind Kastenwagen von der Größe, wie sie von Paketdiensten benutzt werden. Eines trägt den Schriftzug des Landesdenkmalamtes auf der Tür, das andere den der gerichtsmedizinischen Abteilung der Universität Leipzig. Mit gespannter Neugierde verlassen sie das Auto des Pastors und nehmen am Eingang der Gruftkapelle eine Gruppe von Personen wahr. Ein Teil von ihnen ist mit Einmalanzügen, Gummihandschuhen und Mundschutz bekleidet.
„Wie in einem Krimi am Tatort“, schießt es Sophie durch den Kopf und wundert sich gleichzeitig über diesen Gedanken, hat doch das Ereignis einen hohen persönlichen und emotionalen Bezug zu ihr.
Aus der Gruppe an der Gruft nimmt eine Person die Ankommenden wahr und gibt ihr Schreibbrett an ihren Nachbarn weiter, um auf Sophie und den Pastor mit schnellen Schritten zuzukommen.
„Sie müssen Frau Gamier sein“, sagt die Frau in einem Einmalanzug zu Sophie und reicht ihr die Hand. Mit einem Kopfnicken und „Herr Pastor“ wird Jakobsen begrüßt.
„Mein Name ist Doktor Brinkhorst. Wir sind von der Landesdenkmalpflege und mit der Restaurierung dieser Gruftkapelle von der Landesdenkmalpflege beauftragt. Sie gehört zu diesem wunderbaren Ensemble der Kirche und des Friedhofs.“
Während sie noch die Hand von Sophie hält, lässt sie ihren Blick über das Gelände schweifen, das zu ihrer Aufgabe gehört. Einen Moment braucht sie, um sich wieder zu sammeln.
„Verzeihung, wo bin ich mit meinen Gedanken? Es geht ja heute um die Graböffnung Ihrer Vorfahren, entschuldigen Sie bitte. Wir haben zur Öffnung der Särge ein gerichtsmedizinisches Team angefordert, das den Zustand und die nötigen Maßnahmen zur Konservierung der Leichname beurteilen und einleiten kann.
Sophie fühlt sich wieder etwas von der Situation überrollt, doch bevor das Gefühl sich ausbreitet, fährt Dr. Brinkhorst fort.
„Vielleicht gehen wir in unser Fahrzeug und ich erkläre Ihnen zunächst einmal, was die Recherchen über Ihre Vorfahren ergeben haben. Wenn das Team soweit ist, werden wir verständigt.“
Sophie ist froh über diesen Vorschlag und der Gedanke über ihre Vorfahren etwas zu erfahren, macht sie neugierig und lenkt sie ab. Auf dem Weg zum Kastenwagen des Denkmalamtes gibt Frau Dr. Brinkhorst noch ein paar Anweisungen an ihre Mitarbeiter und zieht dann die Schiebetür des Fahrzeuges auf. Sophie und der Pastor setzen sich auf eine Sitzbank, während die Doktorin gegenüber Platz nimmt. Auf dem Tisch in der Mitte befinden sich einige Aktenordner, von denen Dr. Brinkhorst einen herauszieht, aufschlägt und gleichzeitig eine Lesebrille auf ihrer Nase justiert.
„Möchten Sie vielleicht beide einen Kaffee, bevor ich beginne?“, schaut sie beide fragend über den Rand ihrer Brille an. Beide nicken kurz mit dem Kopf.
„Gerne“, erwidert Sophie und der Pastor nickt ebenfalls. Die Doktorin kramt zwei Kaffeebecher, Dosenmilch und Zucker aus einem Schrank in der Seite des Kastenwagens. Als der warme Kaffee aus einer Thermoskanne in die Becher gefüllt wird, verströmt der Geruch etwas Anheimelndes im Inneren des Fahrzeuges. Nun verspürt Sophie eine spannende Neugierde auf das, was sie über die Ahnen ihrer Familie erfahren wird.
„Agnes Gamier“, beginnt Frau Brinkhorst, „war eine geborene Schelmen vom Berg. Zu ihrer Zeit, Anfang des 17. Jahrhunderts, war sie die vierte Tochter einer Landadelsfamilie dieser Region, die hier überwiegend von den Einkünften ihrer verpachteten Ländereien und von der Forstwirtschaft lebte. Francois Gamier ist dem Namen nach hugenottischen Ursprungs und kam, nach unseren Recherchen, um 1705 in diese Gegend. Vormals hatte er eine Anstellung als Meyer, also Verwalter eines Gutshofes, in der Residenzstadt Weilburg, der Grafschaft Nassau-Weilburg. Nach unseren Aufzeichnungen gab er diese aber aus unbekannten Gründen auf, bevor er hierher übersiedelte. Francois und Agnes heirateten 1710, nachdem Francois als Verwalter zwei Jahre im Dienst der Familie stand. Sie hatten drei Nachkommen und brachten es, wie man auch an der wertvollen Gruftkapelle sieht, zu nicht unerheblichem Wohlstand.
Etwas nebulöser ist die Spur von Nolan Gamier und Elisabeth Gamier, geb. Behringer. Von ihnen gibt es keine Aufzeichnungen, außer dass sie mit Francois Gamier hier 1705 eingetroffenen sind. Erst mit der Grablegung treten sie wieder in Erscheinung.“
Sophie saugt all diese Informationen mit weiten Augen auf. Der Pastor lehnt in der Ecke der Sitzbank mit seinem Kaffeebecher in der Hand und es scheint fast so, als habe er ein wachsames, fürsorgliches Auge auf die Situation.
Die Doktorin ist nun voll in ihrem Element. In der nächsten Stunde werden Stammbäume und Geburtsurkunden vorgeführt und erläutert. Plötzlich unterbricht ein Klopfen an der Schiebetür das Geschehen. Frau Brinkhorst schaut erschreckt durch die Unterbrechung über ihre Brille, fasst sich dann und löst den Mechanismus der Tür von innen. Ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes mit heruntergezogenem Mundschutz steht an der Tür und sagt: „Wir wären dann soweit… .“
„Äh…, ja sofort…, wir kommen“, entgegnet Frau Brinkhorst.
Nolan blickt durch den Torbogen des Weilburger Schlosses seinem Vater Francois hinterher, der soeben die beiden Wachposten passiert hat, die mit Gewehr, Bajonett und Säbel bewaffnet am schweren mit Eisennägeln beschlagenen Tor stehen.
Nolan steht mit einem Fuß auf der Treppe zur Küche, direkt hinter dem Eingang zur Wachstube. Mit seinen etwas über sechzehn Lebensjahren ist er schlank gewachsen. Seine olivbraune Haut verrät, genau wie seine kohlschwarzen Augen und seine langen, lockigen, kastanienfarbigen Haare, die er zur Bändigung immer hinten zu einem kurzen Zopf zusammenbindet, ein bisschen die Herkunft aus Südfrankreich, wo seine Flucht gemeinsam mit seinem Vater als Hugenotten begonnen hatte. Sein schmales Gesicht wird oft, trotz der Strapazen der Flucht der beiden letzten Jahre, von einem freundlichen Lächeln aufgehellt. Über seinen Lippen sprießt ein erster, dunkler Bartflaum, der deutliches Anzeichen dafür ist, dass Nolan erwachsen wird.
Ein Küchenjunge mit Holzschuhen drängelt sich mit eiligen, klappernden Schritten an ihm vorbei und bahnt sich den Weg in die Küche. In beiden Händen hält er an den Füßen zusammengebundene Fasane. Sein eiliges Vorbeidrängeln lässt Nolan vermuten, dass er den Auftrag eines Küchenmeisters nicht mit der gebotenen Eile erledigt hat.
Geschäftiges Klappern von Kochgeschirr und Stimmengewirr dringt aus der Küche zu ihm hinaus.
Schnell sucht aber nun sein Blick erneut seinen davonziehenden Vater. Nach einem kurzen Fußmarsch wird dieser wieder den gräflichen Hof Wehrholz erreichen. Hier war bis heute Nolans Zuhause.
Nolans Vater war hier vom Kanzleidirektor Plönnies, einen obersten Verwaltungsangestellten des Grafen Johann Ernst zu Nassau-Weilburg, als Meyer zur Bewirtschaftung des Hofes oberhalb von Weilburg in die Dienste der gräflichen Kanzlei genommen worden. Der Hof erwirtschaftet allerlei landwirtschaftliche Produkte, die zur Versorgung des Schlosses unabdingbar sind. Neben Fleisch, Milch und Getreideprodukten liefert der Hof Wehrholz auch eine nicht unerhebliche Menge von Bauholz, welche bei den momentanen Baumaßnahmen am Schloss und der Errichtung der neuen Kirche eigentlich nie ausreicht.
Dennoch hat Nolans Vater hier ein gutes Auskommen und sichere Einkünfte. Er empfindet die Anstellung nach der Flucht als große Gnade. Nolans Mutter war bei seiner Geburt gestorben, so sieht er es als Gottes Geschick an, beim protestantischen Grafen Johann Ernst zu Nassau-Weilburg in Dienst treten zu können, als der hugenottische Flüchtlingstreck unweit von Weilburg vorbeizog.
„Aber er soll es besser haben“, sagt sich Nolans Vater, obwohl er Nolans Arbeitskraft im Hof Wehrholz gut gebrauchen könnte und schickt ihn ab dem heutigen Tage beim Küchenmeister Dupois im Schloss in die Lehre, um das Handwerk der Kochkunst zu lernen. Dies ist eine hohe Aufgabe, bedenkt man die Stellung des Küchenmeisters. Er zählt zu den am besten bezahlten Angestellten im Schloss. Nur der Kanzleidirektor Plönnies verdient mit 750 Gulden im Jahr mehr als er. Und mit seinen 500 Gulden hat der Küchenmeister immerhin 200 Gulden mehr, als beispielsweise der Medicus des Grafen.
„Meine neue Heimat ist nun die Küche des gräflichen Schlosses und meine Aufgabe ist es, meinem Vater zum Gefallen die edle Kochkunst zu erlernen“, sagt sich Nolan und wendet seinen Blick von seinem Vater ab, dreht sich auf seinen Absätzen der Tür zu, in der der Küchenjunge zuvor verschwunden war und geht mit festen Schritten in Richtung Küche.
Gleich am ersten Tag will er einen guten Anfang machen. Er durchschreitet einen großen, gewölbten Saal mit Tischen und Holzbänken. Hier sieht er, wie die Bediensteten des Schlosses und die Wachsoldaten verpflegt werden.
Die Wachsoldaten, die hier sitzen, gehören zu den zirka fünfzig Mann Militär, die sich Graf Johann Ernst als private Garde leistet. Sie tragen blauweiße Uniformen, einen Spitzhelm mit einer Messingplakette, auf der das Wappen des Grafen eingeprägt ist. Bewaffnet sind sie mit Säbeln und Steinschlossgewehren, auf die, wenn sie Wache schieben, immer ein Bajonett aufgepflanzt ist.
Sie bewachen den Schlosseingang und die Stadttore. Sie kassieren Zölle, überwachen die Märkte, verhaften im Bedarfsfall Personen und verlesen Erlasse des Grafen und seiner Hofbeamten und kontrollieren deren Einhaltung. Da der Graf selten in der Stadt zugegen ist, hat es sich eingebürgert, dass sich die Männer einige Freiheiten herausnehmen, wie Nolan auch schon aus Gesprächen im Hof Wehrholz gehört hat. Oft nutzen die wachhabenden Soldaten gelangweilt ihre Zeit, um die Innenseite der Schlosstorflügel mit allerlei Schnitzereien zu versehen. Im Laufe der Jahre sind die Torinnenseiten so mit Fachwerkhäusern, Soldatenfiguen, Galgendarstellungen und Namenszügen verziert worden. Oft werden auch Passanten oder Lieferanten für ein paar Äpfel oder etwas Brot am Tor drangsaliert – kurzum der Ruf der Garde ist nicht der Beste.
Einige Gardisten sitzen in ihren blauen Uniformen plaudernd und lachend in einer Ecke und löffeln aus Zinngeschirr eine kräftige Kohlsuppe. Ihr Kommandant, Sergeant Altenhöfer, ein großer Mann mittleren Alters, dessen Erfahrung als Soldat und Söldner in dem dunklen und tief gefurchten Gesicht zu erkennen ist, greift mit einem Schwung einen irdenen Krug vom Tisch und führt ihn zum Mund, um einen kräftigen Schluck daraus zu nehmen.
„Wahrscheinlich befindet sich Wein darin“, vermutet Nolan. Wasser wird als Getränk wegen der Angst vor Krankheiten verabscheut. Und schon beschwert sich Altenhöfer lautstark über den wässrigen Wein und schlägt den Krug mit solcher Wucht jähzornig und mit Aufblitzen seiner dunklen Augen auf den Tisch, dass sein Inhalt auf die Tischplatte schwappt. Nolan war in der Zeit der Verfolgung und Flucht als Hugenotte aus Frankreich schon vielen Menschen wie Sergant Altenhöfer begegnet, aber immer wieder flößten sie ihm eine gewisse Furcht ein.
„Ein unangenehmer Zeitgenosse“, denkt Nolan im Vorbeigehen.
Nun durchschreitet er eine niedrige Tür am Ende des Saales, um durch einen schmalen Gang in die Küche zu gelangen. In dem Gang sieht er eine sich nach rechts öffnende Flügeltür zum Schlosshof, durch die die Küche versorgt wird. Im Augenwinkel nimmt er wahr, wie im Hof ein Hilfskoch mit einem Beil ausholt und auf einem Hackklotz einem Huhn den Kopf abschlägt. Er wirft es noch flatternd neben den Klotz, wo schon mehrere kopflose Hühner in einem Korb liegen.
„Junge, komm her, vite, vite, trödele nicht!“, hört Nolan plötzlich eine Stimme hinter sich. Es ist die Stimme seines Lehrherren, Küchenmeisters oder „Maître“ Dupois, wie er lieber genannt werden will. Er wendet sich im Gang um und steht direkt vor der kleinen Holztür zur Schreibstube des Küchenmeisters. Dieser sitzt an einem kleinen Schreibpult, auf dem eine Öllampe ihm nur spärliches Licht gibt. Von hier aus hat Dupois immer ein Auge auf alle Personen, die Waren in seine Küche anliefern. Gleichzeitig hat seine Stube auch eine direkte Tür zur Küche, die von seinem Pult aus einsehbar ist. Nolan tritt durch die Tür in die Kammer und ist mit wenigen Schritten vor dem Schreibpult von Dupois. Dieser schreibt noch seine Zeile in einem dicken Buch zu Ende, steckt den Federkiel wieder in das Tintenfass und schaut dann zu Nolan auf.
„Alors, nimm dir einen Schemel, setz dich!“
Der französische Einschlag in der Sprache des Maître Dupois ist nicht zu überhören und er bemüht sich auch nicht, ihn zu verbergen. Schließlich gilt man, wenn man der französischen Sprache mächtig ist, als gebildet und modern.
Alles, was aus Frankreich vom Hofe des Sonnenkönigs, le „Roi-soleil“, Ludwig des XIV. kommt, ob Baukunst, Sitten, Speisen, ist modern und wird versucht zu übernehmen. Wer nicht Französisch spricht, gibt sich zumindest die Mühe, einige Brocken und Füllworte in seine Sprache einfließen zu lassen, um den Eindruck des Gebildeten und Modernen zu erzeugen.
Nolans Vater Francois wusste, dass der Maître durch und durch ein Anhänger der modernen Kochkunst ist, die sich in den letzten fünfzig Jahren, wie sollte es auch anders sein, in Frankreich entwickelt hatte, wie Francois und Nolan noch vor ihrer Flucht in Frankreich wahrgenommen hatten.
Erwähnenswert ist jedoch sicherlich, dass hier die Quelle allen Neuerns nicht der Hof Ludwigs des XIV. ist, sondern viel eher kleine verschiedene Fürstenhöfe, an denen meisterhafte Köche die Kochkunst in unbeschreiblichen aufwändigen Menüspektakeln vorantreiben und auch die ersten Kochbücher schreiben. So werden in theaterhaften Inszenierungen Hofzwerge und ganze Kapellen in Pasteten eingebacken, die im rechten Moment aus ihrer Pastete springen und zur Unterhaltung der Gäste beitragen. Aus Brunnen fließen, neben Edelsteinen und Goldstücken, wahre Meere aus Wein und es scheint schier unglaublich, welche Mengen durch Gäste bei Festen fürstlicher Anlässe auch in ländlichen Gegenden verschlungen werden können.
Dupois ist ein Anhänger von Pierre de la Varenne, dem Küchenchef des Marquis d´Uxelles. Sein Buch „Le cuisinier Francois“, das als Grundlage der modernen französischen Küche bezeichnet werden kann, ist für ihn wie eine Bibel und Grundlage aller Kreationen, die er in der Küche der Weilburger Residenz schaffen wollte. Dies war für Nolans Vater auch ein Grund, seinen Sohn zu Maître Dupois in die Lehre zu geben.
Nolan rückt sich einen Schemel zum Schreibpult des Küchenchefs, setzt sich und hört aufmerksam zu.
„Alors, Junge, nun bist du nicht mehr ein einfacher Mensch, der irgendein Handwerk lernt, mais non, du wirst die edle Kochkunst erlernen zum Gefallen deines Grafen. Du hast großes Glück. In zwei Wochen wird der Graf erwartet, um die laufenden Bauarbeiten an seinem Schloss, dem Garten und der Stadt zu verfolgen. Er wird einige Audienzen geben und auch ein Festbankett zu Ehren des Besuches des Grafen von SolmsBraunfels. Eine Vermählung steht bevor, vous avez compris, eine Tochter unseres erlauchten Herrn und Landesvaters ist dem Grafen von Braunfels versprochen. Ein großes Fest zu diesem Anlass, nes pas! Bis dahin haben wir dich premierment neu eingekleidet, damit du in der Küche arbeiten kannst“, erläutert Dupois in einem Redeschwall.
In diesem Augenblick, klopft es am Türrahmen zur Schreibstube. Dupois schaut an Nolan vorbei und erblickt einen vornehm gekleideten Mann im Türrahmen. Mit großen Gesten steht er auf und geht dem Mann entgegen.
„Lichtenberger, ce bon, ich habe schon auf Sie gewartet, le poivre, Sie wissen, der Pfeffer droht auszugehen und all die anderen Dinge, Tee, Kaffee, Zucker und Salz, Ihr habt alles dabei?“
Der Mann, ein Händler aus dem fernen Frankfurt, ist mittlerweile eingetreten und schüttelt Dupois die Hand.
„Naturellement, alles dabei Maître, wie bestellt. Mein Gespann steht draußen am Schlosstor zum Abladen bereit.“
„A oui, aber zuerst, quelque chose à boire, mon ami? Einen Krug Wein vielleicht?“, fragt Dupois.
„Merci bien, ich muss noch weiter, lasst uns abladen“, erwidert Lichtenberger.
„Ah, oui! Nolan, gehe Maître Lichtenberger zur Hand, es sind nur einige Säcke. Bring sie gleich in diesen Raum. Ich schicke nach dem Geld!“
Nolan steht schnell auf und folgt dem Kaufmann den kurzen Weg durch das Schlosstor, durch das er vorhin noch seinen Vater entschwinden sah. Zu seinem großen Erstaunen sitzen zwei bewaffnete Männer auf dem Gespann. Sie halten jeder eine Steinschlossflinte in der Hand und sind mit einem Säbel gegürtet. Lichtenberger bemerkt Nolans Erstaunen über die ungewöhnliche Sicherung eines Fuhrwerks.
„Man kann nie wissen.‚.allerlei Gesindel auf den Wegen von Frankfurt bis hierher.“
Nolan nickt und lässt sich einen Weidekorb reichen, in dem sich mehrere kleine Leinensäcke befinden. Den Weg mit dem Weidenkorb macht er, immer in Begleitung von Lichtenberger, dreimal. Beim vierten Mal wird vom Wagen eine Holzschatulle heruntergereicht. Ehe Nolan zugreifen kann, kommt der Kaufmann ihm mit den Worten: „Das nehme ich lieber selbst“ zuvor.
Verwirrt trottet Nolan hinter Lichtenberger in die Kammer des Küchenmeisters. Dort hat Dupois schon mit der Kontrolle der Lieferung begonnen.
„Alors, 5 Pfund Pfeffer á 9 Gulden, 10 Achtel Nauheimer Salz à vier Gulden dreißig und 20 Pfund Zucker á 26 Taler und jetzt bringt ihr den Tee und Kaffee für unsere hochwohlgeborene Gräfin, très bien!“ Der Tee kostet also pro Pfund 18 Gulden und der Kaffee pro Pfund einen Gulden. Lichtenberger, Ihr brachtet also 5 Pfund Tee und 10 Pfund Kaffee.“
„Oui, mon ami, das macht also 188 Gulden und 20 Taler!“ entgegnet der Kaufmann.
Hätte Nolan die Holzschatulle mit Kaffee und Tee getragen, wäre sie ihm wahrscheinlich vor Schreck aus der Hand gefallen! Ihm stockt der Atem! So viel Geld! Er wird in Zukunft 20 Gulden in einem Jahr bei freier Kost und Logis verdienen, aber diese überschaubare Menge an Waren kostete mehr als neun Mal so viel! Schlagartig wird ihm klar, warum das Fuhrwerk des Kaufmanns so scharf bewacht war und warum er die letzte Kiste mit Kaffee und Tee nicht tragen durfte. Allein ein Pfund Tee kostet fast so viel, wie er in einem Jahr verdienen wird! Eingeschüchtert stellt er sich in die Ecke und wartet, bis die beiden Männer ihr Geschäft abgewickelt haben.