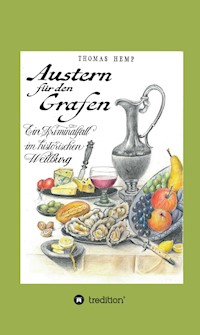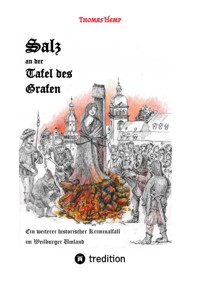
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im zweiten historischen Kriminalroman im Weilburger Umland "Salz an der Tafel des Grafen" vom Autor Thomas Hemp geht es um die Hexenprozesse in der Region im 17. Jahrhundert. Detailreich und fundiert recherchiert erzählt Hemp eine spannende Kriminalgeschichte, wie in seinem erfolgreichen ersten Roman "Austern für den Grafen. In zwei Zeitebenen, der Gegenwart und der Renaissancezeit, wird eine Geschichte geknüpft , die sich eng an historische Ereignisse hält. Das Ermittlerduo aus dem ersten Roman, Sophie Gamier und Peter Rheinschmidt, ist wieder einem Geheimnis in der Gegenwart auf der Spur, was aber seine Wurzel tief in der Geschichte der grausamen Hexenverfolgung hat, welche auch vor dem Weilburger Umland nicht halt gemacht hat. Der Leser erfährt vieles über die unbarmherzige Verfolgung unschuldiger Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft durch bloße Anschuldigungen in den Strudel der Folter, Verbrennung und Enthauptung geraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
© 2024 Thomas Hemp
Dieses Buch ist garantiert ohne künstliche Intelligenz, nur mit realem menschlichem Geist, geschaffen worden. Für alle Rechtschreibe- und Satzfehler ist ausschließlich der Autor verantwortlich!
Illustrationen: Dieter Boger/Thomas Hemp
„Gelbe Seiten“: Eva Weimar
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
ISBN 978-3-384-02390-2
Hardcover
ISBN 978-3-384-02391-9
e-Book
ISBN 978-3-384-02392-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Dieses Buch ist all denen Menschen gewidmet, die von Mitte bis Ende des 17. Jahrhunderts dem widersinnigen Wahn der Hexenprozesse in und um Weilburg zum Opfer fielen. Keiner der obskuren Anklagepunkte des gräflichen peinlichen Halsgerichtes ist den Angeklagten in der Realität vorzuwerfen gewesen. Dennoch führte allein die Anklage, wie in ca. 25000 Fällen in ganz Europa, zu einer Verurteilung und zum Tod.
Die Geschichte dieses Buches ist auch ein Erklärungsversuch, wie es zu einer solchen fanatischen Jagd nach vermeintlichen Hexen und Hexern kommen konnte.
Alle Namen in der Geschichte sind, bis auf den des Johann Preuss aus Merenberg, aus Respekt vor ihrem Schicksal, und der Unwissenheit um ihren wahren Charakter geändert. Abläufe und Geschehnisse, wie sie in Prozessakten im Stadtarchiv Weilburg zu finden sind, kommen der Realität sehr nahe… .
Thomas Hemp
Salz an der Tafel des Grafen
Ein weiterer Kriminalfall im historischen Weilburger Umland
Inhalt
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Prolog
Laut
Warnend
Friedrich
Peter
Graf
Frank
Der
Sophie
Am
Peter
Am
Abends
Eine
Schon
Zur
Peter
Früh
Mit
Der
Ein
Johann
Beim
Der
Sophie
Das
Fischer
Der
Mit
Epilog
Salz an der Tafel des Grafen
Cover
Urheberrechte
Titelblatt
Laut
Mit
Salz an der Tafel des Grafen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
Prolog
Unsere Geschichte spielt im Weilburg der Renaissance von Mitte bis Ende des 17. Jahrhunderts. Eine sich schillernd entwickelnde Epoche voller großartiger kunst- und geistesgeschichtlicher Errungenschaften machte auch vor der Residenzstadt Weilburg nicht halt.
Unter Graf Philipp III. wurde das Hoch-schloss begonnen, welches heute noch in seiner Vierflügelanlage fast unverändert vorhanden ist. Gerundete Giebelfassaden, verziert mit goldenen Kugeln, stellten eine eindrucksvolle Machtdemonstration dar.
Die Jahrhunderte überdauernden Werke in Kunst und technische Errungenschaften, wie beispielsweise die eines Leonardo Da Vinci, sind heute noch Zeugnisse dieser Zeit.
Der Buchdruck mit einzelnen Lettern machte es möglich, Bücher in großer Auflage fast für jeden zugänglich zu machen. Zuvor entstanden Bücher nur in klösterlichen Scriptorien, den Schreibstuben, als mühevolle aber kunstfertig ausgestaltete Handkopien in geringster Auflage.
Umstürze in der Religion, in Form der Reformation Martin Luthers, spalteten Europa in Glaubensfragen durch eine sich in der Renaissance veränderten Menschenbildes hin zu Selbstbewusstsein der Einzelnen, mehr geprägt durch verschiedene Humanisten dieser Zeit.
Dennoch erschütterten dramatische Ereignisse auch ganz Europa. Die Pest raffte fast ein Drittel der Bevölkerung hin und der 30jährige Krieg trug in ähnlicher Weise zum Leid der Bevölkerung bei.
Wetterphänomene, wie Schneefall im Juni bis hin zu „kleinen Eiszeiten“, sorgten für Ernteausfälle und damit zu Nahrungsnot in der gesamten Bevölkerung. Die Kindersterblichkeit war immens hoch und an eine Art von ärztlicher Versorgung war nicht zu denken.
In dieser Zeit war Graf Johann von Nassau-Saarbrücken mit Residenzsitz in Idstein der Vormund des jungen Grafen Friedrich von Nassau-Weilburg. Friedrichs Vater, Graf Ernst Casimir, war früh gestorben und Graf Johann verbrachte aufgrund seiner Vormundschaft viel Zeit in der Residenz Weilburg. Er war ein streng gläubiger Protestant, fest im Glauben, dass der Teufel existiert und er sich mit Hexen und Hexern zum Verderben der Menschheit verbinden würde.
Die beiden Originalstiche auf einem Blatt des Künstlers Merian aus dem Jahr 1655 zeigen idealisiert, wie viele seiner Stiche aus dieser Zeit, das vierflügelige Schloss Weilburg und auch die Stadtansicht von der Westerwaldseite. Das Schloss ist in Form und Fassade, Erkern, Türmen und Giebelwänden heute noch vorhanden. Der großzügige Innenhof ist in unserer Zeit Spielort der wunderbaren Schlosskonzerte. Die Stadtansicht von der Westerwaldseite aus zeigt auf der linken Seite die sicherlich im Bild überdimensionierte Kreuzigungsgruppe an der Heilig-Grab Kapelle. Dann, weiter nach rechts, den Turm der Stadtbefestigung hinter dem Stadttor, der heute noch steht. Inmitten der mit Mauern umfriedeten Stadt ist die Martinskirche zu sehen, die etwa 150 Jahre später der heutigen barocken Kuppelkirche weichen musste. Die sich rechts anschließende Schlossanlage hat in weiten Zügen ihr heutiges Erscheinungsbild erhalten. Häuser drängen sich dicht in winkligen Gassen hinter den Mauern um die Schlossanlage. Die Brücke mit der anschließenden Vorstadt, heute Niedergasse, und auch die Mühle davor findet man heutzutage genauso wieder.
Der einzige, schon fast berühmte Fehler dieses Stichs ist, dass Merian den Fluss Lahn in die falsche Richtung fließen lässt.
13. Octobris anno Domini 1658
Laut
und schwerfällig holpert der Karren langsam mit den eisenbeschlagenen Rädern am späten Vormittag vom Gefängnisturm zum vorbereiteten Richtplatz auf dem Marktplatz durch die verwinkelten, mit Kopfsteinpflaster belegten Gassen von Weilburg. Der Karren, gezogen von einem kräftigen Vollblüter aus den gräflichen Stallungen, kommt nur mühsam und voran, da der Weg, den er sich bahnen muss, durch die große Menschenansammlung noch enger ist, als ohnehin schon. Gerät der Zug ins Stocken, schieben begleitende Wachsoldaten mit ihren Hellebarden das Volk zur Seite, das seit Tagen nur auf diesen Augenblick gewartet hat. Einige Neugierige sind extra aus den umliegenden Gemeinden angereist, um dem sich anbahnenden Schauspiel beizuwohnen. Endlich … endlich wird das Unheil ein Ende nehmen. Die Bevölkerung ist gebeutelt von Missernten, Unwetter und dem Verlust des vielleicht einzigen wertvollen Besitzes in Form einer Kuh, eines Schweins oder Schafs. Dies wird heute ein Ende haben. Man ist zwei Hexen habhaft geworden. Es sind dies die Geschwister Amalia und Eva Hof im Alter von 14 und 15 Jahren aus der Gemeinde Allendorf bei Merenberg. Sie hatten, so hieß es in der Anklageschrift, „böses Feuer aus einem Topf gemacht und sich in der Nacht beim Viehhüten mit dem Teufel in Erscheinung eines jungen Mannes versündigt.“ Am nächsten Morgen waren vier Stück Vieh erschlagen aufgefunden worden.
Erbärmlich ist das Bild, was sich auf dem Karren der Weilburger Bevölkerung bietet. Kahl geschoren sind die Schädel der beiden Mädchen. Hier und da sieht man blutige Stellen, die von einer allzu hastigen und groben Rasur der Haare zeugen. Gekleidet sind sie nur mit je einem weißen, einfachen Leinenhemd welches mit verkrusteten Blutflecken überzogen ist. Ihre Hände sind mit groben Seilen auf den Rücken gefesselt. Man kann ihnen aber ansehen, dass sie zu einer Flucht überhaupt nicht mehr in der Lage sein würden.
Die linke Schulter Amalias, der jüngeren der Schwestern, hängt in einer unnatürlichen Stellung herunter, hat man sie doch in der peinlichen Befragung, wie die Folter heißt, mehrfach an den Händen hinter dem Rücken gefesselt und „aufgezogen“. Bei dieser Foltertechnik wurde man mit einem Seil an den Händen hochgezogen und anschließend wieder fallen gelassen, aber nicht bis zum Boden, sondern so, dass die auf den Rücken gebundenen Arme den freien Fall abfedern mussten. Brachen Schultergelenke oder Armknochen nicht beim ersten, so doch beim zweiten oder dritten Mal, bis die gequälten Menschen das gestanden, was das Gericht hören wollte.
Der Anblick der Verurteilten nach ihrer Tortur erfüllt die Menschenmenge nicht mit Mitleid oder Entsetzen, sondern sie johlt und jubelt und beschmeißt den Zug mit Abfällen, fauligem Obst oder Schlachtresten, so tief ist sie überzeugt, im Schicksal dieser erbarmungswürdigen Kreaturen die Schuldigen für ihr eigenes Unheil zu finden.
„Lasst sie brennen“ und „Richtet sie“ sind die Rufe, die die armen Seelen auf ihrem Weg zum Richtplatz begleiten. Einige in der Menge sind so enthemmt und haben Weidenruten vorbereitet, mit denen sie nach den Opfern schlagen. Trifft eine Rute ihr Ziel, reagieren die Mädchen höchstens mit einem kurzen Zucken. Nichts ist ein Hieb mit der Weidenrute gegen die Schmerzen, die sie durch die peinliche Befragung ertragen mussten.
In den eingefallenen Augen von Amalia und Eva Hof spiegelt sich das Leid der letzten Tage wider … ihr Blick ist ins Leere gerichtet und mit scheinbarer Regungslosigkeit erwarten sie ihr Schicksal.
Am Richtplatz angekommen, erblicken sie zwei Scheiterhaufen. Zwei große Eichenbalken sind nebeneinander senkrecht in den Boden gelassen worden. Vor jeden Balken wurde ein Holzblock gestellt, damit die Verurteilten einen erhöhten Stand haben. Um diese Konstruktion ist eine Vielzahl von Holzscheiten gelehnt, die mit Reisigzweigen unterfüttert sind, um so schneller Feuer zu fangen. Weitere Reisigbündel neben den beiden Scheiterhaufen warten nur darauf, gegen die am Eichenbalken gefesselten Verurteilten gelegt zu werden, damit die rasch emporzüngelnden Flammen vielleicht auch das Leid der Opfer verkürzen.
Als der Zug die Richtstätte auf dem Marktplatz erreicht, erblickt Eva in der aufgebrachten Menschenmenge ihre Mutter – vorbei ist es mit dem dumpfen Blick, schlagartig wird beiden klar, welcher qualvolle Tod ihnen bevorsteht. Ein Schrei entfährt ihrer Kehle, der allerdings im Gejohle der Massen untergeht. Die Mutter Hof hinter der Absperrung streckt ihre Hände flehend nach ihren Kindern aus, in dem Bewusstsein sie nie wieder erreichen zu können.
Amalia und Eva werden von zwei Soldaten vom Karren gezerrt, zu schwer sind die Verletzungen, die sie in der peinlichen Befragung erfahren haben, als dass sie noch zur Gegenwehr fähig wären. Während die Gepeinigten an den Eichenbalken gefesselt werden, verliest der Richter noch einmal das obskure Urteil mit den unter Folter erpressten Geständnissen. Fast gehen seine Worte in der aufgeheizten Stimmung unter. Der Graf Johann von Nassau-Saarbrücken, der die Vormundschaft in der Weilburger Residenz hat, ist am Fenster des Rathauses erschienen, um der Hinrichtung beizuwohnen, deren Urteil er am Vortag unterschrieben hat. Die Soldaten, als Helfer des Scharfrichters, haben die Reisigbündel hüfthoch um die Verurteilten aufgeschichtet, die eher in ihren Fesseln an den Eichenbalken hängen als dass sie noch aufrecht stehen könnten. Nachdem der Richter das Urteil verlesen hat, kontrolliert der Scharfrichter noch einmal die Verschnürung der beiden Mädchen und legt ihnen dabei unbemerkt etwas um den Hals. Als er zur Seite tritt, nickt er den Soldaten zu, die die Reisigbündel im Scheiterhaufen mit einer vorbereiteten Fackel in Brand setzen. Schnell züngeln die Flammen zu den Opfern empor und wie im Höhepunkt eines Schauspieles kreischt die Menge mit den hochschlagenden Flammen laut auf. Nur die Mutter Hof hat ihr Gesicht in den Händen vergraben. Die Flammen haben mittlerweile die Reisigbündel, die an den Mädchen lehnen, erreicht und verhüllen sie mit dichtem Qualm, der nur ab und zu den Blick auf sie freigibt. Plötzlich ertönt aus Eva Hofs Scheiterhaufen ein markerschütternder Schrei und man sieht durch den Rauch das Aufbäumen ihres Körpers gegen den Verbrennungsschmerz. Unmittelbar danach wiederholt sich das schreckliche Schauspiel auch auf dem zweiten Scheiterhaufen, angekündigt durch Amalias Brüllen. Das Volk raunt und johlt, als wolle es die Flammen antreiben, ihre grausige Aufgabe zu erfüllen – Plötzlich … völlig ohne Vorankündigung zerreißen zwei laute Schläge, Schüssen gleich, kurz hintereinander das Szenario. Sofort ersterben die Schreie der Gequälten in einem gurgelnden Ton. Der Qualm gibt kurz den Blick auf die Köpfe frei, aus deren zerrissenen Kehlen jetzt eine Unmenge von Blut pulsierend quillt, während die Körper leblos zusammensacken. Das hat der tobende Mob nicht erwartet und selbst der Graf am Fenster ist zusammengezuckt. Sekunden der Stille allein durch das Knistern der beiden Feuer überlagert, legen sich über den Richtplatz. Nur der Scharfrichter rührt sich nicht, hatte er doch der Mutter Hof ein übliches Angebot gemacht. Gegen ein nicht unerhebliches Salär hatte er ihr versprochen, ihren Töchtern eine Kette mit Säckchen voll Schrot und Schießpulver kurz vor ihrer Hinrichtung um den Hals zu hängen, um durch das Zerreißen der Halsschlagadern ihr Leid im Bruchteil einer Sekunde zu beenden. Der Graf und das jetzt verstummte Volk halten das Ereignis jedoch für Teufelswerk und nur noch ein leises Raunen geht über den Platz.
Mutter Hof erhebt sich aus ihrer gebückten Haltung und mit zittrig ausgestreckter Hand zeigt sie auf das Fenster, aus dem der Graf noch konsterniert auf die sich ihm darbietende Szenerie blickt.
„Brennen sollst Du selbst und des Teufels schlimmste Qualen ertragen … Du bist die Ausgeburt der Hölle …“, schreit sie ihm in ihrem Schmerz entgegen.
Angstvoll weicht der Graf vom Fenster zurück.
Noch keinen Monat später brennt die Mutter Hof selbst auf dem Scheiterhaufen.
Warnend
erhebt der Vorarbeiter an der Schippe die Hand in Richtung des Baggerfahrers. Er überwacht gerade die Ausschachtungsarbeiten für ein neues Ärztehaus am Ende der Frankfurter Straße. Mit dem letzten Hub der Baggerschaufel ist ihm etwas ungewöhnlich vorgekommen und er springt in die Grube. Nachdem er neugierig seine Schippe zum Nachstechen benutzt hat, fährt er verstört zurück als er realisiert was sie zu Tage gefördert haben. Am Boden der Grube, die die Baggerschaufel angeschnitten hat, starrt ein menschlicher Schädel mit leeren Augen schräg nach unten ins Erdreich. In seinem weit aufgerissenen Kiefer steckt ein großer, runder Flusskiesel, der die gesamte Mundhöhle ausfüllt. Reste des Skelettes ragen aus der Wand und wurden teilweise durch die Baggerschaufel beschädigt. Dem Vorarbeiter entgeht aber in seinem Entsetzen nicht, dass der Schädel statt am Halsende des Skelettes eher zwischen Hüfte und Brustkorb in Höhe des Bauchraumes liegt. Über dem Skelett kullern immer wieder aus einer waagrecht darüber angeordneten Schicht große, schwere, runde Flusssteine, die sich aus dem gelockerten Erdreich lösen.
Der Baggerfahrer stellt den Motor seines Arbeitsgerätes ab und gesellt sich mit ungläubiger Mine zu seinem Vorarbeiter.
„Lass uns den Chef und die Polizei alarmieren, hier machen wir nix mehr.“, findet der Vorarbeiter seine Sprache wieder, während der Baggerfahrer noch mit entrücktem Blick zustimmend nickt und sich mit der Hand unter dem Helm kratzt.
Schon kurze Zeit später wimmelt es an der Baustelle von Polizeifahrzeugen. Die Baugrube ist jetzt weitläufig mit Flatterband abgesperrt. Ein Polizist vernimmt mit Notizblock den Vorarbeiter und den Baggerfahrer. Ein Kripobeamter aus Limburg, Polizei-hauptkommissar Fischer, der bei einem unklaren Todesfall immer hinzugezogen wird, steht am Rande der Baugrube gekleidet in einem Schutzoverall. Ein Spurensicherungsteam in der Grube hat das erste Skelett weitgehend freilegen und einen zweites in unmittelbarer Nähe entdecken können. Alle beiden Leichname zeigen dieselben Auffälligkeiten: Sie waren mit der Bauchseite nach unten vergraben worden. Beide Schädel haben den die Kieferhöhle füllenden Stein im Mund, den Blick nach unten gerichtet und liegen nicht an der anatomisch vermuteten Stelle am Halsende, sondern im Becken- und Bauchbereich.
„Da hat einer aber ganz schön gewütet.“, bemerkt ein Spurensicherungsfachmann als er, wie er vermutet, schwere Hiebverletzungen am Hinterhauptbein des zweiten Schädels entdeckt.
„Nicht nur das.“, erwidert der Zweite. „Schau dir die Lage und die multiplen Frakturen der Extremitäten an. Arme und Beine sind an mehreren Stellen gebrochen und liegen auch nicht da wo sie sein sollen.“ Er zeigt mit einem Spatel auf seine Entdeckungen während er sie kommentiert.
„Ich denke hier wurde mit Vorsatz gehandelt. Die Leichen zeigen keine Bestattungszeichen wie Sargreste oder Tücher oder Decken … die wurden in aller Eile verbuddelt und das nicht in jüngster Vergangenheit.“
„Wie kommst du darauf?“, fragt der andere Beamte.
„Sieh dir den Zahnstatus an … die Corona dentis aller Zähne ist ungewöhnlich abgenutzt, es fehlen Zähne, andere sind kariös und nichts am Gebiss ist saniert. Die liegen hier schon seit vor dem 19. Jahrhundert. Nagel mich aber nicht darauf fest.“
„Das stimmt, da hast du Recht.“, erwidert der Kollege kopfnickend und schaut in eine andere Richtung. Mit seinem Spatel zeigt er auf eine ungewöhnlich schwarz verfärbte Stelle in der Wand der Baugrube, die etwas entfernt von den Skeletten ist.
„Schau dir das an … ungewöhnlich finde ich.“, sagt er und beugt sich nach vorne, um vorsichtig in der Verfärbung zu kratzen. Sein Kollege nähert sich und beobachtet das Treiben neugierig. Beide fahren erstaunt zurück, als sich aus der krümeligen Masse plötzlich ein Stück schwarzes Schädelfragment, zirka ein Viertel der linken Gesichtshälfte, herauslöst und die beiden durch die eine erhaltene Augenhöhle scheinbar mit geisterhaften Blick anstiert. Beide Männer richten sich auf und starren sich an.
„Wow, da ist ja leider noch mehr zu entdecken.“, findet einer der Männer Worte.
„Ja, aber ich denke da liegen wir richtig. Die Funde sind nicht aus unserer Zeit und bei der letzten schwarzen Verfärbung handelt es sich um einen Leichenbrand. Das ist wohl eher ein Fall für das archäologisch- anthropologische Institut der Uni Gießen.“, entgegnet der andere.
Polizeihauptkommissar Fischer am Rand der Grube hat das Gespräch mitgehört. Er zieht schon während er sich abwendet sein Diensttelefon aus der Tasche, um den entsprechenden Kontakt herzustellen.
Sophie Gamier zieht an diesem Morgen die Rollladen ihrer Wohnung am Marktplatz der Stadt Weilburg auf und die Gardinen zur Seite, so dass das Morgenlicht der Sonne in ihre Wohnung fällt. Für einen Moment badet sie ihr Gesicht in der wohligen Wärme. Peter Rheinschmidt umarmt sie von hinten und sie schmiegen sich aneinander.
Seit sie das Geheimnis um den Ursprung ihrer Familie vor einiger Zeit mit Peter gelöst hatte, hat sie sich in die kleine barocke Residenzstadt Weilburg verliebt und ist in ein Steuerbüro eingestiegen. Kurze Zeit später fand Peter Rheinschmidt eine Anstellung im archäologisch-anthropologischen Institut der Universität in Gießen.