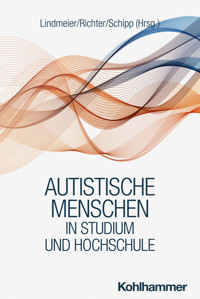
Autistische Menschen in Studium und Hochschule E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Zahl der Studierenden, die sich im neurodivergenten Spektrum verorten, steigt an deutschen Hochschulen ebenso wie international. Dennoch sehen sich diese Studierenden mit neuro-normativen Erwartungen und Herausforderungen konfrontiert. Die Beitragenden dieses Buchs analysieren die Lern- und Lebensumstände autistischer Menschen im Studium und ziehen praxisrelevante Schlussfolgerungen für die Realisierung einer chancengerechten, qualitativ hochwertigen Hochschulbildung & denn inklusive Hochschulen, die die komplexen Bedarfe von Studierenden im neurodivergenten Spektrum beachten, kommen allen Studierenden zugute. Im Mittelpunkt der Beiträge stehen der Übergang von der Schule in das Studium, Herausforderungen, Barrieren und Strategien im und für das Studium sowie der Übergang vom Studium in das Berufsleben. Erfahrungsberichte von Expertinnen und Experten in eigener Sache (autistische Studierende sowie Mitarbeitende an Universitäten) werden um Schilderungen autismusspezifischer Projekte verschiedener Hochschulen im In- und Ausland ergänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort des Herausgebers der Buchreihe
Vorwort
I Übergänge von der Schule an die Hochschule begleiten und gestalten
1 Zwischen Abitur, sozialen Kontakten und Wäsche waschen
2 Von der Schule an die Hochschule: Autist*innen im Übergangsprozess
2.1 Einleitung
2.2 Autist*innen im Übergang von der Schule in das Studium
2.3 Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote an der Schnittstelle Schule – Studium
2.4 Fazit
2.5 Literatur
3 Das Aktion-Mensch-Projekt IBERA: Individuelle Integrationsberatung für Menschen im Autismus-Spektrum mit Hochschulreife
3.1 Literatur
4 Übergang Schule – Studium im Autismus-Spektrum: Unterstützungsmöglichkeiten am Beispiel des kombabb-Kompetenzzentrums NRW
4.1 Einleitung
4.2 kombabb als Anlaufstelle für Studieninteressierte im Autismus-Spektrum
4.3 Die Situation von Studierenden mit (nicht-)sichtbarer Behinderung/chronischer Erkrankung im Studium in Deutschland
4.4 Übergang Schule – Studium: Eine sensible Phase für junge Menschen im Autismus-Spektrum
4.4.1 Zentrale Aspekte im Übergang Schule – Studium
4.4.2 Wie kann der Übergang gut gelingen?
4.5 Studieren im Autismus-Spektrum
4.5.1 Was bedeutet das für den Studienalltag?
4.5.2 Unterstützungsmöglichkeiten im Studium
4.6 Ein Blick in die Praxis
4.6.1 Umfrage an Hochschulen in NRW
4.6.2 Darstellung wesentlicher Ergebnisse
4.6.3 Ergänzende Erfahrungswerte von kombabb
4.7 Fazit und Ausblick
4.8 Literatur
5 Wie erleben Autist*innen den Übergang von der Schule ins Studium? Ergebnisse eines exemplarischen, systematischen Reviews
5.1 Einleitung
5.2 Methodisches Vorgehen
5.3 Ergebnisse
5.4 Diskussion der Ergebnisse
5.5 Fazit
5.6 Literatur
II Barrieren und Herausforderungen in Studium und Hochschule identifizieren und bewältigen
6 Wie inklusiv sind deutsche Hochschulen? Strukturelle Rahmenbedingungen und Entwicklungspotenziale (nicht nur) für autistische Studierende
6.1 Einleitung
6.2 Die Hochschule als exklusiver Raum
6.3 Teilhabe an Hochschulbildung und studentischem Leben
6.3.1 Teilhabe
6.3.2 Universal Design for Learning
6.4 Beeinträchtigt studieren: Die Situation autistischer Studierender
6.4.1 Strukturelle Bedingungen des Studiums als Herausforderung für autistische Studierende
6.4.2 Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit autistischer Studierender
6.5 Fazit
6.6 Literatur
7 Hochleistungsmasking und Übersetzungsfehler: Über die (Un-)Sichtbarkeit von (meinem) Autismus im Studium
7.1 Strukturelle Rahmenbedingungen und (meine) Probleme damit
7.1.1 Autistische Studierende sind (gar nicht so) selten
7.1.2 Und wo ist das Problem?
7.2 Masking und das Ding mit der Kommunikation
7.2.1 »Lost in Translation«
7.2.2 Und warum überhaupt maskieren?
7.3 Wie lassen sich die Gegensätze auflösen – oder auch nicht?
7.4 Zusammenfassung
7.5 Ausblick – Wie kann es also gelingen?
7.6 Literatur
8 Angemessene Vorkehrungen und Nachteilsausgleiche als Voraussetzungen für eine gelingende Teilhabe von Studierenden im Autismus-Spektrum an Hochschulen
8.1 Einleitung
8.2 Individuelle Auswirkungen des Autismus-Spektrums gegenüber den von Hochschulen definierten Studienbedingungen: Skizze eines Spannungsfeldes
8.2.1 Die Säulen des Bildungs- und Lebensraums Hochschule: Wissenschaftsfreiheit, Berufsfreiheit und Gleichbehandlungsgrundsatz
8.2.2 Spezifische Verhaltensweisen von Studierenden im Autismus-Spektrum
8.2.3 Neurotypisch ausgerichtete Anforderungen im Studium
8.2.4 Situationen im Studienablauf mit unterschiedlichen Herausforderungen
8.3 Maßnahmen für die gelingende Teilhabe: Rechtsgrundlagen, Verfahrensweisen und Praxiserfahrungen
8.3.1 Rechtsgrundlagen
8.3.2 Aspekte der Barrierefreiheit im Kontext von Studierenden im Autismus-Spektrum
8.4 Zusammenfassung und Ausblick
8.5 Literatur
9 Eine Minderheit in der Minderheit? Mein Weg als autistische Geisteswissenschaftlerin
10 Selbstbestimmung auf der Tertiärstufe: Wissen und Praxis
10.1 Die Positivspirale der Selbstbestimmung
10.2 Autismus und Hochschulbildung
10.2.1 Vielfalt, Neurodiversität und der Stellenwert von Autismus
10.2.2 Herausforderungen
10.3 Selbstbestimmung verstehen
10.3.1 Motivation als Grundlage des Konzepts der Selbstbestimmung
10.3.2 Die Rolle des Umfelds
10.3.3 Die kausale Handlungstheorie
10.4 Unterstützung der Selbstbestimmung
10.4.1 Die Rolle von autistischen Studierenden beim Erlangen der Selbstbestimmung
10.4.2 Die Rolle des Umfelds bei der Unterstützung der Selbstbestimmung von Studierenden
10.5 Selbstbestimmung: Prämisse des Konzepts der wellenförmigen Inklusion
10.6 Literatur
III Ansätze und Perspektiven für ein autismussensibles Studium an Hochschulen
11 Brücken bauen: Perspektivenübernahme zwischen Studierenden im Autismus-Spektrum und Dozierenden wechselseitig gestalten
11.1 Einleitung
11.2 Ausgangslage
11.3 Unser Autismusverständnis
11.3.1 Autismus und Neurodiversität
11.3.2 Autismus – Individuelle Vielfalt und Gemeinsamkeiten
11.4 Situationen im Studienalltag: Anforderungen und Handlungsanregungen
11.4.1 Kommunikation der eigenen Diagnose und individuellen Bedürfnisse
11.4.2 Gruppenarbeiten
11.4.3 Mündliche Präsentationen
11.4.4 Schriftliche Arbeiten
11.4.5 Workload im Kontext von Seminaren und Prüfungen
11.5 Brücken bauen: Ein wechselseitiger Prozess
11.6 Literatur
12 Ein großer Schritt: Lernfeld selbstständig leben mit Autismus ABW – ein Projekt stellt sich vor
13 Autismusfreundliche(re) Universitäten? Beispiele europäischer Hochschulstandorte
13.1 Die Situation autistischer Studierender an Hochschulen und Universitäten
13.1.1 Stärken autistischer Studierender
13.1.2 Herausforderungen und Barrieren im Studienkontext
13.1.3 Maßnahmen und Strategien an den Hochschulen
13.2 Das EU-Projekt Autism&Uni
13.3 Beispiele aus europäischen Hochschulstandorten
13.3.1 Autism&UniSwiss: Ein Anwendungsbeispiel
13.3.2 Dublin City University – »The World's First Autism-Friendly University«
13.3.3 Französische Universitäten werden Atypie-Friendly
13.4 Ausblick
13.5 Literatur
14 Zusammenarbeit in Aktion: Lektionen aus einem Kooperationsprojekt mit autistischen Studierenden
14.1 Einleitung
14.2 Kontextualisierung des Projekts
14.2.1 Hochschulbildung und autistische Studierende
14.2.2 Inklusive Forschung und Autismus
14.3 Zusammenarbeit in Aktion: Das AuVision-Projekt
14.3.1 Das Kooperationsteam
14.3.2 Datenerhebung
14.4 Erkenntnisse aus dem Projekt »Zusammenarbeit in Aktion«
14.4.1»Interactional expertise« entwickeln
14.4.2 Ausbildung der nächsten Generation von Führungskräften
14.5 Abschließende Punkte
14.5.1 Bedeutung für die Hochschulbildung
14.5.2 Bedeutung für die Forschung
14.6 Literatur
Anhang: Projekt-Empfehlungen
IV Übergänge vom Studium in das Arbeits- und Berufsleben koordinieren und moderieren
15 Gelingensbedingungen für den Übergang vom Studium in den Beruf: Praxisbeobachtungen und Empfehlungen am Beispiel von Salo+Partner
15.1 Herausforderung Studium
15.2 Erhöhte Arbeitslosigkeit unter Autist*innen
15.3 Unterstützungsmöglichkeiten
15.4 Gelingensbedingungen
15.5 Literatur
16 Jenseits der Normen: Einblicke in meinen Arbeitsalltag als (autistische) wissenschaftliche Mitarbeiterin
17 Herausforderungen beim Übergang vom Studium in den Arbeitsmarkt: Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit
17.1 Gesetzlicher Anspruch
17.2 Wirklichkeit: Aktueller Forschungsstand und Arbeitsmarktsituation
17.3 Stärken autistischer Menschen, die dem Arbeitsmarkt »verloren gehen«
17.4 Ausgewählte Fallbeispiele
17.5 Lösungsmöglichkeiten für die Chancensteigerung einer Einmündung in inklusive Arbeit
17.6 Literatur
18 Autist*innen im Übergang vom Studium in den Beruf
18.1 Autismus und Studium
18.2 Übergang ins Arbeitsleben
18.3 Übergang Studium – Erwerbsleben
18.4 Literatur
19 Herausforderungen beim Übergang vom Studium in den Beruf und wie sie erfolgreich bewältigt werden können
19.1 Der Übergang vom Studium in den Beruf
19.2 Ausbildungsniveau autistischer Menschen
19.3 Herausforderungen in der Arbeitswelt
19.4 Abschluss des Studiums und die Suche nach Arbeit
19.4.1 Abschlussarbeit und Praktikum
19.4.2 Bewerbungsphase und Stellensuche
19.4.3 Einarbeitungsphase
19.5 Start in den beruflichen Alltag und die Vorteile neurodiverser Teams
19.6 Literatur
V Anhang
Autor:innenverzeichnis
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Pädagogik im Autismus-Spektrum
Herausgegeben von Christian Lindmeier
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/paedagogik-autismus-spektrum
Die Herausgebenden
Prof. Dr. Christian Lindmeier leitet die Arbeitsbereiche »Pädagogik bei kognitiver Beeinträchtigung« und »Pädagogik im Autismus-Spektrum« an der Universität Halle-Wittenberg. Carina Schipp ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dr. Mechthild Richter war dort ebenfalls tätig und ist nun wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Erfurt.
Lindmeier/Richter/Schipp (Hrsg.)
Autistische Menschen in Studium und Hochschule
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-043648-0
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043649-7epub: ISBN 978-3-17-043650-3
Vorwort des Herausgebers der Buchreihe
Die Buchreihe ›Pädagogik im Autismus-Spektrum‹ soll dazu beitragen, im deutschsprachigen Raum eine erziehungswissenschaftliche Autismusforschung und eine Pädagogik im Autismus-Spektrum zu etablieren. Als Sozial- und Kulturwissenschaft und soziale und kulturelle Praxis sind Erziehungswissenschaft und Pädagogik in erster Linie an Rekonzeptualisierungen von Autismus interessiert, die von der medizinisch-psychiatrischen Konzeptualisierung von Autismus als neurologische Entwicklungsstörung (DSM-5, ICD-11) abrücken und ihr die Anerkennung einer Neurodiversitätsperspektive, operationalisiert in partizipativen Forschungsmodellen, gegenüberstellen (Happé & Frith 2020).
Nicht nur zur Vermeidung einer abwertenden, normorientierten Sprache wird in der Buchreihe daher bewusst auf den medizinisch-psychiatrischen Begriff ›Autismus-Spektrum-Störung‹ (ASS) als personenbezogene Kategorie verzichtet. Stattdessen wird der auf Neurodiversität Bezug nehmende Begriff ›Autismus-Spektrum‹ verwendet und sporadisch auch die von Teilen der weltweiten ›Autistic Community‹ geforderte ›Identity-First-Language‹, welche die Bezeichnungen ›Autist:in‹ oder ›autistische Person‹ bevorzugt.
Der Begriff der Neurodiversität wurde Anfang der 1990er Jahre u. a. von der australischen Soziologin und Autistin Judy Singer (Singer 2017) geprägt. Neurodiversität bedeutet, dass die Menschheit nicht nur ethnisch und in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung und zahlreiche andere Eigenschaften, sondern auch neurokognitiv vielfältig ist. Die Ergänzung durch den Begriff der Neurominorität (neurominority) (Walker & Raymaker 2021) weist Autist:innen als eine neurominoritäre Gruppe aus. Während Neurodiversität die Bandbreite der Unterschiedlichkeit aller Menschen bezeichnet, bedeutet Neurodivergenz, von den vorherrschenden kulturellen Standards für neurokognitive Funktionen individuell abzuweichen. In diesem neueren Diskurs sind die Kulturalisierung von Norm und Abweichung sowie die Überwindung eines Pathologie- bzw. Störungskonzepts ein wichtiges Thema. Anders als das Pathologie-Paradigma, das Neurodivergenz (z. B. Autismus, ADHS) als negative Abweichung von der Normalität ansieht, geht das Neurodiversitäts-Paradigma von der Existenz neurokognitiver Minoritäten aus und erkennt sie als gleichberechtigt mit der Mehrheit in Bezug auf ihre Wahrnehmung, Kognition, Motorik und Kommunikation an.
Eine der zentralen Forderungen der Neurodiversitätsbewegung als Menschenrechtsbewegung, die in den 1990er-Jahren als Antwort auf die Pathologisierung von ›neurologischen Minderheiten‹ entstand (Kapp 2020), ist die Einbindung autistischer Menschen in die (erziehungs-)wissenschaftliche Autismusforschung (Fletcher-Watson & Happé 2019). In der Buchreihe werden daher als Beitragende aller Bände autistische Expert:innen beteiligt sein. Die bisherigen Planungen beziehen sich auf die ersten fünf Bände zu den Themen Autismus und Neurodiversität (Bd. 1), Sprache und Kommunikation bei Autismus (Bd. 2), Schulassistenz bei Autismus (Bd. 3), Autismus und Studium (Bd. 4) sowie Weibliche Adoleszenz und Autismus (Bd. 5). Damit enthält die Reihe neue, innovative Themen ebenso wie seit langem als wichtig erkannte Themen wie Sprache bzw. Sprachbesonderheiten, die allerdings auch stärker als üblich aus der Perspektive des Neurodiversitätskonzepts betrachtet werden.
Literatur
Fletcher-Watson, S. & Happé, F. (2019). Autism: A new introduction to psychological theory and current debate. Routledge.
Happé, F. & Frith, U. (2020). Annual Research Review. Looking back to look forward – changes in the concept of autism and implications for future. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(3), 218 – 232.
Kapp S. S. (Hrsg.) (2020). Autistic Community and the Neurodiversity Movement Stories from the Frontline. Palgrave Macmillan.
Singer, J. (2017). NeuroDiversity: The Birth of an Idea. Judy Singer.
Walker, N. & Raymaker, D. M. (2021). Toward a Neuroqueer Future: An Interview with Nick Walker. Autism in Adulthood, 3, 5 – 10.
Vorwort
Die Idee zu diesem Sammelband über Autist:innen in Studium und Hochschule entstand vor ca. drei Jahren, als wir im Wintersemester 2021/2022 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) während der Covid-19-Pandemie eine Online-Vortragsreihe zum Thema ›Autismus und Studium‹ durchführten. Einige Zeit später waren wir außerdem an der Erarbeitung einer Konzeption für eine universitäre Selbsthilfegruppe für Studierende im neurodivergenten Spektrum beteiligt, die zustande kam, weil insbesondere autistische Studierende mit Fragen nach angemessener (Lern-)Unterstützung an die Beratungsstelle für Inklusion der MLU herangetreten waren. Der lebendige Austausch zwischen den vielen jungen sowie erfahreneren, autistischen sowie nicht-autistischen Vortragsteilnehmenden im Anschluss an die Online-Vorträge sowie die Konzeption der Selbsthilfegruppe haben uns gezeigt, dass auch die beiden Übergänge von der allgemeinbildenden Schule in das Studium bzw. an die Hochschule und von der Hochschule in Arbeit und Beruf Beachtung finden müssen, und nicht nur die Studienerfahrungen und -ergebnisse. Der vorliegende Band bildet aus diesem Grund den gesamten Weg von der Schule bis in die Berufstätigkeit ab und stützt sich dabei auf die Erfahrungen aktueller und ehemaliger autistischer Studierender sowie auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
Wenn die komplexen Bedarfslagen von Studierenden im neurodivergenten Spektrum im Fokus stehen, geht es immer auch um die Entwicklung hin zu einer barrierefreien bzw. inklusiven Hochschule. Neurodiversität ist eine Dimension der neurologischen und sozialen Differenz, die in der Literatur zur Hochschulbildung bislang relativ wenig Beachtung gefunden hat, obwohl die Zahl der Studierenden, die sich im neurodivergenten Spektrum verorten, an internationalen Universitäten zunimmt (z. B. Bakker et al. 2019). Auch im Hochschulkontext zählen zum neurodivergenten Spektrum u. a. Autist:innen, Studierende mit ADHS, zugeschriebener Dyslexie oder Dyskalkulie (z. B. Hamilton & Petty 2023). Diese gruppenbezogene Adressierung wird von Vertreter:innen des sog. Neurodiversitätsparadigmas als pathologisierende, diagnostische Zuschreibung kritisch hinterfragt. Gleichzeitig wird postuliert, dass neurokognitive Unterschiede als natürliche Variationen angesehen werden sollten. Vorherrschend sei hingegen ein marginalisierender (Neuro-)Ableismus, der die Wahrnehmung und die damit einhergehenden Kommunikationsstrategien neurotypischer Menschen zum Standard erklärt.
Belastbare Daten über die akademischen Studienerfolge bzw. -abschlüsse von Studierenden im neurodivergenten Spektrum sind zwar derzeit nicht verfügbar; die vorhandenen Studien deuten jedoch darauf hin, dass das Wohlbefinden und die berufliche Teilhabe in dieser Bevölkerungsgruppe im Vergleich zu Gleichaltrigen tendenziell schlechter sind (z. B. Bayeh 2022).
Auch für die Hochschule als Bildungseinrichtung und -kontext gilt, dass das soziale Umfeld von zentraler Bedeutung ist: Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch im Studium das Lernen von den sozialen Interaktionen zwischen den Studierenden sowie zwischen den autististischen Studierenden und dem Lehr- und Fachpersonal abhängt. In diesem Zusammenhang ist das Problem der doppelten Empathie (Milton 2012) von Bedeutung. Es bezieht sich auf die wechselseitigen Verständnisdefizite zwischen autistischen und sog. neurotypischen Personen, denn wenn Kommunikationspräferenzen und sensorische Empfindungen zwischen den verschiedenen ›Neurotypen‹ variieren, kann dieses Problem besonders ausgeprägt sein. Um doppelte Empathiebarrieren zu überwinden, müssen Lehrende an Hochschulen ihre Vorbehalte und Vorurteile sowie ihre Forschungs- und Lehrpraxis kritisch reflektieren. Dies könnte z. B. bedeuten, dass sie bewusst vermeiden, das Verhalten der Studierenden aus einer neuro-normativen Perspektive zu interpretieren. Auch ein Überdenken der Sprache, die sie verwenden, wenn sie über Unterschiede sprechen, kann dazu beitragen, ein Lernumfeld zu schaffen, das die neurokognitive Vielfalt stärker einbezieht (Bottema-Beutel et al. 2021; Lindmeier 2023).
Um an Hochschulen die notwendige (Lern-)Unterstützung zu erhalten – etwa im Rahmen eines Nachteilsausgleichs – sind Studierende häufig dazu gezwungen, ihre medizinische Diagnose offenzulegen und auf ihre Herausforderungen hinzuweisen, während ihre individuellen Stärken und Kompetenzen dabei oftmals in den Hintergrund treten. Das Aushandeln dieser doppelten Realität stellt für viele neurodivergente Studierende ein Spannungsfeld dar, das die Notwendigkeit eines Wandels hin zu inklusiven Ansätzen wie z. B. dem Universellen Design für das Lernen (UDL) (Lindmeier 2019) offenbart. Die Umsetzung der Erkenntnisse des Neurodiversitätskonzepts in den Universitäten bedeutet, über einfache Anpassungen oder Ergänzungen der derzeitigen Praxis hinauszugehen (d. h. auch über Nachteilsausgleiche). Gegenwärtig liegt die Last zu oft bei den Studierenden, die neuro-normativen Erwartungen zu erfüllen, z. B., indem sie ihr autistisches Selbst zugunsten eines gesellschaftlich erwünschten Verhaltens maskieren (Masking). Um die Praxis zu verändern, müssen Lernen und Lehren für eine vielfältige Studierendenschaft konzipiert und Lernkontexte geschaffen werden, in denen neurodivergente Studierende gesehen und verstanden werden sowie sich entfalten können.
Angesichts dieser Herausforderungen sollten Hochschulleitungen der Verbesserung der sozialen Erfahrungen und der akademischen Ergebnisse von neurodivergenten Studierenden Priorität einräumen. Viele Barrieren sind bekannt, Lösungen werden auch aufgezeigt: Nun sind Hochschulen in der Pflicht, ihren Inklusionszielen näher zu kommen.
Halle an der Saale, Oktober 2024Christian Lindmeier, Mechthild Richter, Carina Schipp
Literatur
Anderson, A. H., Stephenson, J. & Carter, M. (2017). A systematic literature review of the experiences and supports of students with autism spectrum disorder in post-secondary education. Res. Autism Spectr. Disord. 39, 33 – 53. doi: 10.1016/j.rasd.2017.04.002
Bakker, T., Krabbendam, L., Bhulai, S. & Begeer, S. (2019). Background and enrollment characteristics of students with autism in higher education. Res. Autism Spectr. Disord., 67, 101424. doi: 10.1016/j.rasd.2019.101424
Bayeh, R. (2022). Neurodiversity, Intersectionality and Distress: A Quantitative Survey on the Experiences of University Students. MA thesis. Montreal: Concordia University.
Bottema-Beutel, K., Kapp, S., Lester, J. N., Sasson, N. J. & Head, B. N. (2021). Avoiding ableist language: suggestions for autism researchers. Autism Adulthood, 3, 18 – 29.
Hamilton, L. G., Petty, S. (2023). Compassionate pedagogy for neurodiversity in higher education: A conceptual analysis. Front. Psychol., 14, 1 – 9.
Lindmeier, C. (2019). Universelles Design für das Lernen – ein Konzept für die Inklusion in der beruflichen Bildung. In C. Lindmeier, H. Fasching, B. Lindmeier & D. Sponholz (Hrsg.), Inklusive Berufsorientierung und berufliche Bildung – aktuelle Entwicklungen im deutschsprachigen Raum. Beltz Juventa, S. 249 – 264.
Lindmeier. C. (2023). Sprach- und Identitätspolitik der Neurodiversitätsbewegung autistischer Menschen – die Debatte über Person-First Language vs. Identity-First Language. In C. Lindmeier, S. Sallat & I. Ehrenberg (Hrsg.), Sprache und Kommunikation bei Autismus. Stuttgart: Kohlhammer, S. 61 – 72.
Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the ›double empathy problem‹. Disabil. Soc., 27, 883 – 887.
I Übergänge von der Schule an die Hochschule begleiten und gestalten
1 Zwischen Abitur, sozialen Kontakten und Wäsche waschen
Clara Tabea Ketterer
Ich möchte mich mit den Worten einer damaligen Mitschülerin vorstellen: »Das ist die Tabea, die ist manchmal ganz schön komisch.« Das war in der neunten Klasse, kurz nachdem wir einen neuen Klassenkameraden bekommen hatten. Damals hatte ich für dieses »komisch« keinen Namen. Heute schon: Autismus. Im folgenden Abschnitt werde ich berichten, wie sich für mich als Person auf dem Spektrum die Zeit kurz vor, während, hauptsächlich aber nach dem Abitur gestaltet hat. Ein paar grundlegende Dinge muss ich allerdings davor noch erklären, damit die bei mir auftretenden Herausforderungen nachvollziehbar sind.
Ein Merkmal von Autismus, das sich in meinem persönlichen Fall besonders zeigt, ist eine mangelnde Adaptationsfähigkeit, also die erschwerte kognitive Anpassung an eine neue Situation. Vielen von uns Autist:innen fällt es unwahrscheinlich schwer, Planänderungen hinzunehmen und uns auf unbekannte Umgebungen einzustellen. Woran das liegt, möchte ich gerne anhand eines Bildes erklären, das ich auch in Vorträgen immer wieder einsetze:
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Straße unterwegs. Um Sie herum stürmt und gewittert es, als sei der Weltuntergang nahe, außerdem schüttet es wie aus Eimern. Der Regen peitscht auf Sie ein und Sie sind schon völlig durchgefroren. Sie sind schon seit Stunden draußen, aber noch ist weit und breit kein Ende in Sicht. Um sich herum sehen Sie Personen, die in ihre Häuser hasten, wo sie sich nun aufwärmen und erholen können. Sie beneiden diese Leute ... Sie selbst gehen weiter. Irgendwann beginnen Sie zu rennen, immer und immer hektischer, um so schnell wie möglich ins Trockene zu kommen. Ein wenig Regen und Sturm ist ja in Ordnung, aber doch nicht so viel! Aber dort vorne, bei dem Café, dessen Markise noch ausgefahren ist: Da können Sie sich kurz unterstellen, bis es vielleicht ein wenig besser wird. Erleichtert hasten Sie also zu besagtem Café und lassen sich ein wenig antrocknen. Kurz durchatmen! Aber dann kommt auf einmal der Inhaber und dreht die Markise zurück. Sie müssen also weiter. Inzwischen ist der Wind schon so stark, dass Sie richtig kämpfen müssen, um nicht weggeweht zu werden. Eine Sturmwarnung wird herausgegeben. So langsam rückt Ihr Haus näher. Sie freuen sich, als Sie über die Brücke über den mittlerweile reißenden Bach gehen, denn das bedeutet, dass Sie sich am Geländer entlanghangeln können. Es gibt Ihnen Sicherheit auf dem Weg nach Hause, damit Sie nicht doch noch womöglich im Wasser landen. Doch dann stellen Sie nervös fest, dass das Geländer mitten auf der Strecke einfach endet: Es besteht also die Möglichkeit, dass Sie irgendwann im Wasser landen und ertrinken ...
Ein ziemliches dystopisches Szenario, oder? Nun, für mich als Autistin ist das im übertragenen Sinne Alltag. Es geht um das Thema Reizüberflutung. Um uns alle herum herrscht eine ständige Sturmflut an Gedanken, Geräuschen und allgemeinen Eindrücken, instinktiv aufgeschnappten Emotionen und Stimmungen. Neurotypische Personen, also solche Personen, die nicht von Autismus, AD(H)S oder anderen unter dem Begriff Neurodivergenz zusammengefassten Abweichungen der Reizwahrnehmung und -verarbeitung betroffen sind, haben bildlich gesprochen Wohnungen und Häuser, in denen sie sich vor diesen Eindrücken schützen können. Sie haben keine oder zumindest geringere Probleme, nur selbst gewählte Reize zuzulassen. Autistische Personen haben mit genau diesem Filtern oft massive Schwierigkeiten. Um bei meinem Bild zu bleiben: Sie haben kein solches Haus oder wissen, dass dieses noch weit entfernt ist. Sie müssen also diese Reize einfach auf sich einprasseln lassen, ohne eine Rückzugsmöglichkeit zu haben. Gelingt es ihnen nicht, zwischendurch Ankerpunkte zu finden, laufen sie Gefahr, metaphorisch gesehen ins Wasser zu fallen und unterzugehen – was sich als Reizüberflutung bis hin zum Shutdown (völliger Rückzug), zu Panikattacken oder sogar Meltdowns, d. h. (auto-)aggressivem Verhalten aufgrund von Überforderung, äußert.
Für welchen Aspekt stehen nun das Café und das Geländer? Für Vertrautheit, Rituale und bekannte Situationen. Darunter fallen auch die sog. Stimmings, wiederholte Bewegungen, Phrasen oder Melodien, die es einem ermöglichen, sich Sicherheit und Stabilität zu verschaffen. Die Logik dahinter ist, dass solche Bewegungsabläufe und vertrauten Situationen eben keine neuen Reize und Informationen beinhalten, die neu verarbeitet werden müssen. Sie stellen vielmehr eine Möglichkeit dar, sich – wenn auch für begrenzte Zeit – auf bereits bekannte, beruhigende Reize zu fokussieren. Außerdem kann die ständige Wiederholung einer Bewegung zu einer Art Trance führen, die das Ausblenden von Reizen erleichtert. Ebenso wie bspw. ein Säugling seinen Schnuller braucht, brauchen viele Personen mit einer Filterschwäche diese vertrauten Elemente im Alltag, an denen sie sich entlanghangeln können.
Ich bin mir also sicher, Sie können nachvollziehen, dass für mich als Autistin in solchen Zeiten des völligen Umbruchs, die ja sogar neurotypische Personen herausfordern und von einem Wegfallen so gut wie aller Gewohnheiten und vertrauten Situationen charakterisiert werden, vor allem die anstehende Ungewissheit in Kombination mit einem erhöhten Maß an Reizüberflutung und zu verarbeitenden Impulsen ausschlaggebend dafür war, dass ich sehr schnell in ein Burnout bzw. eine depressive Phasen abrutschte. Denn ohne diese Stützen im Alltag zu haben – die Rituale, die vertrauten Orte, die Stimmings – gerät der Geist schnell in Ungleichgewicht.
Aber warum fielen auch die Stimmings weg? Genau das ist der zweite Punkt, der wichtig zu verstehen ist: Social Masking. Das steht unter dem Motto: »Ach wie gut, dass niemand weiß, wie sehr ich mich grade zusammenreiß.« So lässt sich die Tendenz einiger autistischer Personen beschreiben, vor allem solcher, die nicht oder nur geringfügig kognitiv beeinträchtigt sind, sich so gut wie möglich an die Umwelt anzupassen. Sie beobachten schon von klein auf ihre Mitschüler:innen und sind in der Lage, ihr Verhalten haargenau zu analysieren und für sich selbst zu kopieren. Weshalb sie das tun? Weil häufig das intuitive Verständnis für soziale Normen und Regeln einfach fehlt. Ich habe oft gesagt, ich habe den Eindruck, ein Memo nicht bekommen zu haben, in dem alle sozialen Situationen und dazugehörigen Regeln und Muster einmal aufgelistet sind. Ich schaffe es nicht, eine neue Situation intuitiv zu erfassen und passend zu reagieren. Das alles habe ich mir kognitiv antrainiert, indem ich eben andere Personen beobachtet und deren Verhaltensweisen kopiert habe. Genauso habe ich mir aber auch gewisse Eigenheiten wie eben Stimmings oder die Tendenz, wie ein Wasserfall zu sprechen, abgewöhnt bzw. sie unterdrückt. Viele autistische Personen beobachten also und basteln sich aus den beobachteten Verhaltensmustern eine eigene soziale Maske zusammen, mit deren Hilfe sie nicht mehr sozial auffällig sind.
Problematisch daran ist allerdings, dass soziales Handeln für mich vor allem in ungewohnten Situationen kognitiv abläuft, statt intuitiv zu erfolgen. Ich muss also jedes Mal beobachten, welche Situation hier vorliegt, die dazu passende Maske auswählen, mir ins Gedächtnis rufen, wie andere Personen sich in dieser Situation verhalten haben, und schließlich dieses Verhalten selbst zeigen – was allerdings noch der einfachste Teil ist. So kann ich bei sehr gutem Social Masking natürlich absolut unauffällig wirken. Das Problem ist aber, dass auf die Situation nun zwar adäquat reagiert wird, allerdings ein grundlegendes Verständnis für den Grund hinter den gezeigten Verhaltensweisen fehlt – gleich wie bei einer Klausur, in der das gute Resultat nicht durch das Verstehen des Unterrichtsstoffs, sondern lediglich durch Abschreiben und Spickzettel möglich ist.
Das kann mit der Zeit unfassbar auslaugend werden. Und genau diese beiden Probleme – das Wegfallen von vertrauten Strukturen und Stimmings sowie das Social Masking – führen bei vielen autistischen Personen sehr schnell zu massiven psychischen Problemen. Ich habe sehr viel Glück gehabt, ein extrem verständnisvolles und unterstützendes Umfeld zu haben. Allerdings hat auch mich diese Zeit zwischen Abitur und Studium stark gefordert. Im Folgenden soll es also darum gehen, wie ich damit umgegangen bin.
Meine primäre Emotion, die während meines gesamten Abiturs bis zur Zeugnisvergabe leise vor sich hinbrodelte und erst dann so greifbar für mich wurde, als ich mein Zeugnis in den Händen hielt, war: Angst. Angst vor dem Unbekannten, Angst vor der neuen Situation, Angst davor, dass ich den an mich gestellten Anforderungen nicht gerecht werden würde. Vor der Tatsache, dass ich keine Ahnung hatte, was ich nun mit meinem Leben machen sollte. Ich denke, zu einem gewissen Grad kennt das auch jede neurotypische Person. Bei autistischen Personen ist die ganze Sache aber nochmal intensiver. Ich weiß noch genau, als wir die Resultate unserer Abiturklausuren und damit unseren Schnitt erhielten, war ich erstmal wie gelähmt. Und dieses Gefühl der Lähmung ist auch heute noch eine typische Reaktion meinerseits auf Stresssituationen. Oft folgt ein kognitiver Rückzug bis hin zur Flucht in Fantasiewelten wie die von Harry Potter, da das echte Leben mich überfordert. Jedoch war auch diese Flucht nicht nach außen hin sichtbar – das Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz statt Ausgrenzung ist in uns allen tief verankert. Also habe ich vor anderen Leuten immer eine Rolle gespielt.
Ein weiteres Phänomen war, dass ich kurz vor meinem Abschluss frenetisch damit begann, mir Work-and-Travel bzw. FSJ-Programme anzusehen. Auch wenn ich eigentlich innerlich überzeugt davon war, dass es mir nicht guttun würde, in einem mir völlig unbekannten Land mit einer mir nicht vertrauten Kultur unbekannte Aufgaben zu bewältigen und nebenher einigermaßen selbstständig zu leben, befasste ich mich geradezu akribisch mit entsprechenden Angeboten auf der Suche nach Struktur, nach Planungssicherheit und Vorhersehbarkeit. Ich suchte irgendetwas, das es mir ermöglichen würde, meine Zeit nach dem Abitur zumindest teilweise zu planen. Im Nachhinein bin ich jedoch froh, dass keine dieser Bemühungen Früchte getragen hat. Ich begann in dieser Zeit auch, vor allem in der Sicherheit meines eigenen Zimmers immer und immer wieder auf Routinen und Stimmings zurückzugreifen, um so einen Teil der Überforderung mit Vertrautheit abzufangen. Außerdem fiel ich zu einem gewissen Grad auch wieder in Kindheitsmuster zurück, las Kinderbücher und schaute entsprechende Filme – weil mich diese an meine eigene strukturierte, behütete Kindheit erinnerten. So konnte ich dieses Bedürfnis nach Bekanntem zumindest teilweise stillen.
Nachdem ich also nach Zeugniserhalt immer noch nicht wusste, was ich machen wollte, und mich weiterhin durch ganze Aktenordner voller FSJ-Angebote wühlte, bekam ich schließlich über private Kontakte die Möglichkeit, in Spanien ein Praktikum als Deutschlehrerin zu machen. Ich stürzte mich auf diese Chance, versprach sie mir doch die Aussicht auf erneute Struktur und Organisiertheit in einem mir zumindest nicht gänzlich unbekannten kulturellen Raum. Außerdem überraschte mich die Hilfsbereitschaft meiner Chefs und Kolleg:innen. Ich erlebte sie als sehr hilfsbereit und unterstützend, was mir den Einstieg ins Erwachsenenleben erleichterte und mich auch bei meiner Lehrtätigkeit unterstützte.
Dennoch kamen nun völlig neue Aufgaben auf mich zu, die ich noch nie zuvor allein bewältigen musste. Wäsche waschen, einkaufen, kochen, putzen, persönliche Hygiene, aufräumen ... Das alles überforderte mich. Das Problem war, dass ich nicht wusste, wie ich diese vielen unterschiedlichen Herausforderungen angehen sollte. Es war ein riesiger Berg an diversen Aufgaben, die für mich sehr grob definiert waren, aber in ihrer Gesamtheit zu komplex und herausfordernd, um sie kognitiv zu verarbeiten und durchzuführen. Diese mangelnden exekutiven Fähigkeiten sind sehr häufig eine Schwachstelle autistischer Personen. Während ich auf der Arbeit die soziale Maske aufzog und den Anschein wahrte, ich hätte alles perfekt unter Kontrolle, war ich zu Hause in meinen eigenen vier Wänden in Spanien völlig überfordert. Die Arbeit erschöpfte mich zunehmend. Es war für mich ja eine völlig neue Situation, vor einer Klasse zu stehen, und ich schaffte es einfach nicht mehr, mich zuhause erneut um heraus- bis überfordernde anfallende Aufgaben zu kümmern. Wenn Besuch da war, schaffte ich es trotzdem irgendwie, zumindest noch ein wenig aufzuräumen. Abgesehen vom Unterricht schottete ich mich oft völlig ab.
Anmerken möchte ich noch, dass die kognitive Entwicklung, die bei neurotypischen Personen in der Pubertät stattfindet, bei vielen autistischen Personen verspätet auftritt. Viele von uns werden erst mitunter in ihren späten zwanziger Jahren so richtig »erwachsen« und reif genug, um selbstständig leben zu können. Das habe ich damals auch festgestellt. Ich lerne jetzt mit zunehmendem Alter langsam, wie man »menscht« und sich die alltäglichen Aufgaben in kleine Einzelschritte aufteilt. Damals war ich eigentlich noch ein Kind im Körper einer jungen Erwachsenen. Deshalb kann ich nur Folgendes empfehlen, wenn Sie selbst oder eine Person, die Sie kennen, sich auf dem Spektrum verorten: Lassen Sie es langsam angehen. Eine sinnvolle Alternative zum eiskalten Wasser ist das Frosch-Topf-Prinzip: Werfen Sie einen Frosch in heißes Wasser, springt er sofort wieder raus. Setzen Sie ihn in lauwarmes Wasser und erhitzen es nach und nach, wird er sich schnell an die Hitze gewöhnen und nicht rausspringen. Ein bisschen makaber vielleicht. Aber: Versuchen Sie, sich bzw. Ihrer:m Bekannten erst nach und nach Aufgaben zuzuschreiben und bestenfalls diese gemeinsam mit Vertrauenspersonen einzuüben. So gewährleisten Sie Förderung ohne Überforderung.
Aber selbstverständlich war nicht alles an dieser Zeit nach dem Abitur schlecht. Im Gegenteil, in Spanien hatte ich die Möglichkeit, so akzeptiert zu werden, wie ich bin – auch wenn ich immer noch meine soziale Maske trug, wurde ich von der komischen Außenseiterin, die man weitestgehend in Ruhe ließ, zu einem geschätzten Mitglied der Schule, dem man mit Freundlichkeit und Zuneigung begegnete. Das stärkte mein Selbstvertrauen ungemein, da ich dieses Gefühl außerhalb meiner Familie und weniger sehr guter Freund:innen noch nie gekannt hatte. Das war für mich eine Erfahrung, die mich nachhaltig geprägt und auch dazu motiviert hat, in Spanien meine Maske mehr und mehr fallen zu lassen. Der Grund für Social Masking ist bei mir die schreckliche Angst davor, ausgeschlossen zu werden, wenn ich mich so zeige, wie ich bin. Insofern ist die Zeit des Umbruchs auch manchmal ein absoluter Segen, wenn man an das richtige Umfeld gerät.
Nach meinem Aufenthalt in Spanien wurde allerdings schnell klar, dass ich bald anfangen wollte zu studieren. Ich liebe das Lernen, vor allem ordentliche Skripte zu schreiben – es ist eine Aufgabe, die völlig auf Logik und Struktur basiert, und etwas, in dem ich abtauchen kann. Also stürzte ich mich auf das Erste, was mir einigermaßen plausibel erschien: Grundschullehramt. Dass ich dieses Studium abbrach, um Übersetzen zu studieren, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich lernte irgendwann, selbstständig zu leben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und sogar Zimmerpflanzen am Leben zu erhalten, aber es war ein langer Prozess. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er heute abgeschlossen ist.
Abschließend kann ich also sagen, dass meine Zeit zwischen Abitur und Studium vor allem von Unsicherheit ob der vielen Veränderungen und des krampfhaften Suchens nach Sicherheit und Struktur geprägt war. Andererseits verspürte auch ich den Zauber, der dem Neuanfang innewohnt, und lernte einige neue Seiten an mir selbst kennen. Soziale Kontakte fielen in der Anfangszeit völlig weg, da ich dafür einfach nicht mehr die Energie aufbringen konnte – dafür lernte ich allerdings auch in Spanien wiederum neue Freund:innen kennen. Meine autistischen Bedürfnisse mussten in dieser Zeit jedoch deutlich hintenanstehen, und wenn ich einen Tipp geben darf, der aus der Tiefe meines Herzens kommt: Unterdrücken Sie nicht Ihre Bedürfnisse. Machen Sie nicht den Fehler, all Ihre Schwierigkeiten und Empfindsamkeiten zu verbergen, um sich sozial einzufügen – es wird Sie auf Dauer zermürben. Lernen Sie, offen zu Ihren Bedürfnissen zu stehen und sich Unterstützung zu holen, wo Sie sie benötigen – das ist Ihr absolutes Recht und es ist reines Gift, sich ständig selbst zu überfordern. Lassen Sie es langsam angehen und passen Sie bitte auf sich auf!
Danke für das Durchlesen meiner Erfahrungen – ich hoffe, Sie konnten für sich etwas daraus mitnehmen. Alles Gute wünscht Ihnen »die, die manchmal ganz schön komisch ist«.
2 Von der Schule an die Hochschule: Autist*innen im Übergangsprozess
Carina Schipp
2.1 Einleitung
Der Übergang von der Schule in die Hochschule ist eine entscheidende Statuspassage im Leben junger Menschen. Es verwundert daher nicht, dass sich diese Transition als wichtiger Gegenstand der Forschung und des fachlichen Diskurses etabliert hat (Friebertshäuser 2008, 61 ff.). Wird dieser Übergang im Kontext von Autismus in den Blick genommen, muss besonders für den deutschsprachigen Raum festgestellt werden, dass ein Forschungsdesiderat vorliegt, da hierzu kaum empirische Studien vorliegen. Gleichwohl spezifische Maßnahmen zur Studienwahl und -orientierung in Schulen angeboten werden, liegen weder Erfahrungswerte vor, ob diese für autistische Menschen ausreichend sind, noch gibt es Studien darüber, wie autistische Schüler*innen auf den Übergang in ein Studium vorbereitet werden.
Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum sind in Deutschland in allen Schulformen vertreten (Schuwerk et al. 2019); ca. 60 % besuchen allgemeinbildende Schulen und ca. 40 % Förder- oder Sonderschulformen (Theunissen & Sagrauske 2019). Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (Statistisches Bundesamt 2023) erlangen überdurchschnittlich viele (50 %) Schüler*innen im Autismus-Spektrum die allgemeine Hochschulreife (Riedel et al. 2016; Frank et al. 2018). Beim Übergang von der Schule in das Berufsleben oder in ein Hochschulstudium benötigen autistische Personen jedoch Unterstützungsangebote und gezielte Maßnahmen (Schuwerk et al. 2019, 21), die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Allerdings ist die Gestaltung von Übergangsprozessen für Menschen mit Behinderungen aufgrund der verschiedenen beteiligten Institutionen wie Schulen, Hochschulen und auch Arbeitgeber sowie der Sozialleistungsträger mit unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen nicht aufeinander abgestimmt. Es ist nicht klar festgelegt, welche Institution für einen gelingenden Übergang verantwortlich ist, denn die Schulen sind für die Erlangung der Hochschulreife zuständig und die Hochschulen für die Vorbereitung auf ein Berufsfeld, aber nicht für die Unterstützung während des Übergangs. Trotz des großen Bedarfs eines behinderungsspezifischen Übergangsmanagements existieren bisher keine eigenständigen institutionellen Organisationsstrukturen. Hierfür käme in erster Linie die Bundesagentur für Arbeit in Frage, allerdings wurde eine solche Reformierung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes versäumt (Welti & Ramm 2017, 36 ff.).
Laut Lambe et al. (2019, 1531) kann jedoch insbesondere ein Hochschulstudium autistischen Menschen die Möglichkeit bieten, höhere Abschlüsse zu erwerben und dadurch unabhängiger in Bezug auf die Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft zu werden. Tatsächlich strebt ein hoher Anteil autistischer Menschen ein Hochschulstudium an, häufig bewerben sie sich jedoch nicht, erhalten keinen Zugang oder brechen ihr Studium vorzeitig ab. An dieser Schnittstelle mangelt es neben speziellen Unterstützungsprogrammen auch an Forschungsarbeiten zur Wirksamkeit bestehender Angebote. Auch befragte Menschen im Autismus-Spektrum selbst fordern für die Bereiche Schule, Studium und Beruf mehr Beratungsangebote (Schuwerk et al. 2019, 17). In diesem Beitrag soll einerseits der Übergang von der Schule in ein Hochschulstudium von autistischen Menschen beleuchtet werden; andererseits ist es das Ziel, die im deutschsprachigen Raum bereits existierenden Möglichkeiten und Angebote aufzuzeigen.
2.2 Autist*innen im Übergang von der Schule in das Studium
Wie bereits einleitend deutlich gemacht wurde, geht es bei dem autistischen Personenkreis weniger darum, die formale Hochschulzugangsberechtigung oder die vorrangige Unterstützung auf fachlicher Ebene zu erlangen, sondern um eine Unterstützung und Begleitung im Übergangsprozess und auch während des Studiums. »So besteht der höchste Unterstützungsbedarf nicht in der Vermittlung von fachlichem Know-how, sondern im Fördern des Verständnisses für zahllose soziale Prozesse, die für MmA immer wieder eine Herausforderung darstellen« (Dalferth 2014, 238). Im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit in einem Autismuszentrum habe ich sehr viele Autist*innen in diesem Übergangsprozess begleitet, beraten und unterstützt. So berichteten nicht wenige, dass die Vorbereitung auf den Übergang in das Berufsleben oder in ein Studium kaum stattfindet. In der Regel organisieren Schulen teilweise Angebote, die z. B. über Studiengänge informieren, oder es werden Studienberatungstermine in Anspruch genommen, aber diese Angebote stellen hinsichtlich einer Vorbereitung auf diese Statuspassage keine ausreichende Unterstützung dar. Grundsätzlich sind Bildungsübergänge mit einschneidenden Veränderungen verbunden und wenn diese Herausforderungen nicht bewältigt werden können, kann dies das Wohlbefinden und die Motivation junger Menschen beeinträchtigen (Metzner, Wichmann & Mays 2020, S. 1). Teil meiner Beratungstätigkeit war es auch, Klient*innen zu Studienberatungsgesprächen an den Hochschulen zu begleiten bzw. die erste Kontaktaufnahme herzustellen, da diese oft die größte Hürde darstellt. Darüber hinaus kann anhand von Praxiserfahrungen festgestellt werden, dass die akademische Laufbahn der von mir begleiteten Autist*innen von Wechseln und Abbrüchen gekennzeichnet ist. Dies ist aber nicht unbedingt auf die (falsche) Studiengangswahl zurückzuführen, sondern auf die unzureichende Vorbereitung auf ein Studium. Im Rahmen der autismusspezifischen Zusammenarbeit äußerten die autistischen Personen nicht selten, dass sich negative Erfahrungen im Kontext von Institutionen nach der Schule fortsetzten, wenn nicht sogar zugenommen haben. Mit anderen Worten: Autist*innen sind besonders gefährdet, negative Übergangserfahrungen zu machen.
Auch aus den Erfahrungsberichten in diesem Band geht hervor, dass für sie ein Studium viel mehr bedeutet, als nur fachliches Wissen und Können zu erwerben. Diese Erfahrungswerte decken sich zudem mit den unveröffentlichten biographischen Interviewaussagen autistischer Menschen zum Übergangsprozess aus meiner noch nicht abgeschlossenen Dissertation. Hier wird deutlich, dass sich Autist*innen nicht auf das Leben nach der Schule vorbereitet fühlen und dass dieser Übergang weder darin mündet, dass sie beruflich Fuß fassen können, noch, dass dieser als abgeschlossen angesehen werden kann. Wie bereits dargelegt wurde, bedarf es insbesondere im Hinblick auf autistische Personen weiterer Forschung zu individuellen Veränderungen und unterstützenden Ansätzen innerhalb des Übergangsprozesses (ebd.).
Dabei hat das Interesse an empirischer Forschung zu (bildungs-)biographischen Übergängen seit der Jahrtausendwende deutlich zugenommen, was vor allem mit der Endstandardisierung von Lebensläufen zusammenhängt. Endstandardisierung bedeutet, dass Übergänge häufiger und weniger klar abgegrenzt stattfinden: Anfang und Ende sind oft nicht eindeutig bestimmbar – ebenso wenig wie die Kriterien für eine erfolgreiche Bewältigung oder die Voraussetzungen dafür (Wanka et al. 2020, S. 11 ff.). Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass der Transitionsprozess nicht nur autistischen Personen Strategien der Bewältigung abfordert, sondern dass sich dieser für den größten Teil aller jungen Menschen herausfordernd darstellt. Dies ist einerseits mit einem Strukturwandel von Arbeit und damit verbundenen häufiger werdenden Job- und Berufswechseln sowie auch langer Arbeitslosigkeit zu erklären; andererseits sind erworbene Schulabschlüsse oder hohe formale Qualifikationen bzw. Berufsabschlüsse kein Garant mehr dafür, einen sicheren Arbeitsplatz zu erhalten. Junge Menschen müssen mit unkalkulierbaren Situationen umgehen; wegen der sich dadurch verlängernden Übergangsprozesse sind sie entsprechend länger vom Elternhaus abhängig.
Angesichts der Endstandardisierung von Lebensläufen und bestimmten Entwicklungsprozessen, die die »normale Erwerbsbiographie« (Weßler-Poßberg & Vomberg 2007, 29) betreffen, kann nicht mehr von dem Übergang gesprochen werden. Auch die Erwerbsbiographien von Autist*innen sind oftmals durch eine hohe Diskontinuität geprägt, die durch Begriffe wie »Abbruch, Unstetigkeit, wechselhaft, unbeständig« (ebd., 66) bestimmt werden kann. Damit einhergehend konstatieren Kohl, Seng und Gatti:
»Einen Beruf zu erlernen und einem Erwerb nachzugehen ist von selbstverständlicher Wichtigkeit – die Lebenswege von Asperger-AutistInnen in der Ausbildungs- und Berufswelt sind allerdings oft von Verständnislosigkeit, Niederlagen trotz fachlich sehr guter Leistungen sowie von Kompromissen zwischen eigentlichen Interessen und absolvierbaren Möglichkeiten geprägt« (2017, 16).
Obwohl mit diskontinuierlichen Erwerbsbiographien erst der Zeitraum nach dem ersten Berufseintritt gemeint ist, also nachdem eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen wurde (Weßler-Poßberg & Vomberg 2007, 68), tritt diese Diskontinuität in Biographien autistischer Personen bereits direkt nach dem Schulabschluss auf. Auch dies geht aus den biographischen Interviewaussagen hervor, die ich im Rahmen meiner Dissertation erhoben habe; es deckt sich aber ebenso mit meinen berufspraktischen Erfahrungen. Das heißt, dass im Rahmen des übergeordneten Überganges Schule – Beruf zahlreiche kleinere Übergänge parallel bewältigt werden müssen. Anhand der biographischen Aussagen findet dieser Übergangsprozess auch im fortgeschrittenen Alter oft kein Ende, sodass hier nicht von einem abgeschlossenen Übergang gesprochen werden kann. Die Aussagen zum Erleben weisen auch darauf hin, dass die Diagnosestellung einen Übergang markiert, der bewältigt werden muss und nicht selten mit dem komplexen nachschulischen Übergangsprozess zusammenfällt.
»[Dieser] Weg [...] ist oft länger und beinhaltet mehr Umwege für autistische Berufstäter, weil die Lebensphase bis zu einer Diagnosestellung oft weit ins Erwachsenenalter reicht – und bis dahin weder die Person selbst noch die umgebenden Menschen einschätzen können, was es ist, das einen so angreift, wo denn eigentlich die zu lösende Problemlage zu verorten ist. Solange das Seltsame keinen Namen hat, besitzt es keinen nennbaren Umgangscharakter« (Kohl, Seng & Gatti 2017, 17).
Im Kontext von inklusiver Bildung können Übergänge für Autist*innen darüber hinaus auch immer mit Selektionsprozessen einhergehen, die Diskriminierung und Benachteiligung zur Folge haben. Werden Teilhabe-Barrieren in den Blick genommen, so stellt sich der Übergang von der Schule zur Hochschule für Menschen mit Behinderungen als kaum thematisiert heraus; ähnlich sieht es im wissenschaftlichen Kontext aus (Siedenbiedel 2017, 71 ff.). Trotz der Bemühungen (seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009), die Bildungssituation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, sind »Studierende mit Behinderungsstatus [...] an Hochschulen deutlich unterrepräsentiert« (Dalferth 2016, 63; ▸ Kap. 4 und ▸ Kap. 6 in diesem Band). Wird der Personenkreis autistischer Menschen in den Blick genommen, stellt sich der Übergang von der Schule ins Arbeits- und Berufsleben »in aller Regel [...] als problematisch und konfliktträchtig« (Siedenbiedel, Dalferth & Vogel 2009, 29) heraus.
Inzwischen konnten durch Untersuchungen aus dem englischsprachigen Raum (z. B. Lambe et al. 2019; Zeedyk et al. 2019; Cage et al. 2020; Alverson et al. 2019) zu Erfahrungen autistischer Studierender sowohl Herausforderungen als auch notwendige Unterstützungsformen identifiziert werden. Untersuchungen, wie der Übergangsprozess von der Schule an die Hochschule von den Autist*innen selbst erlebt und bewältigt wird, sind auch im Ausland eher selten. Im deutschsprachigen Raum sind sie inexistent (▸ Kap. 5 in diesem Band), denn die durchgeführten Studien konzentrieren sich ausschließlich auf die Ansichten von Eltern und Pädagog*innen. Die Perspektiven autistischer Personen, die sich nach der Schule auf ein Studium vorbereiten, sind jedoch entscheidend, um deren Bedarfe und Perspektiven herausstellen zu können (Lambe et al. 2019, 1531 f.). Um diese Forschungslücke zu schließen, haben sich Lambe et al. (2019) in ihrer Studie mit Herausforderungen und Hoffnungen beschäftigt und folgende Hauptthemen identifiziert: »The Social World, Academic Demands, Practicalities of University Living, Leaving the Scaffolding of Home and Transition to Adulthood« (ebd., 1534; Hervorh. im Original). Diese decken sich auch mit den Erkenntnissen von Lei et al.: »[...] social difficulties, to academic challenges and time management, as well as daily living skills« (2020, 2406). In Bezug auf den Übergangsprozess wurden hier vor allem Bedenken von den befragten Personen geäußert, die den gesamten Universitätsalltag betreffen. Einerseits ist die Vorfreude auf das Studium vorhanden, andererseits bestehen aber auch Ängste, es nicht zu schaffen, ein Teil der sozialen Gruppe der Mitstudierenden zu werden. Die Angst, wie bereits zuvor schon in der allgemeinbildenden Schule keine Freund*innen zu finden und ausgeschlossen zu werden, ist sehr groß (▸ Kap. 5 in diesem Band).
Grundsätzlich sind laut Rohrer und Meyer für einen erfolgreichen Übergang u. a. folgende Faktoren entscheidend:
»Enge Begleitung der Übergänge;
möglichst frühe Begleitung in der Berufsfindung und viel Zeit für diesen Prozess;
Berücksichtigung des Entwicklungsstandes und des Tempos der Klientelen;
hohe Expertise und Fachwissen im Bereich des Autismus-Spektrum und Kenntnisse der autismusspezifischen Unterstützungsbedürfnisse sowie Besonderheiten der Klientelen« (2022, 240).
Laut Dalferth ist beim Übergang von der Schule in ein Hochschulstudium vor allem wichtig, die »tatsächlichen Anforderungen im zukünftigen beruflichen Alltag« (2016, 63) in den Blick zu nehmen, da autistische Studierende den Studiengang eher anhand ihrer Interessen auswählen und ihnen die damit einhergehenden beruflichen Anforderungen oft nicht bewusst sind. Zudem kann es sehr hilfreich sein, autistische Personen bei örtlichen und räumlichen Gegebenheiten zu unterstützen (Wegetraining), entsprechende Angehörige der Hochschule über den Unterstützungsbedarf zu informieren und ggf. eine Studienassistenz zu beantragen. Eine Beratung durch ein regionales Autismuszentrum kann hier sehr hilfreich sein, da diese oft gut vernetzt sind und Kontakte zu Studienberatungsstellen herstellen können (ebd., 63 f.).
Im nächsten Abschnitt sollen deshalb einige Besonderheiten, die im Kontext von Autismus und Studium





























