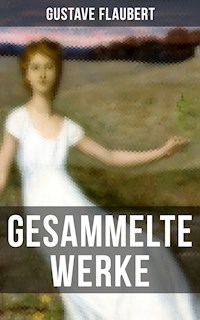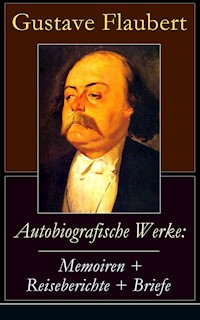
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Autobiografische Werke: Memoiren + Reiseberichte + Briefe" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Gustave Flaubert (1821 - 1880) war ein französischer Schriftsteller, der vor allem als Romancier bekannt ist. Er gilt als einer der besten Stilisten der französischen Literatur und als ein Klassiker des Romans. Zusammen mit Stendhal und Balzac bildet er das Dreigestirn der großen realistischen Erzähler Frankreichs. Inhalt: Gedanken eines Zweiflers (Erinnerungen eines Verrückten) - Autobiografischer Roman Über Feld und Strand (Eine Reise in der Bretagne) Briefe aus dem Orient (Reiseerzählungen) Aus dem Buch: "Ich habe Dir eine große Neuigkeit mitzuteilen, mein lieber Onkel (es ist nicht meine Heirat): ich reise im nächsten Oktober mit Du Camp nach Ägypten, Syrien und Persien. Mein Gesundheitszustand, der nicht besser, sondern im Gegenteil schlimmer wird, hat mich gezwungen, in Paris M. Cloquet zu einer Konsultation aufzusuchen, und er hat mir sehr zu den heißen Ländern geraten. Wenn Du kommst, werde ich Dir das alles ausführlich erzählen; ich habe Dir viel darüber zu sagen. Euch werde ich während meiner Abwesenheit, die fünfzehn bis achtzehn Monate dauern wird, meine arme Mutter empfehlen. Meine Mutter will ihr Haus in Rouen vermieten, denn sie beabsichtigt, einen guten Teil dieser Zeit in Nogent zu verbringen. Das ist auf jede Weise das beste, was sie wird tun können."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autobiografische Werke: Memoiren + Reiseberichte + Briefe
Über Feld und Strand + Briefe aus dem Orient + Gedanken eines Zweiflers (Erinnerungen + Reisen und Eindrücke + Korrespondenz mit verschiedenen Persönlichkeiten in Flauberts Leben)
Inhaltsverzeichnis
Gedanken eines Zweiflers
Mémoires d’un fou, Roman, 1838
Geschrieben 1838, als Flaubert 17Jahre alt war. (Aus dem Nachlass)
Im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen, überall, wo ihr geht, könnt ihr nicht einen Schritt tun, ohne daß Zwangsherrschaft, Ungerechtigkeit, Geiz, Habgier euch voller Selbstsucht zurückstoßen. Überall, sage ich euch, werdet ihr auf Leute geraten, die euch zurufen: »Geh mir aus der Sonne!« – »Hebe dich weg! Du betrittst den Sand, den ich mir auf die Erde gestreut!« – »Kehr um! Du bist auf meinem Grund und Boden!« – »Zurück! Du atmest Luft, die mir gehört!«
Ja, ja! Der Mensch ist ein durstiger Wanderer; er bittet um Trinkwasser; man verweigert es ihm, und er geht zugrunde.
Die Gewalt lastet schwer auf den Völkern, und ich fühle, es ist schön, sie von ihr zu befreien. Ich fühle, wie mein Herz bei dem Worte Freiheit vor Freude lauter klopft, wie ein Kinderherz vor dem Worte Gespenst. – Und doch ist eins wie das andere Wahn. Ein Trugbild, das verwehen, eine Blume, die verwelken muß. Mehr nicht.
So manche werden es versuchen, sie zu erringen, die herrliche Freiheit, die Fürstin aller Träume, den Abgott der Völker. Viele werden es wagen, aber sie werden unter der Last ihrer Bürde zusammenbrechen.
Es war einmal ein Pilger, der durch die große Wüste Afrikas wanderte. Er hatte die Kühnheit,
einen Weg einzuschlagen, der seine Reise um sieben Meilen verkürzte, dafür aber gefahrvoll war, reich an Schlangen, wilden Tieren und mühseligen Felsenstiegen.
Die Nacht brach an. Der Mann bekam Hunger. Er ward müde und matt. Er beschleunigte seinen Gang, um endlich sein Ziel zu erreichen. Doch auf Schritt und Tritt traf er Hemmnisse. Trotzdem verlor er seinen Mut nicht und ging herzhaft weiter.
Da sah er plötzlich vor sich einen ungeheuren Felsblock mitten auf seinem Wege, einem schmalen Saumpfade, der sich steil emporzog, überwachsen von Gestrüpp und Dornen. Er war also genötigt, den Stein bis zum Gipfel hinaufzuwälzen oder ihn zu überklettern oder zu warten bis zum Morgen, wo vielleicht andere Pilger kommen und ihm helfen könnten!
Aber er hatte solchen Hunger, und der Durst quälte ihn so gräßlich, daß er sich ermannte, alle seine Kräfte aufzubieten, um weiter zu kommen, bis zur nächsten Hütte, die noch vier Wegstunden fern war. Er begann mit Händen und Füßen am Felsblock in die Höhe zu klimmen.
Der Schweiß rann ihm in großen Tropfen von der Stirn, seine Arme stemmten sich mühevoll empor, und krampfhaft griffen seine Hände nach jedem Halm, der sich ihm bot; aber das Gras hielt ihn nicht, und er fiel enttäuscht zurück. Wieder und wieder erneute er seine Anstrengungen. Es war vergeblich.
Und immer schwächer wurde er von Fall zu Fall, immer kraftloser, immer verzweifelter. Er verfluchte Gott und lästerte ihn. Schließlich machte er einen letzten Versuch. Diesmal nahm er alle Kraft zusammen, die er noch hatte, und vor dem Aufstieg betete er zu Gott.
Ach, wie demütig, wie hehr, wie innig war dieses kurze Gebet! Weit entfernt, irgend etwas nachzuplärren, was ihn die Amme als kleines Kind gelehrt, waren Tränen seine Worte und Kreuzeszeichen seine Seufzer. Dann kletterte er hinan, fest entschlossen, Hungers zu sterben, wenn es ihm mißglückte.
Nun ist er am Werke. Er klimmt aufwärts; er kommt höher. Es sieht aus, als ziehe ihn eine helfende Hand empor zum Gipfel. Es ist ihm, als schaue er einem ihn rufenden Engel in das lächelnde Angesicht. Da mit einem Schlage ändert sich alles. Eine schreckliche Erscheinung übermannt seine Sinne. Er hört das Zischen einer Schlange, die am Gestein herabkriecht, auf ihn zu. Die Knie wanken ihm, seine Fingernägel, die sich um Felsenspitzen gekrallt hatten, verlieren ihren Halt …. Kopfüber fällt er in die Tiefe.
Was nun?
Er hat Hunger, ihn friert, er ist durstig. Der Wind pfeift über die endlose rote Wüste, und den Mond verdüstern Wolken.
Er fängt an zu weinen und sich zu ängstigen wie ein Kind. Er weint um seine Eltern, die vor Gram sterben werden, und er fürchtet sich vor den Raubtieren.
»Es ist Nacht,« jammert er. »Ich bin schwach und matt. Die Tiger werden kommen und mich zerreißen!« Lange wartet er, daß ihm irgendwer zu Hilfe käme. Aber es kamen die Tiger, zerfleischten ihn und schlurften sein Blut…..
Und wahrlich, ich sage euch, ebenso ergeht es euch, die ihr die Freiheit erobern wollt! Mutlos geworden in euren Anstrengungen, werdet ihr auf irgend jemanden warten, der euch helfen soll.
Und dieser Jemand wird nicht kommen! Nein!
Aber die Tiger werden kommen, euch zerfleischen und euer Blut trinken wie das des armen Wanderers.
Es ist so! Die Not herrscht über dem Menschen.
Ach, die Not, die Not! Ihr habt sie wohl nie verspürt, ihr, die ihr von den Lastern der Armen sprecht? Not ist ein Ding, das’ den Menschen packt, ihn auszehrt, ihn erdrosselt, ihm die Glieder abreißt und dann seine Knochen auf den Schindanger wirft. Not ist ein Ding, häßlich, fahl, stinkig, verkrochen in schmutzige Winkel und Löcher, hinter die Lumpen der Bettler, hinter die Röcke der Dichter. Die Not? Das ist der Mann mit den langen gelben Zähnen an Winterabenden an der Straßenecke, der euch im Grabeston zuflüstert: »Herr! Brot!« und dabei eine Pistole zieht… Die Not? Das ist der Spion, der euch umschleicht, eure Worte erjagt und dann zum Gewalthaber geht und ihm sagt: »Man macht eine Verschwörung! Man hat Gewehre…« Die Not? Das ist das Frauenzimmer, das euch unter den Bäumen der Promenade zupfeift. Ihr tretet heran. Die Frau trägt einen schäbigen alten Mantel. Sie öffnet den Mantel. Ein weißes Kleid schimmert darunter; aber dieses weiße Kleid ist voller Löcher. Und sie öffnet ihr Kleid und zeigt euch ihren Busen; aber dieser Busen ist schlaff, und drinnen wütet der Hunger! Ja, der Hunger, der Hunger! Überall der Hunger: in ihrem Mantel, dessen silberne Schließen versetzt, in ihrem Kleid, dessen Spitzen verschachert sind, in ihren Worten, die euch unter Weh und Leid zurufen: »Komm, komm!« Ja, Überall der Hunger, selbst in ihrem Busen, den sie eurer Lust verkaufen will! – Der Hunger, der Hunger!
Dieses Wort, oder vielmehr das Ding dahinter, hat die Revolutionen gemacht, und noch manche Revolution wird es bringen!
Das Unglück mit seinen tiefeingesunkenen Augen schreitet weiter und weiter. Es greift mit seinen Eisenkrallen nach Königshäuptern, und indem es ihre Kronen zerbricht, zertrümmert es ihnen die Hirnschale. Das Unglück schlägt die Machthaber tot. Es lauert am Bette der Großen; es hockt bei dem Kinde, verbrennt es, verschlingt es. Es bleicht aller Locken, höhlt aller Wangen, tötet alle. Es windet sich und kriecht wie eine Natter, und es zwingt die anderen, daß auch sie kriechen. Das Unglück ist unbarmherzig, unersättlich; sein Durst unlöschbar. Wie das Faß der Danaïden hat es keinen Boden. Seine Habsucht ist grenzenlos. Kein Mensch kann sich rühmen, seinen Fängen entgangen zu sein. Es hängt sich an die Jugend, umarmt sie, liebkost sie; aber seine Zärtlichkeiten sind wie die des Löwen; sie hinterlassen blutige Male. Es taucht plötzlich auf, mitten beim Feste, im vollen Lachen, bei Lust und Becherklang.
Mit besonderer Vorliebe trifft es gekrönte Häupter. Einst lebte in einem Keller des Louvre ein Mann, nein, ein Narr, und dieser Narr preßte sein bleigraues Antlitz in die Gitter des Fensters, durch dessen zerbrochene Scheiben die Nachtvögel flatterten. Er war in vergoldete Lumpen gehüllt. Goldene Lumpen! Stellt euch das vor und ihr werdet lachen! Seine Hände ballten sich vor Wut, sein Mund schäumte, seine ganz nackten Füße stampften auf die nassen Fliesen. Seht, das tat er, der Mann mit den goldenen Lumpen, weil er über sich Ballgetümmel, Gläsergeklirr und Orgelgebraus hörte. Dann starb der arme Narr. Man begrub ihn ohne Ehren, ohne Leichenreden, ohne Tränen, ohne Prunk, ohne Musik. Nichts von alledem! Es war König Karl VI.
Lange Zeit nach ihm lebte ein anderer Fürst, der ein noch gräßlicheres und grausameres Schicksal erlitt. Wer hätte in den heiteren Tagen seiner Kindheit gedacht oder gar gesagt, daß der schöne Kopf dieses jungen Mannes fallen werde vor der Zeit und von Henkershand? Eines Tages saß in einem Saale des Temple eine Familie, trostlos und heiße Zehren weinend, weil einer ihrer Zugehörigen sterben sollte, der Vater der Familie. Er umarmte seine Kinder und seine Frau, und als sie sich ausgeweint hatten und ihre Verzweiflungsschreie im Kerker verhallt waren, öffnete sich die Tür und ein Mann trat ein, der Gefängniswärter, und hinter ihm der Scharfrichter, der mit einem Schlage seiner Guillotine das ganze alte Königtum köpfte. Das Volk heulte vor Jubel um das Blutgerüst herum und rächte an diesem einen Haupte die Hinrichtungen von Jahrhunderten. Dieser Mann war Ludwig XVI.
Nicht viel später sank ein dritter König dahin. Aber unter dem Falle dieses Riesen erzitterte die ganze Welt. Armer großer Mann, gemordet von Nadelstichen wie ein Leu von Mücken! Wie erhaben war seine Wundergestalt bis zuletzt! Wie großartig noch auf dem Totenbette! Wie groß einst auf seinem Throne! Wie groß in der Seele seines Volkes!
Und was ist das alles? Ein Totenbett, ein Grab, ein Kaiserthron, ein Volk? Etwas, was den Teufel lachen macht! Nichts, nichts, dreimal nichts! Und doch war das Napoleon Bonaparte, der größte aller Herrscher, der größte aller Menschen!
Wahrlich, so muß es sein! Jedem das Seine! Die Not den Völkern, den Königen das Unglück!
Das Unglück, das Unglück! Das ist ein Wort, das über dem Menschen waltet wie das Verhängnis über den Jahrhunderten und die Revolution über der Kultur!
»Und was ist eine Revolution?« Ein Windeshauch, der über das Weltmeer streicht. Er verweht, und das Meer rauscht weiter.
»Und was ist ein Jahrhundert?« Ein Husch in der ewigen Nacht.
»Und was ist der Mensch?« Ach, der Mensch, was ist der? Was weiß ich davon? Fragt irgendein Gespenst, was das ist! Wenn es zu reden vermag, wird es euch antworten: »Ich bin der Schatten von dem und dem!«
»Der Mensch ist Gottes Ebenbild.«
Welches Gottes?
»Dessen, der da droben regiert!«
Ist er ein Sohn des Guten, des Bösen oder des Nichts? Wählt unter diesen dreien! Alle drei sind eines!
»Was? Du glaubst an nichts?«
Nein.
»Nicht an den Ruhm?«
Denke an den Neid!
»Nicht an die Wohltätigkeit?«
Und der Geiz?
»Nicht an die Freiheit?«
Siehst du denn nicht, daß der Terror den Nacken der Völker beugt?
»Nicht an die Liebe?«
Und das Dirnentum?
»Nicht an die Unsterblichkeit?«
In weniger denn einem Jahre haben die Würmer einen Leichnam zerfressen. Dann wird er zu Staub. Dann zu nichts. Dem Nichts folgt nichts. Nichts bleibt von uns übrig!
Eines Tages grub man eine Leiche aus. Man schaffte die Überreste eines berühmten Mannes nach einem andern Winkel der Erde. Das war eine der üblichen Feierlichkeiten, eine schöne prunkhafte Komödie wie ein richtiges Begräbnis, nur daß bei einem solchen der Leib des Toten noch frisch ist, bei einer Wiederausgrabung aber schon verfault.
Alle Anwesenden warteten auf den Totengräber, der sich schließlich nach zehn Minuten, ein Liedchen vor sich hersummend, einstellte, ein Biedermann, dem die Gegenwart keinen Kummer und die Zukunft keine Sorge bereitete. Er trug einen Hut aus Wachstuch und im Munde eine Tabakspfeife.
Die Erdschaufelei begann. Und bald erblickten wir den Sarg. Er war aus Eiche, aber doch schon morsch, denn ein einziger ungeschickter Spatenstich zertrümmerte ihn. Nun sahen wir den Toten, den Toten in seinem gräßlichen grauenhaften Zustande. Allerdings hinderte uns zunächst ein auffliegender dichter Dunst, ihn genau zu betrachten. Der Bauch war ihm zerfressen; seine Brust und seine Schenkel schimmerten in mattem Weiß. Wenn man näher herantrat, erkannte man ohne weiteres, daß dieses matte Weiß ein gierig fressendes Würmergewimmel war.
Es ward einem übel bei diesem Schauspiel. Ein junger Mann sank ohnmächtig hin.
Der Totengräber ließ sich nicht stören. Er nahm die stinkende Masse in seine Arme und trug sie zu einem Karren, der einige Schritte entfernt stand. Da er rasch ging, entfiel ihm das linke Bein der Leiche. Er hob es mit einem kräftigen Griff auf und nahm es auf den Rücken. Dann kam er wieder, um das Loch zuzuschaufeln. Da bemerkte er, daß er etwas vergessen hatte: den Kopf des Ausgegrabenen. Er zog ihn an den Haaren heraus. Ein scheußlicher Anblick, diese starren halbgeschlossenen Augen, dieses klebrige bleiche Antlitz mit den hervortretenden Backen und einem Fliegenschwarm auf den Lidern!
Das war also der berühmte Mann! Wo war sein Ruhm, seine Tugenden, sein großer Name?
Der berühmte Mann, das war das verweste, unkenntliche, häßliche Ding da vor uns, das einen abscheulichen Gestank verbreitete und das man nicht lange anschauen konnte!
Sein Ruhm? Ihr seht, man behandelte ihn wie einen gemeinen toten Hund. Alle Anwesenden waren aus Neugier hergekommen, gewiß nur aus Neugier, getrieben von jenem Gefühle, das den Menschen freudig stimmt, wenn er das Leid andrer Menschen sieht, – von jenem Gefühle, das die Weiber verlockt, ihre hübschen blonden Köpfe am Fenster zu zeigen, wenn unten eine Hinrichtung vor sich geht. Es ist die natürliche Wollust, die den Menschen zum Gräßlichen, Grausamen, Grotesken hinzieht.
Seine Tugenden? Man erinnerte sich ihrer nicht mehr. Sein Name? Der war verloschen, denn er hatte keine Kinder hinterlassen, und seine zahlreichen Neffen hatten seinen Tod längst herbeigesehnt.
Ist es auszudenken, daß der Tote da noch vor einem Jahre reich, glücklich, einflußreich war, daß man ihn mit Ehrentiteln anredete, daß er einen Palast bewohnte, und daß er nun nichts ist, daß man ihn als Leiche bezeichnet und daß er in einem Sarge modert! Ach, ein furchtbarer Gedanke! Und auch uns wird es ergehen wie diesem da! Uns allen, die wir jetzt leben, die wir die Abendluft atmen und den Duft der Blumen verspüren! »Man könnte verrückt darüber werden! Kommt denn wirklich auf diesen Augenblick nichts?« Nichts, für alle Ewigkeit nichts? »Das geht über den menschlichen Verstand! Soll es denn unumstößlich wahr sein, daß mit dem Ende dieses Lebens alles aus ist, aus für immerdar? Sagt, gibt es tatsächlich nichts weiter?«
Tor, betrachte einen Totenschädel!
»Aber die Seele?«
Ach ja, die Seele!
Wenn du neulich den Totengräber gesehen hättest, seinen schwarzen Wachstuchhut schief auf dem Ohre, sein Pfeifchen im Munde; wenn du gesehen hättest, wie er das verweste Bein auflas, und wie ihn dies nicht hinderte, dabei zu pfeifen und vor sich hinzuträllern: »Mädel, ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite!« – du hättest laut aufgelacht vor tiefem Mitleid und hättest gesagt: »Die Seele, das ist am Ende der üble Gestank, der aus einer Leiche aufsteigt!«
Trotzalledem ist es ein trübseliger Gedanke, daß nach dem Tode alles aus sein soll! Nein, nein, rasch einen Priester her! Einen Priester, der mir sagt, mir beweist, mich überzeugt, daß die Seele im menschlichen Körper vorhanden ist.
Einen Priester? Aber welchen soll man rufen? Der eine ist beim Erzbischof zu Tisch, der andre hält gerade Bibelstunde, und der dritte hat keine Zeit.
Ja, wollen sie mich denn in die Grube fahren lassen, mich, der ich die Hände vor Verzweiflung ringe, der ich Haß oder Liebe anrufe, Gott oder Teufel?
Ach, der Satan wird kommen. Ich fühle es.
Zu Hilfe!
Weh mir, niemand gibt mir Antwort!
Laßt uns weiter suchen!
Ich habe gesucht und habe nichts gefunden. Ich habe an die Tür geklopft. Niemand hat mir aufgetan, und man hat mich in Frost und Not schmachten lassen, so daß ich vor Mattigkeit beinahe gestorben wäre. – Als ich durch eine finstere, krumme, enge Gasse ging, hörte ich süßliche schamlose Reden, hörte Seufzer und Küsse dazwischen. Ich hörte Schreie der Wollust, und ich sah einen Pfaffen und eine Dirne, die Gott lästerten und sich in geilem Tanze drehten. Ich habe meinen Blick weggewandt und habe geweint. Mein Fuß stieß an etwas. Es war ein Kruzifix aus Erz. Der Heiland im Kot!
Das Kruzifix gehörte wohl dem Priester, der es beim Eintritt in das Haus von sich geworfen hatte wie eine Maske oder ein Karnevalskleid.
Jetzt sagt mir noch, das Leben sei keine gemeine Posse, wo doch der Priester seinen Gott wegwirft, um ein Freudenmädchen besuchen zu können! Trefflich! Der Teufel lacht. Seht ihr’s? Trefflich! Er triumphiert! Wahrlich, ich habe recht, Tugend ist Maske, Laster Wahrheit! Darum reden die Leute so wenig davon. Es ist zu schrecklich zu sagen. Trefflich! Das Heim des ehrsamen Mannes ist Lug und Trug; das Dirnenhaus ist Wahrheit. Das Brautgemach ist Betrug, der Ehebruch darin Wahrheit! Das Leben ist Wahn, der Tod Wahrheit! Kirche und Glaube sind Lügen; die Dirne ist wirklich und wahr. Das Gute ist falsch, und wahr ist der Tod!
Erhebt euer Geschrei, ihr Tugendbolde in gelben Glacéhandschuhen, schreit ach und weh, ihr, die ihr von Sittlichkeit redet und kleine Tänzerinnen aushaltet! Jammert nur, ihr, die ihr eher etwas für euren Hund als für euer Gesinde tut! Klagt, ihr, die ihr einen Menschen zum Tode verurteilt, der aus Not gemordet hat, und selber aus Mißachtung mordet! Zetert, ihr Richter, deren Amtsröcke Blutflecke zeigen! Zetert, ihr, die ihr Tag um Tag zu eurem Richterstuhl über die Köpfe derer hinwegschreiten müßt, die ihr auf dem Gewissen habt! Und ihr, ihr krummfingrigen Staatsdiener, wehklagt nur, ihr, die ihr euch der Gönnerschaft rühmt, die ihr einem Ehemanne angedeihen laßt, während ihr euch bei seiner Frau bezahlt macht! Während ihr dem armen Wicht ein Ämtchen verschafft, spuckt ihr seinem Weibe ins Gesicht!
Oft habe ich mich gefragt, warum ich lebe, zu welchem Zweck ich auf die Welt gekommen bin, und ich habe nichts gefunden als einen Abgrund hinter mir und einen Abgrund vor mir; mir zur Rechten und mir zur Linken, über mir und unter mir, Überall dunkle Nacht.
Warum ekelt mich alles hienieden an? Warum erscheinen mir Tag und Nacht, Regen und blauer Himmel immer wie trübe Dämmerung, in der eine rote Sonne hinter einem uferlosen Ozean untergeht?
»Und die Gedankenwelt?«
Ein anderer Ozean ohne Gestade, die Sintflut Ovids, ein grenzenloses Meer, dessen Ein und Aus der Sturm ist.
Erhaben einfältig, grausam närrisch ist das, was wir Gott nennen!
Man hat so oft von der Vorsehung und der himmlischen Güte gesprochen. Ich habe recht wenig Anlaß, daran zu glauben. Der Gott, der sich damit belustigt, die Menschen heimzusuchen, um zu sehen, bis zu welchem Grade sie zu leiden fähig seien, wäre der nicht ebenso stumpfsinnig-grausam wie ein Kind, das einem Maikäfer erst die Flügel abreißt, dann die Beine und schließlich den Kopf, wohlwissend, daß dies sein Tod ist?
Meiner Meinung nach ist die Eitelkeit der Grund aller menschlichen Handlungen. Wenn ich etwas geredet, etwas vollbracht, irgend etwas in meinem Leben getan hatte und meine Worte oder Taten genau untersuchte, fand ich immer diese alte Närrin, eingenistet in meinem Herzen oder, in meinem Hirne. Viele Menschen sind mir gleich; wenige haben den gleichen Freimut.
Diese vielleicht richtige Betrachtung habe ich aus Eitelkeit niedergeschrieben. Die Eitelkeit, nicht eitel erscheinen zu wollen, veranlaßt mich vielleicht, dies wieder auszustreichen.
Ich glaube, der letzte Ausdruck des Höchsten in der Kunst ist die Idee, das heißt die innere Gestaltung einer Vorstellung, etwas Blitzschnelles, Reingeistiges.
Wer hätte nicht die Wahrnehmung gemacht, daß der Menschengeist überladen ist von zusammenhanglosen, erschrecklichen, glutheißen Ideen und Vorstellungen? Die wissenschaftliche Zergliederung brächte es nicht fertig, sie zu beschreiben. Aber ein Buch davon wäre die Natur. Denn was ist die Dichtkunst, wenn nicht die erlesene Natur, der Inbegriff von Gemüt und Geist?
Ach, wenn ich ein Dichter wäre, wollte ich Schönes schaffen!
Das Leben ekelt mich an. Ich wünschte, ich wäre verreckt, bezecht oder ein Harlekin wie Gott!
Die Menschen können mich…..
Über Feld und Strand
Eine Reise in der Bretagne
Vorbemerkung.
»Über Feld und Strand« entstammt dem Jahre 1847. Die Zählung der Kapitel erklärt sich in der Weise, daß Flaubert mit seinem Gefährten Maxime Du Camp ein gemeinsames Buch schrieb, zu dem Flaubert die ungeraden, Du Camp die geraden Kapitel lieferte. Dieses Buch ist nie erschienen. Ein Fragment aus Flauberts Kapiteln erschien 1858 unter dem Titel »Die Steine von Carnac« im » Artiste«. So wie das Werk hier in Übersetzung geboten wird, erschien es auch in Frankreich erst nach Flauberts Tode.
Kapitel I.
…
Château de Chambord. – Wir sind die leeren Galerien entlang und durch die verlassenen Zimmer gegangen, wo die Spinne ihre Netze über den Salamandern Franz' des Ersten spannt. (Ein schmerzhaftes Gefühl faßt einen bei diesem Elend, das nichts Schönes hat. Es ist nicht der Ruin von überall, mit dem Luxus seiner schwarzen und grünlichen Trümmer, der Stickerei seiner koketten Blumen und seinen Vorhängen gleich Damastfetzen im Winde wogenden Grüns. Es ist ein verschämtes Elend, das sein fadenscheiniges Kleid aufbürstet und den Wohlanständigen spielt. Man bessert das Parkett in diesem Zimmer aus, in jenem andern läßt man es faulen. Man sieht hier eine vergebliche Bemühung, zu bewahren, was stirbt, zurückzurufen, was geflohen ist. Seltsam! das alles ist traurig und es ist nicht groß.
Und dann möchte man sagen, alles habe mithelfen wollen, um Schmach auf ihn zu werfen, jenen armen Chambord, den Primaticcio zeichnete, den Germain Pilou und Jean Cousin meißelten und ziselierten. (Errichtet von Franz I. bei seiner Rückkehr aus Spanien nach dem demütigenden Vertrag von Madrid (1526), ein Monument des Hochmuts, der sich betäuben will, um sich mit seinen Niederlagen abzufinden, verbannt man zuerst Gaston von Orleans dahin, einen besiegten Prätendenten; dann macht Ludwig XIV. aus einem einzigen Stockwerk drei und verdirbt so die wundervolle Doppeltreppe, die wie eine Spirale geschnellt aus einem Guß vom Boden bis zur Zinne führte. Eines Tages spielt Moliere dort den Bürger als Edelmann zum erstenmal, oben im zweiten Stock, auf der Fassadenseite, unter der schönen, mit Salamandern und gemalten Ornamenten bedeckten Decke, deren Farben in Schuppen abfallen. Dann hat man es dem Marschall von Sachsen gegeben; man hat es dem Polignac gegeben und hat es einem einfachen Soldaten, Berthier, gegeben; man hat es durch eine Subskription zurückgekauft und es dem Herzog von Bordeaux gegeben. Man hat es aller Welt gegeben, als ob niemand es gewollt oder behalten gewollt habe. Es sieht aus, als habe es fast nie gedient, und als sei es stets zu groß gewesen. Es ist wie ein verlassenes Gasthaus, wo die Reisenden nicht einmal ihre Namen auf den Wänden zurückgelassen haben.
Als wir über eine äußere Galerie zur Treppe von Orleans gingen, um die Karyatiden anzusehen, die Franz I., M. de Chateaubriand und Mme. d'Etampes darstellen sollen, und als wir um die berühmte Laterne schritten, die die große Treppe abschließt, haben wir mehrere Male den Kopf durch die Balustrade gesteckt, um hinunter zu blicken: im Hofe rieb sich ein junger Esel, der an den Zitzen seiner Mutter saugte, gegen sie; er schüttelte die Ohren, streckte die Nase vor und sprang auf seinen Hufen. Das sah man im Ehrenhofe des Schlosses von Chambord; das sind jetzt seine Gäste: ein Hund, der im Grase spielt, und ein Esel, der auf der Schwelle der Könige säugt, schnaubt und iaht, kackt und springt! ...
. . . . . . . . . . . . .
Château d'Amboise. – Das Schloß von Amboise, das die ganze Stadt beherrscht, die ihm wie ein Haufen Kiesel an einer Klippe zu Füßen hingeworfen scheint, zeigt mit seinen großen und dicken Türmen, die von langen, schmalen Rundbogenfenstern durchbrochen sind, mit seiner Arkadengalerie, die von einem zum andern führt und der falben Farbe seiner Mauern, die durch die Blumen, die von oben hängen, einem buschigen Federbusch gleich auf der bronzenen Stirn eines alten Haudegens, noch düsterer wird, eine schöne und imposante Burgenphysiognomie. Wir haben eine gute Viertelstunde lang den superben linken Turm bewundert der gebräunt ist, fleckenweise gelb, anderswo vom Ruß geschwärzt, und aus dessen Zinnen köstlicher Braunlack niederhängt, und der überhaupt eins jener sprechenden Monumente ist, die zu leben scheinen, und die einen wie jene Bildnisse, deren Originale man nie gekannt hat und die man zu lieben beginnt, man weiß nicht, warum, unter ihren Blicken regungslos und verträumt festhalten.
Man steigt einen sanften Abhang zum Schloß empor und er führt in einen zur Terrasse aufgehöhten Garten, von dem aus sich der Blick voll über das umgebende Land ausbreitet. Es war von zartem Grün; auf den Ufern des Flusses standen Pappelreihen; bis zum Rande reichten die Wiesen, die in der Ferne ihre grauen Grenzen in den bläulichen und dunstigen Horizont verwischten, den der Umriß der Hügel unbestimmt abschloß. Mitten hindurch rollte die Loire und badete ihre Inseln, befeuchtete die Kante der Wiesen, trieb Mühlen und ließ auf ihren versilberten Windungen die großen aneinandergebundenen Boote hingleiten, die friedlich, Seite an Seite, zum langsamen Knarren des großen Steuerruders halb schlafend dahinzogen, und weit hinten sah man zwei große Segel, die in der Sonne vor Weiße strahlten.
Vögel flogen von der Zinne der Türme und vom Rande der Pechnasen auf, ließen sich anderswo nieder, flogen, stießen im Flug ihre kleinen Schreie aus und verschwanden. Hundert Fuß unter uns sah man die spitzen Dächer der Stadt, die verlassenen Höfe der alten Gasthäuser und das schwarze Loch der rauchigen Schornsteine. In die Vertiefung einer Zinne hineingelehnt, sahen, hörten, atmeten wir das alles und genossen der Sonne, die schön war, und der Luft, die lind war und ganz vollgesogen vom guten Geruch der Ruinen. Und dort träumte ich, ohne über irgend etwas nachzudenken, ohne auch nur innerlich, was es auch sei, zu formulieren, von den Panzerhemden, geschmeidig wie Handschuhe, von den schweißfeuchten Wehrgehängen aus Büffelleder, von den geschlossenen Visieren, unter denen rote Blicke glänzten; von nächtlichem Sturmlauf, dem heulenden, verzweifelten, mit Fackeln, die die Mauern in Brand setzten, Kampfbeilen, die die Leiber zerschnitten; und von Ludwig XI., vom Liebeskrieg, von d'Aubigné, und vom Lack, von den Vögeln, dem schönen, glänzenden Efeu, den ganz kahlen Brombeersträuchern; und so genoß ich in meinem träumerischen und gemächlichen Schlürfen: von den Menschen, was das Größte an ihnen ist, ihr Gedächtnis; – von der Natur, was ihr Schönstes ist, ihre ironischen Übergriffe und ihr ewiges Lächeln.
Im Garten erhebt sich mitten im Flieder und in dem Gebüsch, das in den Alleen zurückweicht, die Kapelle, ein Werk des sechzehnten Jahrhunderts, an allen Ecken ziseliert, ein echtes Kleinod lapidarer Goldschmiedekunst, ausgearbeiteter noch drinnen als draußen, ausgeschnitten wie das Papier in einer Zuckerwerksdose, durchbrochen gearbeitet wie der Griff eines chinesischen Sonnenschirms. An der Tür sieht man ein sehr ergötzliches und hübsches Bas-Relief; es stellt die Begegnung St. Huberti mit dem mystischen Hirsch dar, der ein Kreuz zwischen den Geweihen trägt. Der Heilige kniet; darüber schwebt ein Engel, der ihm einen Kranz auf die Mütze legen will; zur Seite sieht man sein Pferd, das mit dem guten Gesicht eines erstaunten Tieres zuschaut; seine Hunde bellen und auf dem Gebirge, dessen Grate und Kantenflächen Kristalle darstellen, kriecht die Schlange. Man sieht ihren flachen Kopf am Fuß der blätterlosen Bäume, die Blumenkohl gleichen, herannahen. Es ist der Baum, wie man ihm in alten Bibeln begegnet, ohne Laubwerk, mit dicken Ästen und Stamm, der Holz und Frucht trägt, aber kein Grün, der symbolische Baum, der theologische und fromme Baum, der in seiner unmöglichen Häßlichkeit fast phantastisch ist. Ganz nah dabei trägt der heilige Christoph Jesus auf den Schultern, der heilige Antonius sitzt in seiner auf einem Felsen erbauten Zelle; das Schwein kehrt in sein Loch zurück, und man sieht nur noch seinen Hintern und den Schwanz, der in eine Trompete ausläuft, während neben ihm ein Kaninchen die Ohren zu seinem Bau heraussteckt.
All das ist ohne Frage ein wenig schwerfällig und von einer nicht gerade rigorosen Plastik. Aber in diesem Biedermann und seinen Tieren steckt so viel Leben und Bewegung, in den Details so viel Witz, daß man viel dafür geben würde, es mitnehmen und es bei sich haben zu können.
Im Innern des Schlosses wiederholt sich die fade Möblierung des Empire in jedem Zimmer. Fast alle sind mit Büsten Louis-Philippes und der Mme. Adelaide geschmückt. Die gegenwärtig herrschende Familie hat die Wut, sich in Bildnissen zu vervielfältigen. Es ist der schlechte Geschmack eines Parvenu, die Manie des im Geschäft reichgewordenen Krämers, der sich selbst mit Rot und Weiß und Gold, mit seinen Berloques auf dem Bauch, dem Bart am Kinn und seinen Kindern zur Seite zu betrachten liebt.
Auf einem der Türme hat man dem gewöhnlichsten Menschenverstand zum Trotz eine Glasrotunde erbaut, die als Speisesaal dient. Freilich ist der Blick, den man von dort hat, prachtvoll. Aber das Gebäude wirkt, von außen gesehen, so beleidigend, daß man, glaube ich, sein Lebtag lieber nichts sehen oder in die Küche essen gehen möchte.
Um wieder zur Stadt zu kommen, sind wir in einem Turm hinuntergestiegen, der dazu diente, daß Wagen fast bis oben hinauffahren konnten. Die leichte und mit Sand bestreute Neigung dreht sich wie die Stufen einer Treppe um eine steinerne Achse. Das Gewölbe ist finster, erleuchtet nur vom lebhaften Licht der Schießscharten. Die Konsolen, auf die sich das innere Ende des Gewölbebogens aufstützt, stellen groteske oder obszöne Gegenstände dar. Bei ihrer Erfindung scheint eine dogmatische Absicht vorgewaltet zu haben. Man müßte das Werk von unten her beginnen, wo es mit einem Aristoteles equitatus beginnt (einem Gegenstand, der schon in einer der Statuen des Chors der Kathedrale in Rouen behandelt ist), und man kommt durch Abstufungen bis zu einem Herrn, der sich mit einer Dame in jener perfiden Positur belustigt, die Lukrez und die» Eheliche Liebe« empfehlen. Die meisten Darstellungen dazwischen sind übrigens sehr zur Verzweiflung derer, die wie wir nach spaßhaften Einfällen jagen, beseitigt, und mit kaltem Blut, ausdrücklich, aus Anstand beseitigt, und, wie uns der Bediente Seiner Majestät in überzeugtem Tone sagte, »weil viele darunter waren, die für die Damen nicht paßten« ...
. . . . . . . . . . . . .
Château de Chenonceau. – Etwas von eigener Sanftheit und aristokratischer Heiterkeit liegt über dem Schloß von Chenonceau. Es liegt etwas vom Dorf entfernt, das sich respektvoll abseits hält. Man sieht es am Ende einer großen Allee, von Wald umgeben, eingerahmt in einen weiten Park mit schönen Rasenflächen. Aufs Wasser, in die Luft gebaut, hebt es seine Türmchen und seine viereckigen Schornsteine. Der Cher fließt darunter her und murmelt am Fuß seiner Bogen, deren scharfe Kanten den Strom durchschneiden. Es ist friedlich und mild, elegant und robust. Seine Ruhe hat nichts Langweiliges und seine Melancholie hat keine Bitterkeit.
Man tritt am Ende eines langen Saals mit Spitzbogengewölbe ein, der einst als Waffensaal gedient hat. Man hat mehrere Rüstungen hineingestellt, die trotz des Zwangs gleichmäßiger Zusammenstellungen nicht stören und an ihrem Platze scheinen. Das ganze Interieur ist mit Geschmack angeordnet. Die Gobelins und die Möbel der Epoche sind erhalten und werden mit Verstand gepflegt. Die großen und ehrwürdigen Kamine des sechzehnten Jahrhunderts verbergen unter ihrem Mantel keine unvornehmen und sparsamen Kaminöfen, wie sie sich in weniger große einzunisten wissen.
In den Küchen, die wir gleichfalls besuchten, und die in einem Joch des Schlosses enthalten sind, las eine Magd Gemüse aus, ein Küchenjunge wusch Teller, und an den Öfen stand der Koch und ließ fürs Frühstück eine erträgliche Menge glänzender Kasserollen kochen. All das ist hübsch, sieht gut aus, riecht nach dem ehrlichen Schloßleben, der trägen und intelligenten Existenz des Wohlgeborenen. Ich liebe die Besitzer von Chenonceau.
Und gibt es nicht außerdem überall gute alte Porträts, vor denen man eine unendliche Zeit verbringen kann, indem man sich die Zeit vorstellt, da ihre Herren lebten, und die Ballets, in denen sich die Hüften all dieser schönen rosigen Damen drehten, und die guten Schwerthiebe, die sich diese Edelmänner mit ihren Rapieren versetzten. Das sind Versuchungen der Geschichte. Man möchte wissen, ob diese Leute wie wir geliebt haben, und welche Unterschiede zwischen ihren Leidenschaften und den unsern waren. Man möchte, daß ihre Lippen sich öffneten, um uns ihre Herzensgeschichten zu erzählen, alles, was sie einst, selbst an Nichtigem, getan haben, und welches ihre Ängste waren, ihre Lüste. Es ist eine reizende und verführerische Neugier, eine träumerische Begier, zu erfahren, wie man sie etwa nach der unbekannten Vergangenheit einer Geliebten empfindet ... Aber sie bleiben für die Fragen unserer Augen taub, sie bleiben da, stumm, regungslos in ihren hölzernen Rahmen, wir gehn vorüber. Die Motten durchbohren ihre Leinwand, man firnißt sie neu, sie lächeln noch, wenn wir verwest und vergessen sind. Und dann kommen andere und betrachten sie auch, bis zu dem Tage, da sie zu Staub verfallen werden, da man ebenso vor unseren eigenen Bildern träumen wird. Und man wird sich fragen, was man zu dieser Zeit machte, welche Farbe das Leben hatte, und ob sie nicht wärmer war ...
. . . . . . . . . . . . .
... Ich würde von all diesen schönen Damen nicht weiter reden, wenn mich das große Porträt der Madame Deshoulieres, in großem weißem Negligé und ganzer Figur (es ist übrigens eine schöne Gestalt und sie erscheint wie das so geschmähte und so wenig gelesene Talent dieser Dichterin beim zweiten Hinsehn besser als beim ersten) nicht durch den untrüglichen Charakter des Mundes, der dick, vorgeschoben, fleischig und sinnlich ist, an die sonderbare Brutalität des Porträts der Madame de Staël von Gerard erinnert hätte. Als ich es vor zwei Jahren zu Coppet sah, konnte ich nicht anders, ich war erstaunt über diese roten Weinlippen, diese weiten, witternden, atmenden Nasenflügel. Der Kopf George Sands zeigt etwas Analoges. Bei all diesen Frauen, die zur Hälfte Männer sind, beginnt die Geistigkeit erst in der Höhe der Augen. Der ganze Rest ist in den materiellen Instinkten stecken geblieben.
An amüsanten Dingen findet sich auf Chenonceau noch im Zimmer der Diana von Poitiers das große Baldachinbett der königlichen Konkubine, ganz aus weißem und kirschrotem Damast. Wenn es mir gehörte, würde es mich Mühe kosten, mich abzuhalten, daß ich mich nicht bisweilen hineinlegte. Im Bette der Diana von Poitiers liegen, selbst wenn es leer ist, das ist wohl so viel wert, wie in dem vieler greifbarerer Realitäten liegen. Hat man nicht gesagt, in diesen Dingen sei das ganze Vergnügen nur Einbildung? Könnt ihr euch also, ihr, die ihr ein wenig Phantasie habt, die sonderbare, historische Wollust vorstellen, wenn man den Kopf auf das Kopfkissen der Maitresse Franz des Ersten legt und sich auf ihren Matratzen umdreht? (O! wie gern gäbe ich alle Frauen der Erde hin, könnte ich Kleopatras Mumie haben!) Aber ich würde nicht einmal wagen, aus Furcht, es zu zerbrechen, das Porzellan der Katharina von Medici anzurühren, das im Speisesaal steht, noch auch den Fuß in den Steigbügel Franz' des Ersten zu setzen, aus Furcht, er könne darinnen bleiben, noch die Lippen an das Mundstück der ungeheuren Trompete zu legen, die im Waffensaal hängt, aus Furcht, ich könne mir die Brust damit zerbrechen ...
Kapitel III.
Château de Clisson. – ... Auf einem Hügel, an dessen Fuß sich zwei Flüsse vereinigen, in einer frischen Landschaft, erheitert durch die klaren Farben der Ziegeldächer, die nach italienischer Manier flach sind und gruppiert wie in Huberts Skizzen, in der Nähe einer langen Kaskade, die eine Mühle dreht, ganz im Laub verborgen, zeigt das Schloß von Clisson sein schartiges Haupt über den großen Bäumen. Ringsum ist es ruhig und still. Die Häuschen lachen wie unter einem warmen Himmel; die Wasser machen ihr Geräusch, der Gischt spritzt auf einem Bach, an dem sich weiche Büschel Grüns benetzen. Der Horizont zieht sich auf der einen Seite in eine fliehende Perspektive von Wiesen hin und steigt auf der andern plötzlich empor, eingeschlossen von einem kleinen bewaldeten Tal, von dem eine grüne Woge zermalmt wird und bis unten hinabrollt.
Wenn man die Brücke überschritten hat und am Fuß des steilen Pfades steht, der zum Schloß hinaufführt, sieht man aufrecht, verwegen und hart über dem Graben, wo es sich mit zähem und furchtbarem Ausdruck aufstützt, ein großes Mauerstück, das mit aufgerissenen Pechnasen ganz bekrönt ist, ganz besetzt mit Bäumen, ganz behangen mit Efeu, dessen weite und frischgehaltene Masse, vom grauen Stein in Spalten und Spindeln durchschnitten, in ganzer Länge im Winde erschauert und einem ungeheuren Schleier gleicht, den der schlafende Riese im Traum auf seinen Schultern bewegt. Das Gras ist hoch und dunkel, die Pflanzen sind kräftig und schroff; der knotige, runzlige, gewundene Stamm des Efeus hebt die Mauern wie mit Hebeln empor, oder er hält sie im Netz seines Astwerks zusammen. An einer Stelle hat ein Baum die ganze Dicke der Mauer durchbrochen und hat, horizontal vorspringend und in der Luft hängend, die Strahlen seiner Zweige nach draußen entsandt. Die Gräben, deren Böschung sich durch die Erde mildert, die vom Rand abbröckelt, und durch die Steine, die von den Zinnen fallen, zeigen eine Kurve, weit und tief wie der Haß und wie der Hochmut; und das Eingangstor mit seinem kräftigen, ein wenig runden Spitzbogen und (einen beiden Öffnungen, die dienten, um die Zugbrücke aufzuziehen, sieht aus wie ein großer Helm, der durch die Löcher seines Visiers blickt.
Tritt man ins Innere, so ist man überrascht, verwundert über das erstaunliche Gemisch der Ruinen und der Bäume; die Trümmer bringen die grünende Jugend der Bäume zur Geltung, und dieses Grün macht die Trauer der Trümmer nur herber. Hier ist das ewige und schöne Lachen, das schallende Lachen der Natur auf dem Skelett der Dinge; hier ist der Übermut ihres Reichtums, die tiefe Anmut ihrer Phantasmen sind die melodiösen Einfälle ihres Schweigens. Ein ernster und träumerischer Enthusiasmus ergreift einem die Seele; man fühlt, daß der Saft in den Bäumen rinnt, und daß das Gras mit der gleichen Kraft und dem gleichen Rhythmus wächst, wie die Steine zerbröckeln und die Mauern zerfallen. (Eine erhabene Kunst hat im höchsten Einklang der sekundären Dissonanzen die schweifende Form des (Efeus auf dem gewundenen Umriß der Ruinen angeordnet, das Haar der Brombeersträucher auf dem Wirrwarr der eingestürzten Steine, die Transparenz der Luft über den festen Ausladungen der Massen, den Ton des Himmels über dem Ton des Bodens, die beide ihr Gesicht im andern spiegeln, was war und was ist. Stets offenbaren so die Geschichte und die Natur, indem sie ihn in diesem engumschriebenen Winkel der Welt erfüllen, den unaufhörlichen Zusammenhang, die endlose Ehe zwischen der Menschlichkeit, die entfliegt, und dem Gänseblümchen, das wächst, zwischen den Sternen, die sich entzünden, und den Menschen, die einschlafen, zwischen dem Herzen, das pocht, und der Woge, die steigt. Und das ist hier an diesem Ort so deutlich durchgeführt, so vollständig, so dialogisiert, daß man innerlich erbebt, als wirke dieses Doppelleben in einem selber, so sehr drängt sich die Wahrnehmung dieser Harmonien und dieser Entwickelungen auf; denn auch das Auge hat seine Orgien und die Idee ihre Freudenfeste.
Am Fuß zweier großer Bäume, deren Stamme sich kreuzen, fließt wie eine leuchtende Woge ein grünes Licht über das Moos und erwärmt diese ganze Einsamkeit. Zu Häupten sendet eine Blätterkuppel, die der Himmel durchlöchert, der in Azurfetzen darüber absticht, ein grünliches und klares Licht hernieder, das, von den Mauern eingeschlossen, all ihre Trümmer reichlich erleuchtet, ihre Falten ausforscht, ihre Schatten verdichtet, alle ihre verborgenen Feinheiten entschleiert.
Schließlich tritt man hervor, man geht zwischen diesen Mauern, unter diesen Bäumen einher, man wendet sich wieder fort, man irrt die Außenwerke entlang und tritt unter die berstenden Arkaden, von denen aus sich eine große schaudernde Pflanze verbreitet. Die überfüllten Gewölbe, die die Toten enthalten, erdröhnen unter den Schritten; die Eidechsen laufen unter den Büschen, die Insekten steigen die Mauern entlang, der Himmel glänzt, und die eingelullte Ruine setzt ihren Traum fort.
Mit seinem dreifachen Gürtel, seinen Erkern, seinen inneren Höfen, seinen Pechnasen, seinen Kellergewölben, seinen Wällen, die wie Rinde auf Rinde und Küraß auf Küraß übereinandergelegt sind, läßt sich das alte Schloß der Clisson noch rekonstruieren und wieder zeigen. Die Erinnerung an die Existenzen von ehemals fließt mit der Ausdünstung der Nesseln und der Frische des Efeus von seinen Mauern herab. Andere Menschen als wir haben da drinnen ihre heftigeren Leidenschaften bewegt; sie hatten stärkere Hände, weitere Brüste.
Lange schwarze Striche steigen noch in Diagonalen die Wände hoch, wie zu der Zeit, da die Scheite in den achtzehn Fuß weiten Kaminen flammten. Symmetrische Löcherreihen im Mauerwerk bezeichnen die Stelle der Stockwerke, zu denen man einst auf Wendeltreppen emporstieg, die zerbröckeln und die ihre leeren Türen auf den Abgrund öffnen. Bisweilen senkte sich ein Vogel, der aus seinem in den Ranken aufgehängten Neste aufflog, mit ausgebreiteten Flügeln nieder und schwebte durch den Bogen eines Fensters, um in die Felder hinauszuziehen.
Hoch oben in einem ragenden, ganz nackten, grauen, trockenen Mauerstück ließen viereckige, nach Größe und Anordnung unregelmäßige Fensteröffnungen durch ihre gekreuzten Stangen die reine Farbe des Himmels glänzen, dessen lebhaftes Blau, vom Stein eingerahmt, das Auge mit überraschendem Reiz anzog. Die Schwalben ließen in den Bäumen ihr gellendes und wiederholtes Geschrei hören. Mitten in all dem weidete eine Kuh, die darinnen wie auf einer Wiese ging, und ihren gespalteten Huf auf dem Grase spreizte.
Man sieht ein Fenster, ein großes Fenster, das sich auf eine Wiese öffnet, die man die Wiese der Ritter nennt. Von da aus, von einer Steinbank, die in die Dicke der Mauer eingelassen war, konnten die großen Damen von damals die Ritter sehen, die nach der eisengepanzerten Brust ihrer Pferde stießen, und die Streitkolben, die auf die Helmstutzen niedersausten, die Lanzen, die zerbrachen, die Männer, die auf den Rasen sanken. Vielleicht hat an einem schönen Sommertag wie heute, als noch die Mühle da, die ihr Geklapper klappert und die ganze Landschaft in Geräusch versetzt, nicht existierte, als noch Dächer über diesen Mauern standen, und flandrische Leder auf den Wänden hingen, als in diese Fenster Wachsleinwand gespannt und weniger Gras zu sehen, aber Stimmen und Lärm von Lebendigen zu hören waren, ja, vielleicht hat da mehr als ein in sein Mieder aus rotem Samt gepreßtes Herz ebendort vor Angst und Liebe gepocht. Wundervolle weiße Hände haben auf diesem Stein, den jetzt die Nesseln bedecken, vor Furcht gebebt, und die gestickten Schleifen der großen Hauben haben in diesem Wind gezittert, der die Enden meiner Halsbinde bewegt, und der den Federbusch der großen Herren beugte.
Wir sind in die Keller hinuntergestiegen, wo Johann V. eingeschlossen wurde. Im Kerker der Männer haben wir noch an der Decke den großen Doppelhaken gesehen, der zum Hängen diente; und wir haben mit neugierigen Fingern die Tür zum Kerker der Frauen betastet. Sie ist etwa vier Zoll dick, durch Schrauben zusammengehalten, mit Eisen geklammert, belegt und gleichsam gepolstert. In der Mitte diente ein kleines vergittertes Türchen, um in das Verlies zu werfen, was nötig war, damit die Verurteilte nicht starb. Das öffnete man, und nicht die große Tür, die, der diskrete Mund der furchtbarsten Vertraulichkeiten, von jenen war, die sich immer schließen und sich niemals öffnen. Es war die gute Zeit für den Haß! Wenn man damals einen haßte, wenn man ihn in einem Überfall aufgehoben oder bei einer Zusammenkunft durch Verrat genommen hatte, aber wenn man ihn endlich hatte, ihn hielt, dann konnte man ihn nach Gefallen zu jeder Stunde, zu jeder Minute sterben fühlen, seine Ängste zählen, seine Tränen trinken. Man stieg in seinen Kerker hinunter, man sprach mit ihm, man feilschte über seine Strafe, um über seine Qualen zu lachen, man erörterte sein Lösegeld; man lebte auf seine Kosten, von ihm, von seinem Leben, das erlosch, von seinem Gold, das man ihm nahm. Der ganze Wohnsitz, von der Höhe der Türme an bis zum Fuß der Gräben, lastete auf ihm, zermalmte ihn, begrub ihn; und die Familienrachen wurden so erfüllt, in der Familie, und durch das Haus selber, das ihre Kraft ausmachte und ihre Idee symbolisierte.
Bisweilen jedoch, wenn dieser Unglückliche, der dort lag, ein großer Herr war, ein reicher Mann, wenn er sterben wollte, wenn man seiner satt war, und wenn alle Tränen seiner Augen den Haß seines Herrn gleichsam erfrischend zur Ader gelassen hatten, redete man davon, ihn loszulassen. Der Gefangene versprach alles; er wollte die Burgen zurückerstatten, er wollte die Schlüssel seiner besten Städte aushändigen, er wollte seine Tochter zur Ehe geben, er wollte Kirchen dotieren, er wollte zu Fuß zum Heiligen Grabe ziehen. Und Geld! Geld außerdem! Er wollte durch die Juden welches schaffen lassen! Dann unterschrieb man den Vertrag, man gegenzeichnete ihn, man datierte ihn voraus; man brachte Reliquien herbei, man schwor darüber, und der Gefangene sah die Sonne wieder. Er bestieg ein Pferd, ritt im Galopp davon, kam nach Hause, ließ das Fallgatter senken, rief seine Leute herbei und hakte das Schwert los. Sein Haß brach in wilden Explosionen nach außen. Es war der Moment des erschreckenden Zorns und der siegreichen Wut. Der Schwur? der Papst befreite von ihm, und das Lösegeld, das zahlte man nicht!
Als Clisson im Schloß von l'Hermine eingesperrt war versprach er, um hinauszukommen, hunderttausend Goldfranken, die Herausgabe der Orte, die dem Herzog von Penthièvre gehörten, die Nicht-Vollziehung der Ehe seiner Tochter Marguerite mit dem Herzog von Penthièvre. Und sowie er draußen war, begann er damit, daß er Chatelaudren, Guincamp, Lamballe und Saint-Malo angriff, die genommen wurden oder kapitulierten. Der Herzog von Penthièvre heiratete seine Tochter, und die hunderttausend Goldfranken, die er gezahlt hatte, gab man ihm zurück. Aber zahlen mußten sie die Völker der Bretagne.
Als Johann V. an der Brücke von Loroux vom Grafen von Penthièvre aufgehoben war, versprach er ein Lösegeld von einer Million; er versprach seine älteste Tochter, die bereits mit dem König von Sizilien verlobt war. Er versprach Montcontour, Sesson und Ingan und so weiter; er gab weder seine Tochter, noch das Geld, noch die festen Plätze. Er hatte gelobt, zum Heiligen Grabe zu pilgern. Er entledigte sich des Gelübdes durch einen Stellvertreter. Er hatte gelobt, weder Steuern noch Subsidien mehr zu erheben; der Papst entband ihn davon. Er hatte gelobt, Notre-Dame von Nantes sein Gewicht in Gold zu geben; aber da er fast zweihundert Pfund wog, geriet er tief in Schulden. Mit allem, was er zusammenraffen und fassen konnte, bildete er schnell eine Liga und zwang die Penthièvre, ihm jenen Frieden abzukaufen, den sie verkauft hatten.
Jenseits der Sèvre, an der er sich die Füße netzt, bedeckt ein Wald den Hügel mit seiner grünen und frischen Masse; es ist die »Garenne«, ein trotz der künstlichen Schönheiten, die man dort hat einführen wollen, an sich sehr schöner Park. M. Semot (der Vater des gegenwärtigen Besitzers, ein Maler des Empire und Hofkünstler) hat dort nach Kräften gearbeitet, um jenen kalten, italienischen, republikanischen, römischen Geschmack zu reproduzieren, der zur Zeit Tanovas und der Madame de Staël sehr Mode war. Man war pomphaft, grandios und vornehm. Es war die Zeit, da man auf den Gräbern Urnen meißelte, wo man alle Welt mit dem Mantel und dem Haar im Winde malte, wo Corinne zur Leyer sang, an Oswalds Seite, der russische Stiefel trug, und wo man schließlich auf allen Köpfen viel wirres Haar sehn mußte, und in allen Landschaften viele Ruinen.
Diese Art von Schönheiten fehlt der Garenne nicht. Man findet einen Vestatempel und gegenüber einen Tempel der Freundschaft.
... Die Inschriften, die zusammengesetzten Felsen, die künstlichen Ruinen sind hier mit Naivität und Überzeugung ausgestreut ... Aber alle poetischen Reichtümer sind in Heloisens Grotte vereinigt, einer Art natürlichem Dolmen am Ufer der Sèvre.
... Weshalb hat man nur aus dieser Gestalt der Heloise, die eine so edle und hohe Gestalt war, etwas Banales und Albernes gemacht, den faden Typus jeder durchkreuzten Liebe und gleichsam das enge Ideal des sentimentalen kleinen Mädchens? Sie verdiente doch besseres, diese arme Geliebte des großen Abälard, sie, die ihn mit so hingebender Bewunderung liebte, obgleich er hart war, obgleich er finster war und ihr weder Bitternisse noch Schläge ersparte. Sie fürchtete mehr, ihn zu verletzen als Gott selber, und sie wünschte ihm mehr zu gefallen als Gott. Sie wollte nicht, daß er sie zur Frau nahm, denn sie fand: »es sei unpassend und beklagenswert, wenn den, den die Natur für alle Werke geschaffen hatte ... wenn den eine Frau für sich allein nahm«. Denn sie fühlte, sagte sie, »mehr Süße bei diesem Namen der Geliebten und Konkubine als bei dem der Gattin, als bei dem der Kaiserin, und wenn sie sich in ihm demütigte, hoffte sie, in seinem Herzen mehr zu gewinnen«
. . . . . . . . . . . . .
Der Park ist darum nicht minder ein entzückender Ort. Die Alleen schlängeln sich im Dickicht und die Baumgruppen reichen in den Fluß zurück. Man hört das Wasser fließen, man fühlt die Frische der Blätter. Wenn uns der schlechte Geschmack, der sich dort findet, gereizt hat, so war es, weil wir von Clisson kamen, denn das ist von einer echten Schönheit, so solide und so einfach, und dann, weil dieser schlechte Geschmack schließlich nicht mehr unser schlechter Geschmack ist. Aber was ist denn der schlechte Geschmack? Er ist unweigerlich der Geschmack der Epoche, die uns vorausgegangen ist. Der schlechte Geschmack der Zeit Ronsards war Marot; der Zeit Boileaus Ronsard; der Zeit Voltaires Corneille, und Voltaire war es zur Zeit Chateaubriands, den zu dieser Stunde viele Leute ein wenig schwach zu finden beginnen. O, ihr Leute von Geschmack in zukünftigen Jahrhunderten! ich empfehle euch die Leute von Geschmack von heute. Ihr werdet ein wenig lachen über ihre Magenkrämpfe, über ihre superbe Verachtung, über ihre Vorliebe fürs Kalb und für die Milchkur, und über die Grimassen, die sie schneiden, wenn man ihnen blutiges Fleisch und zu heiße Poesien vorsetzt.
Da, was schön ist, häßlich sein wird, da, was graziös ist, dumm, was reich ist, arm erscheinen wird, so werden unsere entzückenden Boudoirs, unsere reizenden Salons, unsere hinreißenden Kostüme, unsere interessanten Feuilletons, unsere packenden Dramen, unsere ernsten Bücher – o! o! wie man uns auf den Speicher sperren wird, wie man Makulatur, Papier, Dünger, Mist daraus machen wird! O Nachwelt! vergiß vor allem nicht unsere gotischen Wohnzimmer, unsere Renaissancemöbel, die Reden M. Pasquiers, die Form unserer Hüte und die Ästhetik der Revue des Deux Mondes!
Während wir uns diesen hohen philosophischen Betrachtungen überließen, zog unser Wagen uns bis Tiffanges. Beide in einer Art Weißblechwanne sitzend, marterten wir mit unserm Gewicht das unmerkliche Pferd, das in der Deichselgabel wogte. Es war das Zappeln eines Aals im Leibe einer Berberratte. Senkungen schoben es vorwärts, Steigungen zogen es zurück, Ränder schleuderten es zur Seite, und der Wind bewegte es unter dem Hagel der Peitschenhiebe. Das arme Tier! Ich kann nicht ohne Gewissensbisse daran denken.
Der in den Hügel geschnittene Weg senkt sich in Windungen, an den Rändern mit dichten Stechginsterbüschen oder mit den breiten Zungen eines rötlichen Mooses besetzt. Rechts sieht man am Fuß des Hanges auf einer Erdhebung, die aus dem Grund des Tals aufsteigt und sich wie der Rückenschild einer Schildkröte rundet, große, unregelmäßige Mauerreste, die ihre schartigen Kronen übereinander emporstrecken.
Man geht eine Hecke entlang, man klettert einen kleinen Pfad hinauf, man tritt unter eine ganz offene Halle, die bis zu zwei Dritteln ihres Spitzbogens im Boden steckt. Die Menschen, die einst zu Pferde hindurchgeritten sind, sie müßten sich jetzt beugen. (Wenn es die Erde langweilt, ein Monument zu lange zu tragen, bläht sie sich von unten her auf, steigt wie eine Flut darüber, und während der Himmel ihm am Kopfe zehrt, begräbt sie ihm die Füße.) Der Hof ist öde, der Mauerring leer, die Fallgatter rühren sich nicht mehr, das schlafende Wasser der Gräben ruht glatt und regungslos unter den runden Seerosen.
Der Himmel war weiß, ohne Wolken, aber ohne Sonne. Seine blasse Wölbung dehnte sich weit und bedeckte das Land mit kalter und schmerzhafter Monotonie. Man hörte kein Geräusch, die Vögel sangen nicht, der Horizont selbst ließ kein Murmeln hören, und die leeren Furchen sandten weder das Gekreisch auffliegender Krähen her noch das leise Geräusch des Eisens der Pflüge. Wir sind durch die Dornenranken und das Gestrüpp in einen tiefen und finsteren Graben am Fuß eines großen Turms hinabgestiegen, der sich im Wasser und Schilfrohr badet. Ein einziges Fenster öffnet sich auf einer seiner Flächen, ein Schattenviereck, das von der grauen Linie seines steinernen Fensterkreuzes durchschnitten wird. Am Vorsprung der Schwelle hängt ein mutwilliger Büschel wilden Geißblatts, und er streckt seine grüne und duftende Wolke nach draußen. Die großen Pechnasen lassen, wenn man den Kopf hebt, von unten her durch ihre klaffenden Öffnungen nur den Himmel sehen, oder eine kleine, unbekannte Blume, die sich dort, an einem Sturmtag vom Winde herbeigetragen, eingenistet hat, und deren Samenkorn in der Spalte der Steine im Schutz gewachsen ist.
Plötzlich ist ein Hauch gekommen, weich und lang, wie ein Seufzer, den man hinatmet, und die Bäume in den Gräben, das Gras auf den Steinen, die Binsen im Wasser, die Pflanzen der Ruinen und der riesenhafte Efeu, der den Turm von der Basis bis zum First unter seiner gleichförmigen Schicht leuchtenden Grüns verkleidete, alles erzitterte und schlug sein Laubwerk zusammen; das Korn auf den Feldern rollte seine blonden Wogen, die sich auf den beweglichen Köpfen der Halme immerfort streckten und streckten; der Wassertümpel furchte sich und sandte eine Welle um den Fuß des Turms; die Efeublätter schauerten alle zugleich, und ein blühender Apfelbaum ließ rosige Blütenköpfe fallen.
Nichts, nichts! Der Wind streicht vorüber, das Gras wächst, der Himmel liegt offen da. Kein Kind in Lumpen bewacht eine Kuh, die unter den Kieseln das Moos abweidet; nicht einmal eine vereinzelte Ziege steckt ihren bärtigen Kopf durch einen Spalt der Wälle und entflieht erschreckt, indem sie das Gesträuch bewegt; kein Vogel singt; kein Nest, kein Geräusch! Dieses Schloß ist wie ein Phantom, stumm, kalt, verlassen auf diesem öden Land; es sieht aus wie verflucht und voller wilder Erinnerungen. Und doch wurde er bewohnt, der traurige Sitz, den jetzt selbst die Eulen nicht mehr zu wollen scheinen. Im Turm haben wir zwischen vier gleich dem Boden alter Schwemmen bleifarbenen Mauern die Spur von fünf Stockwerken gezählt. Dreißig Fuß vom Boden ist ein Kamin mit seinen zwei runden Pfeilern und seinem geschwärzten Blech in der Schwebe geblieben; Erde ist daraus gekommen, und wie in einem Blumentisch, der sich dort erhalten hätte, sind Pflanzen darauf gewachsen.
Hinter der zweiten Ringmauer erkennt man auf einem gepflügten Feld die Reste einer Kapelle an den zerbrochenen Schäften eines Spitzbogenportals. Der Hafer ist darin gewachsen, und die Bäume haben die Säulen ersetzt. Diese Kapelle war vor vierhundert Jahren mit Dekorationen aus Goldtuch und Seide, mit Weihrauchfässern, mit Leuchtern, Kelchen, Kreuzen, Edelsteinen, mit Schüsseln aus vergoldetem Silber, mit goldenen Kannen gefüllt; ein Chor von dreißig Sängern, Kaplanen, Musikern und Kindern stimmten dort Hymnen an, zum Ton einer Orgel, die ihnen folgte, wenn sie auf Reisen gingen. Sie waren in Scharlachkleider gekleidet, die perlgrau oder mit Pelzwerk gefüttert waren. Einen davon nannte man den Erzdiakon, einen andern den Bischof, und man verlangte vom Papst, es solle ihnen wie den Stiftsherren die Mitra zu tragen erlaubt sein; denn diese Kapelle war die Kapelle und dieses Schloß war eins der Schlösser Gilles de Navals, des Herrn von Ronci, Montmorency, Retz und Craon, des Generalstatthalters des Herzogs der Bretagne und Marschalls von Frankreich, der am 25. Oktober 1440 als Falschmünzer, Mörder, Zauberer, Sodomiter und Atheist auf der Prée der Madeleine zu Nantes verbrannt wurde.