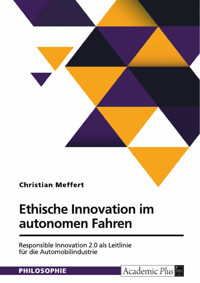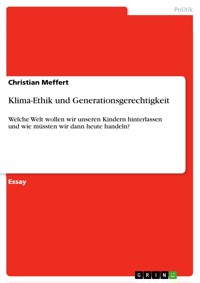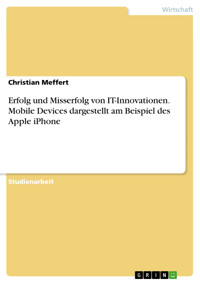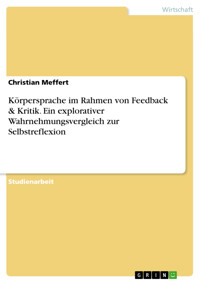0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Jura - Datenschutz, Note: 2,0, Technische Hochschule Ingolstadt (IAW), Sprache: Deutsch, Abstract: Die stetige voranschreitende Vernetzung diverser Geräte, wie zum Beispiel Smartphones bis hin zu Fernsehern, hat sich zum Trend entwickelt. Man spricht auch vom „Internet der Dinge“ – eine Vernetzung immer neuer Geräte mit dem Ziel, dem Nutzer immer individualisierbarere digitalisierte Dienste anzubieten. Diesen Trend hat die Automobilindustrie ebenso erkannt und BMW bietet beispielsweise bereits heute ein breites Portfolio an Vernetzten Diensten im Rahmen von BMW ConnectedDrive und ist damit nach einer aktuellen Studie im Auftrag von Vodafone Marktführer. Realisieren lassen sich solche Dienste, oder fortfolgend auch Automotive Services genannt, durch eine Anbindung an das Internet. Dies wird ermöglicht durch ein im Automobil verbautes Subscriber Identity Module (kurz SIM(-Karte)). Neben den Chancen, welche die Automotive Services beispielsweise für die Sicherheit im Straßenverkehr bieten, bestehen ebenso die Gefahren durch einen Missbrauch dieser Daten. Den Vorteil von Automotive Services will man beispielsweise dadurch nutzen, dass ab 2015 für alle in der Europäischen Union (EU) produzierten Neuwagen der intelligente Notruf (eCall) Pflicht wird und folglich die Vernetzung von Fahrzeugen deutlich steigt. Entgegen der positiven Aspekte sehen Datenschützer hier ein hohes Risiko durch den Missbrauch dieser Daten. Nicht zuletzt seit der NSA-Affäre hat die Gesellschaft sich für das Thema Datenschutz sensibilisiert und so befürchten Kritiker, dass Autofahrer nahtlos überwacht werden könnten – man spricht auch vom „Gläsernen Autofahrer“. So sagte bereits der Volkswagen-Vorstandschef M. Winterkorn auf der CeBit 2014 sinngemäß, dass unsere Fahrzeuge heute schon rollende Rechenzentren mit beispielsweise mehr als 50 Steuergeräten sind und das Auto nicht zur Datenkrake werden dürfe . Die Problemstellung die sich daraus ergibt ist die Frage, wie sich Automotive Services und das Thema Datenschutz zueinander verhalten – Überwiegen die Chancen dieser Technologie(n) die damit neu entstehenden Risiken und welche Gefahren kann dies bedeuten? Die Zielsetzung dieser Arbeit soll es sein, dieser Fragestellung am Beispiel des EU-eCall nachzugehen und eine Antwort auf die Frage zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1.) Thematische Einführung
1.1) Motivation
1.2) Problemstellung & Zielsetzung
1.3) Aufbau der Arbeit
2.) Erläuterungen zum EU-eCall
2.1) Hintergrund – die Initiative „Vision Zero“
2.2) Das Technisches Konzept
2.3) Der Prozess im Notfall
3.) Datenschutz beim EU-eCall
4.) Fazit & Ausblick
Anhang
Quellen der verwendeten Grafiken innerhalb der Abbildung 3 - Prozessablauf des Eu-eCall
Fahrzeugrettungskarte
Positionsbestimmung mittels GSM
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabelle 1 - Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 - Die sieben strategischen Maßnahmen zur EU-Initiative „Straßenverkehrssicherheit 2011 – 2020“
Abbildung 2 - Beispiel für Fahrzeugsensoren
Abbildung 3 - Prozessablauf des Eu-eCall
Abbildung 4 - Beispiel für eine Fahrzeugrettungskarte (1/2)
Abbildung 5 - Beispiel für eine Fahrzeugrettungskarte (2/2)
Abbildung 6 - GSM-Ortung mittels Cell-ID-Methode und Timing Advance
Abbildung 7 - GSM-Ortung mittels EOTD-Verfahren
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 - Abkürzungsverzeichnis
Tabelle 2 - MSD und optionale Daten für den EU-eCall
Tabelle 3 - Prozessschritte des EU-eCall
1.) Thematische Einführung
1.1) Motivation
Die stetige voranschreitende Vernetzung diverser Geräte, wie zum Beispiel Smartphones bis hin zu Fernsehern, hat sich zum Trend entwickelt. Man spricht auch vom „Internet der Dinge“ – eine Vernetzung immer neuer Geräte mit dem Ziel, dem Nutzer immer individualisierbarere digitalisierte Dienste anzubieten [vgl. (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 2014)].
Diesen Trend hat die Automobilindustrie ebenso erkannt und BMW bietet beispielsweise bereits heute ein breites Portfolio an Vernetzten Diensten im Rahmen von BMW ConnectedDrive[1] und ist damit nach einer aktuellen Studie im Auftrag von Vodafone Marktführer [vgl. (Media-Manufaktur GmbH, 2014, p. 44)].
So beispielsweise die BMW TeleServices: bei diesem Dienst sammelt das Fahrzeug selbstständig Daten zum Zustand von Verschleißteilen, Kilometerleistung etc. durch die im Fahrzeug befindlichen Sensoren. Diese Daten werden zur Auswertung an die BMW AG übermittelt. Anschließend werden die gesammelten Daten an den für den Kunden zuständigen Händler weitergegeben. Der Händler kann den Kunden dann beispielsweise eigenständig kontaktieren wenn der nächste Ölwechsel fällig wird und diesem direkt einen Termin vorschlagen [vgl. (BMW AG, 2014)].
Realisieren lassen sich solche Dienste, oder fortfolgend auch Automotive Services genannt, durch eine Anbindung an das Internet. Dies wird ermöglicht durch ein im Automobil verbautes Subscriber Identity Module (kurz SIM(-Karte)).
1.2) Problemstellung & Zielsetzung
Neben den Chancen, welche die Automotive Services beispielsweise für die Sicherheit im Straßenverkehr bieten, bestehen ebenso die Gefahren durch einen Missbrauch dieser Daten. Den Vorteil von Automotive Services will man beispielsweise dadurch nutzen, dass ab 2015 für alle in der Europäischen Union (EU) produzierten Neuwagen der intelligente Notruf (eCall) Pflicht wird und folglich die Vernetzung von Fahrzeugen deutlich steigt [vgl. (© European Union, 1995-2014 , 2014)].
Entgegen der positiven Aspekte sehen Datenschützer hier ein hohes Risiko durch den Missbrauch dieser Daten. Nicht zuletzt seit der NSA-Affäre hat die Gesellschaft sich für das Thema Datenschutz sensibilisiert und so befürchten Kritiker, dass Autofahrer nahtlos überwacht werden könnten – man spricht auch vom „Gläsernen Autofahrer“ [vgl. (Heise Medien Gruppe GmbH & Co. KG, 2014) & (Eichner, 2014)].
So sagte bereits der Volkswagen-Vorstandschef M. Winterkorn auf der CeBit 2014 sinngemäß, dass unsere Fahrzeuge heute schon rollende Rechenzentren mit beispielsweise mehr als 50 Steuergeräten sind und das Auto nicht zur Datenkrake werden dürfe [vgl. (Media-Manufaktur GmbH, 2014, p. 44)].
Die Problemstellung die sich daraus ergibt ist die Frage, wie sich Automotive Services und das Thema Datenschutz zueinander verhalten – Überwiegen die Chancen dieser Technologie(n) die damit neu entstehenden Risiken und welche Gefahren kann dies bedeuten?
Die Zielsetzung dieser Arbeit soll es sein, dieser Fragestellung am Beispiel des EU-eCall nachzugehen und eine Antwort auf die Frage zu geben.
1.3) Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert.
Das Kapitel 1.) beinhaltet die thematische Einführung, die Problemstellung sowie die daraus abgeleitete Zielsetzung. Den Abschluss bildet eine kurze Beschreibung der Struktur dieser Arbeit.
Innerhalb des Kapitels 2.) wird der eCall erläutert. Dazu wird der Hintergrund der EU-Initiative beschrieben, die grundlegende Funktionsweise des eCall erläutert sowie die technische Umsetzung dargestellt. Ergänzt wird das Kapitel um die allgemeine Beschreibung des Prozesses bei der Nutzung des eCall im Notfall sowie die dabei genutzten Daten.
Das nachfolgende Kapitel 3.) thematisiert die Frage, was mit den Daten bei der Nutzung geschieht, welche Risiken die Kritiker des eCall sehen und wie der Prozess des eCall die Datenschutzanforderungen realisiert.
Das Kapitel 4.) schließt diese Arbeit mit einem Fazit ab und bietet einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Themas Automotive Services und Datenschutz.