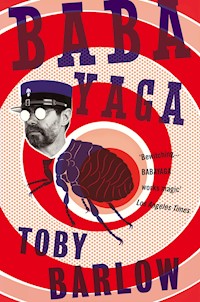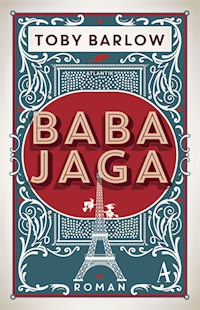
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine schöne russische Hexe und ein Werbetexter, der eigentlich CIA-Agent ist - eine abenteurliche Liebe im Paris der fünfziger Jahre Will, ein liebenswürdiger junger Amerikaner, unterhält für die CIA eine Werbeagentur als Briefkastenfirma - doch leider ist er mit wichtigen Informationen allzu sorglos umgegangen und muss nun seinen ehemals so freundlichen Kollegen aus dem Weg gehen. Zoja, die seit Jahrhunderten kaum einen Tag gealtert ist, verdient ihren Lebensunterhalt damit, reichen Männern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Leider hat sie ihren letzten Liebhaber auf reichlich ungeschickte Weise umgebracht, und Charles Vidot, ein hart arbeitender Polizist mit Intuition, schöpft Verdacht - und wird kurzerhand in einen Floh verwandelt. Doch dann begegnet Zoja Will und ist von seinem Charme und seiner Naivität bezaubert. Zum ersten Mal in ihrem langen Leben verliebt sie sich. Aber die CIA kommt ihnen in die Quere, sie werden in wilde Abenteuer verstrickt, während die Polizei sich mit rätselhaften Verbrechen konfrontiert sieht - bis ganz Paris kopfsteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 723
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Toby Barlow
Baba Jaga
Roman
Aus dem Amerikanischen von Giovanni und Ditte Bandini
Atlantik
Der Mann jagt und kämpft. Die Frau heckt aus und träumt; sie ist die Mutter der Phantasie, der Götter. Sie hat ein Auge für das Zweite Gesicht; und sie hat Flügel, sich aufzuschwingen in die Unendlichkeit der Sehnsucht und der Vorstellungskraft. Um die Jahreszeiten besser zählen zu können, fragt sie den Himmel ab. Doch die Erde besitzt ebenfalls ihr Herz.
Jules Michelet
Die Frauen müssen den Männern immer bestätigen, dass sie die Starken sind. Sie sind die Großen, die Starken, die Wunderbaren. In Wahrheit sind die Frauen die Starken. Das ist nur meine Meinung, ich bin kein Professor.
Coco Chanel
Prolog
Es gibt Fakten, und es gibt Lügen. Es gibt treue Geliebte mit schlechten Alibis. Die Welt ist ein wimmelndes Bienenhaus, angefüllt mit Geschichten, die immer aufs Neue erzählt und wiedererzählt worden sind, seit unsere Zungen sprechen lernten und unsere Ohren sich auftaten. Wir hören all das und sind trotzdem ratlos, gerade eben imstande, im bleichen, unbeständigen Licht unseren Weg auszumachen. Wie der alte Grieche sagte: Wir wissen nichts. Aber das, kann ich Ihnen versichern, ist wahr, das ist passiert. Ich weiß es, weil meine ältere Schwester mir Ende letzten Herbstes in einem Brief davon schrieb – davon, wie in einem Tal unweit der Nordgrenze Frankreichs hinter den hohen Mauern eines versteckten, verfallenden Schlosses eine angejahrte Frau ihre alte Gitarre hervorholte und, sanft darauf zupfend, um die Melodie zu finden, der Nacht ankündigte: »Ich werde dir jetzt ein Lied singen von den Baba Jagas und davon, wie sie nach Paris flohen …«
Erstes Buch
Als ich in Paris lebte, hatten wir einen Ausdruck, einen sehr amerikanischen, der die Sache in gewisser Weise besser als alles andere erklärt. Wir sagten damals: »Nehmen wir die Spur auf!« Das bedeutete, sich kopfüber reinstürzen, ins Unbewusste eintauchen, einfach seinen Instinkten gehorchen, seinen Impulsen folgen – des Herzens oder des Bauches, oder wie immer man das nennen will.
Henry Miller in:The Paris Review
I
Die Zeit machte Zoja zu schaffen. Sie lag auf dem breiten Bett inmitten der zerknitterten Seidenlaken und hörte Léon dabei zu, wie er sich im Bad schrubbte und wie er gurgelte. Da komponierte sich aus den verschiedenen Geräuschen seiner Abendtoilette fast eine Trickfilmmelodie. Er wusch sich immer, nachdem sie sich geliebt hatten, und parfümierte sich aufs Penibelste – tauchte ein in Seifenschaum, Talkumpuder und eine Wolke von Eau de Lisbonne, bevor er heimkehrte, um sich seiner Frau zu stellen. Selbst an Abenden wie diesem, wo seine Claudette nicht in der Stadt war, verrichtete er, aus Gewohnheit, das Ritual. Gewöhnlich störte das Zoja nicht, aber heute Abend machte die Musik sie traurig.
Als er von Dampfschwaden umgeben aus dem Badezimmer herauskam, sah er aus wie ein von einem Kessel ausgespiener grauer Ball von kochendem Blubber. »Stimmt etwas nicht, ma chérie?«, fragte er.
Sie erinnerte sich an den Tag, als er sie während eines Spaziergangs durch den Jardin des Plantes gefunden hatte. Wann hatten sie sich noch mal kennengelernt? Im Frühling ’45? Nicht lange nach Kriegsende, als die Pariser Straßen und Klubs vollgestopft waren mit großäugigen amerikanischen und britischen Soldaten, die, frisch dem Zug aus Calais entstiegen, überall Vergnügungen witterten. Sie hätte sich aus dem Schwarm jeden herauspicken können, doch sie nahm stattdessen Léon, einen stämmigen Pariser mittleren Alters mit kantigem Kinn und breiten Schultern, weit entfernt von dem erschlafften dicken Mann, zu dem er inzwischen geworden war. Viel Zeit war vergangen, während der sie zugesehen hatte, wie seine Umrisslinie nachließ und von massig über rundlich zu fett absackte, seine Augen sich trübten, seine leuchtend blauen Iriden sich zu einem fleckigen Grau verfärbten, blutunterlaufen unter den schweren Lidern und verquollenen Säcken von weingetränktem Fleisch. Wenn er von Brandy betrunken war, erzählte er ihr gern, dass er früher, in seinen Tagen als katholischer Zögling, ein überragender Athlet gewesen war, aber wenn sie ihn jetzt ansah, fiel es ihr schwer, sich das vorzustellen, denn er war einfach ein alter Mann, während sie selbst noch so frisch aussah wie an dem Tag, an dem sie sich zum ersten Mal begegnet waren.
»Ich habe leichte Kopfschmerzen, ich brauche frische Luft«, sagte sie. »Warum ziehst du dich nicht an, und wir machen einen Bummel, bevor du nach Hause gehst?«
»Zu dieser Uhrzeit? Ha! Habe ich dich noch nicht erschöpft?« Als er sich den Rücken mit dem Handtuch abrieb, wackelte sein gewaltiger weißer Bauch. Der Anblick war fast zu albern.
»Ich habe den ganzen Tag geschlafen«, sagte sie. »Es ist ein angenehmer Abend, und es wird dir guttun, deine Knochen zu bewegen.« Sie ließ den Blick durch das Zimmer schweifen – über die hohe Kommode, den schlichten Kristallkronleuchter, das gerahmte dunkle Ölbild mit dem toten Fuchs inmitten reifer Herbstäpfel, das über ihrem kleinen Schreibtisch hing. Auch wenn das Gemälde jetzt einen rein dekorativen Zweck erfüllte, konnte sie sich durchaus an die Zeit erinnern, als Stillleben mit vollgehäuften Schüsseln von errötenden Früchten während der tristen Jahreszeiten des kalten Kohls und der Kellerkartoffeln grüne Hoffnungsknospen am Leben erhalten hatten. Schau her, sagten die Bilder, und verliere nicht den Glauben. Birne, Pfirsich, Apfel und Pflaume, alle werden wieder blühen.
Neben dem Gemälde standen, auf dem Kaminsims, drei zusammengehörige Silberuhren. Léon hatte ihr erzählt, dass sie aus der Sammlung Prinzessin Mathildes stammten. Zoja wusste nicht, ob sie ihm das glauben sollte – ihr eitler und aufgeblasener Léon tendierte fraglos zur Übertreibung. Aber sie genoss durchaus die Behaglichkeit, die jeder dieser kunstvoll gestalteten Zeitmesser spendete. Eine der Uhren zählte außer den Stunden auch die Monate, eine andere gab die Mondphasen an, und die dritte war eine astronomische Uhr, die anzeigte, wie sich der Tierkreis im Laufe des Jahres über den Stunden weiterdrehte. Bei Tag und bei Nacht verliehen die leisen, sanften Glockenspiele dem stillen Appartement eine bezaubernde Note, erdeten Zoja in ihrer gut ausgestatteten Umgebung und verschafften ihr mit ihren zarten Tönen immer wieder eine kleine Freude. Im Lauf der Jahre hatte Léon sie periodisch mit diesen kostbaren Präsenten beschenkt, dazu mit Parfüms, Perlen, Pendants, Fuchsstolen und weichen Lederhandschuhen, hatte ihre anspruchslose Geduld, ihre nachsichtige gute Laune und ihre großzügigen körperlichen Aufmerksamkeiten mit Luxusartikeln vergolten, die sie beschwichtigt und es mit der Zeit fast geschafft hatten, sie das, was bevorstand, vergessen zu lassen. Doch allzu fern war ihr der Gedanke nie. Sie wusste, dass ihr all diese zarten, schönen Schätze fehlen würden; viel würde sie nicht mitnehmen können. Wie für die Sommervögel, die instinktiv die Zweige der Pariser Bäume verließen und sich auf den Weg zu ihren warmen mediterranen Zufluchtsorten machten, war es jetzt auch für sie Zeit zu gehen. Der Fluss der Zeit rauschte ihr bereits laut in den Ohren, schäumte und wallte und spülte das ganze Zimmer fort.
An jenem längst vergangenen ersten Tag hatte sie mit Elga zusammengesessen; die vierschrötige alte Frau war mit halbgeschlossenen Augen eingenickt und sackte immer mehr in die Parkbank, wie ein dickes Plunderstück, das in einem Bäckereiregal abkühlt, während Zoja sich mit einem Roman entspannte. Sie versuchte sich zu erinnern, von wem er gewesen war, mit Sicherheit von einem Russen, Gogol oder Turgenjew. Damals waren sie noch nicht lange in Paris gewesen. Sie erinnerte sich sehr deutlich daran, wie der Schatten über ihre Buchseite gezogen war und dass sie aufgeschaut und Léon erblickt hatte, der da grinsend im Abendlicht stand. Zoja hatte höflich gelächelt. Sie schüttelte die Erinnerung ab und erhob sich vom Bett. »Es ist unser letzter gemeinsamer Abend, bevor deine Claudette in die Stadt zurückkehrt, ich möchte ein Stück mit dir gehen. Keine Sorge, niemand wird uns sehen.« Léon war immer leicht zu durchschauen, spielend zu leiten. »Komm«, sagte sie und warf ihm sein Hemd zu, das auf dem Bett gelegen hatte. »Wir können unten am Fluss entlanggehen. Du kannst mir auf dem Hinweg von deiner Woche erzählen, und ich erzähle dir auf dem Weg zurück ein altes Märchen.«
Er lächelte. Wie jeder Mann, den sie je gekannt hatte, liebte ihr Léon ihre Geschichten, die alten russischen Sagen, die sie ausspann, um ihn zum Grinsen oder zum Lachen, oder zum Schlafen zu bringen. Viele waren ausgedacht, während andere wahr waren, manche waren zotig, andere blutrünstig, aber sie kleidete sie alle in die samtene Wärme von Volksmärchen ein. Jede von ihnen enthielt eine Lehre, die der Aufmerksame und Neugierige entdecken konnte, aber sosehr Léon die Abenteuer verirrter Kinder und schellenklingelnder Tanzbären, durchnässter, hungriger Soldaten, die in einsamen Häuschen eine trügerische Zuflucht fanden, und von Bräuten mit schlangendurchflochtenem Haar auch genoss, bemühte er sich doch nie, die jeweilige Moral der Geschichte zu verstehen. Nur wenige ihrer Männer hatten das je getan. Sie war zu der Überzeugung gelangt, dass Märchen und Fabeln und selbst Sagen äußerst wenig ausrichteten – die Lehren hatten einfach nicht den nötigen Biss, um hängenzubleiben.
Léon würgte sich die Hose um die ausladende Leibesmitte, streifte sich die Hosenträger über die Schultern und rückte seinen steifen Kragen gerade, während sie ihrerseits Unterkleid, Strümpfe und Kleid auflas. Es war ein schöner, untypisch warmer Herbstabend; die Jahreszeit ließ es langsam angehen, aber dennoch wäre sie eigentlich lieber zu Hause geblieben. Hätte er nur nicht diese scheinbar harmlose Frage gestellt! – erst vor wenigen Augenblicken, während er neben ihr lag und noch immer schwer atmete: »Wie machst du es nur, dass du so jung bleibst?«
Ein inneres Stimmchen ließ ihr keine Ruhe, drängte sie, die Sache zu vergessen und zu warten. So unsensibel, wie er war, wusste er vielleicht gar nicht, was er bemerkt hatte. Sie konnten noch ein paar Nächte, vielleicht sogar noch zwei, drei Monate lang beieinanderliegen, und sie konnte sich, und wenn auch nur noch ein paar Morgen lang, sein fettes Schnarchen anhören, wie es gurgelte und schnaubte – was sie liebenswert fand. Wozu die Eile? Schließlich war es nur eine hingemurmelte Phrase gewesen, eine Après-Sex-Liebenswürdigkeit. Sie hätte ihn dazu bringen können, diese Feststellung zu vergessen, aber wozu? Sie wusste ja, mit der Zeit würde ihm immer mehr auffallen. So dumm war selbst ein blöder, aufgeblasener Ochse wie Léon nicht. Was einmal ungeschickte Komplimente gewesen waren, würde jahrelang nachhallen und sich schließlich zu einem klügeren, konkreten Verdacht bündeln. Er würde erkennen, dass seine Schmerzen nicht die ihren waren, sein verschwommener, milchiger Blick würde missgünstig auf ihre klaren, reinen Züge, ihre weiche Haut und stets scharfsichtigen Augen hinunterschauen, und dann würde sich ein untergründiger, seismischer Groll seines zähflüssigen Bewusstseins bemächtigen. Von dem Moment an würden sich bestimmte vorhersagbare Schwierigkeiten einstellen. Nein, es bestand zwar kein Grund zur Eile, aber es war trotzdem besser, es jetzt zu erledigen. Wie Elga häufig sagte: Reiß das Auge, das dich ärgert, aus, bevor es wieder zuckt.
»Guten Tag, Mademoiselle«, waren die ersten Worte, die Léon an jenem lang vergangenen Tag – mit einer leichten Verbeugung und an seinen Strohhut tippend, ganz der Gentleman – zu ihr gesprochen hatte. Die grüne Pracht des sommerlichen Gartens rahmte seinen Körper ein, sodass er im Zwielicht wie eine extravagant geschnittene Buchsbaumhecke aussah, die vor ihren Augen zum Leben erwachte. Was sie, als sie den Unbekannten taxierte, als Erstes wahrnahm, war Geld – sie besaß ein vielfach erprobtes Talent dafür, so etwas zu erspüren. Und noch besser: Sein plattes, dumpfes Grinsen verriet einen Mann ohne große Befähigung zum Staunen oder selbst nur zur Neugier. Er fasste die Dinge so auf, wie er sie sah, und er sah nicht besonders viel. Das war ideal. Hinzu kam eine grinsende Gutartigkeit und, seinem begierigen Blick nach zu urteilen, ein herzhafter Appetit. Und für hungrige Männer hatte sie etwas übrig.
»Meine Liebe«, sagte Léon heute Abend, »du bist wirklich schön.«
Jetzt umarmte sie ihn, schlang ihre Arme um seinen weiten Wanst und schmiegte den Kopf an seine weiche Schulter. Wäre er ein sensibler Mann gewesen, hätte er vielleicht ihre tiefer werdende Traurigkeit gespürt. Aber er war keiner. Von Dienstboten aufgezogen und von der rohen, patriarchalischen Gewalt der Konfessionsschulen konditioniert, hatte er vor ihr Intimität nur in einer klug arrangierten Ehe kennengelernt, und das alles hatte ihm die emotionale Empfindungsfähigkeit eines alten, abgehalfterten Arbeitspferdes gelassen.
Als sie sich zur Tür wandten, warf sie einen Blick auf ein gerahmtes Bild auf dem Kaminsims. Es war die einzige Fotografie von ihnen beiden, die überhaupt existierte; sie hatten sie gemacht, als sie wieder einmal auf einem Abendspaziergang gewesen und zufällig in ein Straßenfest geraten waren. Als sie an Pantomimen und Zauberkünstlern, Leierkastenmännern samt Äffchen, Flohzirkussen und behänden Jongleuren vorüberschlenderten, hatten sie ein Fotoatelier entdeckt. Vom Geist der Ausgelassenheit gepackt, hatte Léon seine gewohnte Vorsicht aufgegeben und eingewilligt, sich mit ihr fotografieren zu lassen. Auf dem Porträt, das vor einem grausamtenen Hintergrund aufgenommen worden war, hielt sie sittsam seine Hand, das schwarze Haar unter einen Hut gesteckt, ihre Augen mit offensichtlicher Zuneigung zu ihm aufschauend. Er stand neben ihr, steif aufgerichtet, und grinste in die Kamera wie ein Großwildjäger, der das Gehörn der einen oder anderen prächtigen, toten Beute hochhält.
Léon war so ein komischer Mann, dachte sie, überhaupt nicht mutig (er hatte sich vom Kriegsdienst freigekauft), aber durchaus gutartig. Ein Ehebrecher, ein Lügner, ein diebischer Mann, der seine Klienten auf ungeschickte Weise betrogen und sich anschließend die Probleme mit Geld vom Hals geschafft hatte – das alles war er, aber dies waren eben die Altlasten der meisten reichen Männer, mit denen sie je zu tun gehabt hatte. Sie hatte ihm viel gestohlen, sie hatte anderen viel gestohlen, und wer weiß schon, wann der erste Diebstahl geschehen war? Nur wenige Menschen, die je eine Münze berührt haben, sind rein oder unschuldig. Aber für einen Mann hatte er ein anständiges Herz. Sie wusste, dass sie jetzt, in diesen letzten Augenblicken, sentimental wurde, ihn sich besser machte, als er war. Sie war wie die Bauerntochter, die liebevoll die süßen, wohlbeleibten Schweine betrachtete, die sich am Morgen der Winterschlachtung grunzend im Schlamm suhlten. »Vergiss nicht, das Licht auszuschalten«, sagte sie.
Einige Zeit zuvor hatten sie durch das offene Fenster ein Geräusch wie von fernem Feuerwerk gehört, aber jetzt lagen die Straßen still da. Sie schlenderten die Rue d’Ulm entlang. Die Märkte waren geschlossen, die Bistros menschenleer, einige wenige Automobile knatterten vorbei. Sie hielt seine Hand, strich sanft mit dem Daumen über seinen fleischigen Ballen. Sie fragte sich, ob sie ihn eigentlich je geliebt hatte.
Sie bogen in die Rue Erasme ein. Léon beklagte sich, wie so oft, über seine steinalte Mutter, für ihn eine ständige Quelle der Frustration. Zoja hatte die Frau nie getroffen, aber Léon zeichnete das Bild einer gestrengen Erzeugerin, die ihren jüngsten Sohn nie anerkannt, einer eiskalten Kreatur, die stets seinen älteren Bruder vorgezogen hatte. »Für mich hat sie nur die Milch der bittersten Gehässigkeit übrig.«
Zoja hörte nur zerstreut zu. Sie versuchte, sich eine undeutliche Sammlung von Wörtern ins Gedächtnis zu rufen, während ihre Augen umherhuschten, die Schatten entlang des Trottoirs nach einem lanzenspitzigen Gitter absuchten, an das sie sich erinnerte. Es würde sich bestens dazu eignen, seinen Schädel aufzuspießen.
II
Will Van Wyck bemühte sich halbherzig, Monsieur Guizot zuzuhören, aber seine Gedanken schweiften ab. Er versuchte sich darüber klar zu werden, wie sein Leben von nun an aussehen würde. Ihm war bewusst, dass dies kein günstiger Zeitpunkt zum Zerstreutsein war, er musste sich konzentrieren, besonders auf das, worüber sich Guizot momentan verbreitete, denn der kleine Menschenball, der da vor seinem Schreibtisch herumfederte, war genau an dem Tag zu Wills allerletztem Kunden geworden.
An diesem selben Vormittag hatte Will noch zwei Kunden für die Agentur betreut, während er achtzehn Monate zuvor für jeden einzelnen Kunden der Firma persönlich verantwortlich gewesen war. Aber im Laufe der Zeit hatten die französischen Geschäftsführer seinen Tätigkeitsbereich in der Firma langsam, geschickt, mit stets tadelloser Höflichkeit mehr und mehr eingeschränkt. Sie lächelten immer, wenn sie ihm weitere Kundenetats aus der Hand nahmen, und es geschah stets während eines drei- oder viergängigen Menüs bei Fouquet bei ein paar guten Flaschen weißem Burgunder. Aber sosehr sie es auch versuchen mochten – und sie versuchten es durchaus –, gelang es ihnen doch nicht, ihn vollständig auszubooten. Die Zentrale drüben in den Staaten wollte, dass er in der Pariser Niederlassung blieb und einen ganz besonderen Kunden betreute, und genau das hatte er die ganze Zeit getan, ohne je ein Wort der Klage und mit kaum einem verpassten Abgabetermin. Er hatte sich ohne jedes Aufhebens den plumpen und offenkundigen machiavellistischen Manövern seiner französischen Kollegen gefügt, hatte liebend gern Verantwortung abgegeben, wann immer Druck auf ihn ausgeübt wurde, weil er bis heute sicher gewesen war, dass sein wichtigster Kunde seinen Posten garantierte. Die einzige unerwartete Überraschung war die Treue seines anderen Kunden, Guizot, gewesen. Dieser emporgekommene Kleinunternehmer hatte seinen Kosmetikhandel erst ein paar Jahre zuvor angefangen – mit einer Badewanne voll heimgebrautem Haarwasser, das er unermüdlich verhökert hatte, bis sein Imperium ganz Westeuropa umfasste. Selbst bei dieser Größenordnung war sein Kundenetat kaum von entscheidender Bedeutung für die Agentur, anders als ihre Automobil-, Zigaretten- oder Spirituosenetats, und die Geschäftsführer grinsten und nickten, als er darauf beharrte, dass Will ihn weiter betreuen sollte. »Amerikaner wissen, wie man verkauft!«, hatte Guizot verkündet, und sie hatten ihm den Wunsch mit Vergnügen erfüllt, vor allem weil sie Guizot nicht ausstehen konnten.
»Obacht! Bumm! Ja! Peng! Unsere Kampagne überrollt das Land! Zeitlich perfekt abgestimmt, sodass sie unsere gesamte hirnlose Konkurrenz mit heruntergelassener pissfleckiger Unterhose erwischt!« Guizot war außerstande, seine Begeisterung zu zügeln, er sprang praktisch in Wills Büro herum. Er führte sich immer so auf, wenn sie eine Werbekampagne vorbereiteten. Will führte für ihn die Verhandlungen, entschied, welche Zeitungen und Radiosendungen sie einkaufen würden, während Guizot enthusiastisch das Produkt, das Kapital und selbst die Werbetexte beisteuerte, deren Abfassung er niemandem in der Agentur zutraute. »Was wissen diese Texter schon von Kunst oder Geschäften, was ich nicht wüsste? Wenn sie so großartige Schreiber sind, wo sind dann ihre Gedichte, ihre Literaturpreise? Und wenn sie so gescheit sind, warum ackern sie dann an ihren Schreibmaschinen, in meinen Diensten?« Normalerweise fand Will Guizots Affentheater amüsant, aber heute nicht.
»Wir werden die Gegenseite pulverisieren! Bam! Bam! Bam! Das ist ein echter Feldzug, keine Werbekampagne, sondern ein militärischer Feldzug, mit militärischer Präzision durchgeführt!« Mittlerweile schrie Guizot schon fast, seine Fäuste flogen blindlings durch die Luft, wie die eines weichgeklopften Boxers. »Sie werden uns nicht entkommen, wir haben sie im Visier! Denn sie sind unser – wie nennen Sie das noch mal, Will? Ach ja, ha, unsere ›Zielgruppe‹. Verstehen Sie, was ich meine? Sehen Sie da unser Zielobjekt, wie es arglos die neueste Ausgabe von Le Monde aufschlägt? Bam! Da sind wir! Krawumm! Das Zielobjekt schlägt die Bonne Soirée oder Vogue auf, aha! Rat-tat-tat! Und wenn es das Radio einschaltet, ah, Will, da wird unsere geheimste Geheimwaffe entfesselt! Ja, haha, unsere süße, unschuldige Kleinmädchenstimme wird seine Widerstandskraft zermürben, es einsaugen mit ihrem Lied: ›Verscheuche deine Pickel. Verscheuche deine Pickel. Ah haha, ah haha …« Jetzt tanzte er schon, hüpfte und klatschte sich rhythmisch gegen die Schuhsohlen, während er sein selbstkomponiertes Werbeliedchen zum Besten gab. Will starrte ihn ausdruckslos an, praktisch taub, während seine Gedanken noch immer um ein ganz anders verlaufenes Kundengespräch kreisten, das er erst vor wenig mehr als einer Stunde über sich hatte ergehen lassen müssen.
Das vorherige Meeting war viel leiser, fast zu ruhig verlaufen, und sein amerikanischer Kunde, Brandon, hatte in viel vernünftigerem Ton gesprochen. Brandon hatte versucht, nonchalant zu klingen, alle Fakten vollkommen plausibel und logisch klingen zu lassen. Es war eine Veränderung, wie sie eben vorkommen kann, erklärte Brandon, die Prioritäten ändern sich einfach. »Hören Sie, Van Wyck. Ich selbst bin darüber auch nicht glücklich, aber davon geht die Welt nicht unter. Man hat doch Kunden für Sie in Chicago, richtig? Da kommen Sie doch ursprünglich her, stimmt’s?«
»Ich bin aus Detroit.«
»Perfekt, sehen Sie? Nehmen Sie dort einen Job an. Die Etats der Automobilbranche sind beachtlich.« Brandon hatte sich in seinem Sessel zurückgelehnt; es war so, als unterhielten sie sich über ein Baseballspiel oder einen Boxkampf. Seine Zuversicht tröstete Will nicht. Bevor man sie ihm abgenommen hatte, waren Wills Pariser Kunden immer ziemlich respektvoll gewesen. Nicht alle verehrten ihn geradezu, wie Guizot es tat, aber im Allgemeinen glaubten sie doch alle, dass sie von der amerikanischen Werbeindustrie etwas lernen könnten, also hörten sie sich aufmerksam an, was Will zu sagen hatte. Aber da er selbst aus den Staaten kam, hatte Brandon, mit seiner schnöseligen Ostküstenart und der krummen Nase, die er sich beim Footballspielen auf der renommierten Brown University verdient hatte, Will stets so behandelt, als sei er nur wenig mehr als ein unbedarfter Erstsemester, den man beliebig schikanieren oder mit Charme blenden konnte, je nach augenblicklicher Laune. »Ihr habt doch AMC, Chrysler, GM und Ford, stimmt’s? Da werden andere Spielregeln gelten, sicher, aber Sie werden prima klarkommen. Heiraten Sie ein Mädchen aus Michigan und kaufen Sie sich ein hübsches Haus im Grünen. Die haben tolle Vororte dort. Und in einen Vorort werden Sie schon müssen. Die Stadt haben die Nigger vereinnahmt. Aber das wissen Sie ja vermutlich selbst.«
Will hatte Schwierigkeiten damit, die Neuigkeit zu verdauen. Er griff nach einer Zigarette. »Wie lange genau, bis die Aufträge auslaufen?« Brandon zuckte mit den Schultern. »Bis nach der Wahl. Bevor Ike draußen ist, passiert nichts. Bringt nichts, vorher den Stecker zu ziehen. Aber egal wer gewinnt, selbst wenn es Nixons Köter wäre, diese Umorientierung wird kommen. Hier spielt sich einfach nichts mehr ab. Die Regierung verlagert ihre sämtlichen Investitionen nach Asien. Alle unsere Etats wandern dorthin aus.«
»Sie werden ebenfalls versetzt?«
»Ich?« Von Wills Frage überrascht, produzierte Brandon ein komisches Lächeln. »Die möchten gern, dass ich mit ihnen nach Süden ziehe, aber ich würde es lieber vermeiden. Ich bastel gerade an einem Projekt, das mich wenigstens ein bisschen länger hier halten könnte, aber es wird keinerlei Werbemaßnahmen einschließen. Ich würde sagen, Sie haben noch ein Jahr, maximal. An Ihrer Stelle würde ich schon jetzt anfangen, Pläne zu machen. Schadet nie, vorbereitet zu sein.«
Will hatte sich im Zimmer umgesehen. Er war einunddreißig Jahre alt, mit einem Eckbüro in Paris. Er hatte hart gearbeitet, um es dorthin zu schaffen. Wenn er jetzt in die Heimat zurückkehrte, würde er als Zuarbeiter der alten Garde hängenbleiben. Er würde an einem Schreibtisch hocken und sich anhören müssen, wie die alte Garde endlos darüber dozierte, wie irgendwas gehandhabt wurde. Die alte Garde würde haufenweise langweilige Markterhebungen in Auftrag geben, bevor sie aufbrach, um ihre Kunden im Country Club zur Strecke zu bringen oder in einem Motel ihre Sekretärinnen zu vögeln. Und in zwanzig Jahren würde er, wenn er Glück hatte, selbst zur alten Garde gehören. »Mist!«
Seine Assistentin, Madame Beloc, steckte den Kopf durch die Tür. »Monsieur Guizot est arrivé.«
»Danke, wir brauchen nur noch eine Minute.«
»Il semble très impatient.«
»Das ist bei ihm nichts Neues«, sagte Will. Sie ging wieder, und Will sah Brandon an. »Ich muss mich jetzt wohl entschuldigen. Wie es aussieht, wartet ein richtiger Kunde auf mich.«
»Ach, was soll das denn heißen«, lachte Brandon. »Ich bin ein richtiger Kunde. Wir zahlen euch Burschen gutes Geld. Wenn ich bloß eine Idee hätte, wie ich Sie weiter bei den Fleischtöpfen halten könnte, würde ich’s tun, glauben Sie mir. Aber sie wickeln diese Sparte ab, und der Kram, mit dem ich mich jetzt abgebe, ist etliche Nummern zu groß für Sie. Sie können froh sein, es ist mörderisch, ein 24-Stunden-Tag.« Brandon schnippte mit den Fingern. »Oh verdammt, da fällt mir ein, hier« – er griff in seine Westentasche und zog zwei Eintrittskarten heraus –, »ich wollte eigentlich bei diesem Empfang heute Abend im Hôtel Rothschild vorbeischauen, aber ich kann nicht. Die Eintrittskarte gehört Ihnen, wenn Sie sie wollen. Es ist an der Rue Balzac, nur ein paar Häuserblocks von hier. Alle Getränke frei, und ich wette, der Sprit wird von der guten Sorte sein. Gehen Sie sich besaufen, nehmen Sie ein Mädchen mit oder lernen Sie dort eins kennen, oder noch besser, lernen Sie dort zwei Mädchen kennen.« Brandon lachte über seinen eigenen Witz, während er zum Gehen aufstand. »Mal ernsthaft, Sie hatten doch nicht geglaubt, es würde ewig so weitergehen, oder? Und jetzt geben Sie mir den Bericht, damit ich meinen Leuten zeigen kann, dass Sie noch immer mit dem Herzen dabei sind.«
Will händigte ihm die Rhône-Poulenc-Akte aus. Penibel zusammengestellt, enthielt die Akte eine Zusammenfassung der Expansionspläne des Chemie- und Pharmaunternehmens, dessen Zulieferer und dessen Bilanz, dazu eine gesonderte Analyse, die die gegenwärtigen Beziehungen des Unternehmens zu den verschiedenen Waffengattungen der französischen Streitkräfte aufschlüsselte. »Sieht so aus, als hätten Sie alles abgedeckt.«
»Das tun wir immer.«
»Haben Sie sonst noch was für mich?«, hatte Brandon gesagt.
Will zuckte leicht zusammen; in letzter Zeit wollte Brandon dauernd mehr. Früher war er vollkommen zufrieden gewesen mit einem monatlichen Bericht über alles, was Will interessant fand. Diese Berichte benutzten die Amerikaner dazu, Europa im Auge zu behalten. Wills übrige Kunden hatten keine Ahnung, dass die Geschäftsgeheimnisse, die sie ihrer Werbeagentur anvertrauten, an eine fremde Regierung weitergegeben wurden, und sie wären mit Sicherheit nicht glücklich gewesen, hätten sie etwas davon erfahren. Die Zentrale schaffte es gut, dies geheim zu halten, selbst vor der Geschäftsführung der Pariser Filiale. Deswegen hatten sie Will die letzten paar Jahre lang dort behalten. Er war der Einzige, der genau wusste, wozu die Berichte dienten und wer sie erhielt. Er wusste, dass er diese Firmen, schlicht gesagt, für Brandon ausspionierte. Das störte ihn nicht, da es sich überhaupt nicht kriminell anfühlte. Die Akten enthielten nichts als die nackten Daten, Berichte über Rohstoffpreise, geschätzte Produktionszyklen, Versorgungsstände und Versandanalysen. Sie mochten einen Einblick in die Expansion eines Mischkonzerns geben oder in neue Geschäftsbeziehungen, die ein Bankunternehmen in Erwägung zog. In letzter Zeit aber waren Brandons Anfragen immer häufiger geworden und hatten sich grundsätzlich auf pharmazeutische, Chemie- und medizintechnische Unternehmen bezogen. Allein in den letzten sechs Wochen hatte Will Brandon Einschätzungen fünf verschiedener Firmen abgegeben, und zwei weitere Berichte hatte er in der Mache. Normalerweise hätte es ihm nichts ausgemacht, aber es erschien ihm nicht richtig, dass Brandon hereinspaziert kam und Will praktisch feuerte – und gleichzeitig solche Ansprüche stellte. Trotzdem, der Kunde war König. »Nächste Woche habe ich den Bericht über Bayer fertig«, sagte Will.
»Prächtig, nur immer weiter her damit« – Brandon lächelte –, »zumindest bis wir das Licht ausdrehen. Sie wollen doch bestimmt nicht die Central Intelligence Agency anpissen, korrekt?«
Will nickte. »Korrekt.« Die Vorstellung, wieder in die USA zurückzugehen, deprimierte ihn so sehr, dass er nicht einmal aufsah, als Brandon den Raum verließ.
Als er jetzt darüber nachdachte, begriff Will, dass dies seine letzte Karte war; er hatte nicht mehr genügend Material, um seinen weiteren Verbleib in Paris zu rechtfertigen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er einen dieser neuen Transatlantikflüge der TWA zurück in die Staaten buchen müsste. Paris hatte einfach so viele Reize, von den hellen Lichtern der Brasserien über die kreischenden Papageien auf dem Vogelmarkt bis hin zum grünen Ausblick von Montparnasse aus. Natürlich gab es außerdem noch die pastellgelb-und-rosa berockten Mädchen, die so lecker wie Sahneschnittchen aussahen, wenn sie mit ihren Büchern unter dem Arm zur Sorbonne schwärmten, und es gab diesen knubbeligen kleinen Bovist von einem Mann, der gerade von Pickeln sang und in Wills Büro herumtanzte. Während er Guizot dabei zusah, wie er durch die Gegend dotzte, wurde Will bewusst, dass er jeden einzelnen Tag, den er in dieser Stadt verbracht hatte, genossen, ausgekostet und zelebriert hatte – und dass es jetzt damit offenbar vorbei war. »Scheiße«, sagte er.
Guizot blieb stehen und hob die Hände in die Höhe. »Jetzt kommen Sie, es ist ein gutes Lied!«
III
Kommissar Vidot stand in der schön möblierten Wohnung herum und kam sich mies vor. Verbrechen waren immer schlimm, und allzu oft waren sie tragisch, abscheulich und durch und durch grauenvoll, und dennoch: Wann immer sie besondere oder ungewöhnliche Umstände aufwiesen, spürte Vidot unweigerlich ein wundersam köstliches Gefühl in seinem Herzen aufwallen, eine wonnevolle Empfindung, die an einen leichten Schwindel grenzte und ihm fast jedes Mal ein extrabreites Lächeln ins Gesicht zauberte. Es war eine blamable Angewohnheit, gegen die er lange angekämpft hatte. Er leitete sie aus der Tatsache ab, dass er schon seit seiner Kindheit einen Riesenspaß an Rätseln, Rebussen, Puzzles, Anagrammen, Wortspielen und Scharaden hatte. Die klassischen Kriminalgeschichten um Dupin, Sherlock Holmes und Inspektor Lecoq hatten den Initialfunken zu seiner Berufswahl geliefert. Seitdem er aber tatsächlich Kriminalbeamter war, zeitigte dieses Lächeln beklagenswerte Folgen, insbesondere wenn seine Amtspflichten die Vernehmung trauernder Hinterbliebener, Nachbarn oder traumatisierter Kollegen einschlossen. Allzu oft war ihm dieses lausbubenhafte Grinsen herausgerutscht und hatte die betrübten Seelen derer, die er gerade befragte, in einen Zustand noch desperaterer Verzweiflung gestürzt. Anrufe waren getätigt, Beschwerden eingereicht worden, und jahrelang hatte er darum gerungen, es aus seinen Zügen zu verbannen und nach Möglichkeit teilnehmender, mitfühlender zu wirken. Doch das kleine Lächeln schlich sich jedes Mal wieder auf seine Lippen und tanzte um seine Mundwinkel, spitzbübisch, fast wie ein nervöser Tic.
Nur gut, dass gerade keine Freunde oder Angehörigen des bedauernswerten Opfers zugegen waren, denn dieser spezielle Fall ließ ihn schon seit dem allerersten Augenblick von einem Ohr zum anderen grinsen.
Auf dem Hügel, der sich im 5. Arrondissement erhob, unweit der Rue Mouffetard, hatte einst, vor langer Zeit, an der Rue Rataud ein hohes spitzenbewehrtes Tor gestanden, das die keuschen, frommen Nonnen, die in dem Kloster lebten, schützte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war das Leben in der Stadt zu chaotisch geworden, also waren die Nonnen ausgezogen, und das Tor war fast vollständig abgerissen worden. Aber aufgrund einer Reihe von Meinungsverschiedenheiten zwischen den beauftragten Abbrucharbeitern, durchweg Anhänger des Protosozialisten Saint-Simon, und den konservativeren katholischen Buchhaltern waren die Arbeiten nie richtig abgeschlossen worden. Der Torbogen war intakt geblieben, er wölbte sich über den Torweg, während sich die scharfspitzigen, schweren nach unten gebogenen Spieße, die ihn bekrönten – primitive Vorläufer des modernen Stacheldrahts –, bedrohlich in Richtung Kopfsteinpflaster krümmten. Ebendort hatte man am frühen Montagmorgen den Leichnam Léon Vallets aufgefunden, herabhängend und durch Schädel und Hals aufgespießt. Blut war über die Wand und die Katzenköpfe gespritzt, wie verschüttete Tünche.
»Wie ist er bloß da hochgekommen?«, war die erste Frage gewesen und die naheliegendste geblieben. Es gab darauf keine überzeugende Antwort. Ein Polizist hatte spekuliert, der Mann sei irgendwie vom Nachbarhaus gestürzt, aber Vidot sah, dass das unmöglich war. Die Haken wiesen ja nach unten, Léon Vallet musste also aufwärts in sie hineingestoßen worden sein. Das kleine Team, das den Tatort untersuchte, stellte mehrere Theorien auf. Vielleicht hatte er auf einem hohen Laster gesessen, der durch das Tor gefahren war. Aber Lastwagen fuhren nicht durch diese engen Straßen, und abgesehen davon – was hätte ein erfolgreicher Finanzmann auf so einem Laster zu suchen gehabt? Hatte er etwa eine Heuwagenfahrt unternommen? Nein, nein. Vielleicht hatte ihn eine Explosion nach oben geschleudert? Das war leicht zu widerlegen gewesen, da es keinerlei Verbrennungsspuren gab, weder am Leichnam noch auf dem Pflaster darunter.
»Hat jemand angegeben, ungewöhnliche Geräusche gehört zu haben?«, fragte Vidot.
»Nein«, sagte ein Streifenbeamter. »Wir haben in der Nachbarschaft gefragt. Es hieß, es sei eine ruhige Nacht gewesen.«
Vidot nickte. Er sah auf die Leiche, die jetzt auf der Straße lag. Das Team hatte über eine halbe Stunde gebraucht, um das Opfer loszuhaken und vorsichtig herunterzulassen. Es war unglaublich, dass Schädel und Hals überhaupt stabil genug gewesen waren, um dieses gewaltige Gewicht zu tragen. Vidot hätte angenommen, dass die Schwerkraft den Rumpf vom Haken herunterreißen und den Inhalt des Körpers auf dem Pflaster verspritzen würde, während der aufgespießte Kopf allein oben blieb, aber andererseits, sagte er sich, ist die menschliche Anatomie eine zähe Angelegenheit, und Knochen hängen ebenso verbissen an Knochen, wie das Leben am Leben hängt.
Die folgenden zwei Tage vergingen mit dem üblichen Vorgeplänkel zur eigentlichen Ermittlung. Vallets Frau, Claudette, wurde über den Mord informiert. Sie war auf dem Land gewesen, im Château der Familie, und hatte erst bei ihrer Heimkehr von der Tragödie erfahren. Sie war gramgebeugt, und auch wenn sie eine Verdächtige blieb, hielt Vidot sie für keine besonders aussichtsreiche. Bei seiner einzigen Begegnung mit der Frau hatte er sie als kleines, mäusiges Wesen kennengelernt, das höchstwahrscheinlich schon vor kräftigen Sommerbrisen und Nachmittagsschatten erschrak – nicht gerade die Sorte, die zu solch einer makabren Tat fähig gewesen wäre. Erste, oberflächliche Recherchen hatten mittlerweile auf einen reichen Fundus an potenziell rachedurstigen Feinden hingedeutet, da sich herausstellte, dass Léon Vallet als Geschäftsmann nicht die größten Skrupel gehabt hatte.
Noch vielversprechender war die Entdeckung, die man bei Durchsicht seiner Kontoauszüge machte: Léon Vallet hatte Miete für ein Appartement bezahlt, das sich nur wenige Häuserblocks vom Tatort entfernt befand. Vidot machte sich in Begleitung von drei Polizisten auf den Weg in die Wohnung. Schon beim ersten Betreten der geräumigen Zimmer war klar, dass, wer immer dort gewohnt hatte, für die Dauer seines Aufenthalts gut versorgt gewesen war: Ölgemälde an den Wänden, teure Laken für das große Bett und in der Anrichte ein vollständiges Service aus feinem Wedgwood-Porzellan. Es interessierte Vidot nicht, dass Léon Vallet ein so behaglich ausgepolstertes Liebesnest gehabt hatte. Was Vidot interessierte, während er in der leeren Kommode schnüffelte und im kahlen Kleiderschrank stöberte, war die Tatsache, dass Léons Geliebte ausgeflogen war.
Er stand mitten im Schlafzimmer und erwog die verschiedenen Möglichkeiten, während die anderen Polizeibeamten die Haussuchung fortsetzen, unters Bett, hinter Sofakissen schauten, die Schubladen des kleinen Sekretärs herauszogen und die Wände des imposanten Kleiderschranks nach doppelten Böden abklopften. Lächelnd, so wie ein Junge, der gekitzelt wird, grinst, bevor er in Gelächter ausbricht, durchquerte Vidot das Zimmer und musterte einen silbernen Bilderrahmen. Er konzentrierte sich einen Moment lang auf das leere Innere des Rahmens, als prägte er sich Details eines Bildes ein, das nicht da war. Dann ging er einen Schritt weiter und richtete seine Aufmerksamkeit auf zwei Uhren, die nicht ganz in der Mitte des Kaminsimses hockten. Er ging so nah heran, dass seine Nase praktisch ihre Glasgesichter berührte, und deutete dann auf den breiten Zwischenraum zwischen ihnen. »Eine Lücke«, sagte er und wandte sich zu dem jungen Polizisten, der neben der Tür stand. »Sie da, wie heißen Sie?«
»Bemm, Monsieur le commissaire.«
»Schön, Bemm, ich möchte, dass Sie bei sämtlichen Pfandleihhäusern und Antiquitätenläden im Umkreis von fünf Kilometern nach einer Tischuhr fragen, ich vermute, dass es ein sehr seltenes Stück ist, das entweder dem Geschäft direkt verkauft oder in Kommission überlassen wurde. Und wenn die Besitzer in letzter Zeit keine hereinbekommen haben, bitten Sie sie bitte darum, die Augen offen zu halten. Deuten Sie an – aber versprechen Sie nichts! –, dass ihre Aufmerksamkeit sich auszahlen könnte.«
Dann ging Vidot in die kleine Küche. Als er hinter die Spüle schaute, sah er zu seiner Freude, dass die Beamten noch nicht in den kleinen Mülleimer geschaut hatten, der neben dem Spültisch an der Wand stand. Das war eine der Stellen, an denen Vidot am liebsten suchte. Die Leute machten sich tendenziell keine großen Gedanken um ihren Müll, und selbst die verschlagensten Verbrecher hatten die Angewohnheit, eine Fülle von nützlichem Material zu hinterlassen – Notizen, Briefe, in einem Fall sogar eine Einkaufsliste von verschiedenartigen giftigen Pharmazeutika. Im Abfalleimer entsorgte Indizien wurden von den Schuldigen fast immer vergessen, als ob jeglicher Müll in dem Augenblick, wo der Deckel zuklappte, dem Nichtsein anheimfiele. Vidot wusste es besser. Er hatte schon mehr als nur ein paar Nachmittage knietief in den Müllkippen und Deponien am Stadtrand verbracht und im Unrat nach klitschigen und verrottenden Beweisstücken geschürft. Er wusste, dass nichts wirklich je verschwand – es wechselte nur seine Form.
Er kippte den Inhalt des Mülleimers in die Spüle und begann, ihn zu durchforsten. Weder Post noch private Aufzeichnungen fanden sich darin, nur drei Eierschalen, ein paar ausgequetschte Zitronen, Fetzen von losgekratztem angebranntem Reis, die ungenutzten Enden eines Baguettes, Überreste einer Gurke, einer Zwiebel und Karotten-Abschabsel, ein Batzen schimmliger Käse und ein paar verschmutzte Seiten von Le Monde. Es gab auch ein paar Knochenfragmente, die er zunächst für Hähnchenreste hielt, obwohl sie rätselhafterweise in etwas eingebettet waren, das wie ein Klumpen faserigen Torfs aussah. Er löste diese Masse behutsam aus dem übrigen Unrat und legte sie auf die Arbeitsfläche.
Der Polizist, der gerade die Küchenschubladen durchsuchte, warf einen Blick über seine Schulter. »So was habe ich lange nicht mehr gesehen.«
»Was ist das?«, fragte Vidot.
»Wir haben früher im Wald danach gesucht, am Landhaus meiner Großeltern. Wir nannten sie Eulenklöten.«
Vidot grinste ihn an. »Eulenklöten?«
»Ja, das sind die Überreste von Mäusen, Ratten oder Kaninchenjungen, was immer die Eule erbeutet und verspeist hat. Die Eule stößt auf die Tiere nieder und verschlingt sie am Stück. Später würgt sie die unverdaulichen Bestandteile in rundlichen Ballen wieder aus. Das ist das, was Sie da haben, da würde ich drauf schwören.«
»Eulenklöten«, sagte Vidot, die Augen auf die Fragmente gerichtet, während er den Gedanken mit einem Gefühl köstlichen Erstaunens in seinem Kopf wälzte.
IV
Obwohl es fast zwei Monate her war, dass sie sich zuletzt gesehen oder gesprochen hatten, hatte keine von beiden viel gesagt, als die Jüngere plötzlich vor der Tür stand. Elga hatte sie hereingelassen und dann den Wasserkessel aufgesetzt. Zoja ließ ihr Gepäck fallen und humpelte zum Sofa. Bevor auch nur das Wasser kochte, schlief sie schon tief und fest. Während der nächsten paar Tage sagte die Alte wenig, sie kochte für sie beide und ging gelegentlich aus dem Haus, um Brühe für die Suppe und Eiswürfel für Zojas blaues Auge zu besorgen.
»Er hat dich geschlagen?«
Zoja schüttelte den Kopf. »Nein. Das hätte er nie getan. Die Worte haben ihn ausschlagen lassen, sein Schuh hat mich erwischt, während er in die Luft ging.«
»Er ist in die Luft gegangen?«
»Der Zauber ist schiefgelaufen. Über mir waren Eisenspitzen, die ich nicht gesehen hatte. Die Worte haben ihn dorthin gezogen. Ich hatte eigentlich ein Eisentor an der Ecke im Auge gehabt. Es ging ganz schnell, und er hat während des Flugs gestrampelt.«
»Wer kann’s ihm übelnehmen, wenn er gestrampelt hat? Niemand möchte sterben.« Elga nickte. »Hast du deine Wohnung leer geräumt?«
»Größtenteils, es war zu viel da, um alles mitnehmen zu können. Aber keine Angst, ich war gründlich genug. Ich habe einen Schrankkoffer aufgegeben und zum Gare de Luxembourg schaffen lassen, einen anderen hat das Taxi am Gare du Nord abgesetzt. Sobald ich eine Bleibe habe, lasse ich sie holen.« Zoja spürte, wie ihr Atem, der aus ihrem Körper kroch, sich erschöpfte. Vielleicht ging es zu Ende. Sie hätte nichts dagegen gehabt, ihre Knochen waren so müde. Ihr Magen fühlte sich so an, als gärte verrottendes Unkraut auf seinem Grund. Da tat sie es schon wieder – zählte auf die Geduld und Nachsicht dieser gebeugten, uralten Kreatur, die weder zur einen noch zur anderen neigte.
Ihr ging auf, dass die Dauer ihrer Aufenthalte bei der alten Frau im Laufe der Jahre, parallel zum Schwinden von deren Geduld, stetig abgenommen hatte. Vielleicht waren sie sich nach so langer Zeit endlich doch entwachsen. Aber sie wusste auch, dass sie die alte Frau als einen Teil ihres Lebens brauchte, ja sogar wollte. Sie waren, soweit sie wusste, die einzigen zwei Verbliebenen.
Früher hatte es auch andere gegeben, und nicht nur die Frauen, mit denen sie zusammen gereist waren, sondern noch weitere, die man auf frühmorgendlichen Märkten oder belebten Straßen gesichtet und mit Blicken und wissendem Nicken gegrüßt hatte, aber diejenigen, die sie mit Namen gekannt hatte, waren seit langem verschwunden, und keine neuen Gesichter waren aus der Menge hervorgetreten. Also schienen sie die Letzten zu sein und mittlerweile einander entwöhnt, und so würde sie nach dieser kleinen Pause wieder allein losziehen – wahrscheinlich noch ehe sie ganz wieder zu Atem gekommen wäre.
Die nächsten paar Tage lag Zoja auf dem Sofa und hörte einem stocktauben Akkordeonspieler dabei zu, wie er irgendwo über ihnen seine Musettes übte. Sie hatte keine Ahnung, wie Elga ihre kleine Souterrainwohnung bezahlte, mit Geld sicherlich nicht, die alte Frau war zu geizig, um sich von einer Münze zu trennen, wenn es auch mit List und Tücke ging. Vielleicht ließ sie dem Vermieter irgendein schmutziges Geheimnis über dem Gewissen baumeln. Oder vielleicht hatte sie ihn dazu gebracht, zu glauben, sie sei überhaupt nicht da, obwohl das ein ziemlich anspruchsvoller Zauber gewesen wäre, selbst für Elga. Diese Frau war schwer zu verstecken. Das Zimmer quoll über von Stößen staubiger Schriften, Haufen getrockneter Kräuter und Regalen über Regalen, vollgestellt mit trüben Einmachgläsern mit eingelegten purpurnen Organen, Klauen und Schnauzen. Die Wände schwitzten einen nasskalten, durchdringenden Geruch von Schimmel aus, vermischt mit verbranntem Ingwer und angegangenem Käse, und aus den dunklen Ecken war ein ständiges Rascheln, Kratzen und Scharren zu hören.
Elga holte einen weiteren Kessel und goss den Tee auf. Zoja sah hinunter auf die stockfleckigen, knotigen Hände der Alten, die Adern erinnerten sie an die knorrigen Baumwurzeln, die sich in den Wäldern des Nordens hartnäckig an die flechtenbewachsenen Steinblöcke klammerten.
»Ich habe ein Geschenk für dich«, sagte Zoja zu der alten Frau. Sie wühlte in ihrer Reisetasche und holte einen großen, in ein Laken geschlagenen Gegenstand heraus. Nachdem sie ihn auf das Sofa gestellt hatte, schälte sie ihn behutsam aus dem Stoff und hielt ihn Elga zum Bewundern hin.
Die Alte warf einen gleichgültigen Blick darauf. »Was soll ich mit einer Uhr?«
Zoja zuckte die Achseln. »Ich dachte, sie würde dir gefallen. Schau …« Sie zeigte auf den kleinen goldenen Schwan, der auf dem Scheitel saß. »Ist sie nicht schön? Wie die Schätze aus dem Palast.«
Elga sagte kein Wort, nahm Zoja aber die Uhr aus den Händen und schob sie auf einen der Papierstöße im Regal. Es war schon immer so gewesen, dass man bei der alten Frau nie wusste – Zoja hatte sie schon wegen eines simplen Zuckerwürfels vor Freude gackern und hüpfen sehen –, aber in diesen letzten paar Tagen schien ihre Laune noch unberechenbarer und finsterer als sonst geworden zu sein.
Die Alte setzte sich auf den Fußboden und fing an, Sonnenblumenkerne zu knacken, während Zoja sich auf das Sofa legte. Ein ständiges Pfeifen im Zimmer hinderte sie am Einschlafen. Zoja schlug die Augen auf und sah, wie der hagere schwarze Ratz endlich unter dem Sofa hervorkam und begann, an der Ecke des Teppichs zu nagen. »Lass dich von Max nicht stören«, knurrte Elga. »Ich schicke ihn gleich raus, seine Besorgungen machen.«
Zoja nickte und schloss die Augen wieder. Sie fühlte sich so, als habe man sie unter Drogen gesetzt, aber sie wusste, dass es am Zauber lag, der sie völlig ausgelaugt hatte. Außerdem hatte sie es von jeher verabscheut, kein eigenes Bett und kein eigenes Zimmer zu haben, wo immer sie auch gerade sein mochte. Bei jemandem zu Gast sein bereitete ihr stets Unbehagen, bei Elga ganz besonders. Ihre Reisen brachten sie immer wieder – für eine Handvoll Tage, einen ganzen Mondumlauf, gelegentlich sogar für Jahre – zusammen, aber dann trennten sich ihre Wege wieder und führten Zoja in die Arme eines betuchten Gönners und Elga zu ihren brodelnden Eintöpfen.
Als Zoja von ihrem kurzen Schlaf erwachte, saß die alte Frau auf der anderen Seite des Zimmers und blätterte, die fetten Füßchen auf dem kalten Holzofen, den Figaro durch. »Hier steht nichts von deinem Léon. Ich schätze, mehr als Was? konnten sie nicht sagen. Seine Frau ist untröstlich, und die Polizei ist noch immer am Schnüffeln.«
Elga knüllte die Zeitung zusammen und warf sie in den Ofen. Dann stapfte sie hinüber zum Sofa und machte sich neben Zoja breit. Die Alte senkte den Kopf und murmelte, mit dem Kopf nickend, vor sich hin. Zoja wartete. Im Zimmer war es still, selbst der Ratz hatte endlich Ruhe gegeben. Als Elga aufsah, war es so, als sei sie zu einer unwiderruflichen Entscheidung gelangt.
Mit einem wütenden Schlag ohrfeigte sie Zoja so fest, dass es dem Mädchen den Schrei von den Lippen riss. Sie packte Zojas Haar, zog sie zu sich heran und bohrte ihre rot glotzenden Augen in das entsetzte Gesicht des Mädchens. »Gab’s keinen Zug, vor den er fallen konnte?«, zischte sie. »Wirkt Gift dir zu langsam? Du musstest schon immer zu dick auftragen, dich zu dämlich aufführen, so eine fürchterliche, lästige Person! Fehler kann man vermeiden. Man muss sie vermeiden! Mein Gott, wie du mich ankotzt!« Sie ohrfeigte sie noch einmal, jetzt fester.
Zojas Worte fielen zwischen ihren Tränen heraus. »Tut mir leid, tut mir leid! Ich bin in Panik geraten. Er hatte es gemerkt, Elga, ich hatte Angst!«
Elga ließ ihr Haar los und stand auf. »Er merkt es, na und? Lutsch einem Mann den Schwanz, und er vergisst so manches. Das ist einfacher, als seinen Kopf auf eine eiserne Spitze zu stecken.« Sie kehrte zu ihrem Stuhl zurück, und das Mädchen rollte sich zu einer weinenden Kugel zusammen. »Bah. Schön. Reiß dich zusammen.« Sie nahm eine Schachtel Streichhölzer aus dem Regal und zündete den Ofen an, ohne Zoja eines weiteren Blickes zu würdigen. »Du machst alles zu unsicher. Die Polizei schnüffelt herum. Wir werden die Stadt verlassen und wieder von vorn anfangen müssen. Warum muss ich bloß deinetwegen diese alten Knochen durch die Gegend schleppen? Ich war hier vollauf zufrieden, bis du aufgekreuzt bist und alles ruiniert hast!«
»Nein, Elga, ist schon gut. Ich gehe. Ich werde dir nicht zur Last fallen.«
»Schön. Geh bald. Du behinderst mich beim Denken, und die Nachbarn werden merken, dass du hier bist. Ich kann ihre Fragen nicht gebrauchen.«
Weniger als eine Stunde später war Zoja abreisebereit, erleichtert, bald da weg zu sein. Unfreundlich drückte die alte Frau ihr eine Einkaufstüte voll Karotten, roten Kartoffeln und ein paar Lauchstangen in die Hand und steckte ihr dann zwei kleine weiße Eier in die Taschen. Zoja fand, dass ein freundliches Wort – keine Entschuldigung, aber vielleicht irgendeine zärtliche Redensart – auch nicht geschadet hätte, aber alles, was die Alte sagte, war: »Komm nicht wieder her. Wenn ich umziehe, werde ich es dich wissen lassen, aber komm nicht wieder. Solltest du Hilfe brauchen, na, halt nach Max Ausschau. Er wird immer in der Nähe sein. Jetzt geh.« Das Mädchen sah auf den Ratz hinunter, der in der Ecke saß und guckte. Sie nickte vor sich hin, die Zähne entschlossen zusammengebissen. Elga hatte recht, es war Zeit zu gehen. Sie hatte sich wahrscheinlich genug erholt, und ihr lädiertes Auge war abgeschwollen, jetzt war nur noch ein dunkler Streifen da, mehr Schmutz- als blauer Fleck, der sie wie ein rußbeschmiertes obdachloses Kaminkehrerkind aussehen ließ.
Die Alte folgte ihr nach draußen bis zur Haustür und sah ihr dann nach, wie sie die Kopfsteingasse entlangging. Ein Brechreiz juckte in Elgas Eingeweiden. Das Mädchen brachte ihr Blut zum Kochen. So viele Jahre lang hatte sie Zoja gebraucht, hatte sich auf sie gestützt, hatte sie dazu benutzt, einen Zufluchtsort zu finden, als sie durch die brutale Landschaft getrieben wurden. Es war für sie beide eine ermüdende Reise gewesen, aus der fernen ländlichen Stille längst verschwundener Wälder durch die schwarzen wogenden Rauchschwaden und das schrille Kreischen stählerner Eisenbahnräder, immer weiter, von Bahnhof zu Bahnhof, sich duckend und ausweichend zwischen der ineinander verbissenen Kriegsmaschinerie sich bekämpfender Imperien und dem zunehmenden technischen Fortschritt. Die Zivilisation überwucherte alles, nahm sie in die Zange, umzingelte sie und vernebelte ihnen den Weg mit dem Pulverdampf und Rauch von Dampfmaschinen, drängte und presste sie durch enge Gassen, die ins Nichts führten, nahm ihnen Trümpfe aus der Hand und zerrte ihnen Flüche aus dem Mund, wenn es ihnen ein ums andere Mal gelang, aus der Gefahrenzone zu springen.
Aber jetzt war alles ruhig, jetzt vergingen Wochen, sogar Monate, ohne dass sie das Mädchen auch nur sah. Es war nicht nötig. Der Kontinent war so friedlich wie ein schlafendes Lamm, und sie beide hatten sich darin eingerichtet. Die Zeitungen sprachen von einem »kalten Krieg«, aber das erschien Elga wie eine seltsame Bezeichnung, sie kannte kalte Kriege, das waren die, wo Beile und Messer, von halberfrorenen Fingern geführt, aus steifgefrorenen Hengstkadavern harte Bratenstücke hackten. Diese wahrhaft kalten Kriege hatten nichts mit dem gemein, was sie jetzt in den Zeitungen las, es war wirklich eine einfachere Zeit, und als der Schlachtenlärm abklang, stellte sie fest, dass das hübsche dunkelhaarige Mädchen mit den schmalen Hüften und dem üppigen Busen allmählich lästig wurde. Jedes Mal, wenn sie Zoja sah, regte es sie mehr auf, wie ein dämliches Bauernlied, das man auf den Tod nicht ausstehen kann, aber gezwungen ist tausendmal über sich ergehen zu lassen, bis man es nicht mehr aus dem Ohr kriegt. Sie wusste den Grund für ihre Gereiztheit nicht zu sagen, aber das Gefühl war so intensiv, dass es sich fast wie eine Geschwulst in ihr anfühlte. Zeit, sie rauszuschneiden, dachte sie, und tschüs.
Wind kam auf, und sie schnüffelte. Kohlenruß, Meersalz, Schinken, Hefe und Hundehaar, nichts Neues, nichts Besorgniserregendes. Sie stand gedankenverloren da, während ihr sinnlose Wörter durch den Kopf purzelten, bis eine Nachbarin mit einem Kasten leerer Milchflaschen lärmend herauskam. Aus ihrem Tagtraum gerissen, watschelte Elga in ihre Wohnung zurück und zog die Tür fest hinter sich zu.
V
Das besmokingte Jazztrio spielte ein quietschvergnügtes Stück, das er nicht kannte, im Getümmel von Abendanzügen war kein Gesicht zu sehen, das ihm vertraut gewesen wäre, und das Durchschnittsalter der Frauen lag irgendwo nördlich der fünfzig. Doch verführt von den Zaubern einer Gratis-Bar, harrte Will aus. Der Anlass war vorgeblich eine Buchpräsentation zu Ehren der Gattin eines Pariser Politikers, aber Will fand nicht, dass die geschwätzigen Gäste sonderlich belesen aussahen. Das Ganze wirkte eher wie die Reader’s Digest-Version vom Untergang des Abendlandes. Die Männer schienen bei ihren Anzügen alle um eine Größe danebengegriffen zu haben, und die Kleider der Frauen waren entweder trist und öde oder aus schrillem Taft. Neben ihm plauderte ein uraltes Gespann von Grandes Dames in kleinen Bunten, die so aussahen, als seien sie aus Tapetenmustern geschneidert, über Sommereinkäufe in Monte Carlo. Eine von ihnen ertappte Will beim Lauschen und fragte abrupt: »Êtes-vous un critique?«
»Nein«, antwortete er höflich, »ich bin nur wegen der Cocktails hier.«
Die Frauen lachten beide, eine Spur zu laut. »Natürlich, wir auch«, sagte die in Blau. Mit den exzessiv geschminkten Gesichtern und nachgezogenen Augenbrauen sahen sie aus wie Wachspuppen, die zu lange in der Sonne gestanden hatten.
»Sind Sie Brite?«, fragte eine.
»Amerikaner«, sagte Will.
»Ah!« Bei dieser Neuigkeit strahlten beide Frauen auf. »Sind Sie Schriftsteller? Künstler?«, fragte das rote Kleid.
»Sind Sie aus New York?«, fiel das blaue Kleid ein.
Will schüttelte zu beiden Fragen den Kopf. »Eigentlich bin ich aus Detroit. Ich arbeite hier bei einer Werbeagentur.«
Bei dieser Eröffnung machten die Frauen ein komisches Gesicht, als hätten sie beide in etwas Widerliches gebissen. Will war sich nicht sicher, ob es das Wort »Werbeagentur« oder »Detroit« war, was ihnen die Laune verhagelt hatte, aber er vermutete, beides. Er entschuldigte sich mit einem höflichen Nicken und bahnte sich einen Weg durch die Menge, bis er bei dem Tisch, auf dem die Bücher gestapelt lagen, ein ruhigeres Plätzchen fand. Er zündete sich eine Zigarette an, lauschte der Musik des Jazztrios und schlug ein Exemplar auf. Laut Auskunft des Umschlags handelte Rendezvous in Saint-Cloud von einer verbotenen Liebe in der Résistance. Er blätterte gerade darin, auf der Suche nach Abbildungen, als eine amerikanische Stimme, die mit einem unüberhörbar aristokratischen Ostküsten-Akzent sprach, ihn von hinten unterbrach.
»Ein hübsches Kunstmärchen, meinen Sie nicht auch?«
Will drehte sich um und sah einen hochgewachsenen, dünnen Mann mit sandfarbenem Haar, der die Bücherstapel mit dem Anflug eines Grinsens beäugte.
»Verzeihung?«, sagte Will.
»Deren Widerstandskampf im Untergrund«, sagte der Mann und deutete auf die Bücher. »Ein einziger charmanter Mumpitz, absurd, tatsächlich nichts weiter als eine kollektive Halluzination.«
Will zuckte innerlich leicht zurück und sah sich nervös um. »Tja also, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, von –«
»Wissen Sie« – der Mann nahm ein Buch in die Hand und musterte den Umschlag –, »ich hab mal einen ehemaligen GI kennengelernt, der auf dem Höhepunkt der deutschen Besetzung hinter den Linien abgeworfen wurde. Als ich ihn kennenlernte, war dieser Bursche ein großer Säufer vor dem Herrn, die Sorte mit voll ausgebildeter Schnapsnase, mit der man kleine Kinder erschrecken kann, aber in seiner Glanzzeit muss er ein richtiger Teufelskerl gewesen sein. Er erzählte mir, wie das OSS ihn mit einer Kiste voll Browning-Maschinengewehren, Revolvern, Granaten, ein paar Thompsons absetzte, eine regelrechte Schatztruhe, wirklich, alles Geschenke für unsere Freunde hier im Untergrund. Das Problem war: Einmal gelandet, konnte er keine Menschenseele finden, die bereit gewesen wäre, ihm das Zeug abzunehmen. Ist wochenlang durch die Stadt geirrt, und alles, was er fand, waren die üblichen perfiden Schwarzmarkthändler, verkommene Kollaborateure und mehr als nur ein paar schnelle Nazikugeln, vor denen er sich ducken musste. Am Ende vergrub er die Waffen am westlichen Stadtrand, irgendwo unten in der Kanalisation, und türmte dann schleunigst über den Ärmelkanal. Er und ich hatten einen richtig netten Abend im Algonquin. Er schenkte mir sogar einen selbstgezeichneten Lageplan von dem Schatz. Sollen wir mal sehen, ob wir ihn ausgraben können?«
»Pardon? Was ausgraben?« Will war ein wenig verwirrt.
Der Mann lächelte. »Die Waffen natürlich. Sie liegen irgendwo da draußen.«
Will war nicht ganz klar, ob man ihn gerade verscheißerte. »Nein, muss nicht sein.«
»Vielleicht ein andermal.« Der Mann trank einen Schluck aus seinem Glas und klopfte sich auf die Jackettbrust. »Ich habe die Karte immer bei mir, in meiner Brieftasche, für den Fall, dass ich je Bedarf an einer Maschinenpistole haben sollte. Klingt vernünftig, meinen Sie nicht auch?«
Will sah sich um, niemand schien sich um diesen kuriosen Mann mit den seltsamen Ideen zu kümmern. Der Bursche streckte die Hand aus. »Angenehm, übrigens. Oliver Pierce Ames.«
»Will Van Wyck.«
»›Van Wyck‹, ja, wie diese neue Schnellstraße drüben in New York. Sie soll ja ganz großartig sein. Sagen Sie, was für Zigaretten haben Sie bei sich?«
»Chesterfield. Möchten Sie eine?«, sagte Will.
»Ah, Gott segne Sie! Von dem Knaster, den die hierzulande verkaufen, hab ich mehr als genug.« Oliver brachte es fertig, die Zigarette zu nehmen und sie sich anzustecken, ohne seinen Vortrag zu unterbrechen. Er war ein gesprächiger Bursche. »Wissen Sie, ich hab Sie reinkommen sehen und wusste auf Anhieb, dass Sie ein Yank sind. Sie sind zu breitschultrig für einen Franzosen. Und so amerikanische Zähne! Also, was hat Sie heute Abend hierher verschlagen?«
»Ein Freund hat mir eine Karte geschenkt.«
»Ein Freund? Was für ein Freund schickt Sie denn auf eine Party wie diese?«
»Na ja, genau genommen war es ein Kollege namens Brandon, er war auf einer Einladungskarte sitzengeblieben. Ich glaube, er nahm an, es würde eine etwas andere Sorte Party werden.«
»Ja, bei Buchpräsentationen kann man nie wissen. Da geht manchmal so richtig die Post ab.« Oliver sah ihn neugierig an. »Ehrlich gesagt, als ich Sie sah, dachte ich zuerst, Sie wären möglicherweise die Eskorte der zwei Grandes Dames dort drüben.
Will lachte. »Nein, nein. Ich bin allein hier.«
Oliver nippte wieder an seinem Drink und sah sich im Saal um. »Brandon, sagen Sie? Nicht zufällig Bob Brandon, was?«
»Doch. Ich habe beruflich mit ihm zu tun. Kennen Sie ihn?«
»Nur oberflächlich. Für Amerikaner ist Paris ein Dorf. Scheint mir ein guter Mann zu sein. Sie arbeiten für die Firma?«
»Ja. Ich wurde vor zwei Jahren von den Staaten hierherversetzt.«
»Wirklich?«, sagte Oliver. »Na, und was tun Sie da?«
»Zurzeit nicht viel«, sagte Will. »Früher habe ich eine Menge Aktionen organisiert, aber neuerdings ist es ziemlich ruhig …«
»Ja, tja« – Oliver trank einen Schluck –, »kann nicht behaupten, ich hätte eine klare Vorstellung davon, wie die Firma arbeitet. Ist wohl auch nicht nötig. Gottchen, nichts ist langweiliger als fachsimpeln, finden Sie nicht?« Oliver warf ihm einen kurzen, neugierigen Blick zu. »Aber das wüsste ich doch gern, wie in Gottes Namen Brandon meinen konnte, das hier könnte für Sie amüsant werden!«
»Das fragte ich mich gerade auch.«
»Aber wirklich. Ich glaube, Ihr Freund muss eine sadistische Ader haben, Sie wie ein Stück Frischfleisch diesen verwahrlosten Witwen zum Fraß vorzuwerfen.«
Will lächelte. »Wie kommt’s, dass Sie hier sind?«
»Ich kenne den Verleger, wir spielen gelegentlich Pikett. Ich hatte gehofft, hier ein paar richtige Schriftsteller zu finden, aber die leben sehr versteckt.« Oliver sah auf seine Uhr. »Eigentlich soll ich mich gleich mit zwei Mädchen treffen, hier grad um die Ecke. Im Taillevent, schon mal da gewesen?«
Will schüttelte den Kopf.
»Da wären also zwei Mädchen, und ich bin nur einer. Vielleicht sollten Sie mitkommen? Im Restaurant geht’s ein Spürchen steif zu, aber das Essen ist sagenhaft, und die Krebsremoulade spottet jeder Beschreibung. Kommen Sie mit, bitte. Es ist immer gut, einen Vierten zu haben.«
Will zögerte noch etwas. Oliver sah ihm in die Augen und lächelte.
Fünf Stunden später lag Will sturzbetrunken auf einer Bank unter dem Pont Neuf und starrte verschwommen auf die Lichter, die auf der tanzenden Oberfläche des nachtschwarzen Flusses spielten. Ein paar Schritte weiter summte Oliver einen Walzer, während er mit der jungen Brünetten namens Juliette einen Schieber tanzte. Sie trug ein kurzes weißes Kleid mit weißen Perlen. Das andere Mädchen, schöner als Juliette und viel zu hübsch für Will, hatte schon vor Stunden ein Taxi nach Hause genommen. Der gelbe Mond stand auf kurz vor voll, und die Sterne oben am Himmel sahen verschwommen und zerlaufen aus, als hätte jemand Wasser darübergekippt, bevor sie ganz trocken waren. Will versuchte, sich zu erinnern, welcher Tag gerade war, und betete, es sei Samstag oder Sonntag. Die Sonne würde bald aufgehen, und er war nicht in der Verfassung, zur Arbeit zu gehen.
Das Abendessen war erfreulich gewesen. Oliver hatte Will als einen alten Freund aus Amerika vorgestellt, und die zwei französischen Mädchen hatten ihm schnell Komplimente wegen seiner Sprachkenntnisse gemacht. Er erklärte, dass die Familie seiner Mutter aus dem frankophonen Kanada nach Detroit ausgewandert war (»Ah, Detroit!«, rief Oliver aus, »das Paris des Mittleren Westens!«), und so sei er mit der französischen Sprache aufgewachsen – jedenfalls mit einer grobschlächtigen, kolonialen Variante davon. Während seines Aufenthalts in Paris sei sein Französisch etwas aufpoliert worden, aber es sei längst nicht perfekt (»Absolument«, lachten die Mädchen, »c’est pas du tout parfait!«). Er wollte ihnen schon noch mehr erzählen, aber Oliver unterbrach ihn mit einer langen Anekdote, die in die nächste überschwappte, und als der Abend voranschritt, zeigte sich, dass Will praktisch keine Chance mehr bekommen würde, sonst noch etwas zu sagen. Also hörte er zusammen mit den Mädchen weiter zu, während der scheinbar omnipräsente Sommelier Flasche um Flasche 47er Clos Saint Jean entkorkte und Oliver von Klatschgeschichten, Gerüchten, Anekdoten und offen zweideutigen Andeutungen übersprudelte, die die Mädchen erröten und in ihre Servietten kichern ließen. Will störte es nicht, Oliver erwies sich als ein sowohl faszinierender als auch amüsant-verrückter Typ, der im Laufe des Abends erzählte, wie er einmal den Oldtimer seiner Mutter, einen Jordan Roadster, in den Connecticut River gesetzt hatte, ihnen ein paar Fetzen von alten Schlachtgesängen der Phillips Exeter Academy vorsang, mit schon leicht knödeliger Diktion ein paar Keats-Verse missglückt-melodramatisch massakrierte und dann, vollends betrunken, eine Reinszenierung seines Einmarschs in Rom mit der U. S. Army darbot.
»Sie waren bei der Infanterie?«, fragte Will, mittlerweile ebenfalls ziemlich beschwipst.
»Ja, nichts besonders Heroisches, hauptsächlich Schreibarbeit. Versorgungskram. Mein Vater hatte natürlich auf einen viel höheren Rang gehofft, aber wie sich herausstellte, geben die verträumten, poetischen Typen eher bescheidenes Offiziersmaterial ab.«
»Na ja, er muss stolz auf Sie gewesen sein, Sie haben Ihren Beitrag geleistet.«
»Oh, stolz war er durchaus. Ich hab ihm ein Foto von mir mit General Patton geschickt. Das hat den alten Herrn eindeutig aufgepulvert«, sagte Oliver und füllte sein Glas nach. »Was ist mit Ihnen? Sie sehen zu jung aus, um damals gedient zu haben, haben Sie Korea mitgemacht?«
»Nein …« Will zögerte, leicht verlegen. Da er aus einer Arbeiterfamilie kam, wusste er, dass er Glück gehabt hatte, nicht eingezogen worden zu sein, und ein Stipendium hatte ihn vor der Notwendigkeit bewahrt, sich freiwillig zu melden, um die Collegegebühren bezahlen zu können. Aber er hatte sich deswegen nie als Glückspilz gefühlt, ganz besonders dann nicht, wenn er mit einem Kriegsveteranen wie Oliver sprach. Das war einer der Gründe, warum er gern im Ausland, in Frankreich lebte, da fühlte er sich diesem Druck weit weniger ausgesetzt. Das Thema kam selten auf; in Paris neigten die Leute dazu, über das, was sie im Krieg gemacht hatten, zu schweigen.
»Na ja, vielleicht haben Sie damals nicht gedient, aber dafür dienen Sie doch jetzt, oder?«, sagte Oliver und beugte sich mit einem wissenden Lächeln vor. »Wir alle dienen.«
Das verwirrte Will, und er wollte schon nachfragen, was Oliver damit meinte, als sein Freund zwei Löffel ergriff und sie den Cancan tanzen ließ, was ihre Damenbegleitung zum Kichern brachte, und die Gelegenheit verstrich, löste sich in allerlei von Obstbränden begleiteten Schokoladen- und Meringendesserts auf, denen weitere Gänge von Olivers überschäumendem Geplauder folgten, diesmal über eine Verschwörung, von der er geradezu besessen war, eine Vertuschungsaktion um eine silberfarbene fliegende Untertasse, die in New Mexico aufgefunden worden sei. Alle lachten über seine Imitation eines kleinen grünen Männchens vom Mars.