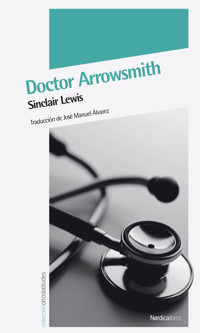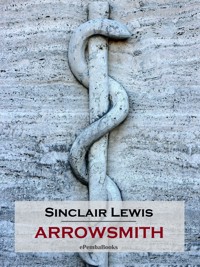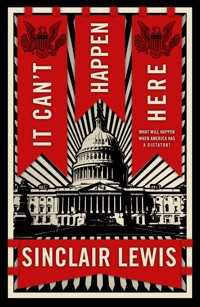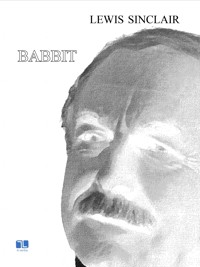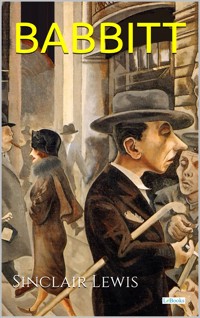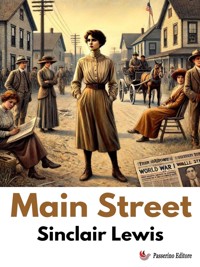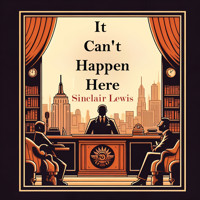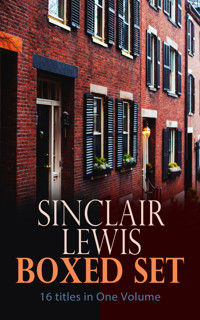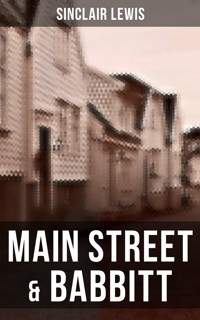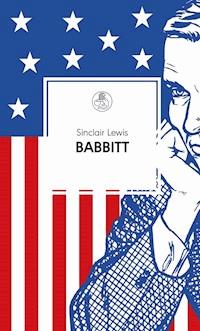
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
«Packendes Porträt der Zwanzigerjahre voller legendärer Charaktere... eine überzeugende Satire auf die Konformität der amerikanischen Mittelschicht.» (The Guardian)
Sinclair Lewis ist der Chronist der US-amerikanischen Mittelschicht. Den Zwang zu Konsum und Konformismus, die Pervertierung des Amerikanischen Traums hat niemand so prägnant und dabei so amüsant beschrieben wie der Nobelpreisträger.
In seinem ereignislosen, durchschnittlichen Kleinstadtleben hat der Immobilienmakler George F. Babbitt sich bequem eingerichtet. Seine drei Kinder sind wohlgeraten, wenn sie auch meist nicht auf ihn hören; mit seiner Frau verbinden ihn liebgewonnene Gewohnheiten. Sein ganzes Streben ist auf gesellschaftliche Anerkennung und wirtschaftlichen Aufstieg gerichtet. Bis ihm eines Tages bewusst wird, dass er all dies so nie gewollt hat, und einen Ausbruchsversuch wagt. Mit feinem Spott, ironischem Witz und stets voller Sympathie für den charakterschwachen Protagonisten erzählt der Roman, wie Babbitt sein rebellisches Selbst wiederentdeckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
«Was für ein Meisterwerk!» Michael Köhlmeier
Ein guter Job, ein Auto, ein trautes Heim, dazu das, was man Freunde nennt – was braucht ein Mann in den besten Jahren mehr zu seinem Glück? Und doch kommen George Babbitt Zweifel, ob das schon alles im Leben gewesen sein soll.
Der US-Klassiker in Neuübersetzung.
Sinclair Lewis hat wie kein anderer den seelenlosen Materialismus der Middle Class als das entlarvt, was er ist: der ganz normale Wahnsinn. Sein Babbitt von 1922 wurde über Nacht zum Inbegriff des Allerweltstypen, der zu bequem ist, um sein eigenes Leben zu leben, und zu feige, um für das einzustehen, woran er glaubt. Der durch und durch unheldische Held stellt auch den heutigen Leser vor brisante Fragen: Kann sich ein Mensch ein Leben lang selbst treu bleiben? Wie viel Heroismus braucht es, um gegen den Strom zu schwimmen? Welche individuellen Freiheiten lassen uns Konvention und Kommerz überhaupt noch? George F. Babbitt, überangepasster Familienvater und Karrierist, wagt eines Tages den Ausbruch aus der Lügenwelt und bekommt daraufhin am eigenen Leib zu spüren, was dem blüht, der sich weigert, das Spiel der Mehrheit mitzuspielen.
Sinclair Lewis
BABBITT
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Bernhard Robben
Nachwort von Michael Köhlmeier
MANESSE VERLAG
Für Edith Wharton
1. Kapitel
I
Zeniths Türme strebten über den Morgennebel auf; nüchterne Türme aus Stahl, Sandstein und Zement, robust wie Felsen, doch schlank wie Silbernadeln, weder Zitadellen noch Kirchen, sondern solide, schöne Bürogebäude.
Der Nebel hatte Mitleid mit den verwitterten Gebäuden früherer Generationen, mit dem Postamt samt seinem schindelgeplagten Mansardendach, den rotgeziegelten Minaretten plumper alter Häuser, den Fabriken mit ihren spärlichen, rußverschmierten Fenstern, den lehmfarbenen Wohnhäusern aus Holz. Die Stadt wimmelte von solch grotesken Gebilden, die mehr und mehr von blitzblanken Türmen aus dem Geschäftszentrum verdrängt wurden, und auf den weiter außerhalb gelegenen Hügeln reihte sich ein neues, hell schimmerndes Haus ans andere, gewiss Heimstätten für Frohsinn und Beschaulichkeit.
Über eine Betonbrücke sauste lautlos eine Limousine mit langem, schnittigem Kühler. Ihre Insassen hatten die Nacht mit der Probe eines Theaterstücks am Little Theater verbracht, einem von Champagner angeregten, künstlerischen Wagnis. Unter der Brücke schlängelte sich die Bahntrasse entlang, ein Gewirr grüner und tiefroter Lichter. Der New York Flyer donnerte vorbei und riss zwanzig Stränge polierten Stahls aus dem Dunkel in sein grelles Scheinwerferlicht.
In einem der Wolkenkratzer stellten die Sender der Associated Press den Funkverkehr ein. Nachdem sie die ganze Nacht hindurch mit Peking und Paris Nachrichten ausgetauscht hatten, schoben sich die Telegrafisten müde die Zelluloid-Augenschirme aus der Stirn. Gähnende Putzfrauen mit abgelaufenen Schuhen schlappten durchs Gebäude. Der Morgennebel driftete davon. Menschenscharen trotteten in langen Reihen mit Lunchpaketen unterm Arm zu den riesigen neuen Fabriken, Konstruktionen aus Hohlziegel und Glas, glitzernde Hallen, in denen fünftausend Menschen unter einem Dach arbeiteten und Qualitätswaren produzierten, die bis an den Euphrat und ins südafrikanische Veldt verkauft werden würden. Frohgemut wie dieser dämmernde Aprilmorgen pfiffen die Sirenen im Chor ihren Willkommensgruß; das Lied der Arbeit in einer wie für Giganten geschaffenen Stadt.
II
Wie ein Gigant wirkte der Mann nicht unbedingt, der nach und nach auf der Schlafveranda seines holländischen Kolonialhauses im als Floral Heights bekannten Wohnbezirk von Zenith erwachte.
Er hieß George F. Babbitt, war gerade, im April 1920, sechsundvierzig Jahre alt geworden und stellte selbst nichts Nennenswertes her, weder Butter noch Schuhe oder Gedichte, doch war er äußerst geschickt darin, Häuser für weit mehr Geld zu verkaufen, als es sich die Leute eigentlich leisten konnten.
Der große Kopf war rosig, das spärliche braune Haar ohne Glanz, sein schlafendes Gesicht das eines Babys, und dies trotz einiger Falten und der roten Brillenabdrücke auf der Nase. Er wirkte nicht gerade korpulent, doch gut genährt, hatte Pausbacken, und die glatte Hand, die hilflos auf der khakifarbenen Decke lag, war ein wenig pummelig. Er machte einen wohlhabenden, betont unromantischen und verheirateten Eindruck; gänzlich unromantisch wirkte auch die Schlafveranda, von der aus man auf eine ansehnliche Ulme, zwei respektable Rasenflächen, eine betonierte Auffahrt sowie eine Wellblechgarage blickte. Babbitt aber träumte wieder einmal den Feenmädchentraum, der romantischer war als purpurne Pagoden am silbrig schimmernden See.
Seit Jahren erschien ihm das Feenmädchen. Wo andere nur Georgie Babbitt in ihm sahen, sah sie einen galanten jungen Mann. Im Dunkel jenseits geheimnisvoller Haine wartete sie auf ihn, und sobald er sich aus dem überfüllten Haus fortstehlen konnte, huschte er zu ihr. Seine Frau, die lärmenden Freunde, sie alle wollten ihm folgen, aber er konnte ihnen entfliehen, an seiner Seite das Mädchen, und gemeinsam kauerten sie an schattigem Hang. Sie war so schlank, so weiß, so willig! Und er sei so witzig, so mutig, sie würde auf ihn warten, dann wollten sie gemeinsam segeln …
Das Rumpeln und Poltern des Milchwagens.
Babbitt stöhnte, drehte sich auf die andere Seite und suchte den Weg zurück in seinen Traum. Jetzt konnte er nur noch ihr Gesicht jenseits nebliger Wasser sehen. Unten knallte der Hausmeister die Kellertür zu. Im Nachbargarten bellte ein Hund. Kaum glitt Babbitt selig zurück in die dämmrige warme Flut, kam pfeifend der Zeitungsjunge vorbei, und die aufgerollte «Advocate» schlug gegen die Tür.
Erschrocken fuhr Babbitt auf, sein Gedärm zog sich zusammen, und noch während er langsam wieder zur Ruhe kam, durchbohrte ihn mit einem Mal das vertraute, nervtötende Rasseln eines Fords, der angekurbelt wurde: schrapp-pött-pött, schrapp-pött-pött, schrapp-pött-pött. Babbitt, selbst bekennender Automobilist, kurbelte mit dem unsichtbaren Fahrer, wartete angespannt mit ihm eine Ewigkeit auf das Grollen des anspringenden Motors und litt mit ihm, als das Grollen wieder verstummte und das infernalisch beharrliche Schrapp-schrapp aufs Neue einsetzte – ein satter, tiefer Ton, ein wummerndes Geräusch am kalten Morgen, ein wütendes, ein unentrinnbares Geräusch. Erst der anschwellende Motorenlärm, der ihm verriet, dass der Ford nun fahrbereit war, erlöste ihn von seiner atemlosen Anspannung.
Er warf einen Blick auf seinen Lieblingsbaum, Ulmenzweige vor goldener Himmelspatina, und tastete sich zum Schlaf zurück wie zu einem süßen Gift. Er, der als Junge so erwartungsvoll ans Leben geglaubt hatte, interessierte sich nicht länger für all die unwahrscheinlichen Abenteuer, die der neue Tag bieten mochte.
Und bis um zwanzig nach sieben der Wecker klingelte, entfloh er erneut der Wirklichkeit.
III
Es war der beste der landesweit beworbenen, serienmäßig hergestellten Wecker, ausgestattet mit allen modernen Schikanen, also inklusive Läutwerk, Weckwiederholung und Leuchtzifferblatt. Babbitt war stolz darauf, von solch einer prächtiger Apparatur geweckt zu werden. Einen derartigen Wecker zu besitzen verlieh einem fast ebenso hohes Ansehen wie der Kauf teurer Cordreifen.
Mürrisch fand er sich damit ab, dem Tag nicht länger entfliehen zu können, und doch blieb er liegen, angewidert von der Tretmühle des Maklergeschäftes, der Familie, ja von sich selbst, weil er so empfand. Am Abend zuvor hatte er mit Vergil Gunch bis Mitternacht Poker gespielt, und nach solchen Auszeiten vom Alltag war er bis zum Frühstück stets ziemlich gereizt. Vielleicht lag es am grässlichen selbst gebrauten Prohibitionsbier und den vielen Zigarren, zu denen ihn der Alkohol verführt hatte; vielleicht lag es auch an seinem Widerstreben, aus dieser herrlich kühnen Männerwelt in die enge Welt der Hausfrauen und Stenotypistinnen zurückzukehren, wo er ständig zu hören bekam, dass er weniger rauchen sollte.
Aus dem Schlafzimmer neben der Veranda hörte er von seiner Gattin ein schauderhaft fröhliches «Zeit zum Aufstehen, Georgie» und jenes energische, kratzige Schrappen, mit dem Haare aus einer Bürste gekämmt wurden.
Er grunzte, zog die dicken, in blassblauem Pyjama steckenden Beine unter der khakifarbenen Decke vor, setzte sich am Bettrand auf und fuhr sich mit den Fingern durchs zerzauste Haar, während die feisten Füße mechanisch nach den Pantoffeln tasteten. Sehnsüchtig hing sein Blick an der Wolldecke – für ihn auf immer der Inbegriff von Freiheit und Heldentum. Er hatte sie für einen Campingausflug gekauft, aus dem nie etwas geworden war, und seither löste sie bei ihm zuverlässig Assoziationen von himmlischem Faulenzen, himmlischem Fluchen und einer Welt Flanellhemden tragender Männer aus.
Mit knirschenden Knien wuchtete er sich hoch und stöhnte, als der Schmerz Welle um Welle hinter seinen Augen vorüberrauschte. Und während er auf das wiederkehrende Brennen wartete, stierte er mit glasigem Blick in den Garten. Wie stets freute ihn, was er sah, dieser ordentliche Garten eines erfolgreichen Geschäftsmannes aus Zenith, soll heißen, der Garten war Gestalt gewordene Perfektion, was seinen Besitzer gleichermaßen perfekt machte. Babbitt musterte die Wellblechgarage und dachte zum dreihundertfünfundsechzigsten Mal im Jahr: «Hat keine Klasse, dieser Blechschuppen. Muss mir eine Holzgarage zulegen. Aber was soll’s, ist das Einzige hier, was nicht ganz modern ist!» Den Blick weiterhin nach draußen gerichtet, dachte er über eine Gemeinschaftsgarage für das Erschließungsprojekt in Glen Oriole nach. Er hörte auf zu ächzen und zu tasten, stemmte die Arme in die Hüften, und der verdrießliche, schlafverquollene Ausdruck in seinem Gesicht wich einer härteren Miene. Mit einem Mal sah er wie jemand aus, der kompetent war, eine Amtsperson, ein Mann, der Pläne schmiedete, Anweisungen erteilte, wie ein Macher.
Getrieben vom Elan seiner Gedanken, schritt er über den kühlen, sauberen, unbenutzt aussehenden Flur ins Bad.
Obwohl das Haus nicht sonderlich groß war, verfügte es wie alle Häuser in Floral Heights über ein geradezu königlich anmutendes, mit Kacheln, Porzellan und silbern glänzendem Metall eingerichtetes Bad. Die Handtuchhalter waren Stangen aus durchsichtigem, nickelgefasstem Glas, die Wanne schien groß genug für einen Langen Kerl der Preußengarde, und über dem Waschbecken prangte eine sensationelle Sammlung von Zahnbürstenhalter, Rasierpinselhalter, Seifenschale, Schwammschale und Arzneischrank, alles so blitzblank und ausgeklügelt wie ein Armaturenbrett. Babbitt aber, der moderne Geräte wie Gottheiten verehrte, war unzufrieden. Schwer hing der Geruch nach heidnischer Zahnpasta im Bad. «Verona wieder! Statt Liliodol zu nehmen, wie ich es ihr jeden Tag aufs Neue predige, geht sie hin und holt sich irgend so ein verfluchtes Stinkezeug, von dem einem ganz schlecht wird!»
Die Badematte war schmuddelig, der Boden patschnass. (Seine Tochter Verona besaß die exzentrische Angewohnheit, gelegentlich schon morgens ein Bad zu nehmen.) Er glitt auf der Matte aus und stieß sich an der Wanne. Er fluchte. Wütend griff er nach der Tube Rasierschaum, seifte sich wütend mit streitlustig geschwungenem, schaumigem Pinsel ein und schabte ebenso wütend mit dem Nassrasierer über seine Pausbacken. Es ziepte. Die Klinge war stumpf. «Verdammt … Mensch … Herrgott … verdammt!»
Er durchforstete den Arzneischrank nach einem Päckchen neuer Rasierklingen (und dachte dabei wie stets: «Wäre billiger, eines von diesen Dingsda zu kaufen und die Klinge selbst am Riemen zu schärfen»), fand das Gesuchte hinter der runden Schachtel Natron, verübelte es seiner Frau, dass sie die Klingen dort versteckt hatte, und lobte sich zugleich dafür, nicht wieder «verdammt» gesagt zu haben. Dann aber sagte er es doch noch einmal, als er mit nassen, schlüpfrigen Fingern versuchte, den grässlichen kleinen Umschlag zu öffnen und die neue Klinge aus dem steifen, klebrigen Wachspapier zu lösen.
Als Nächstes stand das oft bedachte, nie gelöste Problem an, was mit der alten Klinge zu tun war, die schließlich eine Gefahr für die Finger seiner Kleinen bedeuten könnte. Wie gewöhnlich warf er sie dann oben auf den Arzneischrank, wobei er sich zugleich im Geiste eine Notiz machte, demnächst einmal die fünfzig oder sechzig Klingen zu beseitigen, welche auf gleiche Weise dort oben vorübergehend deponiert worden waren. Während der Rasur spürte er eine zunehmende Gereiztheit, die durch rasende Kopfschmerzen und einen leeren Magen nicht besser wurde. Kaum war er fertig, das runde Gesicht glatt und triefnass, die Augen brennend vom Seifenwasser, langte er nach einem Handtuch. Die Familienhandtücher waren nass – nass, klamm und ekelhaft, alle nass, ohne Ausnahme, wie er feststellte, als er blind danach tapste –, sein eigenes Gesichtshandtuch, das seiner Frau, das von Verona, Ted und Tinka, ebenso das einsame Badehandtuch mit dem dicken Monogramm. Und dann tat George F. Babbitt etwas wahrhaft Unerhörtes. Er trocknete sich das Gesicht mit dem Gästehandtuch ab! Eine mit Stiefmütterchen verzierte Petitesse, die nur an ihrem Platz hing, um anzuzeigen, dass die Babbitts zur besseren Gesellschaft von Floral Heights gehörten. Niemand hatte es je benutzt. Kein Gast hatte bislang gewagt, danach zu greifen. Gäste benutzten stets klammheimlich eine Ecke vom nächstbesten Handtuch.
Er tobte: «Himmel noch eins, benutzen die doch alle Handtücher, jeden erbärmlichen Fetzen! Benutzen sie, machen sie patschnass und denken nicht daran, für mich ein trocknes hinzulegen – natürlich hab ich mal wieder das Nachsehen! –, und dann, wenn ich eins brauche und – ja, bin ich denn der einzige Mensch in diesem verflixten Haus, der wenigstens ein bisschen Rücksicht auf andere nimmt? Der sich fürsorglich sagt, es könnte noch andere geben, die nach mir das Bad benutzen wollen? Und der daran denkt …»
Er warf die feuchtkalten Fetzen in die Wanne und genoss rachsüchtig das erbärmliche Klatschen, mit dem sie aufschlugen, als sich seine Frau gleichmütig ins Bad drängte, um ebenso gleichmütig festzustellen: «Ach, Georgie, was machst du denn da? Willst du die Handtücher auswaschen? Das brauchst du aber nicht. Sag, Georgie, du hast doch nicht etwa das Gästehandtuch benutzt?»
Es ist nicht überliefert, welche Antwort er darauf gab.
Zum ersten Mal seit Wochen hatte ihn seine Frau so sehr in Rage versetzt, dass er sie eines Blickes würdigte.
IV
Myra Babbitt – Mrs. George F. Babbitt – war definitiv eine reife Frau. Fältchen zogen sich vom Mundwinkel übers ganze Kinn, und der füllige Hals warf Speckringe. Sie hatte ein gewisses Alter bereits überschritten, was sie nicht zuletzt dadurch bewies, dass sie vor ihrem Mann keine Scham mehr kannte und sich nicht genierte. Zum Unterrock trug sie ein Korsett, unter dem die Haut vorquoll, und sie dachte sich längst nichts mehr dabei, in zu knappen Korsetts gesehen zu werden, hatte sie sich auf ihre dumpfe Art doch derart ans Eheleben gewöhnt, dass sie in ihrer Matronenhaftigkeit frigide wie eine anämische Nonne wirkte. Sie war eine gute Frau, eine freundliche, fleißige Frau, bis auf Tinka aber, ihrer Zehnjährigen, interessierte sich eigentlich niemand für sie oder war sich auch nur im Entferntesten ihrer Existenz bewusst.
Sobald die vielfältigen häuslichen wie auch gesellschaftlichen Aspekte der Handtuchfrage ausführlich erörtert worden waren, entschuldigte sich Myra bei ihrem Mann dafür, dass er einen Kater hatte; und Babbitt erholte sich immerhin so weit, dass er die Suche nach einem ärmellosen Unterhemd über sich ergehen ließ, das, wie er verkündete, böswillig unter seinen sauberen Schlafanzügen versteckt worden war.
In den Verhandlungen bezüglich seines braunen Anzuges gab er sich dann sogar geradezu liebenswürdig. «Was meinst du, Myra?» Er befummelte den Kleiderstapel auf dem Schlafzimmerstuhl, während seine Frau geschäftig auf und ab lief, ihren Unterrock auf für ihn rätselhafte Weise unablässig zurechtrückte oder glatt strich und dabei seiner hämischen Ansicht nach mit dem Ankleiden kein bisschen vorankam. «Was hältst du davon? Soll ich den braunen Anzug noch mal anziehen?»
«Nun, er steht dir wirklich gut.»
«Weiß ich ja, aber eigentlich müsste er mal wieder gebügelt werden.»
«Wenn du meinst. Könnte schon stimmen.»
«Ja, ja, ganz gewiss, er gehört unbedingt gebügelt.»
«Tja, schaden würde es nicht.»
«Nur das Jackett, das braucht eigentlich noch nicht gebügelt zu werden. Wäre doch blöd, den ganzen verdammten Anzug zu bügeln, wenn es das Jackett gar nicht nötig hat.»
«Recht hast du.»
«Die Hose aber, die hat es dringend nötig. Sieh sie dir doch an – diese vielen Falten –, also die Hose muss gebügelt werden, gar keine Frage.»
«Wenn du das sagst. Aber weißt du was, Georgie? Warum trägst du nicht das braune Jackett zu deiner blauen Hose, von der wir eh nicht wussten, was wir damit anfangen sollen?»
«Bist du von allen guten Geistern verlassen? Hast du in meinem ganzen Leben je erlebt, dass ich das Jackett von einem Anzug zur Hose von einem anderen Anzug trage? Für wen hältst du mich? Einen bankrotten Buchhalter?»
«Tja, warum trägst du heute dann nicht den grauen Anzug und hältst nachher beim Schneider an, um die braune Hose abzugeben?»
«Also, ich finde, sie muss wirklich … Wo zum Teufel steckt denn jetzt der graue Anzug? Ah, da ist er ja.»
Die weiteren Krisen des morgendlichen Ankleidens bewältigte er vergleichsweise ruhig und entschlossen.
Als Erstes staffierte er seinen Leib mit dem ärmellosen Doppelrippunterhemd aus, in dem er aussah wie ein kleiner Junge, der zum Festumzug lustlos einen mittelalterlichen Leinenüberwurf trug. Keinen Tag streifte er sich das ärmellose Unterhemd über, ohne dem Gott des Fortschritts dafür zu danken, dass er nicht solch enge, altmodische Unterwäsche wie Henry Thompson trug, sein Schwiegervater und Geschäftspartner. Als Zweites putzte er sich schließlich dadurch heraus, dass er sich kämmte und das Haar nach hinten klatschte. Auf diese Weise wurde eine gewaltige Stirn enthüllt, die sich bis zu fünf Zentimeter über den früheren Haaransatz hochzog. Die wundersamste Veränderung aber erzielte er mit dem Aufsetzen der Brille.
Brillen verleihen eine individuelle Note – die protzige Schildplattbrille, der devote Zwicker des Schullehrers, die verbogene, silberne Brille des alten Dorfbewohners. Babbitt hatte eine riesige, kreisrunde, randlose Brille aus bestem Glas, deren Gestell aus feinen Goldbügeln bestand. Erst die Brille machte ihn zum modernen Geschäftsmann, zu jemandem, der Angestellten Befehle erteilte, ein Auto fuhr, gelegentlich Golf spielte und geradezu allwissend in der Kunst des Verkaufens war. Der Kopf wirkte mit einem Mal markant und sah nicht länger wie der eines Babys aus; zudem bemerkte man nun die breite, stumpfe Nase, die dicke, lange Oberlippe und das ein wenig zu schwabbelige, doch energische Kinn, während man anerkennend verfolgen konnte, wie er sich die übrige Kleidung eines respektablen Bürgers anlegte.
Der graue Anzug war makellos geschnitten, makellos gearbeitet und absolut unauffällig. Ein Anzug von der Stange. Die weiße Paspelierung des V-Ausschnitts seiner Weste verlieh ihm einen Anflug von Solidität und Intellektualität. Bei den Schuhen handelte es sich um schwarze Schnürstiefel, gute Stiefel, ehrliche Stiefel, Standardstiefel, also außerordentlich uninteressante Stiefel. Als einzige Extravaganz leistete er sich einen lilafarbenen Wollschal. Begleitet von ausführlichen, an Mrs. Babbitt gerichteten Bemerkungen (die mit geradezu akrobatischer Finesse ihre Bluse mit einer Sicherheitsnadel an den Rock heftete und kein Wort von dem mitbekam, was er sagte) zog er den lilafarbenen Schal jenem mit einem gobelinartigen Muster vor, auf dem saitenlose braune Harfen unter sturmgebeugten Palmen zu sehen waren, um dann einen Schlangenkopf mit Opalaugen daran zu befestigen.
Den Inhalt der Taschen des braunen Anzugs in jene des grauen Anzugs zu befördern war ein schlechterdings spektakuläres Unterfangen. Und Babbitt nahm es mit derlei sehr ernst. Wie Baseball oder die Republikanische Partei war dies für ihn von zeitloser Bedeutung. Zu dem Inhalt gehörten ein Füllfederhalter und ein silberner Bleistift (für den es ständig an Minen fehlte), die beide in die rechte obere Brusttasche seiner Weste gehörten. Ohne sie hätte er sich nackt gefühlt. An der Uhrkette hingen ein goldenes Federmesser, ein silberner Zigarrenschneider, sieben Schlüssel (von zweien wusste er nicht mehr, wofür sie gut waren) und dazu eine teure Uhr. An der Kette war des Weiteren ein großer, gelblicher Elchzahn befestigt, der ihn als Mitglied des Brotherly and Protective Order of Elks1 auswies. Das Wichtigste aber war sein Notizbuch, eine Loseblattsammlung, die Adressen von längst vergessenen Leuten enthielt, umsichtig verwahrte Erinnerungen an postalische Geldanweisungen, die ihren Empfänger bereits vor Monaten erreicht hatten, Briefmarken, die nicht länger klebten, ausgeschnittene Gedichte von T. Cholmondeley Frink2 und einige Zeitungsartikel, denen Babbitt nicht nur seine Ansichten, sondern auch all seine komplizierten Fremdwörter entnahm, Merkzettel, die sicherstellen sollten, dass er tat, was er nicht vorhatte zu tun, sowie die merkwürdige Buchstabenfolge: D. S. S. D. M. Y. P. D. F.
Allerdings besaß er kein Zigarettenetui. Niemand hatte ihm je eines geschenkt, also hatte er sich diese Angewohnheit auch nie zugelegt und fand folglich Leute mit Zigarettenetuis ziemlich weibisch.
Als Letztes steckte er sich das Abzeichen des Boosters’ Club3 ans Revers. Dank der lapidaren Prägnanz wahrer Poesie standen darauf nur zwei Wörter: «Boosters – Pep!» Der Button verlieh Babbitt ein Gefühl von Loyalität und Größe. Er stellte seine Verbindung zu den Good Fellows dar, zu Männern, die liebenswert und menschlich waren, zu wichtigen Geschäftskontakten. Das Abzeichen war sein Viktoriakreuz, sein Band der Ehrenlegion, sein Phi-Beta-Kappa-Schlüssel4.
Die Finessen des Ankleidens bereiteten ihm beachtliches Kopfzerbrechen. «Irgendwie ist mir ganz flau heute Morgen», sagte er. «Ich glaub, ich hab gestern zu viel gegessen. Du solltest mir so spät abends nicht mehr diese schweren Bananenpfannkuchen vorsetzen.»
«Aber du wolltest sie doch haben.»
«Ich weiß, trotzdem – lass dir gesagt sein, wenn ein Mann die vierzig überschritten hat, muss er auf seine Verdauung achten. Es gibt viel zu viele Leute, die nicht ordentlich auf sich aufpassen. Weißt du, mit vierzig ist ein Mann entweder ein Dummkopf oder ein Arzt – sein eigener Arzt, meine ich. Man achtet einfach viel zu wenig auf so Dinge wie die richtige Ernährung. Also ich finde … nach einem Tag voller Arbeit braucht ein Mann natürlich eine anständige Mahlzeit, aber es täte uns beiden sicher gut, wenn wir abends nur noch etwas Leichtes zu uns nähmen.»
«Aber Georgie, zu Hause esse ich abends doch immer sehr leicht.»
«Willst du damit etwa andeuten, dass ich mir die Wampe vollschlage, wenn ich in der Stadt esse? Na klar! Du fändest das natürlich toll, wenn du den Fraß essen müsstest, den uns der neue Kellner im Athletic Club vorsetzt! Aber egal, ich fühle mich heute Morgen wirklich nicht so besonders. Komisch, mir tut die linke Seite weh – das kann nicht der Blinddarm sein, oder? Gestern Abend, auf der Fahrt zu Verg Gunch, hat mir auch der Bauch wehgetan. Genau hier – so ein scharfer, brennender Schmerz. Ich … Wo sind denn jetzt die zehn Cent hingerollt? Warum gibt’s zum Frühstück eigentlich nicht öfter Backpflaumen? Natürlich esse ich jeden Abend einen Apfel – ein Apfel am Tag, und dir bleibt der Arzt erspart –, aber trotzdem, du solltest öfter Pflaumen auf den Tisch stellen und nicht diesen abartigen Süßkram.»
«Letztes Mal, als es Pflaumen gab, hast du sie nicht angerührt.»
«Na ja, schätze mal, mir war nicht danach. Aber wenn ich mich recht erinnere, habe ich doch ein paar gegessen, oder? Wie auch immer – lass dir gesagt sein, es ist ungeheuer wichtig, dass … erst gestern Abend habe ich Verg Gunch gesagt, dass die meisten Leute nicht ausreichend auf ihre Verdau…»
«Sollen wir die Gunchs nächste Woche mal zum Abendessen einladen?»
«Klar, warum nicht.»
«Aber hör mal, George: Ich möchte, dass du an dem Abend deinen schicken Smoking anziehst.»
«Blödsinn! Die machen sich doch auch nicht fein.»
«Natürlich machen sie das. Weißt du noch, wie du dich als Einziger nicht für das Abendessen bei den Littlefields umgezogen hast? Und wie peinlich dir das war?»
«Mir peinlich? Quatsch, das war mir nicht peinlich. Weiß doch jeder, dass ich mir genauso gut einen teuren Abendanzug leisten kann wie alle anderen auch, warum also sollte ich mir da Sorgen machen, wenn ich ihn mal nicht trage? Ist doch sowieso alles nur eine elende Schinderei. Für eine Frau, die die ganze Zeit im Haus bleibt, mag das ja noch angehen, aber wenn ein Mann den lieben langen Tag schuftet wie ein Pferd, will er sich abends nicht noch schinden und sich für Leute in Schale werfen, die er tagsüber in ganz normalen Sachen gesehen hat.»
«Du weißt aber, wie es dir gefällt, dich im Smoking zu zeigen. Erst neulich hast du mir abends gesagt, wie froh du warst, dass ich darauf bestanden habe. Du würdest dich damit viel wohler fühlen, hast du gemeint. Und übrigens, Georgie, es wäre lieb von dir, wenn du nicht immer Abendanzug sagen würdest. Es ist ein Smoking.»
«Ach, Blödsinn, merkt doch sowieso keiner.»
«Tja, aber die meisten netten Leute sagen Smoking. Stell dir nur vor, Lucile McKelvey würde hören, wie du Abendanzug dazu sagst.»
«Als ob das so schlimm wäre! Lucile McKelvey kann mich mal. Sie stammt ja selbst aus ganz gewöhnlichem Hause, auch wenn ihr Mann und ihr Dad Millionäre sind! Oder versuchst du gerade, mir deine höhere gesellschaftliche Herkunft unter die Nase reiben? Falls dem so ist, dann lass dir gesagt sein, dass dein verehrter Vorfahr väterlicherseits, ein gewisser Henry T., den Smoking nicht mal Abendanzug nennt. Für ihn ist das ein ‹Schwalbenschwanz für Ringelschwanzaffen›, und wer ihn in ein solches Teil stecken wolle, der müsse ihn vorher erst betäuben!»
«Sei nicht so schnippisch, George.»
«Ach, ich mag ja gar nicht schnippisch sein, aber mein Gott, du wirst schon genauso pingelig wie Verona. Seit sie den College-Abschluss hat, hält man es mit ihr nicht mehr aus – die weiß einfach nie, was sie will – soll heißen, ich weiß genau, was sie will! –, sie will nämlich einen Millionär heiraten, in Europa leben und die Hand von irgend so einem Prediger halten, aber zugleich möchte sie hier in Zenith bleiben und eine nervtötende, sozialistische Agitatorin werden oder eine leitende Sozialarbeiterin oder was weiß ich! Herrje, und Ted ist genauso schlimm! Mal will er aufs College, mal wieder nicht. Tinka ist die Einzige von den dreien, die weiß was sie will. Mir geht gar nicht in den Kopf, dass ich so unentschlossene Kinder wie Rone und Ted habe. Denn auch wenn ich kein Rockefeller oder James J. Shakespeare5 bin, weiß ich doch immerhin, was ich will, und plackere mich weiterhin von Tag zu Tag im Büro ab und … Sag, hast du eigentlich schon das Neuste gehört? Wenn ich ihn richtig verstehe, hat Ted sich jetzt in den Kopf gesetzt, Filmstar zu werden und … Dabei habe ich ihm schon hundertmal gesagt, wenn er aufs College geht und ein gutes Jurastudium hinlegt, dann bringe ich ihn in meinem Geschäft unter und … Verona ist übrigens um keinen Deut besser. Hat keinen Schimmer, was sie will. Aber nun mach doch! Bist du noch nicht fertig? Das Mädchen hat schon vor drei Minuten geläutet.»
V
Ehe Babbitt seiner Frau folgte, blieb er kurz am Westfenster des Schlafzimmers stehen. Die Wohnsiedlung Floral Heights lag auf einem Hügel, und obwohl es bis zur Stadtmitte fünf Kilometer waren – Zenith besaß mittlerweile an die drei- bis vierhunderttausend Einwohner –, konnte er die Spitze des Second National Tower sehen, eines fünfunddreißigstöckigen Wolkenkratzers aus Indiana-Sandstein.
Vor dem Aprilhimmel ragten seine schimmernden Fassaden zu einem schlichten Kranzgesims empor, das wie ein Strahl aus weißem Feuer leuchtete. Der Turm stand für Integrität und Entschlusskraft und trug an seiner wuchtigen Macht so leicht wie ein hochgewachsener Soldat. Während Babbitt zum Gebäude hinübersah, wich jegliche Nervosität aus seinem Gesicht, und ehrfürchtig reckte er das schlaffe Kinn. «Was für ein Anblick!», brachte er nur hervor, während ihn der Rhythmus der Stadt aufleben ließ und seine Liebe zu ihr erneuerte. Der Turm war ihm ein Tempelschrein für die Religion des Geschäftemachens, für einen leidenschaftlichen, überschwänglichen, jeden einfachen Menschengeist weit übersteigenden Glauben; und wie er die Treppe zum Frühstück hinabging, pfiff er «Oh, by gee, by gosh, by jingo»6 vor sich hin, als wäre es eine so melancholische wie noble Ballade.
2. Kapitel
I
Erlöst von Babbitts Schusseligkeit und jenen leisen Lauten, mit denen seine Frau ihr Mitgefühl ausdrückte – das sie nicht empfand, weil sie dafür viel zu lebenserfahren war, doch war sie auch zu erfahren, um es nicht zur Schau zu stellen –, nahm das Schlafzimmer gleich wieder etwas Unpersönliches an.
Es führte zur Schlafveranda hinaus und diente ihnen als Ankleideraum. In kälteren Nächten gönnte sich Babbitt den Luxus, auf seine Mannespflicht zur Mannhaftigkeit zu verzichten, und zog sich ins Innere des Hauses zurück, krümmte im Warmen die Zehen und verlachte den Januarsturm.
Das Zimmer zeigte die schlichte, gefällige Farbgebung nach einem der gefragtesten Standarddesigns jenes Raumausstatters, der die Inneneinrichtung für die meisten Fertighäuser in Zenith entworfen hatte. Die Wände waren grau gestrichen, die Holztäfelung war weiß, der Teppich von heiterem Blau; und die Möbel sahen täuschend echt nach Mahagoni aus – die Kommode mit dem großen Spiegel, Mrs. Babbitts Frisiertisch mit den Toilettenartikeln aus fast massivem Silber, die beiden Einzelbetten, dazwischen ein kleiner Tisch mit einer elektrischen Standardnachtlampe, ein Glas Wasser und fürs Nachtschränkchen ein Standardbuch mit farbigen Illustrationen – unmöglich zu sagen, um was genau es sich dabei handelte, da noch niemand das Buch aufgeschlagen hatte. Die Matratzen waren fest, aber nicht hart, triumphal moderne Matratzen für ein Heidengeld, und der Heißwasserheizkörper entsprach exakt den für die Kubikmeterzahl dieses Raumes wissenschaftlich errechneten Maßen. Die Fenster waren groß, ließen sich mit den besten Schnüren und Scharnieren leicht öffnen, und die Holland-Jalousien besaßen eine garantiert lange Lebensdauer. Unter seinesgleichen war das Schlafzimmer geradezu ein Meisterwerk und wirkte wie einem Katalog für lebensfrohe moderne Häuser der mittleren Einkommenskategorie entsprungen. Nur hatte es nichts mit den Babbitts zu tun, auch mit sonst niemandem. Falls darin je gelebt und geliebt worden war, man um Mitternacht einen Thriller gelesen oder sich an einem Sonntagmorgen in wonniger Muße ausgeruht hatte, war davon nichts mehr zu bemerken. Es sah nach einem recht passablen Zimmer in einem recht anständigen Hotel aus. Man erwartete jeden Moment, dass das Zimmermädchen hereinkam und den Raum für Leute herrichtete, die nur eine Nacht blieben, ihn verließen, ohne sich noch einmal umzudrehen, und nie wieder einen Gedanken daran verschwendeten.
In jedem zweiten Haus in Floral Heights fand sich genau das gleiche Schlafzimmer.
Das Haus der Babbitts war fünf Jahre alt. Alles darin war so zweckdienlich und unpersönlich wie dieses Schlafzimmer. Es stellte besten Geschmack unter Beweis, hatte die besten preiswerten Teppiche, war von simplem, lobenswertem Schnitt und verfügte über die neuesten Annehmlichkeiten. Überall hatte der elektrische Strom Kerzen und schmutziges Kaminfeuer verdrängt. Allein für die Lampen gab es in der Fußleiste des Schlafzimmers drei unter kleinen Messingklappen verborgene Steckdosen. Im Flur fanden sich Steckdosen für den Staubsauger und im Wohnzimmer welche für Klavierlampe und Ventilator. Das schmucke Esszimmer (mit dem imposanten Eichenbuffet, einem Geschirrschrank mit Buntglasfenstern, cremefarbenem Wandputz und dem dezenten Stillleben, das einen auf Austern verendenden Lachs zeigte) verfügte über Steckdosen für die elektrische Kaffeemaschine sowie den elektrischen Toaster.
Kurz gesagt, es gab nur eines, was mit dem Heim der Babbitts nicht stimmte: Es war kein Zuhause.
II
Morgens kam Babbitt oft scherzend und beschwingt zum Frühstück, aber heute lief alles merkwürdig unrund. Während er würdevoll über den oberen Flur schritt, warf er einen Blick in Veronas Schlafzimmer und meinte entrüstet: «Was hat es für einen Zweck, der Familie ein erstklassiges Haus zu bieten, wenn sie es nicht zu schätzen weiß und nie in die Puschen oder zur Sache kommt?»
Er marschierte auf sie zu: Verona, eine plumpe, dunkelblonde junge Frau von zweiundzwanzig Jahren, die gerade das Bryn Mawr College abgeschlossen hatte und sich den Kopf nun einzig und allein über gesellschaftliche Verpflichtungen und Sex zerbrach, über Gott und jenen grauen, hoffnungslos aus der Fasson geratenen Sportdress, den sie heute trug. Ted – Theodore Roosevelt Babbitt – ein attraktiver, siebzehnjähriger Junge. Tinka – Katherine –, mit ihren zehn Jahren noch ein Kind, leuchtend rotes Haar und eine zu dünne Haut, die verriet, dass sie zu viele Süßigkeiten aß und zu viele Eiscremesodas trank. Als Babbitt in die Küche stapfte, ließ er sich seine leichte Gereiztheit nicht anmerken. Es hasste es, den Familientyrannen zu geben, und auch wenn er pausenlos herumnörgelte, hatte das eigentlich nichts zu bedeuten. «Hallo, Schnuckiputz!», rief er Tinka zu. Es war der einzige Kosename in seinem Repertoire – von «Liebes» und «Schatz» einmal abgesehen, die seiner Frau vorbehalten waren –, und er schleuderte ihn Tinka jeden Morgen entgegen.
In der Hoffnung, Magen und Gemüt damit zu besänftigen, stürzte er (hastig) eine Tasse Kaffee hinunter. Der Magen fühlte sich darauf nicht länger an, als gehörte er gar nicht zu ihm, dann aber begann Verona, pedantisch und nervig zu werden, und schlagartig kamen Babbitt wieder all jene Zweifel hinsichtlich Leben, Familie und Geschäft in den Sinn, die ihre Klauen bereits nach ihm ausgestreckt hatten, als sein Traum und mit ihm das schlanke Feenkind entflohen war.
Seit sechs Monaten machte Verona die Ablage im Büro von Gruensberg Lederwaren, hatte aber Aussicht auf eine Anstellung als Sekretärin von Mr. Gruensberg, wodurch sich, wie Babbitt betonte, «dein sündteures Studium wenigstens ein bisschen bezahlt machen könnte, ehe du irgendwann heiraten und eine Familie gründen wirst».
Da aber sagte Verona: «Ich habe mit einer Klassenkameradin geredet, die für einen Wohlfahrtsverein arbeitet – ach, Dad, zu der Milchbank7 da kommen die süßesten kleinen Babys! Und ich finde, ich sollte auch so was Lohnenswertes machen.»
«Was meinst du denn mit ‹lohnenswert›? Sobald du Gruenbergs Sekretärin wirst – und das wirst du ja vielleicht, falls du an deinem Steno arbeitest und nicht jeden Abend auf ein Konzert oder zu irgendeiner Quasselparty gehst –, ich schätze, dann merkst du bald, dass fünfunddreißig bis vierzig Mäuse die Woche durchaus lohnenswert sein können!»
«Weiß ich ja, aber … ach, ich will … mich nützlich machen … am liebsten würde ich in einem dieser Settlement-Heime8 arbeiten. Und ich frage mich, ob ich nicht ein Warenhaus überreden könnte, mich eine Fürsorgeabteilung mit hübschem Ruheraum, Chintzvorhängen und Korbsesseln einrichten zu lassen. Oder ich könnte…»
«Jetzt hör mir mal gut zu! Als Erstes musst du begreifen, dass dieses Gutmenschentum und all das Rumgeeiere, dieses Geschwafel von Settlement-Arbeit und Ruheraumerholung nichts anderes bedeuten, als dass du einen ersten Keil des Sozialismus in Gottes schöne Welt treibst. Je früher der Mensch kapiert, dass ihm auf Erden nichts geschenkt wird und er gar nicht erst darauf zu spekulieren braucht, dass es ständig bloß Gratiskost gibt und, ähm, all diese Gratiskurse und jede Menge Krimskrams und Tinnef für seine Kinder, wenn er es sich nicht selbst verdient, desto eher wird er sich an die Arbeit und ans Produzieren machen – produzieren, produzieren, produzieren! Das nämlich braucht unser Land, nicht diesen Schnickschnack, der nur die Willenskraft des Arbeiters lähmt und den Kindern Flausen in den Kopf setzt. Und du … wenn du dich an deine Arbeit hältst, statt so ein dummes Gewese zu machen … Ständig! Als junger Mann habe ich mir überlegt, was ich werden will, und mich durch dick und dünn daran gehalten, nur so habe ich es bis dahin geschafft, wo ich heute bin, und … Myra? Weshalb lässt du das Mädchen den Toast in so kleine Stückchen schneiden? Kriegt man ja kaum zu fassen. Und lauwarm sind sie auch noch!»
Ted Babbitt, Elftklässler an der großartigen East Side High School, hatte mit schluckaufähnlichen Geräuschen versucht, ihn zu unterbrechen, jetzt aber platzte es aus ihn heraus: «Sag, Rone, brauchst du …»
Verona wirbelte herum. «Würdest du wohl so nett sein, Ted, uns nicht zu unterbrechen, wenn wir uns über ernsthafte Dinge unterhalten?»
«Ach, Blödsinn», erklärte Ted kategorisch. «Seit wer den Fehler begangen hat, dich aus dem College zu entlassen, Ammonia, redest du pausenlos davon, was du nicht alles tun willst. Also, brauchst du … ich hätte heute Abend gern das Auto.»
Babbitt, schnaubend. «Ach ja, hättest du das gern! Vielleicht möchte ich ja auch damit fahren?» Verona, protestierend. «Ach ja, hättest du wohl gern, du Klugscheißer, wie? Ich brauche es aber selbst!» Tinka, jammernd: «Aber, Papa, du hast doch gesagt, du würdest heute Abend mit uns vielleicht nach Rosedale fahren!», und Mrs. Babbitt: «Vorsicht, Tinka, dein Ärmel hängt in der Butter.» Sie funkelten sich an, und Verona kreischte: «Wenn’s ums Auto geht, Ted, bist du richtig gemein!»
«Das bist du natürlich nicht! Überhaupt nicht!» Teds Abgeklärtheit konnte einem wahnsinnig auf die Nerven gehen. «Dabei willst du dir nach dem Essen nur den Wagen schnappen, um ihn vor dem Haus von irgendeinem Weibsbild abzustellen und dann den ganzen Abend über Literatuuur und all die Eierköpfe zu tratschen, von denen du einen heiraten wirst – falls er dir denn je einen Antrag macht!»
«Und ich finde, Dad hätte nie und nimmer zulassen dürfen, dass du mit dem Auto fährst! Du und diese widerlichen Jones-Jungs, ihr rast ja wie die Irren. Allein der Gedanke, dass du mit siebzig Sachen die Kurve am Chaautauqua Place nimmst!»
«Wo hast du denn den Blödsinn her? Du hast vor dem Auto doch einen derartigen Schiss, dass du mit angezogener Handbremse den Hügel raufschleichst.»
«Tu ich nicht! Und du … Gibst ständig damit an, wie viel du über Motoren weißt, aber Eunice Littlefield meint, du hättest behauptet, die Batterie treibe die Lichtmaschine an!»
«Du … ach, Mädchen, du kannst doch eine Lichtmaschine nicht mal von einem Differenzialgetriebe unterscheiden.» Nicht ohne Grund gab Ted sich so überheblich. Er war der geborene Mechaniker, wenn es um Motoren ging, ein Tüftler und Bastler; er hatte schon was von Konstruktionsplänen gebrabbelt, als es noch gar keine Konstruktionspläne gab.
«Genug jetzt!», fuhr Babbitt reflexartig dazwischen, während er sich die erste, ihn famos erquickende Zigarre des Tages ansteckte und dabei die belebende Droge der Schlagzeilen der «Advocate-Times» genoss.
Ted verlegte sich aufs Verhandeln: «Also ehrlich, Rone, eigentlich will ich den alten Schlitten gar nicht, aber ich habe einigen Mädels in meiner Klasse versprochen, ich würde sie zur Probe vom Schulchor fahren, und echt, ich habe nicht die geringste Lust dazu, aber ein Gentleman muss nun mal seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen.»
«Hör schon auf! Du und gesellschaftliche Verpflichtungen? In der Highschool?»
«Ach, sind wir jetzt was ganz Besonderes, weil wir auf diesem Gänsecollege waren, ja? Dann lass dir mal was gesagt sein. Es findet sich im ganzen Staat keine Privatschule, auf der es so fantastische Leute gibt wie im diesjährigen Gamma Digamma9. Von zwei Typen sind die Väter sogar Millionäre. Mann, weißt du, eigentlich müsste ich ja schon mein eigenes Auto haben wie so viele Schüler.»
Babbitt riss es fast vom Stuhl. «Ein eigenes Auto? Warum nicht gleich eine Yacht? Oder ein Haus mit Garten? Das schlägt dem Fass nun wirklich den Boden aus! Obwohl der Junge nicht mal seine Lateinprüfungen besteht, erwartet er von mir, dass ich ihm ein Auto finanziere, und sicherlich gleich auch noch einen Chauffeur und vielleicht sogar ein eigenes Flugzeug als Belohnung für die harte Arbeit, die es ihn kostet, mit Eunice Littlefield ins Kino zu gehen! Ehrlich, solltest du je erleben, dass ich dir ein Auto kaufe, dann …»
Nach einigem diplomatischen Hin und Her entlockte Ted seiner Schwester schließlich das Eingeständnis, dass sie am Abend tatsächlich bloß zum Sportzentrum fahren wollte, um sich dort die Hunde- und Katzenshow anzusehen. Also arbeitete Ted darauf hin, dass sie den Wagen vor dem Süßwarenladen gegenüber vom Sportzentrum abstellte, von wo er ihn sich holen wollte. Es folgten komplizierte Arrangements, die regelten, wo der Schlüssel hinterlegt wurde und wer auftankte, und da sie beide leidenschaftliche Anhänger des großen Motorgottes waren, ließen sie sich gleich auch noch ausgiebig über den Flicken am Ersatzreifen und über den verloren gegangenen Wagenhebergriff aus.
Der Waffenstillstand bröckelte, und Ted merkte an, dass ihre Freundinnen «ein Haufen gackernden Schnallen» waren – «hochnäsige, redselige Angeber». Seine Freude wiederum seien, so die Schwester, «abscheuliche Papageien und grässliche, dumme Quasselstrippen». Außerdem: «Ich finde es einfach ekelhaft, dass du rauchst, und diese Sachen, die du dir heute Morgen angezogen hast, die sind echt lachhaft – ehrlich, absolut widerlich.»
Ted stolzierte zum niedrigen, schräg angeschliffenen Spiegel, genoss den Anblick, der sich ihm bot, und grinste. Sein Anzug, der letzte Schrei in Sachen Old-Eli-Montur10, lag hauteng an, die knappe Hose fiel so eben noch über die blitzenden braunen Stiefel; er hatte eine Taille wie ein Balletttänzer, trug ein schrilles Karomuster und quer über den Rücken einen Gurt, der nichts gürtete. Sein Schal war ein riesiges schwarzes Seidentuch, das strohblonde Haar spiegelglatt und ohne Scheitel schlicht nach hinten gekämmt. Wenn er zur Schule ging, kam noch eine Mütze mit schaufelblattlangem Schirm dazu. Am allerstolzesten aber war er auf die Weste, um die er gebettelt, auf die er gespart und für die er Komplotte geschmiedet hatte, eine echte, rehbraune Butlerweste mit blassrosa verblichenen Tupfern, kleine, erstaunlich in die Länge gezogene Pünktchen. An deren unterem Ende trug er einen Highschool-Anstecker, ein Klassenabzeichen und eine Bruderschaftsnadel.
Aber nichts davon war von Bedeutung. Ted war geschmeidig, flink und rot im Gesicht; in den Augen (deren Blick er zynisch fand) lag etwas unverhohlen Begieriges, an dem so gar nichts Vornehmes war. Er winkte der armen pummeligen Verona zu und knurrte: «Sicher, ich finde uns auch über die Maßen lächerlich, ja geradezu abscheulichst; selbst mein neuer Schlips ist, fürchte ich, ein ziemlicher Schandfleck.»
Babbitt bellte: «Das kannst du laut sagen! Und während du dich bewunderst, lass dir nur noch gesagt sein, dass es deiner männlichen Schönheit bestimmt zuträglich wäre, wenn du dir die Eireste vom Mund wischen würdest!»
Verona kicherte, hatte sie für den Augenblick doch im größten aller großen Kriege, dem Familienkrieg, einen Sieg errungen. Ted warf ihr einen vernichtenden Blick zu, um dann Tinka anzuschreien: «Um Himmels willen, jetzt hör endlich auf, die ganze Zuckerdose über deinen Cornflakes auszukippen.»
Sowie Verona und Ted gegangen waren und Tinka sich nach oben verzogen hatte, stöhnte Babbitt auf und meinte zu seiner Frau: «Nette Familie, muss ich schon sagen! Ich bin ja selbst kein Heiliger und beim Frühstück manchmal vielleicht ein bisschen übellaunig, aber wie die endlos pla-pla-plappern, das ist einfach nicht auszuhalten. Ich schwöre dir, am liebsten würde ich mich manchmal irgendwohin verdrücken, wo ich wenigstens ein bisschen Ruhe finden kann. Wenn sich ein Mann sein Leben lang bemüht, den Kindern eine Zukunft und eine anständige Erziehung zu gewährleisten, ist es schon ziemlich frustrierend, wenn er hört, dass sie sich die ganze Zeit wie ein Haufen Kojoten ankläffen und nie … nie … Komisch, hier in der Zeitung steht … Nicht eine Sekunde mal Ruhe … Sag, hast du schon einen Blick in die Zeitung geworfen?»
«Nein, mein Lieber.» In dreiundzwanzig Jahren Eheleben hatte Mrs. Babbitt die Zeitung nur siebenundsechzig Mal in Gegenwart ihres Mannes in der Hand gehabt.
«Neuigkeiten ohne Ende. Gewaltiger Tornado im Süden. Die haben wirklich Pech da unten. Und hör mal, das hier ist wirklich klasse. Der Anfang vom Ende für diese Brut! Im New Yorker Unterhaus wurden Gesetze verabschiedet, die die Sozialisten endgültig ächten sollten! Und in New York streiken die Fahrstuhlführer, aber dafür sind jede Menge Studenten eingesprungen. Prima Jungs! Außerdem fordert eine Massenversammlung in Birmingham, man solle diesen Paddy deportieren, den De Valera, diesen irischen Aufwiegler.11 Wird auch höchste Zeit. Solche Aufwiegler werden doch sowieso alle mit deutschem Gold bezahlt. Überhaupt haben wir uns da gar nicht einzumischen, ob nun in die irische oder in sonst irgendeine Regierung. Finger weg davon, sag ich. Ach, und hier steht noch, aus wohlinformierten Kreisen in Russland verlautet, Lenin sei tot. Großartig. Kapier eh nicht, warum wir da nicht einfach einmarschieren und diesen bolschewistischen Haufen zum Teufel jagen.»
«Wenn du das sagst», erwiderte Mrs. Babbitt.
«Hier steht noch, einer hätte bei seiner Amtseinführung als Bürgermeister einen Overall getragen – noch dazu ein Priester! Was sagst du dazu?»
«Tja, hmmm!»
Er suchte nach der richtigen inneren Einstellung, fand aber, dass ihm weder sein Leben als Republikaner noch als Presbyterianer, als Elk oder als Makler vorgaben, was er von einem predigenden Bürgermeister zu halten hatte, weshalb er grummelnd weiterlas. Sie sah ihn mitfühlend an und kriegte kein einziges Wort mit. Später würde sie die Schlagzeilen überfliegen, die Klatschspalten und die Kaufhausinserate.
«Was sagt man denn dazu! Charles McKelvey hält die bessere Gesellschaft mal wieder mit einer seiner Partys in Atem. Jetzt hör dir an, wie diese Reporterin davon schwärmt:
Nichts schmeichelt der High Society mehr, als wenn sie wie gestern Abend in die ebenso vornehme wie gastfreundliche Residenz von Mr. und Mrs. Charles L. McKelvey geladen ist. Das inmitten von Landschaftsgärten und weitläufigen Rasenflächen gelegene Haus, welches einen der spektakulärsten Ausblicke auf die Hügel von Royal Ridge bietet, gilt trotz mächtiger Steinmauern und seiner für die Inneneinrichtung berühmten, riesigen Räumlichkeiten als ein ebenso reizvolles wie anheimelndes Domizil, dessen Tore gestern für einen Tanzabend zu Ehren von Mrs. McKelveys angesehenem Gast, Miss J. Sheeth aus Washington, geöffnet wurden. Die weitläufige Halle ist von solch großzügigen Dimensionen, dass sie einen perfekten Ballsaal abgibt, in dessen gewienertem Parkett sich das prächtige Schauspiel spiegelte. Doch selbst Tanzfreuden verblassten vor den verlockenden Gelegenheiten zu diversen Tête-à-Têtes, die die Herzen dazu verführten, sich in der lang gezogenen Bibliothek vor dem herrschaftlichem Kamin zu vergnügen oder im Salon mit den tiefen, bequemen Sesseln, deren gedimmte Lampen für scheu hingehauchte Nichtigkeiten à deux wie gemacht zu sein scheinen, oder auch im Billardsaal, in dem man zum Queue greifen und seine Geschicklichkeit bei einem Spiel beweisen konnte, das weder von Cupido noch Terpsichore beflügelt wurde.»
Es stand noch mehr zu lesen da, noch viel mehr, alles im versiertesten Großstadtstil von Miss Elnora Pearl Bates, der beliebten Klatschkolumnistin der «Advocate-Times». Aber Babbitt hatte genug davon. Er knurrte; dann knüllte er die Zeitung zusammen und polterte los: «Ist das zu fassen? Charley McKelvey in allen Ehren, aber als wir zusammen auf dem College waren, da ging’s ihm genau so dreckig wie den meisten von uns. Sicher, er hat im Baugeschäft ein paar satte Millionen gemacht und ist dabei nicht unredlicher vorgegangen als manch anderer, hat sogar nicht mehr Stadträte gekauft als unbedingt nötig. Und sein Haus ist auch ganz gut – selbst wenn es keine ‹mächtigen Steinmauern› hat und die neunzigtausend nicht wert war, die dafür hingeblättert wurden. Aber wenn die jetzt so tun, als wären Charley McKelvey und seine versoffene Schickeria eine verdammte Sippe von, von Vanderbilts, dann kann ich nur müde gähnen!»
Daraufhin Mrs. Babbitt zaghaft: «Ihr Haus würde ich mir ja gern mal ansehen. Ist bestimmt schön. Ich hab nie einen Fuß reingesetzt.»
«Ich schon! Oft – na ja, ein paar Mal. War abends wegen irgendwelcher Geschäfte bei Chaz. So toll ist es da auch wieder nicht. Ich würde nicht mal freiwillig mit dieser Bande von … von Angebern essen wollen. Und ich möchte wetten, dass ich ein hübsches Sümmchen mehr verdiene als so mancher von diesen Großmäulern, die ihr ganzes Geld für einen Abendanzug ausgeben, dabei aber keinen anständigen Satz Unterwäsche besitzen! Sag, was hältst du davon?»
Mrs. Babbitt blieb von den neusten Nachrichten der Makler- und Baubranche in der «Advocate-Times» seltsam ungerührt:
Ashtabula Street, 496 – J. K. Dawson an
Thomas Mullally; 17. April; 15.7 x 112,2;
Hyp. 4000 $………………. Nom.
An diesem Morgen aber war Babbitt zu nervös, um sie noch länger mit Einzelheiten über das Zurückbehaltungsrecht bei Handwerkern, eingetragenen Hypotheken oder Auftragserteilungen zu unterhalten.
Er erhob sich. Und während er sie anschaute, wirkten seine Augenbrauen noch buschiger als gewöhnlich.
Dann, unvermittelt: «Ja, vielleicht … irgendwie doch schade, wenn man zu Leuten wie den McKelveys keinen Kontakt hält. Wir könnten sie ja mal abends zum Essen einladen. Ach, Mist, was verschwenden wir unsere kostbare Zeit mit Gedanken an derartige Leute! In unserem kleinen Bekanntenkreis geht es viel lustiger zu als bei diesen reichen Schnöseln. Vergleich einer nur einen leibhaftigen Menschen wie dich mit solch neurotischen Vögeln wie diese Lucile McKelvey – nichts als hochgestochenes Geschwafel und immer geschniegelt und gestriegelt wie ein Zirkuspferd! Dagegen bist du ein echtes Prachtweib, meine Liebe!»
Ein Anflug von Sentimentalität, den er gleich mit einer Beschwerde kaschierte: «Hör mal, lass Tinka nicht noch mehr von dieser Nusscreme essen. Ist das reinste Gift für das Mädchen. Sorg also um Himmels willen dafür, dass sie aufhört, sich ihre Verdauung zu verderben. Ich sag dir, die meisten Leute haben keine Ahnung, wie wichtig eine einwandfreie Verdauung und ein geregeltes Leben sind. Bin zur üblichen Stunde zurück, denke ich.»
Er küsste sie – na ja, nicht so richtig –, er streifte mit reglosen Lippen ihre nicht errötenden Wangen.
Er hastete zur Garage hinaus und grummelte: «Gott, was für eine Familie! Und jetzt jammert mir Myra auch noch die Ohren voll, weil wir nicht in diesen Millionärskreisen verkehren. Mein Gott, manchmal würde ich den ganzen Kram am liebsten einfach hinwerfen. Und der Ärger im Büro ist genauso schlimm. Da reagiere ich eben mal übellaunig – will ich gar nicht, es überkommt mich aber … Mann, bin ich müde!»
3. Kapitel
I
Wie für die meisten wohlhabenden Bewohner von Zenith bedeutete das Auto für George F. Babbitt zugleich Poesie und Tragödie, Liebe und Heldentum. Das Büro war sein Piratenschiff, das Auto aber der gefährliche Landgang.
Keine der enormen tagtäglichen Herausforderungen gestaltete sich wohl so dramatisch wie das Anlassen des Motors. An kalten Vormittagen kam er nur langsam in Schwung; dann war das lange, besorgniserregende Surren des Starters zu hören, und manchmal musste er sogar Äther auf die Zylinderventile träufeln, was er so überaus interessant fand, dass er beim Mittagessen über jeden einzelnen Tropfen Bericht erstatten und laut vorrechnen würde, wie viel ihn jeder Tropfen gekostet hatte.
An diesem Morgen war er ganz schwarzseherisch darauf gefasst, dass irgendwas schief lief, weshalb er sich seltsam betrogen fühlte, als das Gemisch mit einem satten, süßen Knall explodierte und der Wagen beim Zurücksetzen aus der Garage nicht einmal den von vielen Kollisionen mit der Stoßstange angeschrammten und etwas abgesplitterten Torpfosten streifte. Babbitt war verwirrt und wünschte Sam Doppelbrau weit herzlicher als beabsichtigt einen «Guten Morgen!».
Das grün-weiße, im holländischen Kolonialstil gehaltene Haus der Babbitts war eines von dreien in der Chatham Road. Links von ihnen wohnte Mr. Samuel Doppelbrau, Leiter einer renommierten Großhandelsfirma für Sanitärbedarf. Er besaß ein behagliches Haus, doch ohne jeden erkennbaren architektonischen Stilwillen, eine große Holzkiste mit gedrungenem Turm und breiter Veranda, gestrichen in glänzendem Eidottergelb. Babbitt tat Mr. und Mrs. Doppelbrau gern missbilligend als «Bohemiens» ab, da aus deren Haus oft noch um Mitternacht Musik und obszönes Gelächter drangen, und in der Nachbarschaft kursierten Gerüchte über Schmuggelwhisky und Autorennen. Die Doppelbraus lieferten Babbitt jedenfalls Gesprächsstoff für so manch unterhaltsamen Abend, bei denen er gern mit fester Stimme verkündete: «Ich bin durchaus kein Puritaner, und ich finde auch nichts dabei, wenn man sich hin und wieder ein Schlückchen genehmigt, aber wenn man wie die Doppelbraus ständig über die Stränge schlägt, geht mir das für meinen Geschmack doch ein bisschen zu weit!»
Den Babbitts gegenüber wohnte Dr. Howard Littlefield in einem durch und durch modernen Bau, die untere, mit bleigefasstem Erkerfenster verzierte Hälfte aus dunkelrotem Klinker, die obere Hälfte ein fahler Verputz wie aus rissigem Lehm. Littlefield galt in der Nachbarschaft als großer Gelehrter, als Autorität in allen Dingen, außer Kochen, Motoren oder Kleinkinder. Er hatte am Blodgett College seinen Bachelor gemacht, in Yale einen Doktor in Wirtschaftsphilosophie und war nun Personalchef und Pressesprecher bei der Street Traction Company in Zenith. Innerhalb von zehn Stunden war er imstande, vor dem Stadtrat oder dem Kongress aufzutreten und mit ordentlich aufgereihten Zahlen sowie Präzedenzfällen aus Polen und Neuseeland zweifelsfrei zu belegen, dass seine Straßenbahngesellschaft die Öffentlichkeit geradezu liebte und ihr alles an den eigenen Angestellten lag, dass sämtliche Aktien von Witwen und Waisen gehalten wurden und dass alles, was die Firma zu tun beabsichtigte, dank wachsender Pachteinnahmen den Hausbesitzern und Grundstückseignern sowie dank sinkender Mieten den Armen zugutekam. Wer Littlefield kannte, wandte sich an ihn, wenn er wissen wollte, wann genau die Schlacht bei Saragossa stattgefunden hatte, was das Wort «Sabotage» eigentlich bedeutete, wie es um die Zukunft der deutschen Mark bestellt war, wie man «hinc illae lacrimae!»12 übersetzte oder wie viele Produkte sich aus Kohlenteer gewinnen ließen. Babbitt bewunderte ihn, seit Littlefield ihm gestanden hatte, er säße oft noch bis Mitternacht da und studiere die Zahlenwerke und Zusätze von Regierungsberichten oder überflöge die jüngsten Veröffentlichungen über Chemie, Archäologie oder Ichthyologie, wobei er sich köstlich über die Irrtümer der Autoren amüsiere.
Littlefields größtes Verdienst aber bestand darin, ein intellektuelles Vorbild abzugeben. War er doch trotz seiner etwas befremdlichen Gelehrsamkeit ein ebenso strammer Presbyterianer und überzeugter Republikaner wie George F. Babbitt. Er bestärkte die Geschäftsleute in ihrem Glauben. Wo sie bloß durch leidenschaftliche Intuition von der Vollkommenheit ihrer Geschäfts- und Umgangsformen überzeugt waren, konnte Dr. Howard Littlefield ihnen diese Vollkommenheit mit Verweisen auf Geschichte, Ökonomie und den Bekenntnissen geläuterter Radikaler belegen.
Babbitt war aufrichtig stolz darauf, einen derart gebildeten Menschen zum Nachbarn zu haben, ebenso auch auf Teds Freundschaft zu Eunice Littlefield. Mit ihren sechzehn Jahren war Eunice zwar an keinerlei Statistiken außer jenen interessiert, in denen es um das Alter und die Einkünfte von Filmstars ging, doch war sie – wie Babbitt es so schlüssig formulierte – «nun einmal ihres Vaters Tochter».
Allein ihr Äußeres machte den Unterschied zwischen einem so oberflächlichen Mann wie Sam Doppelbrau und einem so prachtvollen Menschen wie Littlefield deutlich. Doppelbrau wirkte verstörend jung für jemanden von achtundvierzig Jahren. Er trug die Melone stets in den Nacken geschoben, und sinnloses Lachen hatte das rote Gesicht in viele Fältchen gelegt. Für einen zweiundvierzigjährigen Mann sah Littlefield dagegen eher alt aus. Er war hochgewachsen, breitschultrig und füllig; tief grub sich die Goldrandbrille in die Falten seines länglichen Gesichts; das fettige Haar war eine wirre, schwarze Masse; er schnaubte und kollerte beim Reden; der Phi-Beta-Kappa-Schlüssel blitzte auf fleckiger schwarzer Weste; er roch nach altem Pfeifenrauch und erinnerte alles in allem an Beerdigung und Erzdiakon, wodurch er die Grundstücksmaklerei und den Großhandel mit Sanitärbedarf um einen Anflug höherer Weihen bereicherte.
An diesem Morgen stand er vorm Haus und inspizierte das Gras zwischen Rinnstein und breitem Zementfußweg. Babbitt hielt an, beugte sich aus dem Fenster und rief: «Morgn!», woraufhin Littlefield zum Wagen schlenderte und ein Bein aufs Trittbrett stellte.
«Ein schöner Morgen», sagte Babbitt, der sich – verboten früh – die zweite Zigarre des Tages ansteckte.
«Ja, ein wirklich schöner Morgen», erwiderte Littlefield.
«Der Frühling kommt mit mächtigen Schritten.»
«Ja, stimmt, jetzt wird’s richtig Frühling», sagte Littlefield.
«Die Nächte sind aber noch kalt. Habe letzte Nacht auf der Schlafveranda eine zusätzliche Decke gebraucht.»
«Ja, war nicht allzu warm letzte Nacht».
«Aber ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt noch mal richtig kalt wird.»
«Nein, wohl nicht, allerdings hat es in Tiflis, Montana, gestern geschneit», erwiderte der Gelehrte, «und vergessen Sie den Schneesturm nicht, der vor drei Jahren drüben im Westen tobte – ein halber Meter Schnee in Greeley, Colorado; außerdem kam vor zwei Jahren, am fünfundzwanzigsten April, auch in Zenith noch mal richtig Schnee runter.»
«Ist das zu fassen? Sagen Sie, alter Knabe, was halten Sie eigentlich vom Kandidaten der Republikaner? Wer wird für die Präsidentschaftswahl aufgestellt? Und finden Sie nicht auch, es wäre mal an der Zeit, dass wir eine Regierung aus reinen Geschäftsleuten bekommen?»
«Meiner Meinung nach braucht das Land nichts so dringend wie eine gute, solide, geschäftsmäßige Regelung all seiner Angelegenheiten. Und das heißt, wir brauchen eine Regierung aus Geschäftsleuten, ganz genau!», erwiderte Littlefield.
«Freut mich, dass Sie das sagen! Freut mich wirklich! Ich wusste ja nicht, wie Sie in dieser Sache denken, wo Sie doch so viele Verbindungen zu Colleges haben und so, aber ich bin mächtig froh, das jetzt von Ihnen zu hören. Was dieses Land nämlich braucht – gerade jetzt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt –, das ist kein College-Präsident und keine Mätzchen in der Außenpolitik, sondern eine gute – solide – ökonomische – geschäftsorientierte Verwaltung, damit wir wieder auf anständige Umsätze hoffen können.»
«Genau. Es hat sich zwar noch nicht bis zu allen rumgesprochen, aber selbst in China müssen die Akademiker jetzt nach und nach den Praktikern Platz machen, und man weiß natürlich, was daraus folgt.»
«Was Sie nicht sagen! Also ehrlich!», hauchte Babbitt und fühlte sich angesichts der Weltlage gleich viel beruhigter und zufriedener. «Tja, war wirklich nett, unser Pläuschchen. Fürchte, jetzt muss ich ins Büro und ein paar Kunden bearbeiten. Machen Sie’s gut, alter Knabe. Man sieht sich am Abend. Bis dann.»
II
Sie hatten viel geleistet, diese braven Bürger. Noch vor zwanzig Jahren war der Hügel, auf dem sich heute Floral Heights mit seinen glänzenden Dächern, makellosen Rasenflächen und den vielen erstaunlichen Annehmlichkeiten erstreckte, eine Wildnis nachgewachsener, üppig wuchernder Ulmen, Ahornbäume und Eichen gewesen. Entlang der schnurgeraden Straßen gab es auch heute noch einige brachliegende Waldparzellen und die Überreste einer alten Obstwiese. Es war ein herrlicher Tag; an den Ästen der Apfelbäume sprossen die jungen Blätter wie Fackeln aus grünem Feuer, die ersten weißen Kirschblüten strudelten durch einen Gully, und Rotkehlchen lärmten.
Babbitt sog den Erdgeruch ein und schmunzelte angesichts der Rotkehlchen, wie er über spielende Kätzchen oder einen Zeichentrickfilm geschmunzelt hätte. Äußerlich bot er den Anblick des perfekten Geschäftsmannes auf dem Weg ins Büro – wohlgenährt, mit untadeligem braunem Filzhut, randloser Brille, großer Zigarre im Mund und auf vorstädtischer Schnellstraße am Steuer eines passablen Wagens. In ihm aber schlummerte eine aufrichtige Liebe für sein Viertel, seine Stadt und seinesgleichen. Der Winter war vorüber und die Zeit fürs Bauen gekommen, für sichtbares Wachstum; für Babbitt gab es nichts Schöneres. Die morgendliche Depression verflog, und er verbreitete rotwangigen Frohsinn, als er in der Smith Street hielt, um die braune Hose abzugeben und den Wagen vollzutanken.
Die Vertrautheit dieses Rituals gab ihm Kraft, der Anblick der roten, hohen, metallenen Benzinpumpe, die Werkstatt mit ihren Hohlziegeln und Terrakottafliesen, die mit ansprechendem Zubehör gefüllten Schaufenster: blitzende Gehäuse, Zündkerzen mit makellosem Porzellanmantel oder gold- und silberfarbene Schneeketten. Ihm schmeichelte die Freundlichkeit, mit der Sylvester Moon, der dreckigste, aber geschickteste aller Mechaniker, auf ihn zukam, um ihn zu bedienen. «Morgen, Mr. Babbitt!», rief er, und Babbitt kam sich wichtig vor, war er doch ein Mann, an dessen Namen sich sogar Tankstellenbedienstete erinnerten – nicht bloß einer dieser Windhunde, die in ihren Blechkisten durch die Gegend rasten. Er bewunderte, welch Genialität hinter der automatischen Anzeige steckte, die klickend Gallone um Gallone abzählte, bewunderte den klugen Spruch auf dem Schild: «Wer rechtzeitig tankt, bleibt nicht auf der Straße liegen – Benzin heute 31 Cent», bewunderte das rhythmische Gurgeln, mit dem der Sprit in den Tank floss, und die routinierte Gleichmäßigkeit, mit der Moon den Pumpschwengel bediente.
«Wie viel soll’s denn heute sein?», fragte Moon in einem Ton, in dem sich die Souveränität des Fachmanns, die Freundlichkeit vertrauten Plauderns und der Respekt für einen Mann von solch gesellschaftlicher Bedeutung wie George F. Babbitt mischten.
«Machen Sie ruhig voll.»
«Was glauben Sie, Mr. Babbitt, welcher Kandidat bei den Republikanern wohl das Rennen macht?»
«Ist für Vorhersagen noch ein bisschen früh. Uns bleiben ja noch ein guter Monat und zwei Wochen – nein, drei Wochen … müssen fast noch drei Wochen sein … egal, jedenfalls sind es noch über sechs Wochen bis zum Wahlkonvent der Republikaner; und ich finde, unsereins sollte unvoreingenommen bleiben und alle Kandidaten unter die Lupe nehmen – sie sich von Kopf bis Fuß ansehen und prüfen und dann mit Bedacht entscheiden.»
«Sehr richtig, Mr. Babbitt.»
«Aber ich sag Ihnen was – und meine Haltung in dieser Sache ist dieselbe wie vor vier Jahren und vor acht Jahren, und sie wird auch in vier Jahren noch dieselbe sein, ja sogar in acht Jahren noch! Ich erzähle aller Welt, was gar nicht allgemein genug verstanden werden kann, dass wir nämlich als Erstes, als Letztes und ganz grundsätzlich eine gute, solide Regierung von Geschäftsleuten brauchen!»
«Mein Gott, ja, da haben Sie völlig recht!»
«Was halten Sie von den Vorderreifen?»
«Prächtig! Prächtig! Gäb für Werkstätten nicht viel zu tun, wenn sich alle so um ihren Wagen kümmern, wie Sie das tun.»
«Tja, ich gebe mir auch Mühe, ein bisschen vernünftig damit umzugehen.» Babbitt zahlte, fand es angemessen zu sagen: «Ach, behalten Sie das Wechselgeld» und fuhr in einer wahren Ekstase redlichen Selbstgefallens davon. Mit dem Gebaren eines guten Samariters rief er einem respektabel aussehenden Mann an der Straßenbahnhaltestelle zu: «Soll ich Sie mitnehmen?» Und als der Mann einstieg, erkundigte er sich leutselig: «Direkt in die Stadt? Wissen Sie, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, immer jemanden mitzunehmen, wenn ich sehe, dass er auf die Elektrische wartet – natürlich nur, falls er nicht gerade aussieht wie ein Penner.»
«Wäre schön, wenn mehr Autofahrer so großzügig dächten», erwiderte das Opfer seines Wohlwollens pflichtschuldig.
«Ach was, ist doch keine Frage von Großzügigkeit. Tatsache bleibt – was ich übrigens erst gestern Abend meinem Sohn gesagt habe –, dass ich schon immer fand, es sei unsere Pflicht, die guten Dinge dieser Welt mit unseren Mitmenschen zu teilen; und es geht mir wirklich gegen den Strich, wenn sich wer was drauf einbildet und mächtig damit angibt, nur weil er sich mal ein bisschen wohltätig gezeigt hat.»
Da das Opfer unfähig schien, eine passende Antwort zu finden, polterte Babbitt weiter: «Ziemlich dürftiger Betrieb der Verkehrsgesellschaft auf diesen Strecken. Ist doch Nonsens, dass die Elektrische in der Portland Road nur alle sieben Minuten daherkommt. Da kann es an einem Wintermorgen schon mal verdammt kalt werden, wenn man an der Straßenecke wartet und einem der Wind um die Knöchel pfeift.»
«Stimmt. Die Street Car Company kümmert es einen Dreck, wie es uns geht. Denen sollte man mal Bescheid stoßen.»
Babbitt erschrak. «Aber natürlich geht es auch nicht an, ständig nur über die Bahn zu meckern wie diese Spinner, die sie in den Besitz der Kommune überführen wollen, ohne eine Ahnung davon zu haben, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hat. Allein wie die Arbeiter ihre Firma wegen höherer Löhne unter Druck setzen, ist schlicht und einfach ein Verbrechen, und diese Last fällt natürlich auf Sie und mich zurück, die wir sieben Cent pro Fahrschein zahlen! Wenn man das bedenkt, bieten sie auf ihren Strecken eigentlich noch einen ganz passablen Service.»
«Tja …», klang es gequält.
«Verdammt schöner Morgen», konstatierte Babbitt. «Der Frühling kommt mit mächtigen Schritten.»
«Stimmt, es wird Frühling.»
Dem Opfer fiel offenbar nichts Originelles, Witziges ein, und Babbitt versank in tiefes Schweigen und widmete sich dann ganz dem Vergnügen, bis zur nächsten Ecke die Straßenbahn zu überholen: Gas geben, dicht auffahren, hektisch beschleunigen, eingezwängt zwischen riesiger gelber Straßenbahn und der Reihe unregelmäßig geparkter Wagen, dann genau in dem Moment, in dem die Bahn hielt, dran vorbeischießen – eine ganz spezielle Jagd und Mutprobe.
Und währenddessen war er sich ohne Unterlass der Schönheit von Zenith bewusst. Seit Wochen nahm er bloß Kunden oder die vermaledeiten «Zu vermieten»-Schilder seiner Konkurrenten wahr. Heute aber, dank einer unerklärlichen Unpässlichkeit, tobte und triumphierte er in schnellem nervösem Wechsel, wobei das Licht des Frühlings so reizvoll war, dass er den Kopf hob und schaute.