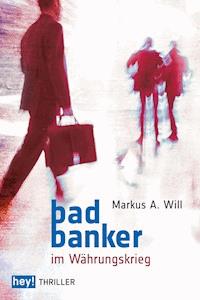
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bad Banker
- Sprache: Deutsch
Ein Wirtschaftskrimi am Puls der Zeit. Wer hätte gedacht, dass der Euro zu einer griechischen Tragödie mutiert? Oder dass China und die USA einen Krieg führen, von dem niemand so richtig etwas mitbekommt? Der Schweizer Bankier Carl Bensien will mit Hilfe einer geheim operierenden "Viererbande", die seit Jahren über den "Schwur von Piräus" verbunden ist, die Welt vor dem drohenden Desaster bewahren. Während sich die Staaten wie in einem Stellungskrieg belauern, beginnt Bensien wie ein Agent in feindlichen Lagern zu operieren. Doch nicht nur den Bad Banker ist Bensien ein Dorn im Augen, sondern auch dem ein oder anderem Staat ... Markus A. Will liefert mit "Bad Banker im Währungskrieg" eine brandaktuelle Erweiterung von "Der Schwur von Piräus" (2011), in der die Verbrechen um die Eurokrise in über 60 Extraseiten bis Ostern 2013 weitergeschrieben werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Markus A. Will
Bad Banker im Währungskrieg
Thriller
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München
Originalausgabe © 2011 bei Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Markus A. Will wird vertreten durch die Agentur Lianne Kolf, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
ISBN: 978-3-942822-06-0
Von Markus A. Will ebenfalls bei hey! erschienen:
Bad Banker und das Holiri-Komplott
Bad Banker im Währungskrieg ist die unabhängig lesbare Fortsetzung von Bad Banker und das Holiri-Komplott.
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
www.markuswill.com
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil I: Sprachlos in Davos
7. und 8. Januar 2010
11. bis 15. Januar 2010
26. bis 31. Januar 2010
Teil II: Alles nur Theater
1. bis 10. Mai 2010
20. bis 27. Juni 2010
13. September bis 31. Oktober 2010
Teil III: DEAD BANKER
25. bis 31. Januar 2011
7. bis 30. Juni 2011
Teil IV: Erneuter Schwur
Oktober 2011 bis Januar 2012
Mai bis September 2012
Oktober 2012 bis Dezember 2012
EPILOG
Dank
Leseprobe: Mord bei Pooh Corner
„Bad Banker im Währungskrieg“ ist die Fortsetzung von „Bad Banker und das Holiri-Komplott“ und die brandaktuelle Ergänzung der 2011 erschienenen Hardcover-Version „Der Schwur von Piräus“. Sie führt die fiktionale Chronologie der Eurokrise in über 60 Extraseiten (Prolog und Zusatzteil IV: „Erneuter Schwur“) bis Ostern 2013 weiter.
Die Handlung reicht mithin vom Ausbruch der Eurokrise in Griechenland im Frühjahr 2010 bis zur Sonderkrise auf Zypern 2013. Dazwischen morden und lieben sich die Helden und Typen des globalen Bankensystems.
Und an Ostern 2013 gibt es nicht nur eine Auferstehung von den Toten, sondern auch das letzte Abendmahl eines Zentralbankers aus Griechenland …
Prolog
Letztes Abendmahl
„Cyprus was not too big to fail.” Wenn er über die Eurokrise sprach, rutschte Dr. Konstantin Diospolos immer wieder ins Englische. Seine dazu passende, herablassende Handbewegung brachte Stratos auf die Palme. Von seinem wütenden Zittern klapperte sogar das Messer leicht auf dem säuberlich leer gegessenen Teller. Der im feinen Zwirn gewandete Europäische Zentralbanker Diospolos war sein letzter Gast an diesem Gründonnerstagabend 2013.
Dieser Arroganzling, vor dem Stratos, der Chef des „El Greco“ mit dem Geschirr stand, war nicht mehr der Diospolos, den er kannte, als dieser noch in den niederen Chargen der Europäischen Zentralbank gearbeitet hatte. Er war nicht mehr der junge Grieche aus bestem sozialistischem PASOK-Hause, der mit Unterbrechungen schon viele Jahre in seinem Restaurant in Frankfurts Innenstadt etwas Heimat suchte. Nicht der Diospolos, der ihm Kunstwährungen á la Bitcoins und der Deutschen Liebe zur alten D-Mark so leichter Hand erklären konnte. Doch Diospolos war es überdrüssig, diese Verrücktheiten noch normalen Menschen zu erklären, einfach zu müde geworden. Ausgelaugt war der monetäre Powerman. Zurzeit schienen die Bürger irgendwie allen alten oder digitalen Währungen mehr Vertrauen entgegenzubringen als dem Euro.
Natürlich wusste der kleine Restaurantbesitzer Stratos nicht, mit welchen Problemen die großen Zentralbanker zu kämpfen hatten. Bitcoins schossen in die Höhe, obwohl kein Mensch sie garantierte, sondern ein Algorithmus im Computer sie berechnete. Deutsche Volkswirtschaftsprofessoren gründeten eine „Alternative für Deutschland“ und wollten alternativlos raus aus dem Euro. Was war dagegen diese kleine mickerige Insel der Aphrodite im Mittelmeer?
Aber das wusste Stratos natürlich nicht. Doch noch einmal würde er für seinen späten Stammgast aus der EZB wohl nicht wieder selbst die Küche anschmeißen, nachdem schon alle Gäste weg waren und ihm eine kleine Platte mit Gyros, Souvlaki, Zaziki und Taramasalata machen. Stratos griff nach dem klappernden scharfen Messer, mit dem Diospolos ungestüm das Fleisch bearbeitet hatte. Selbst beim Essen hatte er kaum mehr Zeit. Gehetzt, gestresst und genervt. Das war seine seit Monaten vorherrschend unbeherrschte Art geworden.
Der Währungskrieg hatte auch aus ihm einen bad banker gemacht. Ob es schon die Zeit beim Internationalen Währungsfonds, die kurze Episode als Staatsminister in Athen oder die Sonderrolle in Italien gewesen war, wusste Stratos nicht. Doch spätestens seit er als Büroleiter von Mario Draghi, dem Präsidenten der EZB, arbeitete, war er anders geworden. „Decisiveness“ war seine Lieblingsvokabel, zur Beschreibung der in unzähligen Krisen zur einzig wahren Macht in Europa aufgestiegenen EZB.
Wenn die Zentralbanker wie in der letzten Woche über Zypern ihren Daumen zu senken bereit waren, dann ging die Schlacht in ihre entscheidende Phase. Unmissverständlich hatte der Rat der EZB den Zyprioten ein Ultimatum gesetzt: ELA sollte wegfallen. Das war kein Kosename für eine Muse, sondern die Kurzform für die Emergency Liquidity Assistance, mit der die zypriotischen Banken mit Geld versorgt wurden, das ihnen niemand anders mehr geben wollte.
Erst nach dieser kleinen Argumentationshilfe – anderen nannten es Erpressung – knickten die Zyprioten ein. „Anderenfalls wäre es so gewesen, als würden einem Intensivpatienten die lebenserhaltenden Apparate abgestellt“, hatte Dispo Stratos während des Hauptganges erklärt, um sein Gleichnis dann selbst lachend als „schief“ zu bezeichnen, „weil die Zyprioten ja gar nicht leben wollten.“ Da war Stratos zum ersten Mal der Kamm geschwollen, aber er hatte sich noch einmal zurückgehalten.
„Was erlaubte sich dieser griechische Arroganzling eigentlich, seit er mit diesem Italiener ohne jede demokratische Legitimation Europa unter das Kuratel der Zentralbank stellte?“, schoss es ihm durch den Kopf. „Angeführt ausgerechnet von einem italienischen Geldgeneral, dessen eigenes Heimatland noch nicht einmal eine stabile Regierung zustande brachte, hoch verschuldet und neben Frankreich doch das wahre Risikoland für den Euro war. So sah es doch aus“, glaubte Stratos. Außerdem schien alles ein bisschen ruhiger in Europa geworden zu sein, seit Griechenland gerettet und die anderen Südländer versorgt waren. Aber das war nur eine trügerische Ruhe gewesen.
Dann kam Zypern. Es war das Zeichen, wie (be)trügerisch doch eigentlich alles war. Stratos verstand die Welt nicht mehr. Auch er hatte jetzt natürlich begriffen, dass das Geschäftsmodell der Mittelmeerinsel, das bislang fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausgemacht hatte, nicht mehr existent war. Allein der Gedanke daran ließ nun auch noch die Gabel auf dem Teller klappern. Der griechische Inselteil hatte als Teil des Eurosystems russische Schwarzgelder und sonstige Mafiamoneten mit hohen Renditen für griechische Staatsanleihen auf die Mittelmeerinsel gelockt. Die zypriotischen Banken hatten sich noch mit griechischen Anleihen vollgesogen, als wirklich alle anderen schon mit einem Schuldenschnitt rechneten.
Zwischen Nikosia, Moskau und Athen gab es seit Jahren jedenfalls regen Flugverkehr an Privatjets, wie die Zeitungen jetzt süffisant berichteten. Man hatte die Zyprioten machen lassen, Brüssel hatte weggeschaut. Dann war es zu spät.
Das war es nun auch für den griechischen Zyprioten Stratos Vangelos. Von seinem sauer in Deutschland zusammengearbeiteten und –gesparten, auch noch ehrlich versteuerten Geld waren 40 bis 50 Prozent weg; denn Stratos hatte weit mehr als 100.000 Euro auf die Bank gebracht. Zum ersten Mal in der Geschichte ging es Sparern wie Stratos ans Eingemachte. Für ihn würde es nichts werden mit der Heimkehr auf die Insel der Aphrodite, wo selbst die kälteste Jahreszeit ein ewiger Frühling war und nicht so ein Winter wie dieses Ostern 2013. Stratos fröstelte, das Klappern auf dem Teller ging weiter, angetrieben von Wut und Kälte.
Europa war nicht mehr wie früher. Die Arbeitslosigkeit explodierte in der Europäischen Union, in der in manchen Ländern jeder zweite Jugendliche keine Arbeit und damit keine Zukunft mehr hatte. Täglich sah Stratos im Fernsehen die Bilder der Trostlosigkeit, gemischt mit drohenden Konjunktureinbrüchen. Erst mit seinem Geld auf Zypern war er persönlich betroffen; denn ansonsten lebte er ja auf der Insel der wirtschaftlichen Glückseligkeit - in Deutschland.
Immer weniger Europäer mochten die Deutschen, immer weniger Deutsche mochten Europa. Und immer mehr Deutsche wollten ihre D-Mark zurück. Eine Partei mit dem Namen „Alternative für Deutschland“ befand sich in Gründung und wollte den Austritt Deutschlands aus dem Euro verhandeln. Ausnahmsweise gab Stratos hier Diospolos recht, der sich über die „apolitischen und weltfremden Professoren“ aufregte, die „den Deutschen eine Alternative vorgaukeln, die es nicht gibt.“ Müde erhob sich der Europäische Zentralbanker. „Rezession, Isolation, Konfrontation, Eskalation und dann, mein Lieber, kommt unsere eigene Exekution.“ Dabei hielt er Stratos die fünf Finger seiner Hand vor das Gesicht. „Das kommt dabei heraus. Und du jammerst über das mickrige Zypern.“
„Wieso habt ihr uns nicht wenigstens gewarnt, Konstantin?“ Schließlich hatte man auch Griechenland, Spanien, Portugal und sogar Italien immer wieder unter die Arme gegriffen und die Lage eigentlich ganz gut stabilisiert. Stratos hatte kleine Schweissperlen auf der Stirn, die im die Wut aus den Poren gepresst hatte.
„Es war doch offensichtlich. Du hättest dein Geld halt abziehen sollen, als es noch gegangen wäre.“ Konstantin hatte seit zwei Wochen kaum geschlafen, seit nach den ersten Verhandlungen sogar die Kleinsparer zur Schuldentilgung herangezogen werden sollten. Seitdem grassierte die Angst vor dem Verlust des Ersparten – zumal der neue Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem dieses Vorgehen als Vorbild für andere Krisenstaaten bezeichnet hatte.
Er hatte diese Aussage zwar sofort wieder zurückgezogen, aber es war in den Köpfen der Menschen. Worte und Währungen als Waffen gehörten zu Diospolos‘ Wachkoma. Seit eineinhalb Jahren an der Seite Draghis kannte er dieses latente Schlafdefizit vor, während und nach den unzähligen Krisengipfeln. Die letzten 14 Tage aber hatten nicht zuletzt wegen des jungen Holländers Dijsselbloem alles in den Schatten gestellt.
„Ich bin Zypriot und Patriot,“ entrüstete sich Stratos.
Diospolos wollte beim besten Willen nicht mehr erklären und verteidigen, was man in den letzten Wochen getan hatte. Er wollte nur noch heim und endlich einmal ausschlafen.
„Stratos, du bist zwar Zypriot, aber kein Patriot, sondern ein Idiot.“ Natürlich hätte er ausgeschlafen nie so etwas gesagt, was er nun müde vor sich hin grummelte, während er eine 50er-Note auf dem Tisch warf. Er hätte die Gabel klappern hören, das Messer sehen können, aber er hörte eben nicht mehr richtig zu und sah nicht mehr richtig hin. „Stimmt so, mein Lieber. Für den Neuanfang.“ Dabei klopfte er Stratos auf die Schulter.
„Ich mag zwar ein Idiot sein, aber dafür war das dein letztes Abendmahl.“ Stratos rammte ihm das Messer mitten ins Herz.
Teil I: Sprachlos in Davos
7. und 8. Januar 2010
Die Viererbande
Immer am ersten Donnerstag eines neuen Jahres traf sich die Viererbande bei einem Griechen. Am 7. Januar 2010 um 20 Uhr in Frankfurt am Main im “El Greco“, einer ehemaligen Kneipe mit typisch deutscher Einrichtung: schweres dunkles Holz, große Theke und einfache Stühle mit Tischen, denen man die Jahrzehnte Stammtischrunden mit Pils und Korn noch ansah. Mit Bildern der Akropolis und ein paar Skulpturen von Athena bis Zeus verziert, sah das El Greco nicht wirklich griechisch aus, aber Stratos war weit und breit der beste griechische Koch, wie der Gastgeber des Abends besser als alle anderen beurteilen konnte: Dr. Konstantin Diospolos war an der Reihe die Viererbande zu bewirten.
Da es am Montag noch einmal kurz zurück an den Arbeitsplatz bei der EZB, der Europäischen Zentralbank, ging, hatte ‚Dispo‘, der Grieche der Viererbande, nach Frankfurt geladen. Elegant in dunkelblauem Cord, ohne Krawatte, stand der kleine Währungsspezialist mit viel zu stark gegeltem Haar bei Stratos, dem Restaurantbesitzer, und wartete auf seine Gäste. An Frankfurt und seine hessische Küche konnte und wollte er sich auch nach fünf Jahren nicht gewöhnen. Berlin, wo er 1970 auf die Welt gekommen war und fünf Jahre mit seinen Eltern im Exil gelebt hatte, war ihm deutlich näher. Seine Mutter war Deutsche, eine waschechte Berlinerin, die sich in einen jungen heißblütigen Griechen verliebt hatte. Die Odyssee durch die Finanzkapitalen dieser Welt würde alsbald eine neue Etappe bieten: Büroleiter des IWF-Chefs in Washington sollte er Ende Januar werden, noch rechtzeitig vor dem World Economic Forum in Davos.
Als Erste der Bande traf ‚Friedhof‘ im El Greco ein, immer ein wenig überpünktlich, was ihrem generell überkorrekten Charakter entsprach. Annafried Olson geborene Fjordhof und von allen deshalb nur Friedhof genannt. Ein Name, den ihr das deutsche Bandenmitglied Ellen Klausen verpasst hatte. Friedhof verband den Trip nach ‚Mainhattan‘ mit einem Besuch beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, aber natürlich zahlte sie die Tage vor der Arbeit in Wiesbaden aus ihrer privaten Schatulle. Als Beamtin bei EUROSTAT, dem Statistischen Amt der Europäischen Union in Luxemburg, war sie bis zum Jahresende für Deutschland zuständig gewesen. Als solche musste sie noch das Zahlenwerk für 2009 abschließen, wofür sie ein paar Tage brauchen würde. Dass sie nun ausgerechnet Chefin für die südeuropäische Gruppe würde, war zwar ein Gehalts- und Karrieresprung, aber um die Zahlen der Südländer hatte sie bislang einen großen Bogen gemacht. Seit das Land 2001 dem Euro beigetreten war, gab es Verfahren gegen und Schwierigkeiten mit Defiziten von Griechenland.
Der neue Job würde alles andere als ein Zuckerschlecken sein. Griechenland war auf dem besten Weg, das Sorgenkind der Europäischen Union zu werden. Sie spürte förmlich, dass die Eurozone in den nächsten Monaten eine griechische Tragödie erleben würde. Im Herbst 2009 hatte die neue griechische Regierung unter Giorgos Andrea Papandreou zugeben müssen, dass die Neuverschuldung viel höher war als bislang offiziell angegeben: 12,7 Prozent statt der erlaubten drei Prozent. Noch im Dezember hatten Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Griechenlands herabgestuft und damit einen gewaltigen Risikoaufschlag der Staatsanleihen ausgelöst. Die Schulden wurden unbezahlbar.
Griechenland war das Problem des Euro und damit von nun auch das von Friedhof. Griechenland hatte sich in die Eurozone hineingelogen. Anna traute der ganzen Sache nicht, selbst den neuen Zahlen nicht. Sie wollte sich erst einmal richtig in die Datenmengen eingraben. Die Griechen hatten Militärausgaben nicht als solche deklariert und damit ihre Verschuldungsquote gedrückt. Aber die früheren griechischen Regierungen hatten vor allem ihr Volk belogen, hatten ihnen vorgegaukelt, dass sie besser im europäischen Wettbewerb lägen, als sie es am Ende taten. Sie hatten mit Staatsgeldern ein System aufrechterhalten, das schon lange nicht mehr funktionierte. Griechenland war zu teuer, um im europäischen Wettbewerb zu bestehen.
Nun musste die neue Regierung unter Papandreou das alles ausbaden. Den stolzen Griechen nicht nur die Wahrheit sagen, sondern auch den Europäern, die es aber alle im Prinzip zumindest geahnt haben mussten. Die Heuchelei ging Anna schon jetzt fürchterlich auf die Nerven. Das jetzige Tamtam ging gegen die griechische Ehre – da musste sie sich nur den heißblütigen Dispo anschauen –, aber Annafried wusste genau, dass es keine Alternative gab. Sonst drohte die Staatspleite, etwas, das in der Eurozone nicht vorgesehen war.
Nicht nur das hatte sie der Bande zu berichten, sondern auch die stille Trennung von Mr. Olson. Nach dahinplätschernden, aber nicht unglücklichen Jahren mit ihm hatte Annafried im Herbst feststellen müssen, dass der Gute sie seit Jahren betrog. Betrug war nicht ihre Sache. Entwaffnend war allerdings sein einziger Vorwurf, den der Mann, mit dem sie zehn Jahre verheiratet war, ihr gegenüber gemacht hatte: „Sieh dich doch an, Anna, sexy ist etwas anderes“. Zwar änderte das nichts für die blonde Dänin, doch machte sie sich selbst Vorwürfe, sich zu sehr in die Arbeit vergraben zu haben. Eben darum wollte sie ihr Leben ändern, aber ohne Mr. Olson.
Annafried wusste, dass sie ihren neuen Stil noch finden müsste. Sie hatte sogar einen style coach aufgesucht. Statt dunkle trug sie nun helle Farben, vorzugsweise beige, und dies selbst im Winter. Die glatt geschnittenen Haare waren einem hübschen Stufenschnitt gewichen, und selbst Schmuck zierte die schlanke mittelgroße Dänin. So war es vielleicht auch gar kein schlechter Zufall, dass sie die Südländer übernehmen musste. Die bevorstehenden Reisen nach Lissabon, Madrid, Rom und Athen würden sicher auch interessanter werden als die Besuche in Wiesbaden und Frankfurt. Aber dort war nicht nur das Leben lockerer, sondern auch die Zahlenlage.
Dispo war Annas neue Lockerheit sofort aufgefallen. Doch ehe er etwas sagen konnte, kam die Dritte im Bunde schon durch die Eingangstüre: ‚Miss Money‘, Dr. Ellen Klausen, lange schon geschieden und Single. Sie sah wie immer klasse aus, stellte Dispo fest, als ihr am Eingang aus dem Mantel geholfen wurde. Klein, aber klasse – alles in den richtigen Proportionen. Ganz entspannt lächelte sie beide an, was auch damit zu tun hatte, dass der junge Chinese, den sie betreute, ihr vor dem Abendessen eine Vollkörpermassage hatte angedeihen lassen, wie man sie von Europäern nicht bekam. Und Ellen kannte den Vergleich.
Ellen war froh, dass Wang Li mit nach Frankfurt gekommen war, auch wenn er sich bis zu ihrer Rückkehr alleine vor dem Fernseher im Hilton vergnügen musste. Und näher als über Wang Li konnte sie an die chinesischen Währungskrieger gar nicht herankommen. Bislang hatte sie chinesische Männer nur mit einer einzigen Ausnahme in ihr Bett gelassen. Mit Wang Li kam allerdings jemand zwischen ihre Laken, der kein Planwirtschaftler mehr war – weder im Bett noch auf dem Parkett. Vielmehr ein in feines italienisches Tuch gewandeter Kommunist. Der junge Chinese war Mitglied der KP, aber wie viele inzwischen war er auch an den besten Universitäten der Welt ausgebildet worden. Und da er unter anderem auch an der ETH in Zürich studiert hatte, sprach er sehr gut Deutsch und war somit der richtige Mann für die Basler BIZ, die Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich.
Wang Li war Ellens neues Filetstück. Da es in der BIZ immer wieder Frischfleisch gab, wenn die Mitgliedsländer ihre Fachkräfte auswechselten, die zudem oftmals auch ihre Familien in den Heimatländern liessen, hatte die extrem gutaussehende Ellen unter der Woche nicht nur viel Arbeit im Generalsekretariat der BIZ, sondern auch ein äußerst zufriedenstellendes Liebesleben. Da die Deutsche fest zur BIZ gehörte, wurde sie auch nicht ausgetauscht und hatte ihren Hauptwohnsitz in Basel, während ihre wechselnden Lover oft am Wochenende nach Hause flogen.
Das Schöne an Wang Li war, dass er ganze zwölf Monate in Basel blieb und nur selten nach Hause flog. Sechs Monate waren bald rum. Mr. Li sollte danach im Umfeld des chinesischen Notenbank-Präsidenten eingesetzt werden und damit im Zentrum einer der inzwischen bedeutendsten Machtfaktoren internationaler Währungspolitik. Hier saß die eine Armee der Währungskrieger, die gegnerischen Truppen, zunehmend schwächer werdend, in Washington.
Ellen war klar, dass Wang Li in Basel den letzten Schliff bekommen sollte, um hinterher dem Yuan in die westliche Welt zu helfen, das heißt, ihn zu einer echten Währung zu machen. Das hatte sie jedenfalls im Freundeskreis ausgeplaudert, was dort zu einigen überraschten Blicken geführt hatte: Die Chinesen wollten sich von niemandem diktieren lassen, was sie wann und wie mit ihrer Währung zu tun hätten.
Auch wenn alle drei gute Jobs hatten, schauten sie dennoch etwas neidisch auf David Wagner. ‚Goliath‘ war nicht nur ein Bär von Mann, er hatte auch den dicksten, bestbezahlten Job der Viererbande. Das sah man zwar seiner meist uneleganten Freizeitkleidung nicht an, war aber so. Als Chef des gesamten Währungsbereichs der Carolina Bank und Managing Director dürfte er Millionen Dollar verdienen oder besser bekommen. Letztes Jahr hatten sich die vier Freunde beim Griechen in London in die Haare gekriegt, weil die anderen drei ihren Goliath so richtig in die Zange genommen hatten, für das, was die Investmentbanken 2008 verbockt haben. Wenn sie sich nicht alle seit gut fünfzehn Jahren gekannt hätten, hätte Dave wohl kein Wort mehr mit diesen drei Zahlenverdrehern, Bedenkenträgern und Währungshütern gesprochen.
1995 waren alle vier Teilnehmer einer ‚European Currency Union Summer School‘ gewesen. Als beste Studenten ihrer Jahrgänge hatten sie ein intensives Auswahlverfahren bestanden und zwei Monate auf Kosten des damals gerade frisch gegründeten Europäischen Währungsinstitutes konzentriert über die bevorstehende Währungsunion geforscht und diskutiert. Das hatte ihnen alle Türen und Tore geöffnet. Denn wo gab es um diese Zeit schon junge Absolventen der Geld- und Währungspolitik, die nicht nur die reine Ökonomik, sondern auch die politische Dimension des Projektes verstanden hatten?!
Gerade dieses Jahr freute sich Dave auf seine alten Kumpel, mit denen er 1995 unvergessliche Monate in Piräus verbracht hatte – gut untergebracht in einem im Sommer verwaisten Internat in Hafennähe. Die Griechen, seit 1981 als zehntes Land Mitglied der Europäischen Union, waren schon früh dabei, sich auch für die Währungsunion zu qualifizieren, sogar mithilfe einer Summer School in Piräus.
Zufällig waren die vier am zweiten Tag in eine Arbeitsgruppe gepackt worden, die sich für ein paar Stunden um die Integration von Geldpolitik und Staatsfinanzen Gedanken machen sollte. Da Dispo aus einer guten linken griechischen Familie kam, genügte ein Anruf und die Gruppe tagte auf der Terrasse des Greek National Yacht Clubs, der auf einem Hügel am Rande des alten Hafens lag und von vorne an eine Schiffskommandobrücke erinnerte. Einer von Dispos vielen Onkeln, der in der Griechischen Zentralbank arbeitete, faxte auch gleich mal ein Argumentationspapier, sodass sie sich weite Teile des Nachmittages der Sonne widmen konnten. Nur Friedhof hatte ein schlechtes Gewissen. Doch auch sie machte zwei Monate alles mit, sie ließ sich eigentlich immer gerne mitziehen – und so entstand die Viererbande.
Als Goliath kurz vor acht Uhr die Türe zum El Greco im Frankfurter Westend aufriss, hatte er allerdings ziemlich beschissene Laune und musste sich mal richtig auskotzen. Dass Carl Bensien Mitch Lehman als Kapitalmarktchef der Carolina Bank gefolgt war, hatte er ja noch geschluckt. Doch als Bensien ausgerechnet Allan Smith, den Finanzchef der Carolina Bank, nach Kramers Tod und Carls Berufung an die Spitze der Bank, zum neuen Kapitalmarktchef gemacht hatte, stank Dave gewaltig. Auf einen ‚Dr. No Risk‘ folgte ein ‚Mr. Number Cruncher‘. So sehr Dave Carl auch als Chef schätzen gelernt hatte, Smith war ein Nichts für einen Währungskünstler wie David Wagner. Noch im Eingang stolperte Dave beinahe über Ellen, die gerade dem Kellner, der mit ihrem fast bodenlangen Ledermantel beschäftigt war, ihren schwarzen Schal reichte.
„Hallo, Miss Money, du siehst wie immer umwerfend aus.“
„Eigentlich müsstest du ja Mr. Money heißen, Goliath“. Ellen drehte sich freudig zu Dave und küsste ihn auf die Wange.
„Dann wären wir ja verheiratet, Süße.“
„Dich würde ich nur des Geldes wegen heiraten.“
„Es hat schon sinnlosere Gründe für Eheschließungen gegeben.“
„Wem sagst du das!“ Ellen löste sich aus Daves Armen, hakte sich bei ihm unter und zog ihn in das gut gefüllte Restaurant.
„Dispo hat etwas Populäres ausgesucht, scheint mir. Dahinten sind wir aber alleine.“ Im hinteren Teil, auf den Ellen deutete, gab es ein kleines Separee. Durch die offene Schiebetüre entdeckten sie Friedhof und Dispo, die ihnen freudig entgegensahen.
„Da ist ja unsere graue Maus.“
„Sei nicht so unfair, Ellen. Nicht alle können so blendend aussehen wie du. Und wenn ich recht sehe, ist sie heute gar nicht grau gekleidet.“ Dave wies mit einer kleinen Kopfbewegung auf Annafried.
„Stimmt“, erwiderte Ellen und blickte überrascht in Richtung Separee. „Recht hast du. Außerdem weißt du, dass ich Friedhof mag.“
„Ja, nicht zuletzt, weil sie dir die Daten für deine Doktorarbeit besorgt hat.“
„Du Ekel!“ Ellen boxte Dave leicht in die Seite, der dabei lachte. „War ein cum laude, und das für die Krönung.“ Nur ungern wurde sie daran erinnert, dass ihre Arbeit über ‚Die Krönungstheorie als ultima ratio der Europäischen Währungsunion‘ nicht gerade ein akademischer Hammer war. Doch anders als Annafried, die freudig strahlend auf ihre Freundin Ellen zukam, hatte Ellen politisches Gespür für das weiterentwickelt, was machbar war, und zwar mehr als alle anderen der Viererbande zusammen. Eine Krönungstheorie, bei der man erst abwarten wollte, bis alle europäischen Staaten am besten in einer Fiskalunion gleich liefen, ehe man ihnen eine einheitliche Währung überstülpen könnte, lag ihrer Meinung nach außerhalb der politischen Realität. Deshalb saß sie auch im Generalsekretariat der BIZ, und nicht in der Statistik oder einer ähnlich langweiligen Institution. Da musste sie sich nicht mit einzelnen Währungen herumschlagen, sondern arbeitete am großen Ganzen: am Währungs- und Finanzsystem, und das war immer politisch.
„Ellen, schön dich zu sehen!“, sagte Annafried und herzte die deutlich kleinere Ellen lange.
„Anna“, entgegnete sie und streichelte ihr dabei über die Wange, „toll siehst du aus. So anders.“ Ellen hielt Annafried auf Armlänge, um sie zu betrachten. „Ich freue mich auch, dich zu sehen. Mehr als die Jungs selbstverständlich.“
„Fällt dir nichts auf, Ellen?“
„Doch, nein, anders siehst du aus. Mehr Farbe und ein schöner Hosenanzug.“
„Die Brille.“
„Wie bitte?“
„Ich trage keine Brille mehr. Gelasert!“ Annafried zeigte mit einem V-Zeichen auf ihre beiden Augen.
„Stimmt, die Brille ist weg. Und du hast Farbe aufgelegt.“ Überrascht nahm Ellen eine Hand vor den Mund, während auch die Jungs sich ihnen beiden zuwandten.
„Dispo hat es auch noch nicht gemerkt.“ Der angesprochene Grieche verzog das Gesicht, als wäre er in einen ganz großen Fettnapf getreten. Den wahren Grund wollte sie sich fürs Essen aufsparen. Ellen ergriff die Chance, die Peinlichkeit zu mildern, und ging in Richtung des Griechen, während hinter ihr Friedhof und Goliath einander in den Armen lagen.
„Ich habe es sofort gesehen, kleines Superhirn.“
„Ich glaube dir kein Wort, du alter Charmeur. Aber danke, Dave. Es tut gut. Das habe ich auch erst vor den Weihnachtsferien machen lassen, um mich in der Pause daran zu gewöhnen. Mal sehen, was die im Büro sagen werden.“ Das Lasern der Augen war der Schlussstein ihrer Stiländerung gewesen, die Mr. Olson ausgelöst hatte. Nachdem sich zum Schluss auch Konstantin und Dave mit heftigem männlichem Schulterklopfen begrüßt hatten, gab es den obligatorischen Ouzo vor dem Essen.
„Nur einmal im Jahr trinke ich Ouzo als Aperitif“, verkündete die Dänin und schüttelte sich so heftig, dass ihre neue Frisur eigentlich auffallen musste.
„Dieses Schütteln und Schaudern, Friedhof, machst du auch schon seit fünfzehn Jahren.“ Dave legte behutsam seine große Pranke um die Schulter der zierlichen Dänin, die für seinen Geschmack hundert Mal besser aussah als noch letztes Jahr. Richtiggehend anziehend.
„Kinder, ich habe Hunger!“ Als Gastgeber des Abends befahl Konstantin Diospolos die Viererbande an den Tisch, eine große runde Tafel, um die herum sich eine gar nicht mehr so unscheinbare Dänin, eine mondäne Deutsche, ein alerter Grieche und ein bulliger Engländer setzten. Hätten diese vier sich nicht in Piräus per Zufall gefunden, sie würden heute kein Wort miteinander wechseln, so unterschiedlich sind sie.
Als die große griechische Vorspeisenplatte mit Taramasalata, Zaziki, Fetakäse, Hummus, Oliven, kleinen Sardellen und Sardinen, scharfen Fleischbällchen und allen anderen Leckereien auf den Tisch kam, fühlten sich die vier Freunde binnen Sekunden nach Piräus versetzt, wo man sich damals selbst als Student opulente griechische Platten leisten konnte. Der damalige günstige Wechselkurs der Drachme war ein Segen für den Tourismus.
Bis Goliath mit seiner Frage alle zurück in die Wirklichkeit holte.
„Gibt's was Neues? Ich bekomme einen richtigen Scheißchef. Carl hat mich nicht befördert.“ Derweil steckte er sich eines der kleinen Bällchen in den Mund.
„Wieso?“ Ellen fragte als Erste, ganz erstaunt. „Der kennt dich doch seit fünfzehn Jahren.“
„Vielleicht gerade deshalb.“ Das Lächeln sollte Dispos Aussage zum Witz machen, aber niemand lachte.
„Keine Ahnung, ich sehe ihn erst nächste Woche zum Vier-Augen-Gespräch.“
„Nur weil er uns vor fünfzehn Jahren betreut hat, muss er dich ja nicht zum Chef machen. Ist doch ohnehin ein purer Zufall, dass du dem letztes Jahr wieder über den Weg gelaufen bist.“
„Das stimmt auch wieder, Ellen.“
„Ich gehe übrigens zum IWF, ganz in die Nähe von Strauss-Kahn. Schon im Februar, endlich. Ein Superjob in einer Scheißzeit, würde ich sagen.“ Dispo löffelte mit etwas Brot nach der Taramasalata.
„Mich trifft's noch beschissener.“ Annafried verschluckte sich dabei fast an ihrem Stück Feta. „Ich bin seit 1. Januar Chefin der Südländer-Statistiken.“ Fast entschuldigend hob sie die Arme. Mit Messer und Gabel in der Hand sah es allerdings eher angriffslustig aus. „Inklusive Griechenland, mein Lieber.“
„Wieso erfahre ich das nicht früher, so ein Scheiß?!“ Etwas gereizt begann Konstantin Diospolos zu überlegen, was es für sein Land bedeutete, wenn Anna die Zahlen kontrollierte. Nur gut, dass er damit nichts direkt zu tun haben würde.
„Das Wort Scheiße ist für heute Abend ab sofort verboten. Gratulation an euch beide.“ Ellen ergriff das Wort in die Stille hinein. „Und noch eine Runde Ouzo für alle. Heute müssen wir noch viel lockerer werden, vor allem ihr zwei.“ Sie blickte nach rechts und links und dachte kurz an ihre Lockerungseinheit mit Mr. Li, die sich der Massage angeschlossen hatte.
Der Ouzo erfüllte seine Aufgabe. Schnell löste sich die Anfangsspannung wieder auf und jeder erzählte, ohne dass heikle Querverbindungen gezogen wurden. Ellen war eine Meisterin darin, bilaterale Gespräche zu moderieren. Das brachte zwar genauso wenig, wie bilaterale Wechselkurse zu moderieren, war aber besser, als sich wieder zu streiten: Nach Goliaths Boni vom letzten Jahr nun Dispos Euro-Drachme?
„Im Übrigen ist Griechenland ja wahrlich nicht das einzige Problem im weltweiten Währungsgefüge.“
„Wie meinst du das?“ Anna konnte so nett naiv fragen.
„Es kann Krieg geben.“
„Krieg?“ Wieder war es Anna, die erschrocken nachfragte, die Hand vor dem Mund, während die Herren zuhörten.
»Währungskrieg! Zwischen den USA und China. Dann wäre Griechenland das geringste Problem, nicht wahr, Dispo?“
„Kann sein.“ Er blieb fast regungslos sitzen, da er als globaler Fachmann und als Grieche wusste, was passieren konnte.
„Wie soll das gehen?“ Interessiert beugte sich Anna ein bisschen nach vorne, als Dave seine Hand auf ihren Unterarm legte.
„Die Währungsarmeen können abwerten, inflationieren, verschulden, fremde Devisen bunkern, Zinsen drehen, Geld drucken, mit Zöllen drohen, konvertieren, manipulieren. Es gibt ein großes Arsenal an Währungswaffen, das die Staaten nutzen können. Und inzwischen haben die Chinesen nicht nur eine Volksarmee mit Millionen von Soldaten, sondern auch Währungsreserven in zig Milliardenhöhe. Weit über zweitausend Milliarden Dollar. Wehe, wenn sie damit Unsinn machen!“
„Und ihr Kapitalmarktsöldner?“
„Wir, Anna, machen bei allem mit. Man muss nur wissen, auf welcher Seite der Front man gerade steht. Eine globale Bank hat ja kein Heimatland mehr.“
„Also auch weiter bad banker!“
„Ja, aber dieses Mal sind wir bad banker im Währungskrieg.“ Dave musste etwas verschmitzt lachen, denn er sah sich natürlich nicht als einen bad banker an.
„So ist es, Dave!“, kommentierte Ellen und biss lächelnd in ein Stückchen Brot, das sie mit einer Sardine belegt hatte.
„Es ist ein Kampf der Blöcke, Anna. Ein regelrechter Krieg. Vergiss deine Statistiken. Dollar gegen Euro runter, Euro gegen Yuan mit, Yuan im Sog des Dollar, dazu ein paar Real, Yen oder Franken, der mal wieder zur Fluchtwährung wird, als wären wir noch im Kalten Krieg. Und die Deutschen kämpfen im Welthandel gegen die USA und China, haben aber keine eigene Währungswaffe mehr. Die chinesische Währung ist nur eine heimische Recheneinheit, die im Ausland keiner haben will oder darf. Such dir etwas aus. Es ist ein großes Durcheinander.“
David Wagner hatte sich eigens einen smarten MBA-Absolventen gesucht, den er den ganzen Tag über nichts anderes machen ließ, als internationale Währungsstrategien, deren Ankündigungen und Umsetzungen mit den realen Entwicklungen an den Märkten zu vergleichen.
„Lass uns heute Abend nicht nur über Währungen reden, und schon gar nicht über Währungskriege.“ Ellen hatte die ganze Weihnachtszeit über kaum etwas anderes getan. Wang Li war nicht nur ein sehr guter Lover, er war auch ein Quell der geldpolitischen Erkenntnis. Und von denen gab es in China nicht viele. Ellen öffnete er jedenfalls die Augen für die eine oder andere Entwicklung. Informationen, die sie sehr gut für ihre Aufgaben gebrauchen konnte.
Schnell waren sie weg von den Problemen der Welt. Und als Annafried auch noch erzählte, dass sie „Mr. Olson ausgebucht“ hatte, dachte niemand mehr an Griechenland, Amerika, China, Deutschland oder wen auch immer. Ohne dass es ein Zeichen zum Aufbruch gab, standen alle vier kurz nach Mitternacht auf: Zeit für das jährliche Ritual.
Fast feierlich griff Dispo in seine Jacketttasche und zückte einen Zettel. Die anderen taten es ihm gleich. Während die Damen ihre Zettelteile aus ihren Handtaschen kramten, genügte Goliath ein einziger Griff in seine Innentasche. Alle vier schoben ihre in Plastik eingeschweißten Zettel-Viertel in die Mitte des inzwischen frei geräumten Tisches. Da sie alle, und zwar seit fünfzehn Jahren, immer in der gleichen Anordnung saßen, fügte sich das Bild aus den vier gleich großen Teilen wie immer perfekt zu einem DIN-A4-Bild zusammen: “Währungssystem à la Diospolos, Fjordhof, Klausen und Wagner“, doppelt unterstrichen.
Das stand jedenfalls handgeschrieben oben drüber – ein paar Fettflecken von Gyros und Zaziki waren auch drauf. Und unten drunter stand: “Der Schwur von Piräus“. Alle vier hatten mit ihren Spitz-, aber auch mit ihren richtigen Namen unterschrieben: Friedhof, Dispo, Goliath und Miss Money – jeweils in der Ecke ihres Zuständigkeitsbereiches. Anfangs, als sie noch Studenten waren, hatten sie sich im Sommer für ein paar Tage getroffen, seit zehn Jahren jedoch am ersten Donnerstag des neuen Jahres.
Der Zettel zerteilte das W in vier Teile, da die Währung in der Mitte ihrer Zeichnung stand. Und weil sie damals noch nicht wussten, wie die europäische Währung heißen würde, hatten sie ein W mit einem Kreis gemalt.
„Weißt du noch, wie lange wir damals benötigt haben, um es auf die wesentlichen Dinge zu reduzieren?“
„Die halbe Nacht, mit viel griechischem Wein. Aber du hattest die Lösung, Friedhof.“ Ellen war heute noch neidisch auf die analytischen Fähigkeiten der Dänin.
„Wenn es einmal durchdacht ist, ist es ja auch ganz einfach und stimmt im Übrigen heute noch, selbst wenn echte Theoretiker über den Zettel sicher die Augen verdrehen würden: Wo sind die Zinsdifferenzen? Wo die Inflationsraten, wo das Geldmengenwachstum? Wo der freie Kapitalverkehr?“
„Recht hast du, das braucht man alles erst, wenn man die Grundfragen geklärt hat.“ Konstantin hatte schon lange nicht mehr auf das ganze Gefüge geschaut, da ja jeder nur sein Viertel besaß. Anna hatte die FISKALPOLITIK mit der VERSCHULDUNG, Dave die GELDPOLITIK mit den ZINSEN, Ellen die WÄHRUNGSPOLITIK mit dem WECHSELKURS und er die allgemeine WIRTSCHAFTSPOLITIK mit dem WACHSTUM. Wenn man alles zusammen betrachtete, konnte man viele Probleme mit diesem einen Blatt lösen.
„Zinsen bewegen nicht nur den Wechselkurs, sondern auch die Verschuldung. Die Verschuldung beeinflusst auch die Wachstumsdynamik und diese wiederum die relative Stärke eines Landes nach außen hin und damit auch den Wechselkurs.“
„Oder, meine liebe Anna“, fügte Ellen spitz hinzu, „stabiles Geld im Innern verhindert Inflation und stützt Wachstum. Das wiederum ist eine Folge solider Wirtschaftspolitik mit guter Bildung, Technologie und Infrastruktur. Das spült Steuern in die öffentlichen Kassen und erlaubt eine solide Verschuldung.“
„Nur dass die in letzter Zeit in vielen Staaten nicht so solide ist, und wenn wir ehrlich sind, fast überall, nicht nur in Griechenland“, steuerte Dispo nicht ohne ein gequältes Lächeln über sein eigenes Land bei, womit er darauf anspielte, dass gerade der Schlendrian in den öffentlichen Kassen die Preise trieb. Fiskalpolitik blieb in der Europäischen Union Sache der einzelnen Staaten. Nur die Geldpolitik war Gemeinschaftssache.
„Kinder, wir könnten auch über unsolide Währungspolitik sprechen.“ Ellen redete gerne so mütterlich, wenn es um Währungspolitik ging, denn in der BIZ bekam sie den unteren Teil der Abbildung hautnah mit: Wie lief die Geld- und Kreditversorgung in den Staaten, wie das Wechselkursregime? Das war Aufgabe der Geldpolitik und musste im Wettbewerb der Staaten in ihrer jeweiligen Kaufkraft bewertet werden. Gerade sie mussten aufpassen, wenn mal wieder mit Gerüchten Wechselkurse getrieben wurden, wenn in Leistungsbilanzen etwas hin- oder hergebucht wurde oder wenn kurz mal der freie Kapitalverkehr durch Kontrollen erschwert wurde.
„Die Chinesen halten sich jedenfalls kaum daran, ihre Währung international freizugeben und sie gemäß ihrer Wirtschaftskraft aufwerten zu lassen.“ Nun war es Dave, der an seinen MBA-Absolventen dachte, mit dem er genau darüber diskutierte. Wenn der Yuan nicht frei getauscht werden konnte, half eigentlich alles nichts. Genauso waren die Chinesen zum größten Gläubiger der USA geworden, indem sie ihre eingenommenen Dollar immer wieder in amerikanische Anleihen anlegten oder sich an Unternehmen beteiligten. China hatte genug Kapital, um die halbe Welt aufzukaufen.
Anna schaute die anderen an: „Ihr erinnert euch an den Streit?“
„Ja!“, tönte es aus drei Kehlen.
„Zinsen und Schulden können genausowenig getrennt betrachtet werden wie Wachstum und Wechselkurse. Das erste Problem haben wir in Europa, das zweite in China und den USA.
„Es wird schon eine Lösung geben!“ Dave gab den Gelassenen, ohne wirklich eine Antwort zu kennen.
„Wir würden jedenfalls eine Lösung finden, wenn man uns nur machen ließe. Ein paar Tage Piräus oder andere schöne Plätze dieser Erde und wir hätten's“, meinte Ellen und stupste Dave an.
„Da haben vor allem die Amerikaner etwas dagegen.“ Dispo hob fast entschuldigend die Hände.
„Was hast du gegen die Amis? Sind dir etwa die gelben kommunistischen Kapitalisten lieber?“, sprudelte es etwas hastig aus Ellen heraus.
„Wir brauchen alle, meine Liebe.“
„Kann ich das mal kurz abfotografieren?“ Dave hatte eine Idee, als er das ganze Gebilde betrachtete, und zückte sein iPhone, ehe er sich dann Annafried zuwandte.
„Nächstes Jahr bist du dran, Friedhof.“
„Da können wir uns ja in Athen treffen, Dispo.“
„Es wäre mir eine Freude, kleine Dänenkrone.“
„Besser Dänenkrone als falsche Drachme, oder?“
„Bei uns zahlt man in Euro, das solltest du bei der Rechnung berücksichtigen.“
„Ja, und zwar ziemlich teuer. Ihr lebt über eure Verhältnisse.“
„Kommt auf die Perspektive an, Anna.“
Er ließ sich leicht reizen, das wussten alle anderen drei der Bande, ein südländisches Heißblut, aber ein herzensguter Kerl. Dave und Ellen standen unschlüssig daneben, als die beiden am Ende des Tages wieder streiten wollten.
„Weißt du noch, was dein Onkel über die Rechnungen sagte, als er uns im Jachtclub eingeladen hatte, Dispo?“
„Nein.“ In der Tat erinnerte sich Dispo nicht an Kleinigkeiten wie Rechnungen, wenn er in Griechenland war. Ganz anders im Übrigen, wenn er in Deutschland war. Da war er korrekter als jeder deutsche Beamte.
„Rechnungen sind dazu da, manipuliert zu werden. Aus unserem privaten Treffen wurde doch noch ein offiziell abrechenbarer Abend mit sogenannten ‘Währungsexperten‘. So seid ihr Griechen, Dispo.“
„Nicht alle, kleine Dänenkrone.“
„Besser ehrlich draußen, als verlogen drin.“ Annafrieds Augen verengten sich zu Schlitzen. Sie wollte ihm schon heute klarmachen, dass er mit ihr erst gar nicht zu diskutieren bräuchte, wenn es um die Daten des Staatshaushaltes gehen würde.
„Anna, du kommst jetzt mit mir!“ Davids Aufforderung ließ keinen Zweifel zu, dass Annafried zu folgen hatte. Er wollte der Sache ein Ende setzen.
„Ich bin auch müde, Leute!“ Ellen spielte die Ermattete, da sie endlich zu ihrem Mr. Li zurück wollte. Der Abend war gar nicht nach ihrem Gusto verlaufen. Das zweite Mal hatte die Viererbande etwas Streit bekommen, auch wenn sie vieles wegmoderiert hatte, so wie sie das auf internationalen Währungskonferenzen gelernt hatte. Anders als dort gab sie der Runde eine ziemlich undiplomatische Abschiedsbotschaft. „Ich hoffe, wir streiten uns jetzt nicht jedes Jahr über irgend so einen Scheiß. Dann können wir die Treffen bald sein lassen.“
„Hattest du das Wort Scheiße nicht verboten?“ Dispo schaffte es mit der Replik zu einem Lacher in der Runde, ehe sich alle freundlich verabschiedeten. Der Grieche blieb noch einen Moment beim Gastwirt. Ellen bog links in Richtung Hilton, Dave begleitete Anna nach rechts in Richtung Frankfurter Hof.
Rachegefühl
Nichts tat sich in der Feuchte ihres Schoßes. Ein Gefühl, das Diana sehr befriedigte und ihr ein Lächeln entlockte, wenn sie mit sich fertig war. Erst spät am Nachmittag dieses 7. Januar 2010 stand sie mit einem Ruck auf, drückte die Zigarette aus und nahm auf dem Weg zur Dusche den letzten Schluck Bourbon. Drüben in Europa war lange schon der nächste Tag angebrochen, die Viererbande lag längst schlafend in den Betten.
Vierzehn bleierne Tage hatte sie mehr oder weniger ununterbrochen in diesem Korbsessel auf der Terrasse verbracht. Nur von wenigen Stunden unruhigem Schlaf unterbrochen, starrte Diana aufs offene Meer. Gegessen hatte sie fast nichts, geraucht viel, getrunken auch – seit vielen Jahren das erste Mal wieder unanständige Mengen. Ihr Körper wurde von Tag zu Tag ausgemergelter, das rotblonde halblange Haar verfilzte zunehmend vom stark wehenden Wind. Das weiße Hauskleid hatte seine saubersten Tage lange hinter sich. Im Grunde stank sie wie ein Schwein, doch es gefiel ihr nunmehr, sich gehen zu lassen. Seit Jahren hatte sie stets auf ihr Aussehen achten müssen, ihr Körper war ihr einziges Kapital. Bis jetzt.
Lediglich zweimal war sie zum Hafen hinuntergegangen, um Bestellungen abzuholen, die ihr ein Hawaiianer mit dem Speed Boot brachte. Natürlich musste sie sich auch bewegen, als es diese beiden unangenehmen Besuche gab. Das FBI kam ohne Anmeldung nach ‚Big Deal‘, um Diana zum Tod von Mitch Pieter Lehman und seinen Mordversuchen an Carla Bell und Carl Bensien zu befragen. Sie hatte es nicht gewusst, aber irgendwie doch geahnt. Vor fünf Tagen waren die FBI-Typen dann noch ein zweites Mal gekommen, ließen über ihr verwahrlostes Aussehen aber keine Bemerkung fallen.
Diana war es noch nicht einmal peinlich gewesen. Offensichtlich interessierten sie sich nicht dafür und wussten nichts, außer dass der international gesuchte Wladimir Godunow mit den Vorfällen zu tun hatte. Nach ihrer ‚kleinen‘ Camilla fragte überhaupt niemand. Und sie redete sich damit heraus, dass Mitch Lehman, „wie Sie ja wohl wissen“, immer sein eigenes Ding gemacht hätte.
Nur noch wenige Tage verblieben, bis die Banker aus ihren Weihnachtsferien in die City, an die Wall Street, nach Manhattan und den anderen Plätzen der globalen Kapitalmarktwelt zurückkehren würden. Gut zwei Wochen hatte mehr oder weniger Ruhe geherrscht, in denen nicht viel mehr geschehen war, als dass einer der ganz großen Trader gekillt worden war. Einer, der als Investmentbanker über Wasser laufen konnte, wie man über ihn geschrieben hatte; einer, der Nutten zur Weihnachtsfeier einlud; einer, der gleichermaßen gierig und geil war; einer, der nur mit dem Privatjet durch die Welt flog, der eine Insel und viele Villen auf der ganzen Welt besaß, von denen nicht mal er alle kannte. Und einer, der Milliarden für seine Bank verdient und Hunderte Millionen Dollar für sich bekommen hatte, sich jedoch im Bunde mit Isabella Davis, seiner ‚Rakete‘, so verzockt hatte, dass er die Carolina Bank fast ruiniert hatte. Einer, über den man beim besten Willen nicht viel Gutes sagen konnte. Kein Geringerer als ‚General‘ Mitch Pieter Lehman war vor vierzehn Tagen, am heiligen Abend, erschossen worden.
Auf dem Weg zur Dusche fiel der schmutzige Einteiler von Diana ab. Sie nahm die Außendusche auf der Terrasse am sichelförmigen Jacuzzi, starrte auf das weite, fast in alle Himmelsrichtungen offene, glatte Meer. Minutenlang lief das Wasser an ihrem Körper herab. Sie wusch ihr altes Leben von sich ab, das noch nach den Männern roch, die sie gehabt hatte, einem starken Raucher gleich, der noch Monate nach dem Entzug aus den Poren stinkt. Dreimal wusch sie ihren rotblonden Schopf. Besonders zwischen ihren Beinen ließ sich Diana viel Zeit mit dem Einseifen, um ihren matten Körper wieder richtig zu durchbluten.
Als sie die Knötchen aus dem Haar heraus gebürstet hatte, hüpfte sie in das warme sprudelnde Wasser. Es blieben ihr weitere dreißig Minuten, um alles noch einmal durchzugehen. So lange benötigte die drehbare Terrasse, um eine Runde um das Obergeschoss zu vollenden. Nur auf der Nordseite war der freie Blick aufs Meer für einen kurzen Moment verstellt. Nachdem die Terrasse mit einem leichten Rückfedern zum Stillstand gekommen und Dianas Kopf im schwappenden Wasser etwas mitgekippt war, entstieg sie dem Bad, das ihr wie ein Jungbrunnen vorkam.
„Ich will Rache!“ Zum ersten Mal seit vierzehn Tagen kamen – mit Ausnahme der kurzen Wortwechsel mit den Bullen und dem Lieferanten – wieder Worte über ihre Lippen.
Vierzehn Tage zuvor fiel nur ein einziger Schuss. Mitch Pieter Lehman starb gegen 19.30 Uhr an Heiligabend 2009. Die Kugel drang knapp zwei Zentimeter oberhalb des rechten Auges in seine Stirn, verließ den Kopf am Ansatz der Wirbelsäule wieder und schlug hinter ihm ins Arvenholz. Die Wucht des Schusses haute den weltweit gesuchten Ex-Kapitalmarktchef der Carolina Bank um. Mit weit aufgerissenen Augen und einem kleinen Loch im Schädel lag er auf dem Boden des Douvalier-Bensienschen Maiensäß. Aus dem Kopf ergoss sich ein wenig Blut auf das helle Holz und verfloss in den Maserungen des ehemaligen Stallbodens. In der alten Hütte oberhalb von Zermatt in den Schweizer Bergen endete das Leben des ewigen Spielers mit seiner grenzenlosen Gier nach dem ultimativen Deal.
8.30 Uhr war eigentlich nicht die Zeit, zu der Diana normalerweise wach war, schon gar nicht am 24. Dezember. Wer wie sie meistens nachts arbeitete, hatte auch in der Freizeit einen anderen Rhythmus. Doch sie hatte diese Nacht sehr unruhig geschlafen, weil sie Angst vor dem hatte, was Tausende von Kilometern weiter östlich geschehen könnte – natürlich nicht wegen Mitch. Die ganze Nacht hatte sich Diana im Bett hin und her gewälzt, war mehrfach aufgrund der durch den heftigen Wind verursachten Geräusche aufgeschreckt. So ganz verwaist war Big Deal doch unheimlich, die Lehman’sche Privatinsel im Pazifik vor Hawaiis Big Island mit dem weißen, einem Leuchtturm gleichenden Haus auf der Spitze des freien Felsens am Rande der Insel, die nun ihr gehörte.
Bei ihren früheren Besuchen war hier immer big Party gewesen. Männer mit meist ausgebeultem Schritt, die sich eines der vielen von Mitch organisierten jungen Mädchen schnappten, als griffen sie am Buffet ‚all you can eat‘ zu. Nur Camilla oder sie packte nie ein Bekannter an. Früher hatte Mitch sie manchmal einem guten Freund spendiert, aber das war längst vorbei.
Nur noch ihm selbst gehörte sie. Erst war ihr das gar nicht aufgefallen, denn als Dienstleisterin tat sie einfach ihren Job. Doch mit dem Heiratsantrag fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Mitch hatte sie nicht mehr zum Fremdvögeln verliehen. Und Camilla wurde sowieso nicht vergeben. Nur an Godunow hatte er sie mehr oder weniger verkaufen müssen.
Mrs. Mitch Lehman beschlich seit Tagen ein ungutes Gefühl hinsichtlich der Sache in Zermatt. Lange Gespräche konnten sie ja nicht führen – ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Betrüger und Mörder hatte seine Nachteile in punkto Gesprächskultur. Auch Camilla konnte sie leider nicht anrufen. Alles sollte auf seine Art und Weise geschehen. Was er genau tun wollte, wusste sie nicht. Dass sie ihn nicht abhalten konnte, wusste sie umso besser. Und eigentlich waren ihr bis auf Camilla auch alle ziemlich egal. Egal, legal, illegal? Was machte das in dieser Zeit noch für einen Unterschied?
Um 8.30 Uhr, elf Zeitzonen zurück, saß sie deshalb schon lange auf der Terrasse vor dem Schlafzimmer und nippte am Kaffee, immer mit Blick auf die Uhr, Mitchs Zeichen erwartend. Nur ‚DC‘ wollte er ihr per SMS schreiben – von einem billigen Schweizer Prepaid-Handy auf ihr verschlüsseltes iPhone. Immer wieder schaute Diana auf das Display, doch ‚Deal Closed‘wurde einfach nicht gesimst. Dabei blickte sie in ihr eigenes Spiegelbild, denn solange der Bildschirm schwarz blieb, ähnelte er einem kleinen Schminkspiegel.
Die Sonne des Pazifiks und die Ruhe der Insel hatten ihr gut getan. Arbeiten musste sie nun nicht mehr, schließlich war sie Ehefrau und nicht mehr Edelhure, auch wenn ihr das eigentlich auch egal war. Vorsicht in der Kommunikation war seit Monaten geboten, auch wenn sie im November insgeheim in Moskau in Anwesenheit von Wladimir Godunow und Camilla Miller als Trauzeugen kirchlich geheiratet hatten, wobei Diana auf das jungfräuliche weiße Kleid nicht verzichtete. Wenn sie schon spielte, dann richtig. Mitch hatte das Kleid zu einem Kommentar über ihren Beruf verleitet. „From High End to Holy End“ konnte ihr jedoch nur ein gequältes Lächeln abringen und ließ keinen Zweifel darüber, was sie für einen Ehemann bekommen hatte. In der Hochzeitsnacht hatte sie ihm bewiesen, dass sie nichts von ihrer Professionalität eingebüßt hatte, auch wenn sie jetzt mit ihm verheiratet war. Diana kannte das Spiel und spielte es, und zwar besser als Mitch es je vermutet hätte.
Viele Jahre war Diana Lundgren Mitch Lehman als dessen persönliche Prostituierte zu Diensten gewesen. Sie kannte ihn intimer als jede andere. Doch als er ihr den Antrag machte, war sie völlig überrascht. Es passte überhaupt nicht in ihren Lebensplan. Nicht die junge blonde Camilla wollte er heiraten, sondern sie, die gut vierzigjährige Schwedin mit dem zweifelsohne noch ziemlich gut gebauten Körper, dem man den täglichen Sport ansah. Diana hatte immer auf ihr Kapital geachtet – mit Ausnahme der letzten vierzehn Tage.
Seit November war Diana Lundgren die zweite Mrs. Mitch Lehman, trug einen schlichten Ehering aus Weißgold und wartete auf Mitchs Privatinsel Big Deal darauf, dass der große Trader seinen letzten Deal zu Ende brachte. Etwas komisch hatten die Behörden auf Hawaii schon dreingeschaut, als sie ihnen Mitte Dezember bei der Anreise die Schenkungsurkunde für das Anwesen unter die Nase gehalten hatte. Doch das FBI war froh, weil es damit einen Fixpunkt hatte, von dem aus man Mitch suchen wollte. Selbstverständlich hatte Diana versucht, Mitch zu überzeugen, seinen letzten grossen Deal einfach zu lassen. Sie hätte die Dinge anders gelöst, wusste aber nur zu gut, dass man einen Big Trader wie Mitch nicht von einem Big Deal abhalten konnte, wenn er einmal richtig Blut geleckt hatte. Diana Lehman wusste, dass sie einen Söldner geheiratet hatte – einen Kapitalmarktsöldner zwar –, aber das machte es auch nicht anders. Sie war eine Soldatenbraut, die zu Hause zu warten hatte, bis er vom Felde heimkam oder gefallen war.
Dieser ‚General‘, wie ihn seine Kapitalmarktsöldner genannt hatten, lag in seiner eigenen kleinen Blutlache im Maiensäß oberhalb von Zermatt, elf Zeitzonen voraus. Es dauerte Stunden, bis die Kantonspolizei den toten Lehman abtransportiert, alle Spuren am Tatort aufgenommen und alle Anwesenden vernommen hatte. Erst gegen 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit kehrte bei den Douvalier-Bensiens wieder Ruhe ein: Madame bat „trotz allem“ zu Tisch. Carla hielt den ganzen Abend die Hand von Carl. Sam und Steve, die Jungs sowie Mademoiselle Rey lockerten alle wieder auf. Nur den beiden Sicherheitsleuten war jeglicher Appetit vergangen.
Später, gegen ein Uhr am Morgen, zog Carla Bell, die stellvertretende Chefredakteurin des CityView, den leicht verklemmt wirkenden Dr. Carl Emil Etienne Bensien, Chief Executive Officer der Carolina Bank, hinter sich her in Richtung ihres Zimmers im ersten Stock, das praktischerweise ein Doppelbett hatte. Carla und Carl verbrachten ihre erste Nacht miteinander, nachdem sie dem Tod ganz knapp entkommen waren. Carla wollte am nächsten Morgen neben Carl aufwachen. Dass Madame Douvalier-Bensien ihr beim Abschied zugezwinkert hatte, hätte sie fast laut loslachen lassen.
Zum Lachen war Camilla derweil gar nicht mehr zumute – der Plan war schiefgegangen. Als sie das hektische Treiben vor dem Polizeigebäude bemerkt und später den Pistenbully mit dem Sarg vom Maiensäß herunterkommen sah, war ihr klar, dass Mitch seinen letzten Deal vermaselt hatte. Doch erst gegen ein Uhr hatte sie Gewissheit. Auf der Polizeistation tat Camilla so, als suchte sie eine bestimmte Bar für einsame Herzen in der Heiligen Nacht und hatte „der Tote heißt Mitch Lehman“ aufgeschnappt. Nicht dass sie irgendetwas für Mitch empfand, schließlich hatte er sie verkauft und obendrein Diana geheiratet, aber nun wusste die Polizei bereits vom Mordversuch. Für sie wurde es höchste Zeit, Zermatt zu verlassen und Diana darüber zu informieren.
Während Wladimir Godunow – nachdem er bis auf Carla alle neun Weihnachtsgäste im Maiensäß für Mitch an den Stühlen gefesselt und für den geplanten Tod vorbereitet hatte – sich aus dem Staub machte, blieb Camilla auf ihrem Posten. Sie sollte Mitch nach den beiden Morden als Japanerin verkleidet aus dem verschneiten Zermatt herausschaffen. Japaner waren in Zermatt am unauffälligsten, da es hier fast mehr davon gab als in Tokio, selbst im Winter.
Zwei Stunden später war sie nun ohne Mitch unten im Tal angekommen. Sie hatte sich in eine blonde Skilehrerin verwandelt, saß in einem Range Rover mit Zürcher Kennzeichen und fuhr in Richtung Simplonpass. Wladimir und sie wollten sich in Domodossola treffen und über das Tessin nach Turin flüchten, um von dort aus mit einem Linienflugzeug Europa zu verlassen. Die Strecke war länger als andere, aber eigentlich konnte niemand auf die Idee kommen, dass jemand durch das verwinkelte und zu dieser Zeit verschneite Centovalli kurven würde.
Kurz vor dem Simplonpass zog sie den Lederhandschuh an, schnappte sich eines der beiden alten Handys mit schnöder Tastatur vom Beifahrersitz und tippte: LIEBE SCHWESTER, DANKE FUER DEN SCHOENEN STAENDER. LEIDER IST ER ABER VOELLIG KAPUTT GEGANGEN, ALS WIR BEIM WEIHNACHTSESSEN SASSEN. ICH MELDE MICH NACH DEM FEST BEI DIR, DEINE C.
Fast hätte Camilla dabei die Abfahrt in Richtung Simplon verpasst. Schnittig nahm sie die Kurve, öffnete das Fenster und warf das Handy in hohem Bogen in den aufgetürmten Schnee neben der Straße. 3.15 Uhr zeigte die Uhr unterhalb des Tachos am Morgen des 25. Dezember 2009. Camilla lag sehr schlecht in der Zeit, weil sich in Zermatt alles verzögert hatte. Godunow hatte ihr eingebläut, auf gar keinen Fall die Geschwindigkeitsbegrenzung zu überschreiten – das flöge in der Schweiz garantiert auf. „Scheiß Mitch“, dachte Camilla, war sich dabei aber nicht im Klaren darüber, welches von den vielen Schlamasseln sie genau meinte, die sie Mitch in den letzten Jahren zu verdanken hatte. Nur gut, dass sie fünf Millionen Dollar per Vorkasse für den ‚Blow Job‘ erhalten hatte, wie sie das Tötungskommando nannte. Bensien, Bell & Co. sollten von Mitch schließlich weggeblasen werden. Sie und Godunow hatten nichts damit zu tun, mussten lediglich für die Logistik sorgen.
Elf Zeitzonen zurück las Mrs. Diana Lehman die Nachricht auf dem Display ihres Handys. STAENDER war Camillas und ihr Codename für Mitch – seit der ersten gemeinsamen Nacht, in der seine Manneskraft nicht kaputtzukriegen gewesen war. Sie hatte Camilla mit ins Geschäft gebracht, als sie merkte, dass sie mit Mitch auf Dauer nicht mehr alleine fertig werden würde, aber auch, weil sie Camilla dominieren konnte. VÖLLIG KAPUTT ließ keinen Zweifel aufkommen: Mitch war tot!
Diana konnte gar nichts dagegen machen. Nach Empfang der Nachricht stieg sofort ein Gefühl in ihr auf, dass sie nun frei war, dass dies aber nicht das Ende sein konnte, sein durfte! Der Plan reifte wie von selbst in diesen faulen vierzehn Tagen, in denen sie ihren Körper kaum bewegt und sich dermaßen hatte gehen lassen. Auch die anderen Mitchs sollten zerstört werden. Das war ihr einziger Gedanke. Ihr Geist war wach, ihr Fleisch schwach.
Bis zum späten Nachmittag des 7. Januar 2010. Nach der Runde um das Obergeschoss entstieg sie dem Jacuzzi, trocknete sich kurz ab und ging, nur mit einem Handtuch um ihre schlanken Hüften, hinunter in die Küche und bereite sich ein Abendessen vor. Dann zog sie ein neues, gut riechendes Hauskleid an und aß langsam, aber so viel, als wollte sie die vierzehn Tage, in denen sie fast nichts zu sich genommen hatte, nachholen: Brot, das zwar etwas hart geworden war, sowie Salami, Schinken und Käse, deren Haltbarkeitsdaten noch nicht abgelaufen waren. Nur vom Alkohol ließ Diana die Finger und trank stattdessen Saft und Wasser.
Gut gesättigt machte sie sich auf und ging in Mitchs Büro im obersten Stockwerk des Leuchtturmes. Auf dem Weg dahin musste sie die Wendeltreppe durch das Schlafzimmer nehmen. Der kleine Schreibtisch, auf dem früher Mitchs Bloomberg-Terminal leuchtete, war verwaist. Wie oft war Mitch mittendrin aufgesprungen, wenn der Terminal mit neuen Flash-Meldungen blinkte, hatte die Meldungen studiert und dann telefonisch schnell ein paar Anweisungen durchgegeben. Als wenn es keine Unterbrechung gegeben hätte, hatte er sie dann weitergevögelt. Wie oft hatte sie ihn dafür gehasst!
Nachdem sie im obersten Geschoss den Laptop hochgefahren hatte, fand sie schnell die gesuchte Privatnummer in ihrer Adressenverwaltung. Mit Blick auf die Armbanduhr, eine mit Brillanten besetzte goldene Cartier, das Hochzeitsgeschenk von Mitch, schnappte sich Diana ihr verschlüsseltes iPhone: 22 Uhr Ortszeit auf den hawaiianischen Inseln. Zehn Stunden weiter westlich war es mithin acht Uhr am Freitagmorgen, eine gute Zeit zum Telefonieren. Diana tippte die Vorwahlen für England und London und dann eine siebenstellige Telefonnummer. Da sie trotz Verschlüsselung davon ausgehen musste, dass ihr Handy abgehört werden könnte, musste sie sehr vorsichtig sein. Keine zweimal klingelte es am anderen Ende ehe jemand abnahm.
„Cindy Fitzpatrick.“ Ein Lächeln ging über Dianas Gesicht.
„Diana hier“, legte sie los, ließ ihren neuen Nachnamen aber vorsichtshalber weg.
„Uh, das nenne ich eine echte Überraschung“, bemerkte Cindy nach einer kurzen Pause. Ihr Stimme klang überrascht.
„Das Leben ist voller Überraschungen, Cindy.“ Diana antwortete schnell, nicht dass Cindy gleich auflegen würde. „Ich muss dich sprechen.“
„Woher hast du eigentlich meine Privatnummer? Wieso rufst du mich zu Hause an?“
„Auf Nummern verstehe ich mich. Und eine Primadonna geht doch immer erst wieder am Montag zur Arbeit, nicht wahr?“
„Was willst du denn besprechen?“
„Das würde ich dir gerne persönlich mitteilen.“
„Kein Interesse, Diana. Das mit Lehman ist vorbei. Und die Primadonna bin ich schon lange nicht mehr.“
„Genau, meine Liebe. Wir haben beide von ihm profitiert, beide ihm gedient, diesem Dreckschwein.“ Letzteres hatte sich Diana extra für die möglichen Abhördienste ausgedacht.
„Dein Tagessatz war deutlich besser als mein Gehalt.“
„Vergiss deinen Bonus nicht. 250.000, stimmt's?“ In Cindys überraschtes Schweigen hinein, dass diese Hure ihren letzten Lehman-Bonus kannte, sprach Diana weiter. „Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben anfangen will.“
„Und dabei bist du auf mich gekommen?“
„Genau.“ Cindy hatte angebissen. Diana freute sich im Privatbüro des Mannes, der sie beide so oft zusammengebracht hatte.
„Wie soll das gehen?“ Am Telefon im Londoner Vorort Barnes spielte eine sichtlich interessierte Chefsekretärin an ihrer Perlenkette. „Ich bin eine gute Katholikin.“
Diana verdrehte die Augen, so wenig überzeugend klang der Vorwurf. „Amen!“
„Ich verstehe dich nicht, Diana.“
„Amen. So sei es, heißt das doch in eurem Club. Zier dich nicht, du brauchst Geld und ich habe eine Idee. Lass uns treffen, das ist keine Sünde.“ Stolz ballte Diana ihre Faust ob der wunderbaren Brücke, die sie ihr gebaut hatte. Noch mehr aber, weil sie Cindy unbedingt für ihren Plan benötigte.
„Ooookay. Wann und wo?“
„Wie wäre es zum Tee bei Fortnum & Mason am Montagnachmittag?“
„Fünf Uhr?“
„Wann sonst, meine Liebe, wir haben doch Stil, oder?“
Prohibition
Fremd kam ihr das kalte verlassene Büro am Freitagmorgen vor. Trotz warmen Rollkragenpulli, Jeans und Over-Knee-Stiefeln, die ihre langen Beine betonten, fröstelte es Carla. Noch lag die Ruhe vor dem Sturm über den leeren Schreibtischen. Erst am Montag würde alles wieder so sein wie immer. Die Investmentbanker schienen das Jahr 2008 schon fast völlig vergessen zu haben, zumindest die Händler in den Legebatterien, den großen Handelssälen der globalen Kapitalmarktwelt. Die Montagsausgabe war im Wesentlichen mit Ausblickstorys vorproduziert worden. Die erste Woche im Jahr war für Journalisten eine Saure-Gurken-Zeit. Erst am Nachmittag würden ein paar Redakteure Aktualisierungen vornehmen, sodass vor fünfzehn Uhr niemand in der Redaktion des CityView auftauchen würde.
Carla Bell war das nur recht. Nach über drei Monaten, in denen sie sich seit dem 28. September 2009, als Don Kramer ermordet worden war, zu ihrer eigenen Sicherheit verstecken musste, kam ihr die Vorstellung, dass nun alles wieder normal laufen sollte, sie täglich an ihrem Schreibtisch als stellvertretende Chefredakteurin Artikel über Banken, Börsen und sonstige verrückte Geschichten schreiben würde, sehr befremdlich vor. Die drei Monate in Zermatt, die Angst und der Tod von Mitch Lehman hatten sie zynischer werden lassen. Das ganze Anschreiben gegen die Zocker hatte doch kaum etwas bewirkt. Nach Schrott-Immobilien schienen nun Währungen oder Rohstoffe die neuen Spielzeuge der Jungs mit den ‚big balls‘ zu werden.
Schon gegen neun Uhr war sie in die Old Bridge Road gefahren, mit der Tube aus Islington kommend, wo sie gestern ihr kleines Appartement wieder reaktiviert hatte. Zwar hatte Samantha die Bude putzen, lüften und mit Blumen versehen lassen und ihren Kühlschrank gefüllt, aber der Bell’sche Körperduft war nach drei Monaten Abwesenheit völlig verschwunden. Als Carl dann gestern Morgen in Richtung New York abgeflogen war, hatte sie sich schweren Herzens zu ihrer eigenen Bude aufgemacht. Einerseits, weil Carl nun das erste Mal weg war, seit Heiligabend; andererseits, weil Carla das letzte Mal in ihrer Wohnung war, als Mitch sozusagen noch hinter ihr her war. Sein Tod beendete zwar die Hatz, nicht aber das Ende der Gier.
Unschlüssig schlenderte sie durch die Redaktion, schaute an jedem Schreibtisch vorbei – nur nicht an ihrem eigenen. Carla spürte, dass ihr die Rückkehr ins Leben schwerfiel, auch wenn sie seit September auf diesen Tag gewartet hatte, wie ein Gefangener auf seine Entlassung.
Simon hatte ihre Unsicherheit sofort gespürt und ihr die richtige Resozialisation verordnet. Vorgestern hatten sie und Carl mit Simon und dessen Frau Cecilia diniert. Im „Savoy Grill“ mussten beide dem bulligen Chefredakteur Trent haarklein berichten, was in der Heiligen Nacht passiert war. Nicht dass Carla oder Carl das gerne ausbreiteten, aber Simon hatte nicht nur ein journalistisches, sondern auch ein freundschaftliches Recht auf ‚first hand information‘.
Den Nachruf hatte Simon zwar schon in eine Ausgabe zwischen den Jahren hineingequetscht, denn mehr war ihm Mitch Lehman nicht wert. Aber wie es seiner ‚Kleinen‘ ergangen war, wollte er doch genauer wissen. Und da waren ihm die Zwischentöne schon bald aufgefallen. Ein „Wofür schreiben wir das alles?“ hatte er von seiner bissigen Carla bislang noch nie gehört. Eigentlich sah Carla noch besser aus als vor drei Monaten: schlank, schön gebräunt, das rotblonde Haar zwar immer noch lang, aber doch etwas kürzer, eleganter. „Fraulicher“, fiel es Simon während des Essens plötzlich ein, was er automatisch mit Carl in Verbindung brachte, auch wenn es mit Ende zwanzig ja ohnehin langsam mal Zeit wurde.
„Ich habe den View of the Year zwar fertig, aber wenn du bis Freitagmittag einen neuen View hast, den ich redigieren kann, dann nehmen wir deinen, Kleine.“
„Sag nicht Kleine, sonst sage ich Simi zu dir.“
„Was ist das denn?“
„Schweizer Kosename für Simon.“
„Uh!“
„Die Idee ist gut, gibt mir Zeit.“
„Du hast seit 2007 alle Views of the Year geschrieben, wenn auch nicht alle alleine.“





























