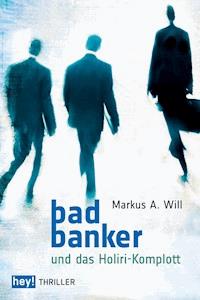
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein packender Thriller um skrupellose Finanzhaie und ihre Gegenspieler in der verführerischen Glamourwelt des Geldes, in der die Gier Einzelner über alles triumphiert. Mitch Lehman will alles, und der Erfolg gibt ihm Recht: Der Starbanker der Carolina Bank gehört zu den big playern seiner Zunft. Er scheffelt Rekordgewinne für die Investmentbank und es scheint, als könne ihn nichts und niemand aufhalten. Als 2008 die ganze Bankenwelt zu explodieren droht, findet der Tanz auf dem Vulkan ein abruptes Ende. An den Schauplätzen London, New York, Hawaii, Frankfurt und Zermatt erlebt der Leser ein rasantes Rennen um Macht, Sex, Geld und Einfluss, das in einem dramatischen Showdown an Weihnachten 2009 ein überraschendes Ende findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1003
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Markus A. Will
bad banker
und das Holiri-Komplott
Thriller
Copyright der E-Book-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München
Originalausgabe © 2010 bei Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Markus A. Will wird vertreten durch die Agentur Lianne Kolf, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Umschlaggestalltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: FinePic®, München
ISBN 978-3-942822-05-3
-1-2-3-4-5-
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
www.markuswill.com
Prolog
Rekordjahr 2006
Driving home for Christmas
Drei Tage zuvor
Krisenjahr 2007
Stress im Januar
Hot Summer in the City
Rauswurf im Advent
Katastrophenjahr 2008
(Un)glücklicher Januar
Giftiges Frühjahr
Tödlicher Sommer
Untergang im Herbst
Abgetaucht zum Jahresende
2009 – Das Jahr danach
Lehman lebt
Es weihnachtet
Epilog
Dank
Seit 2007 tobt in der realen Welt die Finanzkrise mit ihren absurden Finanzinstrumenten, komplizierten Verschachtelungen, harmlos klingenden Zertifikaten und Derivaten sowie der Gier und auch Arroganz verschiedener Akteure in der Parallelwelt des globalen Kapitalmarkts. Alles das ist wirklich geschehen.
In dieser Realität spielt der Bad Banker, eine fiktionale Story, deren Handlung völlig frei erfunden ist. Alle Figuren, Banken, Szenen und Dialoge sind erfunden. Sollte es Namensgleichheiten geben oder Gegebenheiten ähnlich stattgefunden haben, so ist das Zufall. Nichts ist so geschehen, vieles hätte aber genau so geschehen können.
Prolog
»Don soll nicht umsonst ermordet worden sein«
Freitag, 2. Oktober 2009, St. Lawrence Cemetery in New Haven, Connecticut, gut eine Autostunde nördlich von New York City Knapp fünf Tage sind seit dem Attentat auf Donald F. Kramer, Chief Executive Officer der Carolina Bank, vergangen. An der Wall Street starren selbst die coolsten Trader gebannt auf die Bildschirme und verfolgen die Trauerfeier live auf CNN worldwide. Auch in der City, Londons Finanzmeile, hängen die Banker fassungslos vor den Fernsehapparaten.
Die endlos scheinende Wagenkolonne kommt nur im Schritttempo auf der Forrest Road voran. Männer in schwarzen Anzügen überprüfen am großen Kreisel in der Friedhofsmitte, unterstützt von der New Haven City Police, jeden einzelnen Wagen. Die zahlreichen Nobelkarossen müssen nach links abdrehen und werden zum westlichen Ende des Friedhofs dirigiert. An dieser Stelle darf aus Sicherheitsgründen nur noch der Leichenwagen mit Don Kramers sterblichen Überresten passieren, die Trauergäste müssen ihre Limousinen verlassen und die letzte Strecke zu Fuß gehen.
Die großen Blätter der Platanen entlang der breiten Allee, auf der die Trauernden dem mächtigen Sarg folgen, haben bereits eine gelbliche Färbung angenommen. Der Wind spielt mit den Blättern, und wenn es leise rauscht, klingt es wie ein Herbstrequiem. Die Sonne steht bereits tief, noch wärmen die Strahlen. Nahezu alle tragen dunkle Brillen, hinter denen verweinte Augen verborgen bleiben. Don Kramer war ein sehr beliebter Mann und ein ganz Großer der Wall Street.
Über zweihundert Personen sind erschienen, darunter sämtliche mächtigen Bosse der Wall Street, der gesamte Vorstand der Carolina Bank, Vertreter der Notenbank Federal Reserve Bank, des Finanzministeriums Treasury, der Börse New York Stock Exchange und der allmächtigen Aufsichtsbehörde Securities & Exchange Commission. Selbst das WhiteHouse hat einen hohen Beamten aus dem Stab des neuen Präsidenten geschickt, um den Wall-Street-Tycoon auf seiner letzten Reise zu begleiten; eine handschriftliche Kondolenznote des Präsidenten hat er der Witwe bereits überreicht.
Maud Kramer, verhüllt unter einem schwarzen Schleier, hat sich bei Carl Bensien eingehakt; krampfhaft hält sie eine rote Rose in der Hand und folgt festen Schrittes dem Sarg ihres Mannes in der Limousine vor ihnen. Maud versucht, Haltung zu bewahren. Nur Carl, einer von Dons besten Freunden, mit dem er oft im Yale Golf Club ein paar Löcher gespielt und dabei über diese verdammte Finanzkrise gesprochen hat, merkt, wie sehr die Witwe auf seinen Arm angewiesen ist.
Auch nach Lehmans Auftritt am Jahrestag der Pleite vor knapp drei Wochen hatte niemand wirklich geglaubt, dass aus der Drohung blutiger Ernst werden könne, auch wenn die Sicherheitsvorkehrungen seitdem massiv verstärkt worden waren. Der Mord an »DFK« im einundvierzigsten Stock des World Financial Centers, in seinem eigenen Büro im World Headquarter der Carolina Bank, hatte alle eines Besseren belehrt.
Meter um Meter schiebt sich die Menschenschlange voran. Als die Menge von der großen Allee zu Dons letzter Ruhestätte einbiegt, blickt Carl Bensien besorgt auf die vielen Menschen. Wenn es der Mörder geschafft hat, am helllichten Tag in die Investmentbank einzudringen und den CEO zu erschießen, wie wollte da der Security Service verhindern, dass auch an diesem Ort ein weiterer Mord geschieht? Selbst die dezent aufgestellten Kameras von CNN wirken bedrohlich auf den neuen Mann an der Spitze der Carolina Bank.
Hier könnte er sie alle treffen. Alle, die noch viel gieriger waren, als es Don Kramer jemals gewesen war; wie sehr Bensien diese Leute in seinem Innersten verabscheut. Für Maud Kramer war es jedoch keine Frage, dass der Verwaltungsrat ihm noch vor der Beerdigung die Leitung der Bank anvertrauen würde. »Du musst das machen, Carl«, hatte sie ihn angefleht: »Don soll nicht umsonst ermordet worden sein.« So ließ er sich in die Pflicht nehmen, obwohl er als ehemaliger Chief Risk Officer genau wusste, welches Risiko er eingeht und welchem Risiko die Carolina Bank wegen dieser beschissenen Holiris ausgesetzt ist. Ein Bensien drückt sich nicht, und Don hätte dasselbe für ihn getan.
Als Carl Bensien neben Maud Kramer im Kreise der Angehörigen, für die Stühle aufgestellt wurden, vor dem offenen Grab Platz nimmt, sieht er nur versteinerte Mienen, die auf den mit unzähligen roten Rosen geschmückten Sarg starren. Man hatte dafür gesorgt, dass CNN die Kameras nicht auf die trauernde Familie und die engsten Freunde richtet, sondern hauptsächlich das Grab, den Pfarrer und die große Menge zeigt. Ob diese Herren des Geldes dem Pfarrer lauschen, ist nicht zu erkennen; versteckt hinter ihren dunklen Brillen ist ihnen durchaus bewusst, dass es auch sie hätte erwischen können. Jeder hatte einen Lehman in den eigenen Reihen wirbeln lassen. Und alle haben die giftigen Wertpapiere verkauft, die plötzlich alle fast ohne Wert sind.
Als der Sarg ins Grab hinabgelassen wird, stehen die Banker und Händler in New York an der Wall Street still; für eine Minute stoppt der Handel. Viele falten die Hände, einige beten. CNN zeigt beide Orte gleichzeitig: Im linken Teil des Bildschirms wird die Trauerfeier von St. Lawrence Cemetery übertragen, auf dem rechten werden die Reaktionen der Händler in den verschiedenen Finanzinstituten der Wall Street eingefangen. Carla Bell, die aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort ausharren muss, schießt bei diesen Fernsehbildern nur eines durch den Kopf: Hätten sie doch nur früher einmal für einen Moment innegehalten. Sie presst ihre Hände zusammen, Carla hat Angst, auch wenn Sam nicht von ihrer Seite weicht.
Wie viele Tote mag es schon gegeben haben und wie viele werden noch folgen, geht es Carl Bensien durch den Kopf; er zieht dabei den Scheitel seines grau-melierten Haars mit der Hand nach, während er die an der Witwe vorbeiprozessierende Kondolenzschlange nach vertrauten und vertrauenswürdigen Gesichtern absucht. Seit Beginn der Krise ist nichts mehr, wie es einmal war. Giftige Zertifikate und Derivate haben eine Bank nach der anderen zerstört, nur mit Billionen-Dollar-Spritzen seitens der Regierungen ist der Super-GAU bislang abzuwenden gewesen. Sie sind kaum überstanden, die dunklen Wochen, in denen selbst die abgebrühtesten Banker vor Angst zitterten, dass alles zusammenbrechen würde. Einige, wie Isabella Davis, haben den Druck nicht ausgehalten.
Als die Trauerfeier vorüber ist, gibt sich Bensien einen Ruck und nimmt die zerbrechliche Maud Kramer in die Arme: »Ich werde dafür sorgen, dass Lehman seiner gerechten Strafe nicht entgehen wird.« Dann bittet er Allan Smith, den Finanzvorstand der Carolina Bank und ebenfalls ein enger Freund der Kramers, die Witwe zum anschließenden Empfang zu begleiten. Er verabschiedet sich mit einem kurzen Nicken von den engsten Vertrauten und macht sich auf den Weg. Die Nachricht, die ihn kurz vor der Beerdigung erreichte, duldet keinen Aufschub.
Seinen Fahrer hat Bensien an das andere Ende der Sicherheitsabsperrung beordert, damit er nicht den ganzen Weg zurück und damit an allen Leuten vorbei muss. Bereits hundert Meter von der Trauergemeinde entfernt und seine Limousine im Blickfeld, da hört er hinter sich den Kies knirschen. Weit und breit ist kein Security-Mann zu sehen. Carl Bensien dreht sich um und traut kaum seinen Augen: Lenny Peters, einer der mächtigsten Männer der Wall Street, ist ihm gefolgt:
»Warum so eilig, Charly? Ich wollte noch etwas mit dir besprechen.«
»Leider keine Zeit, Lenny, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Tut mir leid.«
»Dafür hast du doch jetzt deine Leute, du bist nicht mehr Dr. No Risk, Charly. Du bist jetzt der Boss, einer von uns, Carl. Ein Dr. Big Boy.« Der kleine Lenny Peters erreicht den hoch aufgeschossenen Carl Bensien und blinzelt ihn gegen die Sonne an.
»Einer von euch? Vielleicht. Doch nicht so wie ihr, Lenny.« Carl dreht sich um und geht die letzten Meter zur wartenden Limousine betont langsam. Als sein Fahrer in Richtung Friedhofstor steuert, sieht er Lenny Peters immer noch kopfschüttelnd und wie angewurzelt an der Stelle stehen. Schade, dass CNN das Bild nicht einfangen kann, denkt Carl und wählt von seinem verschlüsselten Telefon aus eine Nummer in der Schweiz.
Rekordjahr 2006
Driving home for Christmas
London
»Ich liebe diesen Song«, seufzt Carla Bell, als Chris Rea With a Thousand Memories haucht. »Schade, dass es schon vorbei ist.«
»Mal sehen, Lady, ob ich das Lied auf einem anderen Sender finde. Stimmt ja an keinem Tag so wie heute.«
In das Gelächter schnarrt der Suchlauf auf die zahlreichen Verkehrsmeldungen. Der Blick der jungen Journalistin trifft die Augen des Fahrers im Rückspiegel. Fahrer und Taxi haben sicher zwanzig gemeinsame Dienstjahre auf dem Buckel; die Sitze sind abgewetzt, der Motor dröhnt mit leichten Schlägen, es riecht muffig. Nicht unsympathisch der Mann hinter dem Steuer, die randlose Brille ziert ein rundliches, unrasiertes Gesicht, die zotteligen Haare reichen ihm hinten bis über den Kragen.
Ihr Blick fällt auf die Swatch: Zwölf Uhr, um zwölf Uhr zweiunddreißig fährt ihr Zug, und es geht ausgesprochen langsam voran. Die Melodie von Big Ben erklingt, als sie über die Brücke am House of Parliament vorbeifahren. Sie kurbelt das Fenster runter und nach dem letzten »Dong« schnell wieder hoch. Es ist nasskalt, wie immer um diese Jahreszeit in London.
Das Taxi kämpft sich weiter Richtung Greenpark und Knightsbridge, der Fahrer hatte ihr überzeugend erklärt, diese Route sei zu dieser Tageszeit die beste. Von Southwark Bridge in der Nähe der »Financial Times« geht es auf der East Side der Themse bis zur Westminster Bridge und nun weiter an den Parks und dem Buckingham Palace vorbei in Richtung Paddington Station.
Carla hatte das Taxi auf den letztmöglichen Zeitpunkt bestellt, weil sie ziemlich spät aus dem Bett in ihrem kleinen Apartment in Islington gekrochen war. Am Abend zuvor hatte sie sich noch mit einigen Kollegen, die auch erst am 24. Dezember nach Hause fuhren, auf ein paar Drinks im Hampstead Heath getroffen.
Auf dem Weg zum Bahnhof musste sie noch kurz bei der Redaktion vorbei, um ihre Geschenktaschen einzuladen. Und dann kreuzte auch noch Simon auf, als sie wieder ins Taxi steigen wollte. Chefredakteur Simon Trent war auf dem Weg in die Stadt, um endlich das Weihnachtsgeschenk für seine Frau zu besorgen, wie er es immer erst am Morgen des Heiligen Abends tat. Es wurde ein längerer Schwatz, und Carla genoss jedes Wort aus dem Mund des Bosses über ihre große Story, den traditionellen View of the Year.
Am Montag, 8. Januar 2007, erscheint auf der Titelseite des »CityView« der View of the Year, ein Ausblick, den die City-Banker am ersten Arbeitstag des neuen Jahres vorfinden würden. Diese Ehre ist ihr zugefallen – einRitterschlag von Simon Trent. Erst ein Jahr dabei und schon mit dem View betraut. Darauf ist Carla Bell mächtig stolz; gleichzeitig blickt sie besorgt auf den Verkehr. Zwölf Uhr zwei, und der Zeiger bewegt sich unerbittlich weiter. Das Geplauder mit Simon hat zwar Spaß gemacht, aber die Minuten fehlen ihr nun auf dem Weg zur Paddington Station.
Natürlich wäre die Tube schneller gewesen, aber schließlich schleppt sie nicht nur ihren Koffer, sondern auch noch die Geschenke für ihren Vater und ein paar alte Freunde mit sich. Beim Gedanken an die überfüllte U-Bahn und den Mief in den Röhren verzieht sie angewidert ihr Gesicht. Auch wenn Heiligabend diesmal auf den Sonntag fällt, brodelt es in der Stadt. Alle Geschäfte haben geöffnet – Highnoon für Last-Minute-Shopping ist angesagt.
»Mein Zug geht in einer halben Stunde. Schaffen wir das?«, fragt sie ihren Fahrer.
»Lady, Sie wissen gar nicht, wie oft ich ›Schaffen wir das?‹ in den letzten Tagen gehört habe.«
Derweil fördert der Suchlauf ein Sammelsurium an Musik zutage – nur nicht Chris Reas heiser quengelnden Bariton.
Carla ist müde, die letzten Tage hatte sie nicht viel Schlaf bekommen. Journalisten, insbesondere die besten Federn der Finanzpresse, werden stets vor Weihnachten von den Unternehmen hofiert, und Carla hatte sich keine der angesagten Partys entgehen lassen. Trotz ihrer Sorge, den Zug zu verpassen, schließt sie die Augen und lässt sich in die Polster sinken. Augenblicklich taucht die Erinnerung an die Weihnachtsfeier der Carolina Bank vor drei Tagen auf. Dass der junge Banker sie tatsächlich für eine Nutte gehalten hatte, geht ihr nicht aus dem Kopf. »Schätzchen, ich habe auch einen Schuss frei«, hatte der Kerl sie angebaggert. »Vom großen Mitch geschenkt bekommen« hinzugefügt und »wie wärs, bist du gerade frei?« gefragt.
Als der Fahrer in den Rückspiegel schaut, ist die junge Frau in den leichten Taxischlaf gefallen, den er nur zu gut von seinen Gästen kennt. Sie dürfte etwa Mitte zwanzig sein, hat attraktive, etwas herbe Gesichtszüge und schulterlanges, rotblondes Haar. Ihre ramponierte Handtasche wie die Labels der Geschenktüten lassen darauf schließen, dass sie nicht besonders viel verdient. Wahrscheinlich eine Journalistin. »CityView«, wo er – bei laufendem Taxameter selbstverständlich – geschlagene achtzehn Minuten auf sie warten musste, klingt danach. Rund um Southwark Bridge hatte sich seit ein paar Jahren die Medienszene in den alten Fabrikhallen entlang der Themse festgesetzt und dem Quartier zu etwas mehr Glanz verholfen.
Die junge Frau ist ungeschminkt, mittelgroß, trägt Rollkragenpullover, Jeans und schlichte Damenschuhe mit kleinem Absatz. Mantel und Mütze hat sie neben sich drapiert und die Füße auf ihren Koffer in dem geräumigen Londoner Cab hochgelegt. Unter dem dünnen Rollkragenpullover zeichnen sich feste Brüste ab, die sich unter einem dezenten goldenen Amulett im Rhythmus ihres ruhigen Atmens heben und senken.
Schrill und unvermittelt reißt ein Handy Carla Bell aus ihrem Schlummer. Sie ist schlagartig wach und schaut direkt in die Augen des Taxifahrers im Rückspiegel. Der fühlt sich ertappt, konzentriert sich wieder auf die Straße und die stehende Kolonne vor ihnen. Schöne rehbraune Augen hat sie, denkt er. Langsam wird ihm mulmig zumute, ob er rechtzeitig am Bahnhof sein würde.
Beim vierten Klingeln fischt sie endlich das Handy aus ihrer Handtasche. Zwölf Uhr zwanzig zeigt das Display und DAD HOME als den Anrufer, der sie aus dem Schlaf gerissen hat.
»Hi Dad. Bin auf dem Weg«, gähnt sie leise in ihr Handy.
Sie verdreht die Augen, während sie zuhört. »Ich schaffe das schon, habe einen cleveren Taxifahrer erwischt.« Dabei schaut sie den Mann hinter dem Lenkrad beschwörend an.
»Keine Sorge, Dad, zum Early Christmas Drink im Prince of Wales bin ich auf jeden Fall zu Hause. Holst du mich am Bahnhof ab? Ich habe ziemlich viel Gepäck.«
Sie sieht ihn förmlich vor sich: Constable Steven Bell, dem niemand seine vierundfünfzig Jahre geben würde, ist einen ganzen Kopf größer als seine Tochter, die schlanke Figur hat sie von ihm. Sein grauer Schnauzer, den er wie ein Walross zu seinem etwas längeren grauweißen Haar trägt, gibt ihm etwas Gemütliches, was schon manchen Gauner arg getäuscht hatte.
»Ja, meine Story ist fertig. Simon ist zufrieden. Habe ihn eben noch in der Redaktion getroffen. Der geht glatt erst jetzt los, um ein Geschenk für seine Frau zu kaufen.«
Sie hört kurz zu, ehe sie wieder spricht: »Vielleicht muss ich Anfang des Jahres noch ein bisschen daran feilen, aber uns bleibt genügend Zeit. Alles easy, Dad.«
Der Dad am anderen Ende scheint nun länger zu antworten, beobachtet der Fahrer.
»Ich habe die Story ›Business is never usual‹ genannt. Denn eigentlich kann es 2007 nicht so weitergehen. Aber das erkläre ich dir zu Hause in Ruhe. Simon ist jedenfalls auch besorgt. Ich soll dich übrigens herzlich von ihm grüßen.«
Carla Bell weiß, wie froh ihr Vater darüber ist, dass Simon Trent eine Art väterlich-schützende Hand über sie hält, ohne sie zu schonen oder zu bevorzugen. Beide verstanden sich auf Anhieb, als Steven Bell im Frühjahr seine Tochter in der Redaktion besucht hatte.
»Dad, hast du eigentlich schon einmal mit echten Nutten zu tun gehabt?«, wechselt sie zur Überraschung des Fahrers plötzlich das Thema. Der stellt das Radio leiser, ohne dass sein Gast es bemerkt, weil er dabei leicht auf das Gaspedal tippt und der Motor aufheult.
»Ich meine natürlich beruflich. Du hast doch als Polizist schon viel gesehen.«
Was für eine Frage. Der Fahrer starrt angestrengt auf die Straße und versucht, ja nichts zu verpassen.
»Hast du nun oder hast du nicht? Mal ehrlich, Dad: Sehe ich aus wie eine Nutte?«. Carla Bell betrachtet sich dabei in der Trennscheibe, die ihr als Spiegel dient. Sie weiß um ihre Attraktivität und dass die Männer es ihr, wenn sie es darauf anlegt, leicht machen. Nutte! So recht will ihr das immer noch nicht in den Kopf, auch wenn sie schnell durchschaut hatte, wie das passieren konnte.
Anscheinend hat es den Vater am anderen Ende völlig irritiert, denn die junge Frau hält das Handy ein Stück vom Ohr weg. Selbst vorne kann der Fahrer den Vater hören: »Natürlich nicht! Was um Himmels willen treibst du in London?«
»Ich war nur auf einer Weihnachtsfeier.«
»Und da hat man dich für eine Escort gehalten?«
»Oh, du kennst dich aus?«
»Carla, das ist überhaupt nicht witzig.«
»Bitte, Dad, in gut zwei Stunden bin ich zu Hause, dann reden wir«, beschwichtigt sie ihn.
Zwölf Uhr fünfundzwanzig, es wird knapp.
»Bis später. Love you, Dad!«
Carla blickt auf und direkt in die fragenden Augen ihres Fahrers: »Alles mitbekommen?«
»Yeah! Ließ sich nicht vermeiden. Aber keine Sorge: Taxis sind verschwiegene Orte.«
»Und die Fahrer?«
»Ehrensache, junge Dame.«
»Ziemlich blöde Geschichte, die mir da passiert ist.«
»Geht mich nichts an.«
»Sehe ich aus wie eine Nutte? Taxifahrer kennen sich doch damit aus, oder?«
»Nein!«
»Wie bitte?«
»Sie sehen nicht aus wie eine Nutte. Aber dass ihr Dad sich Sorgen macht, ist doch wohl verständlich.«
»Ach, mein Dad, er ist wunderbar. Manchmal etwas zu nervig mit seiner Fürsorglichkeit, aber ansonsten prima. Er hofft inständig, dass ich pünktlich bin, aber das schaffen wir doch, nicht wahr?«
»Ich habe selbst Kinder, die alle an Weihnachten nach Hause kommen. Sie sind meine letzte Tour für heute. Da werde ich noch etwas Gas geben, Lady, damit Sie rechtzeitig zu Ihren Eltern kommen.«
»Ich habe nur noch meinen Dad. Meine Mutter ist gestorben, als ich zehn war.«
Carla wundert sich, dass sie dem Fahrer gegenüber ihre Mutter erwähnt. Normalerweise verdrängt sie gerade vor Weihnachten die Erinnerungen an sie und besonders den Schmerz über ihren Tod. Vielleicht hat ihr Mitteilungsbedürfnis auch damit zu tun, dass gestern Abend dieser Name plötzlich wieder aufgetaucht ist: Stanley Asthon. Der Fahrer unterbricht ihre Gedanken: »Wo müssen Sie denn hin?«
»Nach Hertfordshire. Mein Vater ist Polizist, und wir wohnen etwas außerhalb in einem dieser alten Cottages – sehr ländlich und sehr gemütlich. An Heiligabend gehen wir beide immer in den Prince of Wales, unser altes Dorfpub, wo sich viele Alte und Junge aus dem Dorf zu einem Umtrunk treffen, bevor in den Familien die Bescherung beginnt – es hängt also alles von Ihnen ab!«
Um zwölf Uhr achtundzwanzig biegt das Cab in die Straße vor Paddington Station ein. Der Fahrer zwängt das Taxi in eine schmale Lücke und lässt sich von den ärgerlich hupenden Wagen nicht aus der Ruhe bringen. Knapp, aber es reicht.
Carla zahlt und gönnt sich und ihrem Fahrer ein für ihre Verhältnisse großzügiges Trinkgeld. Als sie aussteigen will, klingt es aus dem Radio:
I'm driving homefor Christmas
Ican't wait to see those faces
I'm driving home for Christmas
»Pech gehabt«, grinst Carla, »aber trotzdem Dankeschön und Ihnen frohe Weihnachten.«
»Ihnen auch! Und grüßen Sie Ihren Vater. Unbekannterweise. Scheint 'ne interessante Tochter zu haben!«
»Ach übrigens: Ich bin Journalistin. Just for the record.«
»Natürlich«, lächelt der Mann und grüßt mit der Hand an der Stirn, während er sich bereits in den Verkehr einfädelt. »Das behaupten viele, Lady«, murmelt er in sich hinein, als er um die Ecke biegt.
Zermatt
»Grüezi, Herr Dr. Bensien. Willkommen daheim.«
»Merci, Max. Schön, Sie zu sehen. Aber ganz sind wir ja noch nicht in Zermatt.«
Max verzieht selbstredend keine Miene darüber, dass der vornehme Dr. Bensien ihn auf der Stelle korrigiert, obwohl man in Täsch doch eigentlich schon in Zermatt ist. Doch so pingelig war er schon immer gewesen, dieser feine Herr aus dem Douvalier-Bensien-Clan.
Carl Bensien ist spät dran. Im dichten Schneetreiben hatte er für die Anreise zum Verladebahnhof Täsch länger gebraucht als geplant.
»Der Zug fährt in zehn Minuten, Dr. Bensien. Ich versorge Ihr Gepäck und parke das Auto. Oben wartet jemand auf Sie.«
Das Skiparadies in den Schweizer Alpen ist autofrei. In großen Hallen an der Talstation lassen die angereisten Gäste aus aller Welt ihre Fahrzeuge stehen und begeben sich mit der Zahnradbahn nach Zermatt. Im Ort selbst verkehren nur Elektrofahrzeuge und Pferdekutschen. Die vielen Fußgänger verleihen Zermatt etwas Gemächliches, selbst wenn der Ort kurz vor Weihnachten mit den vielen Lichtern und Verkaufsständen an jeder Ecke eine hektische Betriebsamkeit entwickelt. Carl Bensien kennt Zermatt noch aus jener Zeit, als es nicht viel mehr als ein kleines Dorf war. Nur noch die Fahrt in der roten Bahn, dann ist er wirklich angekommen. Wie seit zweiundfünfzig Jahren. Außer letztes Jahr.
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.« Den älteren Hausdiener kennt Carl noch aus der Zeit, als im Bensien-Clan die Welt noch völlig in Ordnung schien; Max, in seiner schicken Uniform, hat ganz rote Bäckchen vor Kälte, was ihm ein gesundes Aussehen verleiht.
Carl Bensien steigt entspannt in die Zahnradbahn, die ihn in weniger als einer halben Stunde gemütlich nach Zermatt schaukeln wird. Das Glück ist ihm hold: Er hat das Abteil in der ersten Klasse für sich allein, während in den beiden anderen Waggons Stimmen aus aller Herren Ländern ihrer Freude auf weiße Weihnachten und Skifahren lauthals Ausdruck geben.
Driving home for Christmas intoniert gerade das Familienoberhaupt einer vielköpfigen amerikanischen Familie, während er seine Schar mit zügigen Handbewegungen in das Abteil dirigiert. Es sind die letzten Reisenden, der Schaffner winkt mit der Kelle, und ruckelnd setzt sich der Zug in Bewegung.
Seit Wochen dudelt der Song in New York und London aus allen Boxen und Kehlen; eigentlich kann Bensien die Melodie schon lange nicht mehr hören, aber als er nun wirklich heimkommt und die majestätischen weißen Berge immer näher rücken, kann sich auch der verschlossene Bankier einer leisen Sentimentalität nicht mehr verschließen. Sobald er heimischen Boden betritt, wird aus dem internationalen Banker ein Eidgenosse, und ganz automatisch verfällt Carl Bensien dann in das vertraute Schweizerdeutsch.
Er streckt seine langen Beine aus, verschränkt die Arme vor der Brust. Sein Blick schweift durchs Abteil und bleibt an der Werbung an der Wand hinter der Fahrerkabine hängen: »Ricola! Die guten alten Kräuterbonbons. Wer hat's erfunden?« Bensien muss schmunzeln, als er an den Mann aus der Bonbonwerbung denkt, der so treuherzig-hartnäckig »Wer hat's erfunden?« fragen kann.
Das ist wenigstens etwas zum Anfassen. Aber es könnte auch ein Kunstname für ein Zertifikat sein: Risk Collateral Leveraged Asset oder ähnlich. RICOLA. Wie dieses HOLIRI aus dem Londoner Labor. Klingt süß, obwohl es eines der kompliziertesten Derivate ist, für die beim besten Willen die Verbriefungen von abgeleiteten Wertpapieren nicht erfunden worden sind: HOLIRI – Holistic Individual Risk Security – wie verrückt muss man eigentlich sein, um solche Dinger zu entwickeln?
»Ohne Risiko, Carl«, hatte Isabella Davis ihm diese Woche auf seine Rückfrage bezüglich der Risiken energisch am Telefon beschieden.
»Ohne Risiko ist gar nichts im Leben«, hatte er ihr entgegnet, ehe sie sich zum Schluss wenigstens gegenseitig noch »Frohe Weihnachten!« gewünscht hatten.
Während Carl Bensien das Werbeplakat mustert und sich der Zug in eine weitere Kurve auf dem Weg nach oben legt, murmelt er: »Sind ja Super-Senior-Tranchen, die ersten fünf Milliarden, die ich ihr als Weihnachtsgeschenk genehmigt habe. Da kann ja nichts passieren.«
Das Telefonat mit Isabella Davis vor drei Tagen hatte ihn ein paar graue Haare gekostet. Die hochbezahlte Finanzingenieurin hatte sich nur widerwillig mit seinem Zugeständnis von fünf Milliarden Dollar zufriedengegeben, dann aber eingesehen, dass sie sich an dem Schweizer die Zähne ausbeißen würde, wenn sie auf ihrer Forderung bestehen würde. Seinem Assistenten Tim war bei den Summen, die Isabella von ihm als Anlagekapital verlangt hatte, der Mund offen geblieben.
Der quirlige Rotschopf, seit einem halben Jahr sein neuer Risk Assistent, wird sicher schon in Aspen bei seinen Eltern sein. Bensien war zum Abschied ein bisschen schroff zu ihm gewesen, als sie nach dem Telefonat mit Isabella Davis noch weiter über die Holiris diskutiert hatten. Still für sich gelobt er Besserung und tippt in sein Handy: »Lieber Tim, dir und deiner Familie frohe Weihnachten in Aspen. Bin gerade in Zermatt angekommen. Wir sollten im kommenden Jahr mal zusammen Ski fahren gehen. Mal sehen, ob so ein alter Mann wie ich dich noch im Griff hat. Beste Grüße, Carl Bensien.«
Als er die Sendtaste gedrückt hat, fährt der Zug in den Bahnhof von Zermatt ein. Carl Bensien steht auf, nimmt Mantel und Hut. Noch einmal blickt er auf das Ricola-Plakat. Mir gefallen die Holiris nicht, legt er sich gedanklich fest: Verschiedene Risiken verschiedener Menschen auseinanderzuschneiden und dann neu zusammenzuwürfeln, nein. Und die Risiken sollen alle nichts miteinander zu tun haben? Das kann nicht sein. Aber das prüfe ich im neuen Jahr, beschließt er und verlässt das Abteil.
Gegen Viertel vor drei Uhr dürfte er im »Zermatterhof« sein – bis zum familiären Kirchgang um fünf Uhr bleibt ihm noch ausreichend Zeit für einen Besuch bei Erwin an der Bar, rechnet er beim Umstellen seiner Patek Philippe – ein Erbstück, das bereits sein Großvater getragen hat – auf kontinentaleuropäische Winterzeit.
Seine achtzigjährige Mutter hatte ihn ausdrücklich zu diesem Weihnachtsfest nach Zermatt bestellt. Madame Antoinette Catherine Douvalier Bensien ist die Matriarchin des Clans, seit sein Vater Emil Bensien vor zehn Jahren gestorben war. Sein Kompromiss besteht darin, im Grandhotel »Zermatterhof« zu übernachten und nicht im Familienchalet.
»Eine Tradition bricht man nicht, Carl«, hatte ihn seine Mutter am Telefon vor ein paar Wochen belehrt; die älteste geborene Douvalier führt als gestrenge Hausherrin auch in Zermatt unwidersprochen das Zepter. Die Douvaliers besitzen seit Ewigkeiten ein Familienchalet am Dorfrand von Zermatt, etwas abseits vom Trubel, wie es sich für eine zurückhaltende Genfer Privatbankierfamilie gehört. Von außen wirkt das von hohen Tannen vor neugierigen Zaungästen geschützte Anwesen eher schlicht, ist aber innen sehr geräumig. Aus massivem, Jahrhunderte altem Arvenholz gebaut, bietet das Chalet einen fantastischen Blick auf das Matterhorn.
Carl ist immer gerne dort gewesen. Schon als Knabe bei Opa Douvalier, dann mit Mutter und Vater, später mit Frau und Kindern. Seine Mutter hatte bemängelt, dass ihr Sohn nach der Scheidung im letzten Jahr nicht nach Zermatt gekommen war. Um der Kinder und auch der Familie wegen, wie er sich selbst gegenüber zugeben muss, hatten sich Carl Bensien und seine Exfrau Martina inzwischen arrangiert.
Er musste sich eingestehen, dass die arrangierte Heirat zweier alteingesessener Schweizer Kaufmannsfamilien nicht funktioniert hatte, auch wenn Martina und er in jungen Jahren und mit den Kindern durchaus glückliche Zeiten miteinander verbracht hatten. Über die Jahre waren sie zu einer »Gemeinschaft mit Kindern« geworden – zu wenig, um fern der Heimat auch in London gemeinsam glücklich zu sein. Das wiederum hatte niemand in der Schweiz so richtig mitbekommen; umso mehr hatte die Trennung und spätere Scheidung in der Familie für Ratlosigkeit und Entsetzen gesorgt.
Während seine Söhne Emil und Etienne direkt aus dem Internat und seine Exfrau aus Zürich angereist sind, hat Carl Bensien die Reise aus New York auf sich genommen. Trotz der enormen Distanz fühlt er sich nicht müde; Fliegen ist sein tägliches Brot. Der elegante Bankier zählt zu den Menschen, die im Flug wie ein Baby schlafen können, was ihm in der First Class trotz seinen 1,92 Metern problemlos gelingt.
Oben am Bahnhof wartet der angekündigte Porter am Ausgang. Ohne Namensschild in der Hand, in Zermatt kennt man die Sprösslinge der Douvaliers.
»Dr. Bensien, willkommen. Dort vorne steht ein Schlitten für Sie.« Der Mann hätte ein Zwilling von Max sein können.
»Merci.« Das Schneetreiben hat ein wenig nachgelassen, und Carl atmet die feucht-frostige Luft tief ein. »Seien Sie mir nicht böse, aber ich möchte laufen.«
»Bei diesem Wetter, Dr. Bensien?«
»Ich bin weit gereist, um heute hier zu sein, und warm angezogen. Da kommen mir ein paar Schritte zu Fuß sehr gelegen.«
»Wie Sie wünschen. Ich kümmere mich um das Gepäck.«
»Das ist nett von Ihnen«, Carl winkt dem jungen Porter zu und stapft auf die Bahnhofstraße. Es sind nur wenige hundert Meter bis zu seinem Hotel, und er genießt es, sich in der Menge treiben zu lassen. Auf der Straße wimmelt es von Menschen, geschäftig eilen die meisten von Laden zu Laden. Unübersehbar funkeln die Schaufenster der Bijouterie, in der er damals die Ringe gekauft hatte. Bis sie sich entscheiden konnten, hatten sie den Juwelier an den Rand der Geduld getrieben. Martina wollte ganz moderne, er eher klassische Ringe. Am Ende war die Klassik eher im Metall versteckt, sie wählten Gold statt Platin, dafür bekam Martina die leicht achteckige Form. Zuletzt erwiesen sie sich klug genug für pragmatische Lösungen. Selbst die Scheidung, das gemeinsame Sorgerecht und die Urlaube mit den Kindern stellten einen für beide akzeptablen Kompromiss dar. Nur die Lust auf eine feste Bindung, die hatte Martina ihm gründlich verdorben. Seit der Trennung führte Carl Bensien kaum ein auch nur halbwegs passables Liebesieben, wie er sich eingestehen musste. Ein paar halbherzige Versuche hatte er zwar unternommen, doch dabei war es geblieben, echte Gefühle hatte er dabei nicht empfunden.
Über sich und seine Familie nachdenkend, erreicht der Bankier den »Zermatterhof«: Rechts und links der Zufahrt desGrandhotels türmt sich der Schnee. Unter dem großen Dach der Eingangshalle klopft sich Carl Bensien den Schnee vom Mantel. Das ganz in Kirschholz gehaltene Entree, dekoriert mit Christsternen und Tannenzapfen, vermittelt sogleich die Behaglichkeit, die er noch aus Kindertagen kennt, wenn er Großvater Douvalier begleiten durfte, der in diesem Haus stets zur gleichen Zeit an jedem Sonntagnachmittag einen Apéritif zu sich nahm.
»Ich gehe an die Bar«, nickt er der Rezeptionistin zu, nachdem er eingecheckt hat.
»Gerne, Herr Dr. Bensien. Ich werde Ihnen Bescheid sagen, sobald Ihr Gepäck im Zimmer ist.«
»Lassen Sie sich Zeit. Ich werde erst um fünf erwartet«, antwortet Carl, bereits auf dem Weg in die Rudenbar.
My feet on holy ground
So I sing for you
Though you can't hear me
»Hier auch«, seufzt Carl leise beim Betreten der Bar. Diese amerikanische Leier passt einfach nicht zum Spross einer Zürcher Industriellenfamilie mit hochkultivierten Wurzeln mütterlicherseits in Genf.
»Dr. Bensien, wie schön, Sie hier zu sehen. Ich habe Sie vermisst im letzten Jahr.« Erwin Blatter, seit über dreißig Jahren im Haus und seit achtzehn Jahren Barchef im »Zermatterhof«, kommt extra hinter der Theke hervor, um dem Gast herzlich die Hand zu schütteln.
»Salü, Erwin. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite.«
»Calanda?«, fragt der rundliche Barkeeper, den alle nur beim Vornamen nennen. Sein Haupthaar war früher auch schon voller, stellt Carl Bensien fest. Die Bar hat sich seit seinem letzten Besuch nicht verändert. Die helle Verkleidung des Tresens, der ebenfalls helle Parkettboden mit dem dunklen Gitternetz und die dazu farblich passenden Hocker mit weichem Lederpolster bilden einen schönen Kontrast zur dunklen Holzvertäfelung im Eingangsbereich, zu dem hin sich die Rudenbar öffnet, ähnlich wie in seinem Londoner Club, dem er auch nach seinem Wechsel zur Carolina Bank nach New York treu geblieben ist.
Als Chief Risk Officer hält er sich meist zweimal im Monat für ein paar Tage in der englischen Metropole auf und wohnt dann im Club. Bensien schätzt vertraute Orte; ob Club oder Bar – er ist ein Gewohnheitsmensch. Also hockt er sich mit Schwung auf seinen angestammten Platz an der runden Theke mit Blick in die Empfangshalle, wo er schon als Junge gesessen ist.
»Wie immer, Erwin.« In London und New York verlangte es ihn so manches Mal nach diesem Schweizer Bier. Schneller als gewöhnlich nimmt er einen großen Schluck – bereits nach dem ersten Zug ist das Glas halb leer.
»Sie sehen blass aus, Dr. Bensien, wenn ich mir das erlauben darf.«
Natürlich weiß Erwin, dass er sich diese Vertraulichkeit bei Carl Bensien leisten darf.
»Zu viel Fliegerei, zu viele Meetings, Erwin. Ich habe in den letzten Monaten kaum frische Luft bekommen. Investmentbanking ist ein ungesundes Geschäft.«
»Ich denke, Sie sind seit zwei Jahren in New York stationiert?«
»Stimmt, aber man muss diesen Händlern rund um den Erdball immer wieder in die Augen schauen. Sonst machen die, was sie wollen.«
»Wie bei mir, Dr. Bensien. Ich schaue den Leuten an der Bar in die Augen, und ich weiß, ob ich ihnen trauen kann.«
»Vielleicht sollte ich die nächsten zwei Wochen mal bei Ihnen hinter der Bar stehen.« Und in das Gelächter hebt er sein Glas: »Noch ein Bier bitte.«
»Ihrer Figur hat die viele Fliegerei aber nicht geschadet«, ein gewisser Neid in Erwins Stimme ist unüberhörbar.
»Fitnessclub, Erwin. Im Gebäude. Dreimal pro Woche morgens. Wer will schon durch New York oder London rennen, wenn er zuvor in der Schweiz joggen konnte?«
Relativ zügig trinkt Carl Bensien auch sein zweites Bier, ehe die junge Rezeptionistin mit dem Schlüssel zu ihm kommt.
»Frohe Weihnachten, Erwin. Bis morgen. Heute ist en famille.«
»Bitte grüßen Sie Ihre Frau Mutter und, ähm…, Ihre Familie.«
»Schon gut, Erwin. Was meinen Sie, warum ich hier wohne? Hat auch seine Vorteile, denn sonst musste ich immer vom Chalet herunterlaufen.«
Lächelnd verabschiedet er sich und begibt sich in eine Medium Suite, ausgestattet mit Schlafzimmer und einem kleinen Erker im Wohnraum nebst Esstisch – alles in Holz gehalten. Aus beiden Zimmern hat der Bewohner einen atemberaubenden Blick auf das Zermatter Wahrzeichen.
Wenn er schon vierzehn Tage im Hotel wohnen muss, will sich Carl Bensien auch bewegen können. Zudem beabsichtigt er, sich mit seinen Söhnen ungestört von fremden Ohren zu treffen; im Chalet hörte immer jemand mit. Und wenn die drei Bensiens ordentliche Burger essen wollten, mussten sie sich vor seiner Mutter und seiner Exfrau verstecken.
Erwin serviert gerade in der Halle eine Magnumflasche Veuve Clicquot an Russen, als Bensien aus dem Aufzug tritt. Er mustert die Gruppe, und seine leicht hochgezogene Stirn verrät dem Barchef, wie wenig der Bankier deren Gebaren schätzt.
Carl Bensiens langer, schlanker Körper steckt in einem maßgeschneiderten, einreihigen Flanellanzug, darunter trägt er eine Weste mit drei Knöpfen; eine seiner wenigen Lässigkeiten, die er sich gestattet, ist seine in der Hosentasche befindliche linke Hand. Nur der Doppelschlitz am Rücken erlaubt, dass der dunkelgraue Anzug trotzdem perfekt sitzt. Bensien hat ein bräunliches Einstecktuch passend zur Krawatte gewählt, die mit einem grauen Streifen leicht durchwirkt ist und eine dezent modische Note setzt. Das maßgeschneiderte Hemd ist hellblau, ohne Monogramm mit Manschetten-Erbstücke seines Großvaters. Monogramme, so hatte ihm sein Vater beigebracht, gehören sich bei Zürcher Industriellen nicht – werden sie doch zur äußersten Zurückhaltung auf allen Ebenen erzogen. Die Hose ist derart geschnitten, dass sie auch ohne Gürtel passt; sie sitzt leicht auf den Schuhen auf und hat keinen Schlag. Im Winter bevorzugt Bensien Schuhe mit schwarzer Gummisohle, da das Leder bei Nässe und Schnee leicht brüchig werden kann.
Einzig diese Kniestrümpfe, denkt Erwin, als er sie bei einem langen Schritt des Bankiers hervorblitzen sieht. Sein Gast trägt stets Strümpfe, die ein paar Farbstufen heller sind als die jeweilige Hose. Vor einigen Jahren hatte Bensien einmal mit einigen seiner früheren Internatskollegen aus der Westschweiz an der Bar gebechert. Viel lockerer als sonst war Dr. Bensien da, im Kreise seiner Buddies. Nicht so kontrolliert, erinnert sich Erwin. Die Jungs hatten ihm erklärt, dass der hellere Sockenton das Erkennungszeichen ihres Internats sei, das sich über die Jahre erhalten hat.
Als Bensien an Erwin vorbeigeht, fragt der eine Russe gerade: »Können Sie spielen ›Driving home for Christmas‹?«
Bensien hält kurz an: »Na denn, frohe Weihnachten, lieber Erwin« und, mit Stirnrunzeln zu den Russen, »trotz allem.«
»Ihnen auch, Dr. Bensien.« Der Barkeeper schaut Carl noch einen Moment hinterher. Als Bensien die große Eingangstür des »Zermatterhofs« geöffnet wird, rufen die Glocken zum Kirchgang. In Zermatt ist es sechzehn Uhr dreißig.
Carl Bensien trifft eine Viertelstunde später vor der Kirche ein. So richtig wohlfühlt er sich heute nicht in seiner Haut. Martina und die Kinder zu sehen ist das eine, aber an Weihnachten, wenn selbst seine Mutter ein wenig die Contenance der Romantik und dem Likör opfert, wird ihm das Ganze sentimentale Auf und Ab vielleicht doch zu viel. Noch eine Viertelstunde bis zur Weihnachtsmesse.
»Hallo, Dad«, klingt es synchron von beiden Söhnen und gleichzeitig reserviert, als sie ihren Vater entdecken. Seit ihrer Zeit in London nennen die Jungs ihn am liebsten ›Dad‹. Carl Bensien schlägt die Kühle der Buben auf den Magen; er weiß, wie sehr es ihm die beiden verübeln, dass er nicht mit Martina in die Schweiz zurückgekehrt ist. Die Jungs umarmen ihren Vater dennoch herzlich, weil sie froh sind, dass er in diesem Jahr wieder mit in Zermatt ist. Der Größere, Emil, obwohl erst fünfzehn Jahre alt, ragt schon fast an den Vater heran. Etienne ist einen Kopf kleiner, aber auch jünger als sein Bruder. Anfang Januar wird Etienne dreizehn Jahre alt. So lange will ihr Vater in Zermatt bleiben. Die altmodischen Namen haben sie von ihm, Dr. Carl Emil Etienne Bensien, der sie wiederum von seinem Vater und Großvater mütterlicherseits geerbt hat.
»Hallo, Carl.«
»Hallo, Martina«, begrüßt Carl Bensien seine Exfrau mit drei Küssen ä la Suisse. Martina Bensien trägt Nerz mit passender Fellmütze. Ihre 1,80 Meter verleihen dem Pelz noch mehr Eleganz, ihr filigraner Körper braucht im Winter viel Wärme. Sie trägt elegante Winterstiefel zur Hose – ein Zugeständnis an die klirrende Kälte. Das Schneetreiben hat inzwischen aufgehört.
Nachdem er sich schnell aus ihrer Umarmung gelöst hat, begrüßt Carl Bensien reihum die Familie. Onkel Theodore mit Frau Claudine und den Kindern Fabienne und Dominik, seiner Cousine und seinem Cousin. Carls und Dominiks Hände streifen sich kaum.
»Hallo, Dom.«
»Hallo, Ceeb.«
Dominik und er waren im selben Internat gewesen, allerdings nicht in derselben Klasse, da Carl zwei Jahre älter ist als sein Cousin. Niemand nannte ihn im Internat Carl, sondern alle Ceeb – die Anfangsbuchstaben seiner Vornamen. In der Familie ist Dominik der Einzige, der ihn Ceeb nennt. Seit Carl vor zehn Jahren allerdings den Kopf für Dominiks Fehler hinhalten musste, ist ihre Freundschaft dahin.
Dom war schon immer ein Draufgänger gewesen und hatte zu viel riskiert. Nur dass Carl dummerweise für die Währungsgeschäfte verantwortlich war, weil er eben älter war, etwas schneller studiert und dann auch erfolgreicher bei Douvalier & Cie. gearbeitet hatte. Dominik hatte sich Zeit gelassen und war erst mit fünfunddreißig Jahren in die Bank der Familie eingetreten, die sein Vater Theodore, Carls Onkel, leitete.
Zu jener Zeit war Carl schon sieben Jahre dabei; nach Studium und Promotion war er mit dreißig Jahren als Trainee bei Douvalier & Cie. eingetreten. Während Carls älterer Bruder Claus von ihrem Vater auf die Übernahme der Industrieholding, der Bensien-Gruppe, vorbereitet wurde, sollte Carl die Interessen des mütterlichen Douvalier-Vermögens bei der Bank vertreten. Mutter war neben ihrem jüngeren Bruder Theodore eine der großen Anteilseignerinnen von Douvalier & Co. Privatbankiers in Genf.
Vor zehn Jahren, mit zweiundvierzig, stand Carl Bensien kurz davor, Gesellschafter der Bank zu werden und entgegen der Tradition als ein Namensfremder seinem Onkel Theodore Douvalier als Sprecher zu folgen. Doch Dominik Douvalier, der zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre mehr oder weniger in der Bank gefaulenzt hatte, ohne sich richtig in das Geschäft hineinzuknien, hatte sich mit Währungsrisiken verzockt. Und Cousin Carl trug die Verantwortung.
Theodore Douvalier hatte die Chance genutzt, seinen Neffen aus der Privatbank zu drängen, da er ansonsten kaum hätte durchsetzen können, dass sein Sohn eines Tages die Leitung der Bank übernehmen könnte. Sein Schwager war kurz zuvor völlig unerwartet verstorben, und die Bensiens standen zu sehr unter Schock, um sich zu wehren.
Carl Bensien verließ die Bank und ging nach London, da er der Schweiz beruflich den Rücken kehren wollte. In der City arbeitete er für eine der Mitte der Neunzigerjahre noch existierenden Privatbanken. Dominik Douvalier wurde Anfang 2001 Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Douvalier & Cie. Privatbankiers in Genf. Seit dieser Zeit waren die Zürcher Douvalier Bensiens – wie der Familienzweig von Carls Mutter genannt wurde – nicht mehr in der Geschäftsführung der Bank in Genf vertreten. Das Verwaltungsratsmandat übernahm Carls älterer Bruder Claus, der jedoch rein gar nichts von Banking verstand.
Verstohlen mustert Carl Bensien seinen Cousin, der – zumal er ihm nicht in die Augen schauen konnte – sich verlegen mit Martina unterhält. Dicklich, zu wenig Bewegung, ungesund – wenigstens bekommt ihm das Ganze nicht auch noch, denkt Bensien. Noch mehr erstaunt ihn jedoch, dass ihm die Begegnung überhaupt nicht zusetzt, und das stimmt ihn an diesem Tag zum ersten Mal ausgesprochen heiter.
Er grüßt weiter in die Runde der zahlreichen Nichten und Neffen, die er kaum mehr auseinanderhalten kann, ehe am Ende seine Mutter Antoinette auf ihn wartet. Mutter hat volles Ornat angelegt. Der ganze Familienschmuck wird heute ausgeführt, alles von erlesener Eleganz. Madame Douvalier Bensien, im Kostüm von Chanel, trägt das Haar silbergrau mit Wasserwelle. Sie würde selbst bei minus zwanzig Grad Celsius keinen Hosenanzug tragen. Handschuhe, Fellmütze und -mantel sowie Stiefel mit leichtem Absatz vervollständigen ihre eindrucksvolle Erscheinung.
»Bonsoir, mon eher«, sagt sie und küsst Carl auf die Wange, der sich respektvoll zu ihr hinunterbeugt. »Ich schätze es sehr, dass du hier bist.«
»Ich freue mich auch, Mutter. Du siehst blendend aus.«
»Merci, mein Sohn.«
»Wo ist Claus?«, fragt Carl und blickt nach seinem älteren Bruder suchend um sich.
»Er kommt erst morgen«, antwortet seine Mutter schneidend. »Keiner hält mehr etwas auf die Tradition, mein Sohn.«
»Mutter, es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Lass uns nicht davon anfangen. Es ist Weihnachten.«
Das Einsetzen der Kirchenglocken beendet den aufkeimenden Zwist. Carl hakt seine Mutter galant unter, seine Söhne nehmen Martina in die Mitte. Auf den Stufen zur Kirche schaut ihn die Matriarchin noch einmal von der Seite an: »Man kann alles ändern, Carl, wenn man nur will. Auch du.«
Perth
»Let's go, Jim«, mit müder Stimme und einem Fingerzeig auf ihre Lange Eins bedeutet Isabella Davis ihrem Mann, dass es Zeit ist, die Feier zu verlassen. Die große Herrenuhr macht sich gut an ihrem kräftigen rechten Handgelenk. In Perth ist es wenige Minuten nach Mitternacht. Während für den Douvalier-Bensien-Clan in der Dorfkirche von Zermatt der Heilige Abend beginnt, ist er für Familie Davis bereits so gut wie vorbei. Isa, Jim und die fünf Kinder Pete, Rich, Charlie, Claudia und Melissa sind müde, Jetlag und die sommerlichen Temperaturen im Westen von Australien leisten ihren Teil.
Isabella Davis trägt ein blaues, kniefreies Kleid mit weißen Punkten und Spaghettiträgern. Bei über zwanzig Grad im Dezember genau das richtige Outfit. Die blauen Ballerinas mit der weißen Hacke seien witzig, meinte wenigstens ihre Älteste, als sie sich vor Stunden auf den Weg zu den Großeltern Davis gemacht hatten.
»Okay, let's go, Davis family«, wiederholt Jim mit seinem dröhnenden Bass die Anordnung seiner Frau. Da alle satt und müde sind, gibt es keine Widerworte. Bei diesem Blick weiß Jim, dass es keinen Sinn hat, seine Frau überreden zu wollen, doch noch einen Moment zu verweilen. Ohnehin war es schwierig genug für ihn gewesen, Isabella davon zu überzeugen, nach so langer Zeit die Weihnachtstage wieder einmal bei seinen Eltern in Perth zu verbringen.
»Schön war es, Mama.« Isabella küsst ihre Schwiegermutter beim Abschied auf die Wange. Das Heucheln fällt ihr für ein paar Tage nicht schwer.
Der Tannenbaum in der großen Halle des Golfklubs ist an manchen Stellen mit weißer Farbe besprüht worden, um Schnee zu evozieren. Solange man nur auf den bunten Baum mit den roten Kugeln und dem glitzernden Lametta schaut, funktioniert das wie eine Fata Morgana … Doch ein Blick aus dem Fenster genügt, um zu realisieren, dass draußen keinSchnee liegt und die Sonne nur Nachtruhe hält. Auch der Speisesaal ist weihnachtlich dekoriert. Man merkt den Australiern halt doch ihre europäische Herkunft an, stellt Isabella einmal mehr bei sich fest, wenn sie sich in »down under« aufhält.
»Legst du mir die Stola um, Jim?«
Isabella hält den Kopf meist leicht schräg nach links vorne geneigt. Ihr blondes Haar fällt vom Scheitel dann nach vorne und bedeckt ihre linke Gesichtshälfte. Mrs Davis, wie sie Jim manchmal scherzhaft vor anderen nennt, hat diese Haltung seit Jahrzehnten einstudiert, sie ist ihr zur zweiten Natur geworden. Nur wenn sie den Kopf ganz hoch nimmt, sieht man beide blauen Augen und die Narben. Dieser unglaubliche Blick, denkt Jim.
Vor dreizehn Jahren hatte sie James Davis auf einer Happy Hour in New York kennen gelernt; seitdem setzt sich meistens Isabella durch. Jim spielt in dieser Beziehung eindeutig die untergeordnete Rolle, schließlich ist es seine Frau, die in ihrer Familie das Geld nach Hause bringt. Nicht, dass er als Anwalt schlecht verdient, aber Isabellas Gehalt als Managing Director bei der Carolina Bank in London konnte er nicht im Ansatz erreichen. Als Physikerin mit Spezialgebiet »Rocket Science« berechnet und strukturiert Isabella Davis alles, was die Carolina Bank an Derivaten und Zertifikaten auf den Markt bringt. Sie ist, wie sie fast immer in der Bank genannt wird, die »Rakete« des Kapitalmarktbereichs.
Schnell verabschiedet sich der Londoner Davis-Zweig bei den australischen Familienmitgliedern, die alle zusammen im Chidley Point Golf Club am Swan River getäfelt haben. In Perth ist es auch nach Mitternacht noch angenehm warm, selbst wenn vom nahen Indischen Ozean ein laues Lüftchen weht. Eine Viertelstunde später sind die sieben Davis in ihrer Suite im »Ozean Beach Hotel« angekommen, ein Hotel, das seine beste Zeit hinter sich hat.
Als Isabella die Suite betritt, rümpft sie ein wenig ihre Nase; aber es ist ja nur für ein paar Tage, ehe sich die ganzeFamilie zum Skilaufen in die französischen Alpen aufmacht. Da liegt dann richtiger Schnee, was die Kinder und Jim kaum erwarten können, für Isabella jedoch eine große Überwindung bedeutet, da ihre Narben extrem kälteempfindlich sind. Wenigstens muss sie dann die lärmige Sippschaft ihres Gatten nicht mehr ertragen, und während sechs Mitglieder ihrer Familie auf den Brettern die Pisten hinunterwedeln, freut sich Isabella auf ruhige Stunden im Hotel und kleine Spaziergänge im Schnee.
Die Kinder ziehen sich schnell mit ihren Geschenken in ihren Bereich der geräumigen Suite zurück, während Isabella sich auszieht und ins Bad begibt. Sie muss sich das Bad mit Jim teilen, weil die beiden Mädchen sich nicht mit den drei Jungs im gleichen Badezimmer aufhalten wollten. Selbst eine Drei-Zimmer-Suite mit »nur« drei Bädern kann ziemlich klein sein, wenn sich fünf Kinder darin breitmachen.
Jim beobachtet seine Frau, die bereits in ihr seidenes Nachthemd geschlüpft ist, durch die geöffnete Badezimmertür. Die schwere Perlenkette legt sie immer erst am Nachttisch ab, ebenso die Uhr. Beide nicht von ihm. Beide Sonderboni. Ringe und Ohrstecker behält sie auch nachts an. Ein kleiner Trost für ihn, dass er sie ihr geschenkt hat.
Isa ist mit 1,74 Meter für eine Frau recht groß und als ehemalige Leistungssportlerin immer noch durchtrainiert und schlank. Seit dreiundvierzig Jahren vergeht kaum ein Tag, an dem sie keinen Sport macht; jeden Morgen verbringt sie eine halbe Stunde im Keller an den Geräten. Etwas maskulin ist sie, was ihr in der Männerwelt der Trading Floors das Leben leichter macht. Als sie merkt, dassJim sie beobachtet, schließt Isabella die Türe.
»Du Spanner«, dringt es durch die geschlossene Türe, mit einem Lächeln in der Stimme, glaubt Jim jedenfalls herauszuhören. Der Spiegel auf der Außenseite der Badezimmertür zeigt ihm einen Neunundvierzigjährigen mit schütterem Haar und Doppelkinn, gekrönt von abstehenden Ohren in Shorts und T-Shirt, mit neunzig Kilo deutlich übergewichtig.
Gott sei Dank, gesteht er sich selbst ein, haben die Kinder mehr von Isabellas Schönheit als von seinem Äußeren geerbt. Aber Jim weiß, warum sich Isabella für ihn entschieden hat. Er ist nicht zu anspruchsvoll und in jeder Hinsicht hilfsbereit.
»It is a deal, Jim«, antwortet sie stets, wenn er sich – was selten genug geschieht – beklagt. Beide führen das, was man eine zufriedene durchschnittliche Funktionsehe nennt. Isabella fühlt sich wohl in Jims Gegenwart, sie vertraut ihm mehr als jedem anderen. Sie ist stolz auf das, was sie aufgebaut haben, wie sie oft genug betont, aber geknistert hat es eigentlich nie zwischen ihnen, geht es ihm durch den Kopf. Andererseits haben beide das, was sie wollten: eine Familie und ansonsten viel Freiraum. Sie für ihre Arbeit, er für seine Arbeit, beide auch für die Kinder, aber Jim ist in Familienangelegenheiten wesentlich engagierter als seine Frau. Das Öffnen der Badezimmertür reißt Jim aus den Gedanken, die ihn immer wieder einholen.
»Frei für dich, mein Schatz.«
»Dankeschön«, freut sich Jim, den langsam die Müdigkeit übermannt.
Ihre Wege kreuzen sich und Isabella nimmt Jim in den Arm, küsst ihn und murmelt: »Es war gar nicht so schlimm bei deinen Eltern.«
Jim, plötzlich wieder hellwach, nutzt die seltene Gelegenheit und versucht seine Frau zu liebkosen. Zu seiner Überraschung lässt sie sich sogar darauf ein, was er dem guten australischen Rotwein und den sommerlichen Temperaturen zuspricht.
Sie küssen sich, werden jedoch durch ein Brummen gestört. Isas Handy vibriert auf dem Nachttisch. Sie löst sich aus der Umarmung ihres Mannes und nimmt ihr Handy zur Hand.
»Oh, den muss ich nehmen«, sie lächelt und schaut kurz zu Jim hinüber. Der weiß bei diesem Lächeln ohnehin, wer am anderen Ende der Leitung ist, und verzieht sich ins Bad.
»Okay«, hört er sie noch sagen, ehe Isabella anfängt zu singen:
But I will be there
To sing this song
To pass the time away
Driving in my car
Christmas
Gonna take some time
Jim kann weder das Lied noch den Kerl am anderen Ende der Leitung ausstehen, weiß aber, dass er gegen ihn nicht ankommt. Was Frauen an Mitch Lehman so anziehend finden, ist ihm ein Rätsel. Er stopft sich zwei Wattebäusche in die Ohren und erledigt seine Nachttoilette. Nach dem Zähneputzen nimmt er sie noch einmal heraus, um den Stand der Gesangsstunde zu testen:
Get my feet on holy ground
So I sing for you
Though you can't hear me
When I get through
And feelyou near me
Zum Glück ist der Kerl weit weg, denkt Jim und stopft sich die Ohren wieder zu. Er entscheidet, etwas länger im Bad zu bleiben und auf dem Klo zu lesen, bis der Spuk vorbei und seine Wut vielleicht verraucht sind. Als er das Bad schließlich verlässt, zeigt die Uhr auf Isabellas Nachttisch halb zwei Uhr morgens am 25. Dezember 2006. Isabella schläft.
»Was das nun wieder sollte«, murmelt er. Seine Wut hat sich immer noch nicht verzogen. Jim geht dicht auf seine Frau zu, beugt sich über sie und holt aus. Mit voller Wucht zielt seine rechte Hand in Richtung ihrer linken Wange. Die Narben sind klar zu erkennen – eine schwere Verbrennung aus ihrer Kindheit. Die ganze linke Seite, vor allem die Partie hinter ihrem Auge bis über das Ohr hinaus und den oberen Teil des Halses, waren schwer verbrannt, als sie als zehnjähriges Mädchen mit dem Gaskocher hantierte. Vorne auf der Wange waren fast alle Narben wegoperiert worden, und man musste schon ganz nahe an sie herankommen, um etwas zu erkennen, aber das ließ Isa ohnehin nicht zu. Von der Schläfe an und um das Ohr herum konnten die Schönheitschirurgen nichts mehr ausrichten. Besonders wenn sie ungeschminkt ist und ihre Haare den schlimmeren Teil unter dem Ohr nicht verdecken, sind die Narben deutlich zu erkennen. Isabellas Gesicht wirkt dann auf einmal geradezu hässlich.
Kurz vor der Wange hält Jim inne und streichelt sie ganz zart. »Ich könnte dich an die Wand klatschen, wenn du mit diesem Kerl redest«, sagt er leise. Isabella hört ihn nicht, sie schläft seelenruhig den Schlaf der Gerechten.
Für Jim ist unerklärlich, dass eine Frau mit ihrer Verantwortung so ruhig schlafen kann. In seine Musterung schiebt sich die Erinnerung an ein Telefonat zwischen Isa und Mitch Lehman, ihr Boss und Gesangsadressat. Völlig untypisch hatten sich Mitch und Isabella gestritten – über irgendwelche Holiris. Als Jim nach dem Telefonat gefragt hatte, worum es denn gegangen sei, hatte sie noch ganz in Rage gezischt: »Das verstehen nur Finanzingenieure.«
»Aber das ist Mitch doch auch nicht«, hatte Jim eingeworfen.
»Genau das ist das Problem, mein Lieber«, hatte sie erwidert und sich Jims Zärtlichkeiten hingegeben. Isabella konnte den Schalter umlegen wie ein binäres System.
Ihr großer Brustkorb hebt und senkt sich rhythmisch, die Brillantohrringe glitzern im Schein des Lichts aus dem Bad. Während Jim seine Frau ansieht, kommt ihm in den Sinn, dass die Partner in seiner Anwaltskanzlei letzthin sorgenvoll über die Risikopositionen der Banken gesprochen haben.
Muss ich Isa gelegentlich drauf ansprechen, nimmt er sich vor, ehe er das Licht im Bad löscht und schwer vor Müdigkeit ins Bett sinkt. Isa liegt nun auf ihrer rechten Seite, mit dem Gesicht zu ihm, sodass er die ganzen Narben sieht. Eine Frau mit zwei Gesichtshälften: links hässlich und vernarbt, rechts schön und eben. Jim hat oft versucht, ihr Bild im Kopf zu »mischen«, aber es funktioniert nicht, man kann nur jeweils eine Seite von Isabella betrachten, beide zusammen irritiert sein Gehirn. Selbst wenn die Haare die linke Seite verdecken, liefert ihm sein Gehirn die Narben darunter.
New York
»Na dann, frohe Weihnachten. Ich kann es schon jetzt kaum erwarten, dich in zwei Wochen wiederzusehen«, schmeichelt Mitch seiner »Bonus-Lady«, die seit Jahren wesentlich dazu beiträgt, dass seine Geldmaschine auf Hochtouren läuft.
»Montag, 8. Januar, acht Uhr morgens, mon Général«, hat sich Isabella noch auf der anderen Seite der Welt verabschiedet und sich nach Ende der globalen Gesangsstunde schlafen gelegt. Zwischen den beiden liegt die halbe Welt: Isabella ist in Perth, Australien, »General« Mitch Pieter Lehman in New York City, USA, dreizehn Zeitzonen trennen die beiden Banker.
Mitch Lehman sitzt um halb eins mittags, 24. Dezember, in einer New Yorker Flughafen-Lounge. Er wartet auf das Auftanken seines Flugzeugs und auf seine Schwiegereltern. Das Ziel lautet Hawaii, wo er eine Insel gekauft hat, die er seiner Familie nun als seine neueste Trophäe vorführen will.
Als Lehman vor einer halben Stunde die weihnachtlich dekorierte Lounge der Privatjetkunden betreten hat, hörte er dieses Driving home for Christmas aus den Lautsprechern. Bei diesem Song denkt er stets an Isabella Davis – und das seit über zwanzig Jahren. An einer Weihnachtsparty an der Universität in Austin waren sie zusammengekommen. Beide hatten zu viel getrunken: Isa warf ihre Hemmungen wegen ihrer Narben über Bord, Mitch wollte sich einfach vergnügen. Zu den Klängen von Driving homefor Christmas aus dem Partykeller waren sie unbemerkt in seine Studentenbude im ersten Stock geschlichen.
Mitch war die sportlich herbe schöne Frau schon vorher aufgefallen, die sich immer zur Seite drehte und sich halb zu verstecken schien, sobald man einander ins Gesicht schauen musste. Gesellschaftliche Anlässe in Texas waren fast noch schlimmer als anderswo für Isabella, weil gerade im Lone Star State alles immer besser, schneller, schöner oder größer war als im Rest der USA. Ihre Eltern versuchten alles, ihr das Leben am Stadtrand von Dallas so behütet wie möglich zu gestalten. Aber Isabella wollte nach der Verbrennung nie mehr mit den anderen Mädchen spielen, wie es sich für einen Haushalt mittleren Einkommens in Texas gehörte, Ballett tanzen oder im Chor singen. Sie zog es vor, mit den Jungs draußen rumzutoben. Erst als die Spielkameraden die Mädchen als Frauen zu entdecken begannen, begann Isabellas Leidenszeit. Ihre Unsicherheit wurde schlimmer, je älter sie wurde.
Isabella war es nicht entgangen, dass dieser junge Student aus Kalifornien sie irgendwie anders, unbekümmerter betrachtete als die anderen. Mitch hatte niemandem erzählt, dass er in einem Armenviertel von Los Angeles ohne Vater und bei einer Mutter, die in einer Bar arbeitete, aufgewachsen war. Er hatte alles gesehen, was das Leben für jemanden am untersten Ende der Kaufkraftklasse für jemanden bereithielt: zerschlagene Gesichter, misshandelte Frauen, Drogensüchtige, gewalttätige Männer, Verbrennungen, Schnittwunden, Schüsse und Blut und nicht zuletzt schnellen, miesen Sex in Besenkammern und in Treppenhäusern.
Mitch kapierte schnell, dass man in diesem Viertel nur überleben würde, wenn man sich geschickt aus allem heraushielt. Und er lernte, wen man für sich einspannen und ausnutzen konnte. Er suchte sich gezielt und äußerst raffiniert seine Partner und nahm sich stets das beste Stück vom Kuchen. Dem katholischen Pfarrer Melander gaukelte er den geborenen Messdiener vor und ließ sich von diesem, ohne mit der Wimper zu zucken, das College bezahlen. Für den Gebrauchtwagenhändler schaffte Mitch die besten Unfallwagen ran, auch wenn er manchmal nachhelfen musste. Die einsame Dame aus dem Kirchenchor beglückte er mit seiner Männlichkeit und nahm von ihr das Startgeld für die Uni.
Als es an der Zeit war, ging er nach Texas, um Los Angeles endgültig hinter sich zu lassen.
Mitch Lehman war nicht besonders intelligent, sondern nur gerissen. Er nahm sich, was er brauchte, das hatte er auf der Straße gelernt. Isabella, das hatte er begriffen, war eine sehr gute Studentin, sie würde ihn durch die Prüfungen bringen, wenn er ihr nur genügend den Hof machen würde. Und Charme hatte er. Schließlich musste er neben der Uni arbeiten, um sein Studium zu finanzieren, zum Lernen blieb nicht viel Zeit.
Im Dunkel der vierten Adventsnacht hatten sie sich damals ihrer Leidenschaft hingegeben. Für Isa war es eine Erlösung, dass es einen Mann gab, der nicht am nächsten Morgen erschreckt davonlief, wenn er ihr vernarbtes Gesicht bei unbarmherzigem Tageslicht sah. Von diesem Morgen an erkor sie Mitch Lehman zu ihrem heimlichen Traumprinzen.
Als sie ihn Monate später einmal fragte, warum ihn ihre Narben nicht zu stören schienen, bekam sie die verblüffende Antwort: »Die sehe ich nicht, Isa. Ich sehe durch die Narben hindurch.« Dass er Leid und Abgründe bereits zur Genüge gesehen hatte, damals in Los Angeles, erzählte er auch ihr nicht.
Für Mitch blieb diese erste sexuelle Begegnung mit Isa unvergesslich. Und er dachte immer an die Adventsnacht mit ihr, sobald die ersten Takte von Driving home gespielt wurden, kurz darauf erfolgte ganz automatisch der Griff zum Handy. So auch heute in der New Yorker Flughafen-Lounge.
Charlotte hat bislang Gott sei Dank nichts davon mitbekommen.
Die ausnehmend hübsche Texanerin hatte sich Mitch an der Uni gezielt ausgesucht. Als sich sein Studium dem Ende näherte, war es Zeit für Mitch, wieder auf ein Pferd zu setzen, das ihn seinen Zielen näherbrachte, obwohl sich zwischen ihm und Isabella eine Vertrautheit entwickelt hatte, die er sonst bei niemandem zuließ.
Nach ausführlichen Recherchen über die Generalstochter und ihre gesellschaftliche Mitgift entschied sich Mitch für Charlotte. Wie der Pfarrer, der Autohändler, die ältere Dame und die junge Isabella betrachtete er auch Charlotte nur als einen weiteren Stein, der seinen Erfolgsweg pflastern würde. Nach der »Physikkanone« Isa jetzt »Miss University« Charlotte, die ansonsten kaum durch Leistungen an der Uni auffiel.
Isabella hatte den Tag kommen sehen; ihr war immer klar gewesen, dass ihre gemeinsame Zeit noch im Biotop des Campus enden würde. Niemand würde eine Frau mit solch entstellenden Narben an seiner Seite haben wollen, wenn es darum ging, seinen Platz im richtigen Leben zu erobern. Sie war nicht vorzeigbar, das wusste Isabella, deshalb musste sie mit außergewöhnlichen Erfolgen diesen Makel wettmachen, und zwar dauerhaft. Folglich würde sie sich jemanden suchen müssen, dem nicht gerade die große Auswahl zu Füßen lag. So war Isabella ein paar Jahre später bei Jim Davis gelandet.
Charlotte war nicht der Grund, sondern nur der Auslöser für das Ende ihrer abgeklärten Beziehung mit ein paar emotionalen Splittern. Und ihre Wege trennten sich ohne großen Streit und Tränen, sie wussten beide, wann es an der Zeit war, Adieu zu sagen.
Schnell und ohne emotionales Geplänkel fanden sie wieder zusammen, als Mitch in der Carolina Bank jemanden brauchte, der komplexe Probleme und Strukturen genau durchrechnen konnte. Und das war Isa.
Seit dieser Zeit hängen sie wieder wie die Kletten aneinander, ohne jedoch ihren alten Beziehungsstatus zu erneuern. Sie telefonieren täglich miteinander, wenn der andere auf Reisen ist, und leisten sich sogar ein paar Gefühle rund um die Erinnerungen an die studentische Weihnachtsnacht.
Charlotte wiederum hatte Mitch gewählt, weil dieser Mann den Ehrgeiz in sich hatte, den an dieser Universität kaum jemand schlagen konnte, wie Charlottes Vater erkannte, als ihm Mitch Lehman das erste Mal vorgestellt wurde.





























