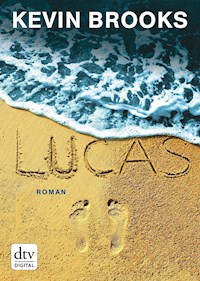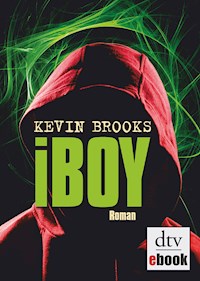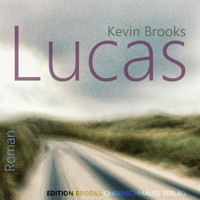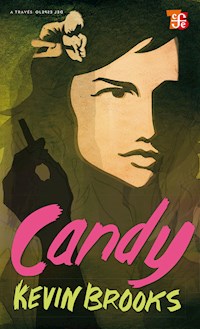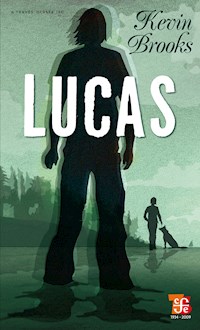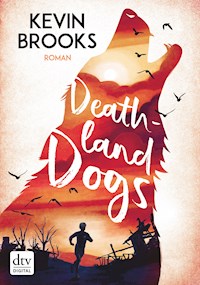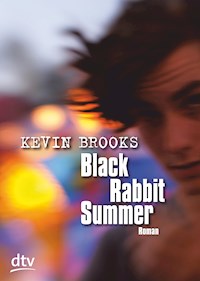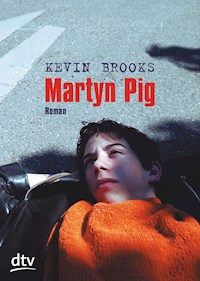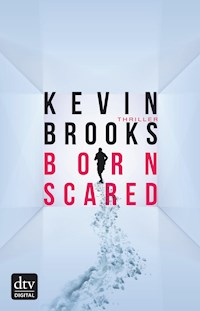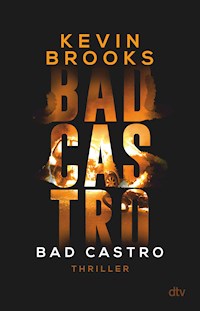
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der neue Brooks – relevant, spannend, brandaktuell Eine Nacht voller Unruhen. Ein jugendlicher Gang-Leader, den alle »Bad Castro« nennen, auf der Flucht. Und Judy, eine junge Polizistin, die nicht mehr weiß, wo Recht und Unrecht ist. Als das Polizeiauto überfallen wird, gelingt es Judy und Castro, sich unerkannt aus dem Wagen zu retten. Gemeinsam fliehen sie vor dem entfesselten Mob, der für sie gleichermaßen gefährlich ist. Denn längst ist nicht mehr klar, wo die Grenzen zwischen Freund und Feind sind – und dass sie in Wahrheit mehr verbindet, als ihnen klar ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kevin Brooks
Bad Castro
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
»Das sind doch bloß kleine Bengel, sprechende Tote, lebende Tote, Tote, die sich bewegen … Ruck, zuck packen sie zu und töten dich, aber das Leben ist sowieso schon vertan …«
Roberto Saviano, Gomorrha
»Ich, Judy Ray, erkläre feierlich und aus fester Überzeugung, dass ich der Queen gemäß den Regeln der britischen Polizeiordnung mit vollem Einsatz dienen werde, dass ich Fairness, Lauterkeit, Fleiß und Objektivität walten lassen, die Menschenrechte achten und im Sinne der Gleichheit aller Menschen handeln werde, und dass ich mit ganzem Einsatz für Frieden sorgen und jedes Vergehen gegen Menschen oder Eigentum unterbinden und nach bestem Wissen und Gewissen alle Pflichten gemäß dem Gesetz erfüllen werde.«
EINS
Wir waren zu viert im Wagen, als es passierte. Mark Gillard fuhr, Jason Dunn saß auf dem Beifahrersitz und ich mit Castro hinten. Es war gegen 9 Uhr abends, so gut wie kein Tageslicht mehr, und wir fuhren am Südrand der Clapham Common vorbei Richtung Osten, zurück zum Polizeirevier in Stock Hill. Es war nicht mehr weit – höchstens ein paar Kilometer –, doch die Chancen, heil dort anzukommen, standen schlecht. Die Ausschreitungen, die erst ein paar Stunden zuvor in Stoke Newington anfingen, hatten sich so schnell ausgebreitet, dass es inzwischen überall in der Stadt brannte. Dichter schwarzer Rauch hing in der Luft, Sirenen heulten in der Ferne, und die Straßen im Süden von London, durch die wir fuhren, wirkten wie ein Kriegsgebiet. An manchen Stellen waren die Zerstörungen so schlimm, dass es beinah unmöglich schien, sich einen Weg hindurchzubahnen. Autos brannten – manche schon nur noch schwelende schwarze Gerippe, andere standen noch lodernd in Flammen. Geschäfte waren verwüstet – Eisenrollos herausgerissen, Schaufenster zertrümmert und Türen eingetreten. Und überall lagen Trümmer – zerbrochenes Glas, Ziegel, Pflastersteine.
Wir waren bisher noch nicht in ernsthafte Schwierigkeiten geraten – kein aufgepeitschter Mob, keine willkürlichen Übergriffe –, doch das hier war Gang-Territorium und wir waren die Polizei. Und in so einer Nacht, mitten in der aufgeheizten Atmosphäre der Randale, hätten wir uns keinen übleren Ort aussuchen können. Wir waren der Feind. Wenn einer von uns in dieser Nacht in die falschen Hände geriet, dann war’s das. Das einzig Positive war, dass wir in Zivil in einem zivilen Fahrzeug saßen – einem unscheinbaren grauen Volvo –, insofern konnte man uns nicht sofort als Polizei identifizieren. Doch das hieß nicht, dass niemand wusste, wer wir waren. Die lokalen Gangs waren genauso gut über uns informiert wie wir über sie. Sie kannten unsere Namen, unsere Gesichter, die Autos, die wir fuhren. Und inzwischen wussten sie sicher auch, dass man Castro wegen Mordverdacht festgenommen hatte und er zum Verhör nach Stock Hill gebracht werden sollte. Unter normalen Umständen wäre das kein Problem gewesen. Egal, wie gern uns die Gangs daran gehindert hätten, jemanden zu verhaften, sie ließen es am Ende doch lieber bleiben. Selbst wenn sie es schaffen sollten, wussten sie ganz genau, wie entschlossen wir reagieren würden, deshalb zahlte sich das Ganze für sie nicht aus. Aber das hier waren keine normalen Umstände. Die Ausschreitungen veränderten die Situation. Regeln galten nicht mehr. Und wir sperrten schließlich nicht irgendwen hinter Gitter. Das hier war der Junge, der bei allen nur Bad Castro hieß.
Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen – soweit ich wusste, hatte das keiner von uns. Am meisten wunderte mich, wie jung Castro war. Nach den Gerüchten, die uns zu Ohren gekommen waren, dachten wir, er müsste circa fünfzehn, sechzehn sein, doch als ich ihn sah, konnte ich das nicht mehr glauben. Und jetzt, wo er direkt neben mir saß – und stumm aus dem Seitenfenster schaute, die gefesselten Hände im Schoß –, war mir klar, dass er nicht älter als dreizehn, vierzehn sein konnte. Wobei das keinen Unterschied machte. Egal, wie alt er sein mochte, er war Bad Castro. Seine Jungs würden ihn suchen. Seine Feinde auch. Falls wir ihnen dabei im Weg waren, würden sie uns im Handumdrehen erledigen.
Die Situation war nicht gut. Und wenn Gillard und Dunn auf mich gehört hätten, wären wir niemals dort reingeraten.
Ich hatte ihnen gesagt, dass es gefährlich sei, das Polizeirevier zu verlassen. Der Protest in Stoke Newington mochte ja halbwegs friedlich begonnen haben, aber er brauchte nicht viel, um sich hochzuschaukeln und außer Kontrolle zu geraten. Die Bedingungen waren perfekt für einen Aufstand: Es war ein heißer Samstagabend, die Sommerhitze lag immer noch schwer über der Stadt … die Emotionen kochten hoch. Wenn es irgendwann in den Straßen losgehen würde, dann jetzt. Genau das hatte ich zu Gillard und Dunn gesagt. Es gab keinen Anlass, ausgerechnet jetzt loszupreschen und Castro festzunehmen. War es nicht besser, wenn wir uns Zeit nahmen und erst einmal abwarteten, was in Stoke Newington abging? Doch sie wollten nicht auf mich hören. Warum auch? Sie waren erfahrene Detective Sergeants, beide seit mindestens zwanzig Jahren im Dienst. Ich dagegen war gerade mal neunzehn und hatte meine Ausbildung erst letztes Jahr abgeschlossen. Für sie war ich doch bloß »die neue Kleine«. Selbst wenn ich sie durch ein Megafon angebrüllt hätte, hätten sie nicht auf mich gehört.
»Mach, was du willst«, hatte DS Gillard zu mir gesagt. »Wenn du die ganze Nacht lang hier rumsitzen und warten willst, was passiert, okay. Aber bild dir nicht ein, dass wir das auch tun.«
Es gab an diesem Abend jede Menge Trug und Schein unter der Oberfläche, und das lag nicht allein an Gillard und Dunn. Wir hatten alle unsere verdeckten Motive, und es war uns auch allen klar, dass wir etwas voreinander verbargen, aber nicht, was und warum. Wir wussten nicht genug über die gegenseitigen Geheimnisse, um zu begreifen, was sie auslösen würden. Deshalb konnten wir drei fürs Erste nur weitermachen mit der Heuchelei und hoffen, dass wir das Ganze durchschauten, bevor es zu spät war.
Wir beschleunigten wieder. Das schlimmste Teilstück der Straße lag hinter uns – ein scheinbar endloser Hindernisparcours aus brennenden Autos und Schuttbergen – und die Erleichterung, durchgekommen zu sein, war deutlich zu spüren. Es war, als hätten wir alle die Luft angehalten – uns bewusst, wie angreifbar wir gewesen waren, als wir uns durch das Labyrinth aus Wracks schlängelten – und könnten jetzt endlich wieder durchatmen. Selbst Castro wirkte auf stille Art erleichtert. Das Letzte, woran ich mich erinnere, bevor es passierte, war ehrlich gesagt, dass ich den Blick zu ihm wandte und er mit einem kleinen stummen Lächeln im Gesicht zurückschaute. Ich nahm es als ein Zeichen der Anerkennung, eine gegenseitige Bestätigung, dass wir ohne Schwierigkeiten eine heikle Stelle passiert hatten und wieder auf Kurs waren. Und einen kurzen Moment lang war es für mich okay, diese Erleichterung mit Castro zu teilen.
Dann zerbarst alles in einem ohrenbetäubenden blechernen Lärm.
ZWEI
Ich wusste nicht, was geschah. Ich erinnere mich nur noch, wie ich quer über den Rücksitz geschleudert wurde und mit dem Kopf gegen etwas prallte, danach wirbelte, kugelte und stürzte alles wild durcheinander und warf mich unter dem knirschenden Taumeln von Blech durch die Gegend, ohne dass ich irgendetwas dagegen tun konnte. Als es endlich aufhörte und alles still wurde, lag ich zusammengesackt im Fußraum hinter dem Fahrersitz.
Ich hatte keine Schmerzen von dem Schlag gegen meinen Kopf, aber ich fühlte mich auch nicht gut. Und als ich so völlig verkrümmt und verdreht dalag, mit dem Gesicht am Boden, spürte ich, wie mir ein dichter roter Nebel in den Kopf stieg, und wusste, wenn ich nicht schnell etwas dagegen tat, würde ich das Bewusstsein verlieren. Ich wollte mich aufrichten, umdrehen und mich mit dem Ellenbogen vom Boden abdrücken, doch ich hatte kaum angefangen, mich zu rühren, als mich eine Hand an der Schulter wieder nach unten drückte.
»Bleib da«, sagte eine Stimme. »Halt still.«
Ich begriff, es war Castro. Ich hatte ihn völlig vergessen gehabt. Auch Gillard und Dunn hatte ich vergessen.
»Was ist los?«, fragte ich. »Wieso bist du –?«
»Duck dich!«
Ein plötzlicher lauter Knall zerschnitt die Luft, das unverkennbare Geräusch eines Schusses, und als Nächstes warf sich Castro neben mich und drückte mich nach unten. Im nächsten Moment folgte ein weiterer Schuss und diesmal glaubte ich ganz in der Nähe einen dumpfen Einschlag zu hören.
Dann wieder Stille …
»Nicht rühren«, flüsterte Castro.
Der Nebel in meinem Kopf wirbelte so wild, dass mir ganz übel und schwindelig wurde.
»Scheiße«, murmelte Castro.
Ich hörte Schritte … zuerst nur leise, dann kamen sie näher, wurden lauter, deutlicher … vorsichtig, langsam … kurze Pause … eine gedämpfte Stimme …
In dem Moment wusste ich, das war’s. Das war das Ende. Es war die einzige Gewissheit in meinem vernebelten Kopf, so klar und deutlich, als wenn es bereits passiert wäre. Ich konnte ihn hören, ihn spüren – den Schuss, diesen dumpfen Knall …
Doch dann hörte ich etwas anderes – ein lautes Rennen und Rufen –, und ich wusste, das passierte nicht bloß in meinem Kopf. Das war real. Hier und jetzt. Der Lärm von mindestens einem Dutzend Leuten, die wegrannten und brüllten – DA! DA HINTEN! HIER LANG! BEEILT EUCH! –, das Geräusch, wie sie an uns vorbeiliefen, an dem Wagen, und wie sich ihre Schritte schnell die Straße hinunter entfernten …
Dann spürte ich, wie sich Castro bewegte, sich langsam hochreckte, um hinauszusehen, was los war. Etwa fünf Sekunden später rührte er sich erneut. Diesmal beugte er sich zwischen den beiden Vordersitzen hindurch. Noch einmal ungefähr fünf Sekunden verharrte er dort, dann setzte er sich wieder zurück.
»Kannst du aufstehen?«, fragte er mich.
Ich versuchte, Ja zu sagen, doch es kam als ein Juuh heraus.
Ich hörte ein Klicken, ein leises metallisches Schnappen und im nächsten Moment zogen mich Castros Hände vom Boden und halfen mir wieder auf den Sitz. In meinem Schädel drehte sich alles – mein Kopf war vernebelt und schwer, er pochte wie wild, ich konnte nicht richtig gucken. Was ich sah, war völlig verruckelt und verschwommen. Außerdem war alles dunkel – eine tiefgraue Düsternis hing in der Luft – und ich konnte nur so eben die Gestalten von Gillard und Dunn auf den Vordersitzen erkennen. Sie wirkten vollkommen reglos. In dem flackernden Halblicht war es schwer zu erkennen, doch es schien, als ob sie bloß dasäßen, ganz still und völlig gefasst.
Dann gab es links von mir einen harten Schlag. Ich drehte mich um und sah, wie Castro versuchte, mit der Schulter die Seitentür aufzustemmen. Die Tür war verbogen und klemmte, doch als er noch einmal mit der Schulter dagegenstieß, knirschte es metallisch und die Tür ruckte ächzend auf. Er schaute sich um, überprüfte die Straße und stieg dann aus.
Ich glaube, ich fühlte überhaupt nichts.
Er war weg, das war alles. Wir hatten unseren Verdächtigen verloren. Das war nicht gut, aber auch kein Weltuntergang. Wir hatten ihn ein Mal gefunden, dann würden wir ihn auch ein zweites Mal finden.
»Gib mir deine Hand.«
Das war Castro. Er stand an der Tür, beugte sich in den Wagen und streckte mir die Hand hin.
Ich starrte sie an.
»Wir müssen weg«, sagte er. »Wenn wir hierbleiben, bringen sie uns um.«
Ich weiß nicht, wie weit wir kamen, ehe ich endgültig ohnmächtig wurde, doch wir mussten schon in der Nähe der Bäume gewesen sein. Als ich aus dem Auto stieg, war ich jedenfalls eindeutig noch bei Bewusstsein gewesen. Ich erinnere mich, wie meine Beine nachgaben und Castro mich auffing … und ich weiß auch noch vage, wie ich über das Straßenpflaster taumelte … dann wich der harte Belag einer Wiese … und alles wurde dunkler und stiller … die warme Nachtluft hüllte mich ein, machte mich schläfrig, schloss mir die Augen und zog mich nieder …
Dann nichts mehr.
DREI
Das Erste, was ich sah, als ich die Augen aufschlug, war Castro, wie er mich anstarrte. Während ich auf der Erde saß – die Beine ausgestreckt, mit dem Rücken an einem Baum –, hockte er direkt vor mir und blickte mir mit der stillen Eindringlichkeit eines neugierigen Kindes in die Augen. Die Unterarme hatte er leicht auf die Knie gestützt und ich sah, dass die Handschellen fehlten.
»Wieder okay?«, fragte er.
Ich nickte, was ich sofort bereute, weil mir ein sengender Schmerz durch den Kopf fuhr. Es war, als ob man mir einen Schraubstock um den Schädel gelegt und die Backen fast bis zum Anschlag gespannt hätte. Solange ich mich nicht bewegte, war der Schmerz weniger schlimm, ich spürte dann nur ein Pochen in der linken Kopfhälfte. Also saß ich fürs Erste einfach bloß da und hielt mich so still wie nur möglich.
Trotz des Schmerzes schien mein Verstand jetzt wieder klarer. Im grauen Licht der Dämmerung konnte ich nichts Genaues erkennen, doch offenbar befanden wir uns in einer kleinen Baumgruppe irgendwo in den Grünanlagen der Clapham Common. Ich wusste nicht exakt, wo wir waren, und ich hatte Mühe, mich zu erinnern, wie wir es hergeschafft hatten, aber an den Rest erinnerte ich mich, zumindest an das meiste – die Verhaftung, die Ausschreitungen, die Fahrt zurück durch verwüstete Straßen. Ich sah vor mir, wie Castro neben mir hinten im Wagen saß, und ich sah, wie er mich still anlächelte … doch für ein, zwei Sekunden war es das. Mein Kopf war leer. Ich hatte absolut keine Erinnerung an das, was als Nächstes passiert war. Aber noch bevor ich die Leere richtig registrierte, explodierte alles in einem plötzlichen blechernen Knall und auf einmal war das Ganze wieder da – wie ich durch das Auto flog, mein Kopf gegen irgendwas schlug, wie alles außer Kontrolle geriet, durch die Luft wirbelte, das taumelnde Krachen und Knirschen von Blech, danach die Ruhe, die Stille, mein Kopf auf dem Boden …
Roter Nebel …
Stille.
Schritte.
Schüsse.
Gillard und Dunn.
Ich starrte Castro an. Seine Augen fixierten ein paar Sekunden lang meine – ruhig und konzentriert, ohne jede Emotion – und dann verschob sich sein Fokus und er sah nicht mehr mich an, sondern an mir vorbei in das Dunkel. Ich spürte keinen Schmerz, als ich den Kopf drehte und seinem Blick folgte, und ich hatte auch gar keine Zeit, drüber nachzudenken. Was Castro sah, war so offensichtlich, dass ich es sofort erkannte. Es nicht zu sehen, war völlig unmöglich. Die zwei brennenden Autos waren keine fünfzig Meter entfernt, die lodernden Flammen erhellten das Halbdunkel mit einem sengend orangen Schein. Einer der Wagen stand in der Mitte der Fahrbahn, mit der Schnauze zu uns. Der andere, der uns am nächsten war, stand schräg auf dem Bordstein, zwischen Straße und Grünanlage. Er brannte so stark, dass er praktisch nicht mehr zu erkennen war, doch ich wusste, es war unser Auto … der zivile Volvo … der Wagen, aus dem ich eben erst getaumelt war und in dem ich Gillard und Dunn zurückgelassen hatte …
»Sind sie da drin?«, fragte ich Castro, unfähig, den Blick von dem brennenden Fahrzeug zu lösen.
»Ja.«
Und da begriff ich. Die Schüsse …
Die Stille.
Die Schritte.
Die Schüsse.
Die verschwommenen Gestalten von Gillard und Dunn auf den Vordersitzen … die nichts machten … nur dasaßen … ganz still und ruhig …
Sie waren schon tot, als wir den Wagen verließen.
Als ich mein Handy herauszog, um das Revier anzurufen, kam die Anzeige Kein Netz. Ich hielt das Handy hoch und schwenkte es ein bisschen umher, und als das nicht half – außer den Schmerz im Kopf auszulösen –, probierte ich es mit Aus- und Wiedereinschalten. Doch es kam immer die gleiche Info: Kein Netz.
Ich dachte, egal. Den Tod von Gillard und Dunn zu melden, war nicht wirklich dringend. Im Moment konnte man wegen der beiden sowieso nichts tun. Während der Ausschreitungen ließ sich der Tatort nicht untersuchen. Und was mich betraf … na ja, ich hätte sicher nichts lieber getan, als das Revier in Stock Hill zu informieren, was passiert war, ihnen zu sagen, wo ich mich befand, und zu hören, ich solle mich nicht rühren und abwarten, Unterstützung sei auf dem Weg, ein Einsatzwagen käme in wenigen Minuten …
Aber was machte das schon, wenn es nicht gleich passierte? Kein Grund zur Sorge. Es gab ein Handy-Problem, das war alles.
Kein Netz.
Ich musste es eben später noch mal probieren.
Der Wagen, der uns gerammt hatte, war ein Range Rover, erklärte mir Castro. Und es war eindeutig kein Unfall gewesen.
»Sie sind aus einer Seitenstraße gekommen und voll in uns rein«, sagte er.
»Und du bist sicher, es waren nur zwei in dem Wagen?«
»Sonst hab ich keinen gesehen.«
»Konntest du sie erkennen?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie hatten Kapuzen auf und ein Tuch vor dem Mund.«
Ich schwieg einen Moment, betrachtete seine Augen und versuchte herauszufinden, ob er die Wahrheit sagte. Nach allem, was ich noch wusste, hatte er in den Sekunden vor dem Zusammenstoß nicht aus dem Seitenfenster geschaut. Er hatte mich angesehen, da war ich mir sicher. Ich sah es genau vor mir, wie er neben mir saß und mich mit einem stillen Lächeln im Gesicht anschaute. Er konnte nicht mehr von dem Range Rover mitbekommen haben als ich. Und ich hatte gar nichts gesehen. Das heißt, entweder log er oder meine Erinnerung war falsch.
»Und was war, als die beiden ausstiegen?«, fragte ich. »Hast du sie da besser sehen können?«
»Na ja, glaub schon. Aber –«
»Erzähl mir, was du gesehen hast.«
»Um ehrlich zu sein, wirklich viel hab ich nicht mitbekommen. Ging alles ein bisschen –«
»Was hatten sie an?«
Er zuckte mit den Schultern. »Kapuze, Jogginghose und -jacke, Turnschuhe … das Übliche eben.«
»Groß, klein?«
»Einer der beiden war etwa eins achtzig, der andere ein bisschen kleiner.«
»Wer von ihnen hatte die Waffe?«
»Der Größere.«
»Was für eine?«
»Pistole. Halbautomatik.«
»Haben sie irgendwas gesagt?«
Er schüttelte wieder den Kopf. »Die wussten genau, was sie tun. Sie sind auf uns zugekommen, ein paar Meter vor dem Wagen stehen geblieben, dann hat der Größere die Pistole hochgenommen und Gillard und Dunn durch die Windschutzscheibe erschossen.«
»Bist du sicher, dass beide erschossen wurden?«, fragte ich.
Er nickte. »Gillard hat er in den Kopf geschossen. Dunn traf die Kugel in die Brust, schien mir ein Herzschuss.«
In diesem Moment wurde mir plötzlich die Nüchternheit von Castros Stimme bewusst und ich begriff, dass ich ihn nicht mehr als Kind sah. Das überraschte mich nicht besonders. In unseren täglichen Auseinandersetzungen mit Jungen wie Castro konnten wir es uns nicht leisten, sie als Kinder zu sehen. Doch das rechtfertigte nichts. Was immer Castro sein mochte – ein Gangster, ein Krimineller, ein eiskalter Killer –, er blieb trotzdem noch immer ein Junge. Er sollte nicht im Detail beschreiben müssen, wie zwei Polizisten ermordet wurden. Das war einfach nicht richtig.
Aber nichts von dem allen war richtig. Gillard und Dunn, Castro, der Zusammenstoß, die Ausschreitungen … alles hatte sich von Anfang an falsch angefühlt.
»Was ist danach passiert, als Gillard und Dunn tot waren?«, fragte ich.
»Die zwei Typen sind um den Wagen rumgelaufen, jeder auf einer Seite.«
»Glaubst du, sie wussten, dass wir da drin waren?«
Er nickte. »Sie müssen uns gesehen haben, als sie uns rammten.«
Das hatte ich nicht gemeint und vermutlich war ihm das klar. Es ging mir darum, ob sie schon vor dem Zusammenstoß gewusst hatten, dass wir im Auto saßen. Oder präziser gesagt, ob sie wussten, dass er drinsitzen würde. War das der Grund gewesen, wieso sie uns gerammt und dann Gillard und Dunn erschossen hatten? Denn auf jeden Fall waren sie hinter Castro her, entweder um ihn zu befreien oder um ihn zu schnappen … vielleicht hatten sie auch ganz einfach vorgehabt, ihn zu töten. Doch wenn das der Fall war, wieso lebten wir beide dann noch?
Ich schloss die Augen und dachte darüber nach, schickte mich zurück zu dem Moment der Stille, als für mich nur noch eines klar war: dass ich gleich erschossen würde … doch dann hatte ich den plötzlichen Lärm von Leuten gehört, die wegrannten und brüllten – DA! DA HINTEN! HIER LANG! BEEILT EUCH! –, das Geräusch, wie sie an uns vorbeiliefen, an dem Wagen, und wie sich ihre Schritte schnell entfernten …
»Hast du sie gesehen?«, fragte ich und öffnete wieder die Augen.
»Ja, hab ich doch gerade gesagt –«
»Nein, ich meine die andern, die die beiden von dem Range Rover wegtrieben. Ob du die gesehen hast.«
Castro nickte. »Waren so ungefähr fünfzehn, vielleicht auch mehr.«
»Gang-Kids?«
»Ja.«
»Von welcher Gang?«
»Weiß nicht.«
»Was soll das heißen? Das musst du doch wissen.«
Er schüttelte den Kopf. »Hab von denen noch nie einen gesehen.«
»Und das soll ich dir glauben?«
Ich wusste, dass er log. Die Gang stammte mit Sicherheit hier aus der Gegend und wir waren nicht weit von Castros Stammgebiet entfernt, also mussten sie entweder Rivalen oder Verbündete sein. Es war unmöglich, dass er nicht wenigstens ein paar von ihnen kannte.
Ich schaute wieder zu den beiden brennenden Wagen hinüber. Das Feuer loderte weiter – züngelnde Massen oranger Flammen und schwarzer Qualm, der aus der Hitze aufstieg –, und während ich auf den Volvo blickte, ertappte ich mich bei der Frage, ob Gillard und Dunn wirklich dort drin waren. Ich hatte nur Castros Aussage und es gab keinen Grund, ihm zu glauben. Er war ein Krimineller. Zu lügen war bestimmt seine zweite Natur. Gut möglich, dass alles, was er mir erzählt hatte, nichts als ein Haufen Lügen war. Aber selbst wenn, war es trotzdem keine vergeudete Zeit, mit ihm zu reden. Man kann viel daran ablesen, wie jemand lügt. Man kann viel daraus erkennen, was jemand nicht sagt oder tut. Wieso hatte sich Castro nicht aus dem Staub gemacht und mich im Wagen zurückgelassen? Es hatte ihn nichts dran gehindert. Und er konnte es ja wohl schlecht aus reiner Herzensgüte getan haben. Nicht umsonst hieß er Bad Castro. Wenn die Geschichten stimmten, die ich über ihn gehört hatte, war schwer zu glauben, dass er überhaupt so etwas wie ein Herz besaß. Wieso hatte er mir also geholfen? Wieso war er immer noch da? Wieso sprach er mit mir? Was hatte er davon?
Irgendetwas musste es geben.
Ich schaute in die Nacht. Es war jetzt vollkommen dunkel, so gegen zehn. Der schwarze Himmel wurde von Flammen, zuckenden Blaulichtern und umherschwenkenden Scheinwerfern der Polizeihubschrauber erhellt, und trotz des Lärms – oder vielleicht gerade deshalb – lag eine merkwürdige Stille in der Luft, die dem Ganzen eine gewisse Klarheit verlieh.
Als ich wieder zu dem brennenden Volvo hinüberschaute, kam ein Auto dröhnend aus einer Seitenstraße gerast. Musik wummerte aus den offenen Fenstern, und als der Wagen mit kreischenden Reifen und schleudernd bremste, um dem brennenden Range Rover auszuweichen, sah ich für einen kurzen Moment eine Kapuzengestalt auf dem Rücksitz, die mit etwas herumschwenkte, was aussah wie ein Maschinengewehr. Ich beobachtete, wie der Wagen in die Nacht davonjagte, und als sich die stampfenden Bassbeats in der Ferne verloren, drehte ich mich zu Castro um.
»Wer hat die Autos angezündet?«, fragte ich ihn. »Als wir raus sind, haben die doch noch nicht gebrannt, oder?«
»Das waren zwei Jungs auf einem Moped«, erzählte er. »Die tauchten auf, als wir gerade raus waren. Der Junge hinten hat in jeden Wagen einen Molotow-Cocktail geworfen.«
»Irgendeine Idee, wer sie waren?«
Er schüttelte den Kopf. »Hatten beide einen Integralhelm auf.«
»Natürlich«, antwortete ich und warf ihm einen vielsagenden Blick zu.
Das kümmerte ihn nicht. Offenbar war ihm vollkommen gleichgültig, ob ich ihm glaubte oder nicht. Etwas anderes hatte ich auch nicht erwartet. Dieser Haltung begegnete ich in meinem Beruf ständig – Na und? Was soll’s? Tja, was weiß ich? –, aber bei Castro wirkte es irgendwie anders. So als wenn es bei ihm nicht bloß eine Haltung wäre, er schien das wirklich so zu sehen. Es war auch keine Arroganz. Keine Überheblichkeit oder Geringschätzung, nichts Böswilliges. Es war ihm nur einfach egal, was andere über ihn dachten.
Ich sann einen Moment darüber nach, überlegte, dass es vielleicht gar nicht schlecht war, so zu leben, dann schob ich den Gedanken beiseite und checkte noch einmal mein Handy.
Kein Netz.
Ich probierte wieder das Übliche – schwenkte es in der Luft, schaltete es ab und wieder an – und versuchte auch, den Notruf zu erreichen, doch es half alles nichts. Ich überlegte, ob es an meinem Handy lag. Vielleicht war es bei dem Unfall kaputtgegangen. Doch es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden – ich musste es mit einem anderen Gerät versuchen. Aber Castro hatte kein Handy. Zumindest hatte er das behauptet, als wir ihn festnahmen. Er meinte, er würde nie Handys benutzen. Und Gillard hatte ihn durchsucht und tatsächlich keins gefunden. Was natürlich nicht ausschloss, dass er trotzdem eins hatte. Gillard hatte ihn gründlich überprüft – ihn von oben bis unten abgetastet, alle Taschen durchsucht –, aber Jungs wie Castro kennen natürlich sämtliche Tricks, und wenn er eins bei sich trug, hätte es mehr gebraucht, als ihn bloß überall abzutasten. Und als ich ihn jetzt ansah, ihn beobachtete, wie er mich