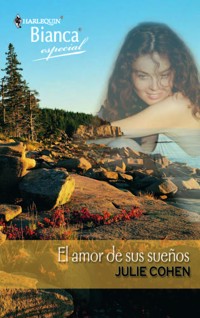9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Saffy hat ein Geheimnis. Und sie schämt sich zutiefst dafür. Es ist nicht etwa die Tatsache, dass sie eine Serienmörderin ist. Darauf ist sie sogar ziemlich stolz. Denn natürlich bringt sie nur die bösen Männer um die Ecke und macht die Welt damit zu einem besseren Ort. Ihr Geheimnis ist viel schlimmer als das: Saffy hat sich verknallt. Doch das Ganze gerät aus dem Ruder und droht zur Besessenheit zu werden. Während sie also damit beschäftigt ist, ihren nächsten Mord zu planen, muss sie eine viel schwierigere Aufgabe lösen: Wie erobert man seinen Schwarm? Doch wenn es eines gibt, das Saffy weiß, dann ist es, wie man einen Mann zu fassen bekommt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Saffy hat ein Geheimnis. Und sie schämt sich zutiefst dafür. Es ist nicht etwa die Tatsache, dass sie eine Serienmörderin ist. Darauf ist sie sogar ziemlich stolz. Denn natürlich bringt sie nur die bösen Männer um die Ecke und macht die Welt damit zu einem besseren Ort. Ihr Geheimnis ist viel schlimmer als das: Saffy hat sich verknallt. Doch das Ganze gerät aus dem Ruder. Während sie also damit beschäftigt ist, ihren nächsten Mord zu planen, muss sie eine viel schwierigere Aufgabe lösen: Wie erobert man seinen Schwarm? Doch wenn es eines gibt, das Saffy weiß, dann ist es, wie man einen Mann zu fassen bekommt …
Die Autorin
Julie Mae Cohen ist die dunklere und lustigere Version der erfolgreichen Autorin Julie Cohen. Die Literaturwissenschaftlerin ist Dozentin für Kreatives Schreiben an der University of Reading, Vizepräsidentin der Romantic Novelists’ Association und Gründerin der Regenbogengruppe für LGBTQ+-Autoren. Mit ihrem Teenager und einem Terrier von zweifelhafter Herkunft lebt sie im englischen Berkshire. »Bad Men« ist ihr erster Thriller.
Julie Mae Cohen
BAD MEN
Aus dem Englischenvon Frank Dabrock
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe BADMEN erschien erstmals 2023 bei Zaffre, an Imprint of Penguin Random House UK.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 08/2025
Copyright © 2023 Julie Mea Cohen
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
[email protected](Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Wiebke Bach
Umschlaggestaltung: Nele Schütz nach einem Entwurf von Emily Rough und unter Verwendung von Bildmaterial von Susan Burghart
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31029-5V002
www.heyne.de
Für dich. Ja, für dich. Du weißt schon, wer gemeint ist.
Die Menschen können sich eher eine tote Frau vorstellen als eine Frau, die bereit ist zu töten.
– Alia Trabucco Zerán, Las Homicidas
Prolog
Newport, Rhode Island, vor siebzehn Jahren
Wir spielen Susies Lieblingsspiel, bei dem ich einen Ladenbesitzer mime und sie mit ihren Plüschtieren nacheinander hereinkommt, um verschiedene Gegenstände aus ihrem Schlafzimmer zu kaufen, während ich so tue, als wollte ich keinen davon abgeben.
»Nein, Sir«, sage ich mit gespielter Empörung. »Ich kann Ihnen keine Socken verkaufen. Die führen wir nicht. Sie müssen sich in der Tür geirrt haben, Sie wollten bestimmt in den Laden nebenan, da gibt es jede Menge Socken.«
»Aber da sind doch welche«, sagt ihr Stoffschaf mit tiefer Stimme und deutet mit dem Kopf auf die offene Schublade direkt neben meinem Kopf.
»Diese Socken sind nicht verkäuflich«, sage ich. »Für kein Geld der Welt.«
»Aber ich brauche Socken, und das hier ist ein Laden.« Mit ihrem Lispeln klingt der Satz hinreißend.
»Das sind ganz besondere Socken. Sie sind absolut unverkäuflich, sie gehören zu unserer Sammlung wertvoller Gegenstände, die für die Nachwelt erhalten wird.«
Susie kichert. Sie zupft an einem ihrer blonden Zöpfe, die ich heute Morgen extra für sie geflochten habe, weil sie wie die Heidi aus ihrem neuen Buch aussehen wollte. Der linke Zopf sitzt noch einwandfrei, aber der rechte löst sich langsam auf, während sie daran herumspielt.
»Saffy«, schimpft sie mit mir. »Du musst Mr. Sheep verkaufen, was er verlangt.«
Wenn wir irgendein Spiel spielen, fällt sie jedes Mal aus der Rolle. Sie kommandiert mich gern herum und weist mich zurecht. Susie hat für jedes Spiel ihre eigenen Regeln, und im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen – denen der Erwachsenen – komme ich nicht dahinter, was ihre Regeln sind oder wie sie sich ändern. Das ist einer der Gründe, warum ich so gern mit ihr spiele. Es ist nie langweilig.
»Nun, das Schaf sollte etwas verlangen, was ich ihm auch verkaufen kann, Susie-san.«
Das ist mein Kosename für meine Schwester. Harold bezahlt für uns Japanischunterricht und auch alles andere.
»Wenn ich diese speziellen Socken nicht haben kann«, sagt Susie mit der Stimme von Mr. Sheep, »dann geben Sie mir die Socken, die Sie tragen.«
»Diese hier?« Ich strecke entrüstet meine Füße aus und wackle mit den Zehen. »Das sind meine Socken. Ohne die bekomme ich kalte Füße.«
»Ich will Ihre Socken haben, und zwar sofort.«
»Was zahlen Sie mir dafür?«
Susie runzelt die Stirn und denkt nach.
»Fünfhundert Dollar«, sagt sie schließlich.
»Ich kann Sie Ihnen nicht für weniger als fünfhundert Dollar und fünfzig Cent geben.«
»Fünfhundert Dollar und achtzehn Cent.«
»Abgemacht.« Ich ziehe meine Socken aus. Rosafarbene Hello-Kitty-Socken. Eigentlich bin ich viel zu alt dafür, und sie sind zu klein für meine Füße, die in diesem Sommer zwei Nummern gewachsen sind. Ich streiche die Socken sorgfältig glatt, sodass sie möglichst faltenfrei sind, und rolle sie wie eine Biskuitrolle zusammen. »Erzählen Sie mir nur nicht wie beim letzten Mal, Mr. Sheep, dass sie kein Geld dabeihaben.«
Ich strecke meine Hand aus und reibe die Finger aneinander, um ihr zu signalisieren, dass ich Bargeld sehen will.
»Miss Susan?« Meg erscheint in der Tür. »Ihr Vater möchte, dass Sie eine Runde mit ihm schwimmen gehen.«
Meine Hand erstarrt. Verweilt mit gekrümmten Fingern unbeweglich in der Luft.
»Okay«, sagt Susie, steht auf und lässt Mr. Sheep auf dem Teppich liegen. Der Teppich ist himmelblau und hat ein Muster aus weißen Wolken. Ich habe ihn ausgewählt, als ihr Zimmer eingerichtet wurde, damit sie jeden Tag das Gefühl hat, über Luft zu gehen. Ich wollte, dass wenigstens einer von uns unbeschwert und glücklich ist.
»Nein«, sage ich.
»Ich schwimme gern«, sagt Susie.
Das stimmt. Sie ist eine gute Schwimmerin. Ich habe es ihr selbst beigebracht, wenn Harold nicht zu Hause war. Der Pool ist kein schlechter Ort. Ihn trifft keine Schuld. Die Umgebung selbst ist bedeutungslos; was dort geschieht, ist von Bedeutung.
»Aber du warst erkältet«, sage ich. »Das ist keine gute Idee. Du könntest dich wieder erkälten.«
Meg hat ihre Nachricht überbracht und sich wieder zurückgezogen. Seit dem Tod unserer Mutter ziehen sich unsere Bediensteten häufig zurück. Sie geben sich größte Mühe, das, was sich direkt vor ihren Augen abspielt, zu ignorieren.
»Aber Daddy …«
»Ich werde Harold sagen, dass du Schnupfen hast. Du kannst dir Arielle, die Meerjungfrau ansehen. Ich gehe stattdessen mit ihm schwimmen.«
»Immer gehst du mit Daddy schwimmen.« Sie schiebt ihre Unterlippe vor, und ich kann nicht anders, als sie zu kitzeln, bis sie lacht. Unter ihrem rosafarbenen T-Shirt wölbt sich ihr runder Kinderbauch, und wenn sie lacht, kommen, wo eigentlich die Schneidezähne wären, ihre Zahnlücken zum Vorschein. Sie ist erst sechs.
Erst sechs.
Ich war allerdings fünf, als ich das erste Mal mit Harold schwimmen war.
»Wir gehen später schwimmen«, sage ich. »Wir spielen dann Marco Polo.«
»Versprochen?«
»Hoch und heilig – solange Mr. Sheep seine Schulden begleicht.«
Ich gehe zum Fernseher in der Ecke und nehme die DVD. Susan macht es sich auf ihrem Sitzsack bequem und ich starte den Film. Ich beuge mich vor und küsse meiner Schwester auf den perfekten Scheitel, den ich ihr heute Morgen gezogen habe, und auf ihre unschuldige weiße Haut.
Dann gehe ich durch den stillen, mit Teppich ausgelegten Flur zu meinem Zimmer und ziehe meinen Bikini an.
Das tue ich jedes Mal, obwohl ich weiß, dass es sinnlos ist. Er ist Teil seines Spiels, des Spiels, zu dem er mich zwingt, eines Spiels, dessen Regeln ich so gut kenne wie jede einzelne Sommersprosse auf meinem Handgelenk, wie die Form jedes Fingernagels.
Manchmal schwimmt er danach noch. Seit Kurzem, nach den letzten paar Malen, habe ich mir das ebenfalls angewöhnt. Ein paar kräftige Kraulzüge das Becken rauf und runter, immer und immer wieder. Ich zeige ihm, dass ich eine gute Schwimmerin bin. Dass ich meinen Atem und meinen Körper kontrollieren kann, dass ich im Wasser in meinem Element bin.
Hat er deswegen nach Susan statt nach mir gefragt?
Es ist niemand zu sehen, als ich die glatten Stufen der Haupttreppe hinuntergehe und meine Hand über das glänzende Geländer gleiten lasse. Jedenfalls niemand, der lebt. Aus den Goldrahmen an der Wand blicken Harolds Vorfahren auf mich herab. Etwa die Hälfte sieht aus wie er, die andere Hälfte hat keinerlei Ähnlichkeit mit ihm. Was ein Segen ist, wie unsere Mutter immer gesagt hat. Der respektable, biedere Herr auf dem Bild am unteren Treppenende trägt eine Art Halskrause und eine Perücke. Er war Richter und hat die gleichen hellblauen Augen wie Harold. Sie sind so gemalt, dass sie einem überallhin folgen. Dieser Effekt entsteht, wenn die Iris das untere Lid nicht berührt; mein Kunstlehrer hat mir das mal gezeigt. Ich habe darauf ein Dutzend Gesichter gezeichnet, deren Augen einem folgen, und sie im Unterrichtszimmer aufgehängt. Aber sie haben mich nicht beschützt.
Ich hätte damals in England aufs Internat gehen können, wenn ich das gewollt hätte, aber ich bin lieber bei meiner Schwester geblieben. Denn ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde.
Meine Füße machen auf dem Perserteppich ein kratzendes Geräusch und klatschen dann über die Steinfliesen. Ich bin diesen Weg so oft gegangen, dass im Boden eigentlich ein Trampelpfad sein müsste. Harold verbringt den Sommer nicht gern in New York. Er mag die Meeresluft, seine Yacht und den Außenpool, sein kleines Reich aus Wasser.
Der Pool ist durch eine hohe Hecke vom Haus abgeschirmt. Als ich sie umrunde, ist Harold bereits im Wasser. In einer Ecke des tiefen Bereichs, direkt vor mir. Er hat die Arme neben dem Sprungbrett auf dem Beckenrand abgestützt und strampelt mit den Beinen.
Harold Lyon ist ein gut aussehender Mann. Seit ich ein kleines Mädchen war, seit meine Mutter ihn geheiratet hat, habe ich das immer wieder zu hören bekommen. Aber ich habe das nie verstanden. Er hat rotblondes Haar, das sich noch nicht wie bei einigen seiner Vorfahren auf den Porträts gelichtet hat, und er hat helle Augen mit blonden, fast weißen Wimpern. Er treibt viel Sport und hat einen durchtrainierten, muskulösen Körper. Seine Brust ist mit Sommersprossen übersät, und in ihrer Mitte sprießt dichtes rotblondes Haar, das, wie ich weiß, im Gegensatz zu denen auf seinem Kopf borstig und elastisch ist.
Meine Mutter hat ihn geliebt. Ich finde das eine befremdliche Vorstellung, aber ich versuche, die Sache objektiv zu betrachten, dann schmerzt es nicht so sehr.
Beim Klang meiner Schritte dreht er sich um, und er macht ein finsteres Gesicht, als er sieht, dass ich gekommen bin.
»Ich habe Meg gebeten, deine Schwester herzuschicken«, sagt er.
»Du wirst Susie nicht bekommen.«
Ich stehe, etwa einen halben Meter vom Pool entfernt, neben Harold und krümme meine Zehen auf dem Beton. Es ist kalt draußen, eigentlich ist heute kein Badewetter. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Die Brustwarzen unter meinem Bikinioberteil sind hart und ragen wie winzige Brüste hervor. Mehr habe ich nicht vorzuweisen. Trotz meiner für mein Alter ungewöhnlichen Körpergröße und meiner riesigen Füße habe ich noch keine Rundungen entwickelt, wie es die Zeitschriften nennen. Ich habe noch nicht mal meine Periode bekommen, obwohl in den Büchern, die man mir gegeben hat, steht, dass ich bald den ungewissen und beängstigenden Weg ins Erwachsenenalter beschreiten werde.
Vielleicht will er mich deswegen nicht mehr. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass ich geschwommen bin oder sonst irgendwas getan habe, jedenfalls nicht bewusst. Vielleicht liegt es einfach an meiner natürlichen Entwicklung. Dem normalen Lauf des Lebens.
Es ist September und die Blätter an den Bäumen beginnen bereits, sich gelb zu färben. Harold gehören alle Bäume, die man durch die Fenster des Hauses sehen kann.
»Was meinst du damit?«, sagt er. »Ich will nur schwimmen.«
Er hat dabei ein süffisantes Grinsen im Gesicht. Dieses Spiel habe ich von ihm gelernt: Wie man etwas Bestimmtes sagt, obwohl man eigentlich etwas völlig anderes meint. Wie man so lügt, dass alle so tun, als würden sie es glauben.
»Du wirst ihr das nicht antun«, sage ich. »Du kannst das weiter mit mir machen. Ich werde auch so tun, als ob es mir gefällt, wenn du das willst. Aber du wirst sie nicht anrühren.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.«
»Sie nennt dich Daddy. Wenigstens habe ich das nie getan.«
»Nun, ich bin ihr Vater.«
»Du bist nicht ihr richtiger Vater.«
Harold macht erneut ein finsteres Gesicht. »Seraphina, lass das Theater. Geh los und hol deine Schwester.«
»Nein.«
Er dreht sich jetzt ganz zu mir um, das Gesicht verzerrt vor Wut und unbefriedigtem Verlangen.
Ich darf nicht mit den Zähnen klappern. Ich sage mir, dass ich mich nicht schämen muss. Ich tue das hier für meine Schwester. Niemand kann mich sehen. Niemand kann uns hören. Sonst hätte das hier längst aufgehört.
Oder vielleicht auch nicht. Harold ist ein starker Mann und wir sind nur zwei kleine Mädchen.
Er blickt jetzt noch finsterer drein und erhebt sich mit dem Oberkörper aus dem Pool. Früher hat er mir immer gut zugeredet und Komplimente gemacht. Mir das Blaue vom Himmel versprochen. Ich habe ein Zimmer voller Spielsachen, mit denen ich nie gespielt habe, und einen Schrank voller Schokolade, die ich nicht essen will.
»Sei nicht albern«, sagt er. »Tu nicht so, als wärst du eine Frau. Das ist absurd. Du bist nichts als Haut und Knochen. Warum sollte dich jemand haben wollen? Du bist ein hässliches Mädchen und du wirst eine hässliche Frau sein.«
Aber ich höre, wie seine Stimme etwas anderes sagt, das, was er früher zu mir gesagt hat. Wie seine Stimme von den Fliesen des Pools widerhallt, wenn man bei ihm im Wasser ist. Mein Mädchen, mein hübsches Mädchen, mein kleines Geheimnis.
Ich stelle mir vor, wie er das zu meiner kleinen Schwester sagt, die noch nicht weiß, wie dieses Spiel läuft. Zu Susie, die glaubt, sie könnte aus der Rolle fallen und bestimmen, was als Nächstes passiert. Die unschuldig und glücklich ist, unfähig, ihr Innerstes zu schützen.
Dann stürze ich los. Ich gehe auf alle viere und werfe mich über den Beton hinweg auf ihn. Ich will ihn zum Schweigen bringen. Ich will, dass er aufhört. Ich habe die Finger ausgestreckt, um ihm das Gesicht zu zerkratzen. Aber sie verfehlen seine Augen und ich streife mit den Nägeln nur seine Wangen. Dennoch ist es mir gelungen, ihn zu überrumpeln, und sein Kopf schnellt nach hinten. Ich höre, wie seine Zähne aufeinanderschlagen, als er mit dem Kopf seitlich gegen das Sprungbrett knallt.
Haare und Schädel geben ein feuchtes Schmatzen von sich.
Sein Körper, der kräftiger ist als meiner – er war immer kräftiger und größer – wird schlaff, und mein Gewicht drückt ihn nach unten. Ich hocke auf ihm und sein Kopf ist unter Wasser.
Er ist allerdings noch bei Bewusstsein. Irgendwie kann ich es spüren. Vielleicht kenne ich ihn inzwischen so gut, dass ich jede seiner Launen, jede noch so kleine Regung registriere. Aber er ist überrascht und ich bin auf ihm. Ich schaffe es, meine Beine auf seine Schultern zu schieben, umschließe mit den Oberschenkeln seinen Kopf und drücke ihn nach unten. Dabei halte ich mich am Beckenrand fest und setze all meine Kraft ein, die ich mir beim Kraulen antrainiert habe, hoch und runter, hoch und runter. Ich will ihm zeigen, dass ich stark bin, dass ich kein kleines Mädchen mehr bin.
Harold setzt sich zu Wehr. Er umklammert meine Oberschenkel, so ähnlich, wie er das sonst auch immer getan hat. Er steckt sogar seine Finger in mein Bikinioberteil. Sein Hinterkopf drückt gegen die Stelle meines Körpers, die er immer so selbstverständlich und besitzergreifend berührt hat, als hätte er mit der Heirat meiner Mutter einen Anspruch darauf erworben.
Die Luft sprudelt wie ein Furz aus seiner Lunge und seinem Mund.
Ich kichere in die kühle Luft hinaus. Während Harold sich hilflos gegen mich stemmt, wird mir plötzlich klar, wie mein Leben als Erwachsene vielleicht aussieht. Was aus mir werden wird, wenn ich meine Periode bekommen habe, wenn mein Körper weiblichere Formen annimmt. Ich werde die Regeln des Spiels ändern. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen.
Das … wird wunderbar.
Harolds Gegenwehr erlahmt sehr viel schneller, als ich dachte. Trotzdem halte ich den schlaffen Körper zwischen meinen Beinen noch eine Weile fest. Währenddessen starre ich auf die Eibenhecke und erinnere mich daran, wie ich früher in einem Einmachglas aus dem Poolwasser und den roten Eibenbeeren einen Zaubertrank gemixt habe. Dafür habe ich die Beeren mit einem Stock so lange zerquetscht, bis die braunen Samen auf der Oberfläche schwammen und das Wasser sich blutrot färbte.
Die Beeren sind giftig, hat mir meine Mutter erklärt. Dudarfst das Wasser nicht trinken, wenn du sie hineingetan hast. Mum wusste nicht, dass ihr Mann und der Swimmingpool sehr viel gefährlicher sind als irgendwelche Beeren. Sie ist zu früh gestorben. Ich habe sie in ihrem Bett gefunden, immer noch wunderschön, mit einer Überdosis Tabletten. Mein Stiefvater sagte mir, das sei ihre Schuld.
An den Beckenrand geklammert, drücke ich Harold so lange unter Wasser, bis meine Kräfte nachlassen und ich vor Kälte zu zittern beginne, obwohl mein Blut heftig pulsiert. Ich öffne meine verkrampften Beine. Und Harold treibt davon. Es hieß immer, er habe schöne Schultern, und schönes dichtes Haar. Seine Haare und seine Schultern hängen jetzt ins Wasser und seine Hände bewegen sich wie schlaffe Quallen auf und ab. Er sieht aus wie eine achtlos weggeworfene Puppe.
Ich packe ihn am Bund seiner Shorts, zerre ihn zum Beckenrand und versuche, ihn die Leiter hochzuziehen, doch außerhalb des Wassers ist er sehr viel schwerer, also lasse ich ihn mit dem Gesicht nach unten auf der Oberfläche treiben. Er hat das Wasser immer geliebt. Alles scheint perfekt.
Für eine Minute betrachte ich seinen Körper. Mein Atem geht jetzt wieder gleichmäßig, und ich lächle, weil ich mir vorstelle, wie Susie sich in ihrem Zimmer Arielle, die Meerjungfrau anschaut und zu Part of Your World mitsingt. Ich hoffe, dass sie irgendwann ihren Prinzen treffen und glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben wird.
Ihr kann jetzt nichts mehr passieren.
Aber ich muss dafür sorgen, dass mir ebenfalls nichts passiert. Also unterdrücke ich mein Glücksgefühl und begrabe es tief in meinem Innern. Ich schließe die Augen und hole tief Luft, und dann noch mal und noch mal, während von meinen Haaren Wasser auf den Beton tropft.
Ich schreie.
Dann renne ich so schnell ich kann zum Haus. Denn ich wollte gerade schwimmen gehen und habe im Pool meinen ertrunkenen Stiefvater gefunden. Endlich bin ich diejenige, die bestimmt, was als Nächstes passiert.
Ich bin zwölf Jahre alt. Und blicke einer freudigen Zukunft entgegen.
1
London, Gegenwart
Mein Name ist Saffy Huntley-Oliver und ich töte böse Männer.
Natürlich weiß das niemand. Nach außen hin bin ich jemand ganz anderes. Ich bin ein ehemaliges Model und damit wohl ein Mitglied der High Society, obwohl ich keineswegs so gesellig bin, wie das klingt. Ich habe einen Abschluss in Kunstgeschichte an der Durham University, wie das für Frauen meiner Gesellschaftsschicht fast schon obligatorisch ist. Ich habe nur eine durchschnittliche Note erzielt, was ein hartes Stück Arbeit war – nicht, weil der Abschluss so schwer war, sondern weil ich schlau genug war, keinen Abschluss mit Auszeichnung zu machen. Niemand traut einer intelligenten Frau. Ich sitze im Vorstand von drei Wohltätigkeitsorganisationen – eine kümmert sich um die Speisung hungernder Kinder, eine um den Schutz missbrauchter Frauen und eine um die Pflege misshandelter Esel (irgendwie habe ich mich dazu breitschlagen lassen). Ich bin Vegetarierin, und ich bin bisher nur zweimal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, als ich im Alter von zweiundzwanzig und vierundzwanzig einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens bekommen habe. Zum Glück wurde ich beim zweiten Mal bloß von einer Radarfalle fotografiert, sodass man nicht sehen konnte, was im Kofferraum meines Wagens lag.
Böse Männer zu töten, ist mein privates Hobby, meine Herzensangelegenheit, das, was mich antreibt. Mein bescheidener Versuch, die Vorherrschaft der Männer zu zerschlagen. Ich habe im Alter von zwölf damit angefangen, sozusagen aus Versehen, und bin dann im Lauf der Zeit immer besser geworden. Mein Hobby eignet sich nicht wie die Backkunst für Instagram, aber immerhin ist es besser für die Oberschenkel.
Ihr habt vielleicht noch nie von mir gehört, aber bestimmt schon von einigen meiner Opfer. Die Nachrichten sind voller böser Männer. Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, Stalker, Lügner, gewalttätige Ehemänner, Hochstapler, Betrüger, Frauenhasser und Oberlehrer.
Letzteres war nur ein Witz. Soviel Freizeit habe ich nun auch wieder nicht.
Natürlich muss ich mein Hobby geheim halten, aber es ist mir nicht peinlich. Warum sollte mir etwas peinlich sein, das Spaß bereitet und die Welt zu einem besseren Ort macht? Sind Cher etwa ihre Schönheitsoperationen peinlich? Oder Dolly Parton ihre Perücken?
Nein, mir ist etwas anderes peinlich. Etwas, was weniger illegal, aber sehr viel verwirrender ist. Weniger erklärbar, aber banaler.
Ich bin verliebt.
***
»Was für ein Gefühl ist es, einen Mörder zu schnappen?«
Jonathan Desrosiers sitzt auf einer Theaterbühne in einem blauen Sessel. Er ist schlank, rasiert und trägt eine Jeans und ein weißes Button-down-Hemd. Er hat dunkles, dichtes Haar, das sich bestimmt kräuselt, wenn er es länger wachsen lässt. Er hat hohe Wangenknochen und hinter seiner Brille funkeln grüne Augen. Ich sitze in der siebten Reihe und kann von dort zwar seine Augenfarbe nicht erkennen, aber ich weiß von dem Foto auf der Rückseite seines letzten Buches, Gnadenlos, dass sie grün sind.
Es hat mich voll erwischt.
Auf eine Leinwand hinter der Bühne wird das Cover von Gnadenlos projiziert. Davor sitzt Jonathan zusammen mit der Interviewerin der Veranstaltung, einer hübschen Frau, die aussieht, als käme sie direkt von der Schule. Sie trägt ein geblümtes Kleid und eine Brille, die zu groß für ihr Gesicht ist, und ihre unbekümmerte Art steht im Gegensatz zu ihrer offensichtlichen Faszination für Jonathans Arbeit. Allerdings würde ich sagen, dass der Großteil des Publikums bei dieser Buchveranstaltung Frauen zwischen zwanzig und fünfzig sind. Sie scheinen heutzutage die größte Bevölkerungsgruppe unter den True-Crime-Lesern auszumachen. Vielleicht weil wir so eine Scheißwut auf die Welt haben.
»Was für ein Gefühl ist es, einen Mörder zu schnappen?«, wiederholt Jonathan und ich beiße mir auf die Innenseite meiner Lippe. Ich habe Jonathan Desrosiers zunächst durch seinen Podcast, Eiskalte Killer, kennengelernt, und wenn ich sage, kennengelernt, dann meine ich, dass ich mich in meinem Bett zwischen den Laken gerekelt habe, während ich seiner unglaublich sinnlichen Stimme lauschte, die von Mordfällen berichtete. Das war vor zwei Monaten und seitdem habe ich eine Episode nach der anderen gehört.
»Wie ich mich dabei fühle, spielt eigentliche keine Rolle«, sagt Jonathan. »Wichtig ist, dass man Timothy Bachelor gefasst und zur Rechenschaft gezogen hat, dass Efraín Santander entlastet wurde. Und dass Liannes Familie endlich ein wenig zur Ruhe kommen konnte.«
»Ja natürlich. Aber was für ein Gefühl war das?«
»Also, nur damit das klar ist: Ich war nicht dabei, als Timothy Bachelor verhaftet wurde. Und auch nicht, als er ein Geständnis abgelegt hat. Damit hatte ich nichts zu tun, das waren die hervorragenden Polizeibeamten, die einen gefährlichen Mörder aus dem Verkehr gezogen haben …«
»Ohne Sie hätte die Polizei ihn nie geschnappt«, unterbricht ihn die Interviewerin. »Die Polizei hatte den falschen Mann verhaftet und war offenbar überzeugt, den Richtigen zu haben. Nur aufgrund Ihrer Arbeit ist die Polizei überhaupt auf Bachelor aufmerksam geworden.«
Ein zustimmendes Murmeln im Publikum. Die anderen lieben ihn genauso wie ich. Fast hasse ich sie dafür.
»Dieses Verdienst gebührt meinem Freund DCI Harrison, der mir Gehör geschenkt hat, der sich die Beweise, die ich gesammelt hatte, angesehen und sie seinem Team vorgelegt hat.«
»Er war ein Freund Ihres Vaters, nicht wahr? Aus seiner Zeit bei der Metropolitan Police?«
»Das stimmt und er ist der eigentliche Profi. Man kann zwar von seinem Sessel aus ein Verbrechen aufklären, aber das nutzt nichts, wenn man niemanden verhaften darf. Die Polizei hat sich in Gefahr begeben, während ich in meinem sicheren Studio saß und meine Podcasts produziert habe. Und natürlich …« Jon beugt sich auf seinem Sessel nach vorne, und die Interviewerin auf der Bühne tut das ebenfalls, und ich auch, denn er hat die Stimme gesenkt, und ich will kein einziges seiner Worte verpassen – »hätte ich nichts herausbekommen, wenn Lianne Murrays Familie nicht so mutig gewesen wäre. Sie hat so viel Zeit mit mir verbracht und ist mit mir in stundenlangen Gesprächen immer wieder die schlimmste Nacht ihres Lebens durchgegangen, sehr viel ausführlicher, als man das erwarten konnte. Sie haben mich zu sich eingeladen und mir ihr Herz ausgeschüttet, obwohl sie das nicht mussten. Sie wussten, dass sie Lianne nicht wiederbekommen würden, aber sie wollten alles tun, damit ihr Mörder zur Rechenschaft gezogen wird.«
Ich muss an die Episode seines Podcasts denken, in der er zusammen mit Lianne Murrays Schwester und Mutter den Tatort aufgesucht hat. Daran, wie zurückhaltend und respektvoll Jonathan war und die Frauen von ihrer ermordeten Angehörigen erzählen ließ. Ihm waren die beiden und Lianne wirklich wichtig, ein neunzehnjähriges Mädchen, dessen Leben von einem bösen Mann vorzeitig beendet wurde.
»Das Leben der Murrays ist seitdem nicht leicht gewesen«, fährt er fort. »Marcia hat Krebs im vierten Stadium. Und Dorothy sitzt jeden Abend in Liannes unverändertem Zimmer und redet mit ihrer Tochter. Während Timothy Bachelor, der Lianne mit einem Reifenheber getötet hat, gemütlich im Gefängnis sitzt und Jura studiert. Sie haben zwar Gerechtigkeit bekommen, aber sie werden Lianne nicht wieder zurückbekommen.«
Ich weiß aus dem Internet, dass Jonathan die Tantiemen aus dem Verkauf seines Buchs den Murrays gespendet hat, was er jetzt jedoch nicht erwähnt. Jonathan ist ein guter Mensch.
»Aber Sie haben immer noch nicht meine Frage beantwortet«, sagt die Interviewerin. »Eine junge Frau wurde beim Joggen brutal ermordet. Die Polizei hat die falsche Person verhaftet. Und ein relativ unbekannter True-Crime-Podcaster bemerkte den Irrtum und hat unermüdlich recherchiert, Beweise gesammelt und Interviews geführt, bis er den wahren Mörder gefunden und die Polizei dazu gebracht hatte, gegen ihn zu ermitteln. Ihnen ist es zu verdanken, dass Timothy Bachelor geschnappt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Allein Ihnen. Und das hat Sie zum beliebtesten True-Crime-Autor des Landes gemacht. Sie haben seitdem ein halbes Dutzend ungeklärter Fälle gelöst. Aber mit Lianne Murray und ihrem Mörder Timothy Bachelor fing alles an. Was für ein Gefühl ist es zu wissen, dass Sie die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben?«
Jonathan Desrosiers holt hörbar Luft. Er schaut über das Publikum hinweg, und für einen Moment scheint es, als würde er mich direkt anblicken. Aber ich trage einen Hut und einen, ehrlich gesagt, scheußlichen Rollkragenpulli, und er würde mir nicht mal Beachtung schenken, selbst wenn er mich sehen würde.
»Es ist ein tolles Gefühl«, sagt er.
Wir haben so viel gemeinsam. Es ist ein Jammer, dass er verheiratet ist.
Und dass er, nebenbei bemerkt, Jagd auf Mörder macht. Aber niemand ist perfekt, oder?
2
Jons Verlag hatte stapelweise Bücher und einen Karton voller Filzstifte bereitgestellt, und ein junger, eifriger Mann aus der PR-Abteilung reichte ihm jedes Hardcover mit der aufgeschlagenen Titelseite herüber, auf der ein Post-it mit dem Namen für die Widmung klebte. Jons Aufgabe war es, mit jeder Person, die an seinen Tisch kam, ein paar freundliche Worte zu wechseln, sich anzuhören, wie sie von ihrer Lieblingsepisode seines Podcasts Eiskalte Mörder erzählte oder von einem ungelösten Fall, den er für seinen Podcast lösen könnte, von dem Buch, das sie gerade schrieb oder schreiben wollte, oder von dem Podcast, den sie irgendwann produzieren würde, wenn ihre Arbeit es zuließ. Außerdem gab es immer eine Person, die erklärte, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, und Jons Hilfe dabei brauchte, eine Spendenaktion zu starten (er bat sie, ihm über seine Website eine E-Mail zu schicken), und eine Person, die mit ihm über den Druckfehler auf Seite 216 seines letzten Buches reden wollte (er bat sie, seinem Verlag eine E-Mail zu schicken). Aber einige Leute wollten zum Glück nur, dass er ein Buch signierte, und waren nicht daran interessiert, sich mit ihm zu unterhalten.
Und dann war da noch Simon.
»Hi, Jonathan«, sagte er, während er sich zum Tisch vorschob. Er trug wie üblich eine beige Jacke und einen blauen Pulli über einem blauen Hemd und hatte seine Haare sorgfältig über seine kahle Stelle gekämmt. Seine Fingernägel waren auf Hochglanz poliert, sein Gesicht war rosig und frisch rasiert und in seiner Brille spiegelte sich das Transparent hinter Jon. »Das war ein tolles Interview.«
»Danke, Simon«, sagte Jon und nahm vom PR-Mann ein Buch entgegen. »Wow, es kommt mir so vor, als hätte ich Sie erst kürzlich gesehen.«
»In Nottingham, letzte Woche. Sie haben dieselben Schuhe getragen.«
»Sie haben ein Auge für Details, nicht wahr?«
»Das sagen jedenfalls meine Kollegen! Ich schätze, das haben wir beide gemeinsam.«
Jon warf einen Blick auf das Buch. »Ist das auch für Sie? Sie haben inzwischen mindestens fünf Exemplare.«
»Schreiben Sie das Datum neben Ihre Unterschrift. Ich dokumentiere gern alles. Mein Name schreibt sich Simon Simons, aber er wird ausgesprochen wie …«
»Simon Simmons. Ich weiß.« Jon signierte das Buch wie alle anderen Bücher.
Für Simon Simons
Viel Glück bei der Spurensuche!
Mit den besten Wünschen
Jonathan Desrosiers.
Er trug das Datum ein, klappte das Buch zu und gab es ihm. Simon hielt es mit beiden Händen vor den Körper, und nichts deutete darauf hin, dass er vorhatte zu gehen, damit die nächste Person in der Schlange ihr Buch entgegennehmen konnte.
»Es hat mir gefallen, als sie sagten, dass die Lebensumstände und nicht das Schicksal einen Menschen zum Mörder machen«, sagte Simon. »Ich meine, Sie haben vollkommen recht, jeder von uns könnte in einer bestimmten Situation zum Mörder werden. Ich habe häufig darüber nachgedacht. Mein Nachbar …«
»Der mit den Katzen?«
»Sie haben es nicht vergessen! Das ist nett von Ihnen, Jonathan! Ja, der mit den Katzen. Wissen Sie, ich habe sie gestern wieder gezählt, und ich schwöre, es sind jetzt fünfzehn. Sie sollten mal sehen, wie viele Katzenfutterdosen in seiner Recyclingtonne sind, und er spült sie nicht mal richtig aus. Ich glaube, mit dem stimmt was nicht. Ich wünschte, Sie könnten ihn kennenlernen und mir sagen, was Sie von ihm halten.«
Jon schaute zu der Person, die hinter Simon in der Schlange stand, und warf ihr einen entschuldigenden Blick zu.
»Die Tatsache, dass er viele Katzen hat, ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen«, sagte Jon. »Als Haustierbesitzer braucht man ein gewisses Maß an Mitgefühl, was im Widerspruch zur Persönlichkeit eines eiskalten Killers steht.«
»Tja, das sollte man meinen, aber es gab auch Dennis Nilsen und Bleep und Harold Shipman hatte …«
»Nun, es stimmt, jeder Mensch ist anders«, sagte Jon.
»Haben Sie irgendwelche Haustiere, Jonathan?«
»Nein, habe ich nicht. Simon, das ist alles wirklich sehr interessant, aber ich denke, es warten noch andere Leute.«
»Oh, sicher, sicher, natürlich.« Aber Simon rührte sich nicht von der Stelle. »Hören Sie, Jonathan, ich weiß, das ist vielleicht etwas aufdringlich, aber ich finde unser Gespräch auch sehr interessant. Vielleicht möchten Sie ja mit mir etwas trinken gehen, wenn Sie hier fertig sind? An der Ecke ist das Red Lion. Ich schätze, dass ich Ihnen nach all der Zeit einen Drink schuldig bin.«
Oh, Simon. Seine Hände umklammerten fest das Buch, und seine Wangen waren noch rosiger als sonst, als hätte er sich schon vor langer Zeit innerlich darauf vorbereitet, diese Frage zu stellen.
»Tut mir leid«, sagte Jon. »Heute Abend geht es nicht.«
»Oh«, sagte Simon. »Haben Sie schon was mit Amy vor?«
»Ja«, log Jon. »Aber danke für das Angebot.« Er griff nach dem nächsten Buch und warf der Frau hinter Simon ein aufforderndes Lächeln zu, worauf sie vortrat.
»Oh, okay«, sagte Simon. »Also, danke für das Buch. Ich schätze, ich sehe Sie nächsten Monat in Oxford. Ich hätte mir beinahe keine Karte gekauft, weil ich an dem Abend eigentlich einen Konzerttermin hatte, aber ich habe einen Ersatz gefunden.«
»Sie sind herzlich willkommen«, sagte Jon, der seinen Blick bereits auf das Post-it mit dem nächsten Namen gerichtet hatte.
***
Kurz nach Mitternacht setzte ein Wagen Jon vor einem Haus in Shepherd’s Bush ab, nachdem er den Abend in einem anderen Pub als dem Red Lion verbracht hatte. Ein wenig verwundert stellte er fest, dass in seinem Wohnzimmer noch Licht brannte. Er hantierte mit seinen Schlüsseln herum und öffnete die Tür.
»Babe?«, rief er und bückte sich, um seine Schuhe auszuziehen. »Tut mir leid, dass es spät geworden ist. Ich dachte nicht, dass du noch wach bist. Ich habe den ganzen Abend dabei zugesehen, wie der PR-Typ und die Interviewerin miteinander rumgemacht haben.« Er schaffte es erst beim zweiten Versuch, seine Jacke aufzuhängen. Vielleicht war das letzte Bier eines zu viel gewesen.
»Ich fühle mich ausgedörrt und uralt«, fügte er hinzu.
Jon ging ins Wohnzimmer und rechnete damit, den eingeschalteten Fernseher zu sehen, eine offene Weinflasche auf dem Couchtisch und seine Frau im Schlafanzug unter einer kuscheligen Decke.
Doch Amy stand vollständig bekleidet neben zwei Koffern.
»Ich habe gewartet, bis du nach Hause kommst«, sagte sie. »Ich wollte dir keine Nachricht hinterlassen.«
Für eine Minute bekam Jon keine Luft mehr und dann stieß er alle Worte gleichzeitig hervor. »Amy? Was machst du da? Wo willst du hin? Ich dachte, wir hätten das geklärt.«
»Du hast gedacht, wir hätten das geklärt. Deshalb hast du mich nie gefragt, wie es mir geht.«
»Wo willst du hin?«
»Das geht dich nichts mehr an. Das Haus ist zwar immer noch auf meinem Namen eingetragen, aber ich will nicht, dass du auf der Straße lebst. Deshalb komme ich erst mal woanders unter, bis du eine neue Bleibe gefunden hast.« Sie schlang ihre Handtasche um die Schulter und Jon machte unwillkürlich einen Schritt zur Seite, um den Weg zur Tür zu versperren.
»Aber du warst – du hast in letzter Zeit wieder glücklicher gewirkt«, sagte er.
»Dann habe ich Neuigkeiten für dich. Ich bin keineswegs glücklicher gewesen. Ich habe mich genauso unglücklich und einsam wie in den letzten Monaten unserer Beziehung gefühlt. Wie in den letzten Jahren.«
»Weil ich gearbeitet habe?«
»Weil du besessen bist, Jon! Du gehst nicht einfach zur Arbeit, du kennst nichts anderes!«
Er hielt die Hände in die Höhe. »Moment mal, das ist nicht fair.«
»Doch! Es ist ja nicht so, dass wir auf das Geld angewiesen wären. Wir verdienen beide sehr gut, wir könnten uns freinehmen und das Leben genießen. Aber du hängst ständig im Studio vor dem Computer oder bist unterwegs und redest mit unglücklichen Menschen, und das macht dich unglücklich und mich auch. Dieses Haus ist von Leid erfüllt.«
»Das ist nicht fair, denn ich mache das nicht wegen des Gelds. Ich mache das, um anderen Menschen zu helfen.«
»Wenn du den Menschen helfen willst, Jon, arbeite ehrenamtlich für eine Wohltätigkeitsorganisation. Lauf einen Marathon. Bau irgendwo eine Schule. Warum machst du nicht so was?«
»Ich … ich kann nicht.«
»Nein, du willst nicht. Denn dein ganzes Leben dreht sich nur um diese Mordfälle.«
»Amy, du bist so …«
»Ich bin gar nichts. Ich habe es einfach nur satt!« Sie deutete auf die Bücherregale voller True-Crime-Titel und kriminaltechnischer Literatur. Auf die über die Beistelltische verstreuten Notizbücher. Und die mehr als zwanzig Exemplare seines letzten Buchs, die sich in einer Ecke stapelten. »Du kannst nur noch an tote Menschen denken. Das war nicht immer so, aber inzwischen dreht sich hier alles bloß noch um Mord, Mord, Mord! Und ich brauche etwas Leben in meinem Leben.«
Sie nahm ihre Koffer. Sie waren offenbar ziemlich schwer. Als wollte sie ihn für immer verlassen.
»Amy, bitte, geh nicht. Lass uns darüber reden.«
»Die Zeit dafür ist längst abgelaufen. Mach Platz.«
Jon rührte sich nicht vom Fleck. »Ich denke nicht nur an meinen Job. Ich denke auch an dich. Die ganze Zeit, Ames. Wenn du bloß wüsstest …«
»Du hast eine komische Art, das zu zeigen.« Sie presste die Kiefer zusammen.
»Bitte. Wir schaffen das. Ich werde mich ändern. Ich werde tun, was du verlangst.«
»Jon, ich glaube nicht, dass du dich je ändern wirst.«
Ihre Stimme klang so traurig, dass er zur Seite trat und sie vorbeiließ.
»Ich liebe dich«, rief er ihr hinterher.
»Tut mir leid«, sagte sie, öffnete die Haustür und verschwand hinaus in die Nacht.
3
Als Jon am nächsten Morgen allein aufwachte, waren seine Augenlider verklebt. Er wankte ins Badezimmer, und während er sich kaltes Wasser ins Gesicht spritzte, bemerkte er die leere Stelle, wo Amys Zahnbürste normalerweise lag, und das ausgeräumte Regal, in dem ihre Gesichtsöle und Feuchtigkeitscremes sonst immer standen. »Warum brauchst du so viele Flaschen und Tuben mit diesem schleimigen Zeug, das du dir ins Gesicht schmierst?«, hatte er sie jedes Mal gehänselt, wenn eine neue Flasche, Tube oder Dose aufgetaucht war. »Um hübsch auszusehen«, hatte sie dann geantwortet. Aber an diesem Morgen wurde ihm klar, warum diese Flaschen, Tuben und Dosen in Wirklichkeit existierten: um von Amys Anwesenheit zu zeugen, um zu beweisen, dass sie Teil seines Lebens war, dass sie sich in jedem Winkel des Hauses breitgemacht hatte.
Jon legte sich wieder ins Bett. Ihm dröhnte der Schädel und er hatte einen trockenen Mund. In dem Glas auf dem Nachttisch war immer noch etwas Whisky. Es war schon komisch, wie sexy ein Schlaftrunk war, wenn man mit einem anderen Menschen im Bett lag, und wie armselig, wenn man sich bis zur Besinnungslosigkeit betrank, weil man von seiner Frau verlassen worden war.
»Sie ist gegangen«, krächzte er laut Richtung Decke. »Sie ist weg.«
Normalerweise registrierte er in seinem Umfeld jede noch so kleine Einzelheit. Darauf war er sehr stolz; darauf hatte er seine Karriere aufgebaut. Trotzdem hatte er nicht gemerkt, dass seine Frau – der einzige Mensch, den er je geliebt hatte – ihn verlassen wollte.
Er war Amy gestern Abend auf die Straße vor ihrem Haus hinterhergerannt und hatte sie angefleht, bis sie in ein wartendes Taxi gestiegen und davongefahren war. Offenbar hatte sie den Wagen bereits gerufen, bevor er nach Hause zurückgekehrt war. Das Ganze war wohlüberlegt und endgültig – ebenso wie die Tatsache, dass sie ihre Wundermittel aus dem Bad mitgenommen hatte, ihre Sachen aus dem gemeinsamen Kleiderschrank und ihre Lieblingsbücher aus den Regalen. Auf der Arbeitsplatte in der Küche lagen ihr Hochzeits- und ihr Verlobungsring.
Es war kein spontaner Entschluss gewesen. Sie hatte alles akribisch geplant.
Jon tastete nach seinem Telefon neben dem Whiskyglas auf dem Nachttisch. Vielleicht hatte sie angerufen oder eine Nachricht geschickt. Vielleicht hatte sie es sich anders überlegt. Vielleicht hatte er eine reumütige Nachricht bekommen: Baby, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Können wir reden?
»Bitte, lass eine Nachricht da sein«, flüsterte er, obwohl er nicht an Gott glaubte und nicht wusste, zu wem er überhaupt betete. Vielleicht zu Amy.
Aber da war keine Nachricht. Nur die Liste mit den Anrufen, die er gestern Abend getätigt hatte, mit den Nachrichten, die er ihr geschickt hatte. Amy hatte keinen der Anrufe entgegengenommen, keine der Nachrichten gelesen.
Auf gewisse Weise war das eine deutliche Nachricht. Sie wollte nichts von ihm hören, und wenn er es weiterhin versuchte, würde er nicht nur einen verzweifelten Eindruck machen, sondern auch absichtlich ihre Wünsche missachten.
Trotzdem rief er sie erneut an. Eine aufgezeichnete Stimme forderte ihn auf, eine Nachricht zu hinterlassen. Er konnte sich nicht mehr an all die Nachrichten erinnern, die er gestern Abend auf die Mailbox gesprochen hatte, schon gar nicht nach den ersten paar Gläsern Whisky. Aber auch auf die Gefahr hin, sich zu wiederholen, hinterließ er eine weitere: »Amy, bitte. Lass uns reden.«
Dann – er hatte jegliche Selbstachtung verloren – rief er ihre Mutter an.
»Oh, Jonny, es tut mir so leid«, sagte Monica, sobald sie abgenommen hatte. »Aber ich kann nicht mit dir darüber reden. Geht es dir gut? Hast du genug zu essen?«
»Ich wusste nicht, dass sie so unglücklich war«, sagte Jon zu seiner Schwiegermutter, die ihn immer gemocht hatte. »Wusstest du das?«
»Na ja …«
»Du wusstest es?«
»Das war ziemlich offensichtlich, Jonny.«
»Was hat sie gesagt?«
»Sie meinte, du arbeitest rund um die Uhr.«
»Ja, aber ich hatte vor …« Er verstummte. Denn hatte er wirklich vorgehabt, mehr Zeit mit ihr zu verbringen? Oder war das ein leeres Versprechen gewesen, wie all die anderen leeren Versprechen, seiner Ehe den Vorrang vor seiner Karriere zu geben? Er hatte weder einen Flug gebucht noch einen Tisch in einem Restaurant reserviert. Er hatte gedacht, dass sich ihre Beziehung, auch ohne sein Zutun, von allein wieder einrenken würde.
»Jonny«, sagte Monica mit sanfter Stimme, »du weißt ja, warum das so ein Problem für sie ist. Ihr Vater hat jahrelang mit uns zusammengelebt, ohne wirklich da zu sein.«
»Sag ihr, dass ich ausziehen werde, sobald ich was anderes gefunden habe«, sagte er und beendete den Anruf. Dann schleuderte er das Telefon gegen die Wand, als wäre das alles die Schuld des Telefons und nicht seine.
***
Er musste sich jetzt entscheiden, ob er die Whiskyflasche leeren oder joggen gehen wollte. Er schnupperte an seinen Achselhöhlen und verzog das Gesicht. Sein Vater hatte auch immer so gerochen – nach Whisky und Schweiß. Als er noch jung war, fand er das beruhigend. Aber inzwischen wusste er, was das zu bedeuten hatte, und er hasste es.
Er zog eine Jogginghose und ein T-Shirt an, die er aus dem Korb mit der Schmutzwäsche gefischt hatte. Vielleicht würde ihm die Bewegung bei der Entscheidung helfen, was er jetzt tun sollte. Anschließend würde er ein Bacon-Sandwich essen, zwei Ibuprofen einwerfen und sich hinsetzen, um eine Lösung für die Situation zu finden. Das Ganze war ein Rätsel, oder? Das Rätsel seiner Ehe. Er war sehr gut darin, Rätsel zu lösen.
Aber dieses Rätsel konnte er nicht lösen. Für dieses Rätsel gab es nur eine Antwort, nämlich, dass Amy ihn verlassen hatte und er schuld daran war.
Als er in der Küche eine Kapsel in die Nespresso-Maschine steckte, vermied er es, einen Blick auf die Ringe zu werfen. Die Maschine war ein Geschenk von Amy. »Wenn du zu Hause Kaffee trinkst«, hatte sie gesagt, »solltest du wenigstens anständiges Zeug trinken und keinen Pulverkaffee.«
Würde so seine Zukunft aussehen? Würde er jedes Mal, wenn er sich einen Kaffee machte, daran denken, dass seine Ehe in die Brüche gegangen war?
Du musst dir eine neue Kaffeemaschine anschaffen, sagte er sich. Aber mit dem feinen Gespür eines Autors für den unvermeidlichen Lauf der Dinge wusste er, dass er das nicht tun würde. Es schmerzte zwar, sich beim Anblick der Maschine daran zu erinnern, wie verzückt Amy gewesen war, als sie ihm die Maschine geschenkt hatte. Und es würde auch in Zukunft schmerzen. Aber er würde die Maschine behalten, weil der Schmerz bedeutete, dass das alles wirklich passiert war. Ganz schön krank, oder?
Er stand neben dem Küchentresen und trank seinen Kaffee. Der Espresso war stark und schwarz und schmeckte bitter vor Selbsthass.
Dann – seinem Kopf ging es inzwischen etwas besser – holte er seine Joggingschuhe unter dem Hocker hervor, wo er sie das letzte Mal hingekickt hatte, zog sie an, suchte zehn Minuten lang nach dem Türschlüssel und öffnete schließlich die Haustür, um joggen zu gehen.
Auf der Eingangsstufe stand eine schwarze Mülltüte. Sie war voll und oben zugeknotet.
»Was zum Henker«, sagte er, während er die Straße rauf- und runterschaute, als wüsste er, wie jemand aussah, der gerade seinen Müll auf der Eingangsstufe abgeladen hatte. Natürlich wusste er das nicht. Es waren zwar ein paar Leute unterwegs, die normale Dinge taten, wie zur Arbeit zu gehen und ihren Hund Gassi zu führen, aber keiner von ihnen sah aus, als würde er illegal Müll entsorgen. Vielleicht war es der Müll eines der Nachbarn. Doch das war eher unwahrscheinlich, denn Bridie, die nebenan wohnte, hatte ihm und Amy nach ihrem Einzug äußerst detaillierte Anweisungen gegeben bezüglich Abfuhrterminen, Recycling, Kompostierung und der richtigen Nutzung der Tonnen, und in regelmäßigen Abständen wiederholte sie diese Anweisungen, nur für den Fall, dass sie sie vergessen hatten.
Hatte er etwa ein Abfallverbrechen begangen und Bridie hatte ihn auf diese passiv-aggressive Weise daran erinnert? Aber Jon benutzte keine schwarzen Müllbeutel, und Bridie führte einen Feldzug gegen Plastik, was sie ihm jedes Mal erzählte, wenn sie sich trafen. Dieser Beutel bestand nicht aus dem üblichen dünnen Plastik, es war ein Beutel aus dickem, strapazierfähigem Material, wie man ihn für Gartenabfälle benutzte. Also …
Sein Schädel hämmerte, und er dachte daran, den Beutel einfach dort stehen zu lassen. Aber dann müsste er sich bei seiner Rückkehr darum kümmern, verschwitzt und durstig, und bis dahin hatten vielleicht irgendwelche Scherzbolde oder ein neugieriger Hund ihn aufgerissen und den Inhalt über die Eingangsstufe verstreut.
Seufzend hob er den Beutel am Knoten hoch, um ihn in eine von der Stadt und Bridie gebilligten schwarzen Tonnen vor dem Haus zu werfen. Er stöhnte auf, der Inhalt des Beutels war unglaublich schwer. Schwerer als der normale Müll, als hätte jemand eine Ladung Backsteine entsorgt. Der Plastikbeutel spannte sich unter dem Gewicht. Jon schleppte ihn über die Eingangsstufe und beförderte ihn in die Tonne an der Eingangspforte. Mit einem dumpfen Schlag landete er im Innern.
»Guten Morgen, Jonathan«, sagte Bridie und Jon schaute auf. Sie stand auf ihrer Eingangsstufe und tat so, als würde sie nach der Post sehen.
»Haben Sie mitbekommen, wie jemand Müll vor meiner Haustür abgeladen hat?«, fragte er.
»Nein, hab ich nicht. Aber ich habe Sie gestern Abend draußen gehört. Es klang, als hätten Sie einen Streit gehabt. Ist alles in Ordnung?« Sie blickte ihn durch ihre Großmutterbrille mit zusammengekniffenen Augen an.
»Mir geht’s gut«, sagte er. »Alles bestens.« Er rieb sich die Stirn und bemerkte einen intensiven künstlichen Geruch, wie von Parfüm. Er kam ihm bekannt vor – nichts, was Amy benutzte –, es war ein maskuliner Geruch, eher wie von Aftershave. Aus irgendeinem Grund musste er dabei an blaue Wolle denken.
»Ich habe Türknallen gehört, Autos, die kommen und wieder fahren«, fügte Bridie hinzu.
»Tja«, sagte Jon, »wir leben schließlich in der Stadt. Dann bis später, Bridie.« Er drehte sich um und begann, die Straße hinunterzujoggen, als ihm plötzlich einfiel, dass in dem Müllbeutel vielleicht Sachen von Amy waren, oder von ihm – irgendwelches Zeug, das sie aus Versehen eingepackt hatte –, und er kehrte um.
An der Ecke blieb er stehen und wartete, bis Bridie wieder verschwunden war. Dann lief er zügig zur Tonne.
Der Beutel lag auf anderen Beuteln mit Haushaltsabfällen. Voller Lebensmittelverpackungen, Kaffeesatz, alten Socken und Zahnpastatuben. Voller Überresten von Dingen, die er und Amy gekauft hatten, als sie noch zusammen waren, die sie achtlos weggeworfen hatten und die jetzt wertlos waren. Wie ihre Ehe.
Er zog an dem Knoten. Er war so fest zugeschnürt, dass er seine Fingernägel zur Hilfe nehmen mussten, um ihn zu öffnen, und er brauchte so lange dafür, dass er sich albern vorkam, weil er sich mit dem Oberkörper in eine Mülltonne beugte. Er wollte es schon aufgeben, als sich der Knoten plötzlich löste, und er öffnete den Beutel.
Zunächst sah er nur ein dunkles, feuchtes Bündel.
Und dann einen menschlichen Fuß.
4
»Es war der Müllbeutel-Killer, nicht wahr?«
Wie die letzten paar Stunden gezeigt hatten, verfügte Jon zwar nicht gerade über die beste Menschenkenntnis, sofern es nicht um einen skrupellosen Mörder ging. Dennoch hatte er kein Problem, DI Athertons Gesichtsausdruck zu deuten. Der Mann hasste ihn.
»Die sterblichen Überreste befanden sich zwar in einem Müllbeutel«, sagte Atherton. »Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass dies die Tat eines Serienmörders war. Nicht jeder Mord ist ein spektakulärer Kriminalfall, obwohl man das nicht denken sollte, wenn man Ihren Podcast hört. Manchmal werden Leichen einfach in Müllbeuteln gefunden, weil die Beutel billig sind, nicht auslaufen und sich problemlos entsorgen lassen.«
Die beiden saßen im Polizeirevier auf Plastikstühlen. Man hatte Jon mitgeteilt, dass man dort seine Aussage aufnehmen werde, damit man sein Haus auf forensische Beweise untersuchen könne. Er dachte voller Sorge an den halb leeren Kleiderschrank, die ausgeräumten Schubladen und die beiden Ringe auf dem Küchentresen.
»Sie hören meinen Podcast?«, fragte Jon.
»Nein«, sagte Atherton. »Ich halte das für kindische Sensationsmache, wenn Sie es wissen wollen. Genau wie Ihre Bücher. Das ist alles absoluter Müll.«
»Da sagen Sie was. Ein weiterer Grund dafür, dass Mörder ihre Opfer in Müllbeuteln entsorgen, könnte sein, dass sie ihre Opfer buchstäblich für Müll halten.«
»Leute wie Sie brüsten sich gern damit, dass sie zufällig auf irgendwelche Hinweise stoßen. Es macht Ihnen Spaß, die Polizei alt aussehen zu lassen.«
»Ich zolle der Polizei stets meine Anerkennung. Wie DCI Harrison weiß.«
»DCI Harrison ist im Ruhestand. Und Sie erwecken den Eindruck, dass ein Mord eine tolle, aufregende Sache ist, obwohl die Beamten, die vor Ort ihren Job machen, wissen, dass das absolut nicht zutrifft.«
»Aber es war der Müllbeutel-Killer, oder?«
Atherton seufzte.
»Dies ist die sechste Leiche, die in den letzten acht Monaten in London auf diese Weise entsorgt wurde«, insistierte Jon. »Wann ist die erste aufgetaucht? Letzten Oktober, oder? Und dann eine im Dezember, eine weitere im Februar und zwei weitere im April. Alle Opfer sind weiße Männer und sie wurden alle zerstückelt in Müllbeuteln gefunden. Ihre Köpfe sind bisher nicht aufgetaucht. Das passt absolut ins Muster.«
»Sie wissen eine Menge über diese Fälle. Wollen Sie mir nicht sagen, woher?«
»Das ist nur das, was in der Presse stand. Soweit ich weiß, hat man die Beutel alle in irgendwelchen Gassen oder auf Brachflächen gefunden. Keine wurde vor der Tür eines Wohnhauses gefunden.«
»Tja, ist das nicht seltsam?«
»Ist es das?«
»Lassen Sie uns noch mal durchgehen, wie Sie die sterblichen Überreste gefunden haben.«
»Dürfte ich unser Gespräch aufnehmen?«, fragte Jon mindestens zum sechsten Mal.
»Dürfen Sie nicht.«
»Vielleicht können wir später noch mal reden, damit ich es aufnehmen kann.«
»Das können Sie vergessen.« Atherton lehnte sich in seinen Stuhl zurück. »Gehen wir alles noch mal durch.«
Jonathan wollte das alles nicht noch mal durchgehen.
Er hatte eine Menge Zeugen von Verbrechen interviewt, Opfer von Verbrechen und die Familien von Opfern. Er hatte ihre Erschütterung und Verzweiflung erlebt. Und um ehrlich zu sein: Er hatte ihre Erschütterung und Verzweiflung ausgeschlachtet. Wenn normale Menschen mit Gewalt in Berührung kamen, reagierten sie auf unterschiedlichste Weise. Sie distanzierten sich davon oder durchlebten erneut diesen Moment. Sie brachen in Tränen aus, saßen mit versteinerter Miene da oder schlugen einen merkwürdig flapsigen Tonfall an. Aber was sie alle verband, war der Schmerz.
Jon saß lieber auf der anderen Seite des Mikrofons, stellte lieber die Fragen, statt sie zu beantworten. Es war sehr viel leichter, Fragen zu stellen und zu beobachten, als seinen Gefühlen ausgesetzt zu sein und Angst zu haben.
»Haben Sie vorher schon mal eine Leiche gesehen, Desrosiers?«
Jon musste daran denken, dass die Körperteile in dem Beutel ganz blass gewesen waren. Ganz bläulich. Außerdem hatten die dunklen Haare auf dem Bein alle abgestanden. Und die Zehennägel waren säuberlich geschnitten gewesen, was bedeutete, dass das Opfer vor seinem Tod geduscht oder gebadet hatte, dass es mit einem Nagelknipser in seinem Badezimmer gestanden hatte, in einem entwürdigenden Zustand, aber makellos gepflegt. Sich die Nägel zu schneiden, war etwas so Alltägliches. Man dachte währenddessen nicht im Traum daran, dass ein Fremder den eigenen Fuß in einem Müllbeutel finden könnte.
»Nein«, sagte Jon. »Noch nie, nicht in natura. Nur auf Fotos.«
»Den Anblick vergisst man nicht, was?«
Jon bekam ihn nicht mehr aus dem Kopf. »Wissen Sie, wer das Opfer ist?«, fragte er.
»Ich stelle hier die Fragen. Erzählen Sie mir noch mal, was passiert ist.«
Einige Leute, die Jon interviewt hatte, weinten. Einige waren aufgewühlt gewesen, andere distanziert. Einige brachten keinen Ton mehr heraus. Andere schilderten unzählige Details, unbedeutende, zufällige Details, als wollten sie das Grauen unter lauter Belanglosigkeiten begraben. Und einige Leute äußerten sich völlig unverblümt. Er erinnerte sich, dass Deven Michaels, der junge Mann, der Lianne Murrays Leiche gefunden hatte, immer wieder nur diesen einen Satz wiederholen konnte: »Da war so viel Blut.«
»Kann ich ein Glas Wasser haben?«, fragte Jon. Atherton gab ein Knurren von sich und stand auf.
Jon war klar, dass er nur Zeit schindete. Denn trotz seiner Faszination für Verbrechen, obwohl er jedes noch so kleine Detail über die Tragödien kannte, die anderen Menschen zugestoßen waren, wollte er nicht über das reden, was ihm zugestoßen war. Wie er aufgewacht war, einsam und verzweifelt, mit dem bitteren Geschmack von Alkohol im Mund und dem Wissen, dass er seine Ehe zerstört hatte. Wie er direkt vor seiner Haustür einen Müllbeutel mit Leichenteilen gefunden hatte, was eine groteske, aber äußerst zutreffende Metapher für das war, was aus seinem Leben geworden war. Und er wollte auf keinen Fall darüber reden, wie er die Mülltonne durchwühlt hatte, über den Anblick eines menschlichen Fußes, blass und furchterregend, das Wirrwarr aus Körperteilen, den Gestank von verfaulten Lebensmitteln und Blut und …
»Blaue Wolle«, sagte er laut.
»Wie bitte?« Atherton war mit einem Plastikbecher voller Wasser wieder zurückgekehrt.
»Nichts. Nur – ein Detail, das mich an etwas erinnert hat. Aus dem Beutel kam ein Geruch, der mich an blaue Wolle erinnert hat. Weiche Wolle.«
»Wie kann ein Geruch blau und weich sein?«
»Keine Ahnung. Es ist …« Jon zuckte mit den Achseln und nahm einen Schluck Wasser, während Atherton sich auf seinen Stuhl fallen ließ.
»Hören Sie, Desrosiers, ich kannte Ihren Vater. Er war eine Legende. Aber Sie – ich mag Sie nicht.«
»Dachte ich mir schon.«
»Ich halte Sie für einen Aasgeier. Sie weiden sich am Unglück anderer Menschen.«
»Ich habe Fälle aufgeklärt, DI