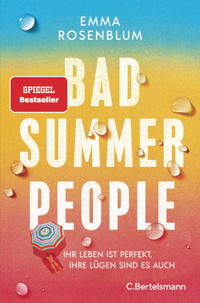
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der perfekte Sommer. Die perfekte Ehe. Das perfekte Geheimnis? Der SPIEGEL-Bestseller jetzt im Taschenbuch!
Jeden Sommer lassen Jen Weinstein und ihre Freundin Lauren Parker ihr privilegiertes Leben in New York hinter sich, um die schönsten Wochen des Jahres auf Fire Island zu verbringen, einer idyllischen Düneninsel, gleich neben Long Island. Hier residiert „altes Geld“, man kennt sich seit Jahren und vertreibt sich die Zeit mit Tennis, kühlen Cocktails im Clubhaus und Beach-Picknicks. Die Ehemänner checken die Börsenkurse, bei Jen und ihren Freundinnen hat längst das Rennen auf den neuen attraktiven Tennislehrer begonnen – es scheint, ein ganz normaler Sommer zu werden. Bis nach einem Sturm eine Leiche in einer Böschung gefunden wird …
Und während die Tage länger und heißer werden, zeigen sich immer mehr Risse im scheinbar perfekten Leben von Jen und ihren Freunden: Wer schläft mit wem? Wem ist das Geld ausgegangen? Und: Wer hat mit wem noch eine Rechnung offen …?
„Sagen Sie alle Verabredungen ab – ich habe dieses Buch innerhalb eines Wochenendes inhaliert und konnte einfach nicht die Finger davon lassen!“ Lucy Foley
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Der perfekte Sommer. Die perfekte Ehe. Das perfekte Geheimnis?
Jeden Sommer lassen Jen Weinstein und ihre Freundin Lauren Parker ihr privilegiertes Leben in New York hinter sich, um die schönsten Wochen des Jahres auf Fire Island zu verbringen, einer idyllischen Düneninsel, gleich neben Long Island. Hier residiert »altes Geld«, man kennt sich seit Jahren und vertreibt sich die Zeit mit Tennis, kühlen Cocktails im Clubhaus und Beach-Picknicks. Die Ehemänner checken die Börsenkurse, bei Jen und ihren Freundinnen hat längst das Rennen auf den neuen attraktiven Tennislehrer begonnen – es scheint ein ganz normaler Sommer zu werden. Bis nach einem Sturm eine Leiche in einer Böschung gefunden wird …
Und während die Tage länger und heißer werden, zeigen sich immer mehr Risse im scheinbar perfekten Leben von Jen und ihren Freunden: Wer schläft mit wem? Wem ist das Geld ausgegangen? Und: Wer hat mit wem noch eine Rechnung offen …?
Die perfekte Sommerlektüre, frisch, sexy, spannend und ganz einfach beste Unterhaltung für die heißesten Tage des Jahres!
Emma Rosenblum begann ihre Karriere beim New York Magazine. Nach Stationen bei Bloomberg Businessweek und Glamour wurde sie schließlich Chefredakteurin bei ELLE. Für eine große New Yorker Digitalmedien-Gruppe entwickelt sie heute Content-Strategien. Mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Söhnen lebt Emma Rosenblum in New York City. Bad Summer People ist ihr erster Roman.
»Sagen Sie alle Verabredungen ab – ich habe dieses Buch innerhalb eines Wochenendes inhaliert und konnte einfach nicht die Finger davon lassen!«
Lucy Foley
»Clever gemacht und im besten Sinn böse – ein Buch wie der süffige Strandcocktail, von dem man nicht genug bekommen kann!«
Kevin Kvan, Autor von »Crazy Rich Asians«
»Beziehungen, Freundschaften, enttäuschte Gefühle – und die Verwicklungen, die daraus entstehen. Eine Geschichte, die definitiv Lust auf mehr macht.«
Vogue.com
www.cbertelsmann.de
Emma Rosenblum
Bad Summer People
Ihr Leben ist perfekt, ihre Lügen sind es auch
Roman
Aus dem Englischen von Carolin Müller
C. Bertelsmann
Für Monty, Sandy und Charles,meine besten Summer People
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
Zweiter Teil
7
8
9
10
11
12
13
Dritter Teil
14
15
16
17
18
19
Vierter Teil
20
21
22
23
Jason Parker
Sam Weinstein
Lauren Parker und Jen Weinstein
Micah Holt
Rachel Woolf
Fünfter Teil
24
25
26
27
28
29
30
Epilog
Dank
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Prolog
Die Leiche wurde von Danny Leavitt entdeckt, einem schlaksigen Achtjährigen mit einer schlimmen Erdnussallergie. Es war frühmorgens, vielleicht halb acht, nach einer Unwetternacht, als er mit seinem schwarzen Kinderfahrrad auf der Suche nach Schnecken im Ort herumfuhr. Die Bohlenwege waren nass und rutschig und übersät mit Blättern und kleinen Zweigen, die der starke Sturm herabgeweht hatte. Es war zwar kein richtiger Wirbelsturm gewesen, aber fast – ein heftiger Microburst oder Fallwind, der die Insel unerwartet getroffen, Terrassenmöbel mitgerissen und etliche Dächer im Ort leicht beschädigt hatte. Das Haus von Dannys Familie in direkter Strandlage war unversehrt geblieben, die Stromleitung intakt, aber seine Mutter hatte ihm hinterhergerufen, er solle vorsichtig sein, und ihn vor herabgerissenen Kabeln gewarnt.
Er war etwa zehn Minuten den Surf Walk, die Straße, in der er wohnte, vom Meer Richtung Bucht entlanggefahren. Dann hatte er beschlossen, rüber zum Neptune Walk zu fahren, wo sich der Spielplatz befand, um zu sehen, in welchem Zustand er war. Also bog er vom Surf Walk in den Harbor Walk, überquerte den Atlantic Walk, den Marine Walk und die Broadway Road und bog dann links in den Neptune Walk ein. Auf Höhe des Hauses der Cahulls, eines netten Ehepaars mit einem kleinen Sohn namens Archie, erregte etwas Glänzendes seine Aufmerksamkeit. Er hielt an, stieg ab und entdeckte ein Fahrrad fast versteckt in dem überwucherten, etwa einen Meter tiefer liegenden Bereich am Rande der Bohlenwege. Nach den Überflutungen durch Hurricane Sandy waren alle Holzwege des Ortes erhöht worden, und Dannys Vater war wie so viele andere aus Salcombe der Ansicht, man hätte dabei etwas übertrieben. »Da bricht sich noch mal einer den Hals«, hatte Danny seinen Vater brummeln gehört.
Danny ging davon aus, dass das Fahrrad vom Sturm dorthin geweht worden war, also packte er es am Vorderrad und zerrte es auf den Promenadenweg hinauf – kein leichtes Unterfangen, da es sich um ein Erwachsenenrad handelte und Danny eher klein für sein Alter war. Erst dann bemerkte er, dass das Fahrrad etwas anderes verdeckt hatte: einen Menschen, der mit dem Gesicht nach unten im Schilfgras lag. Der Körper war seltsam verdreht und vollkommen reglos. Danny schnürte es die Kehle zusammen, fast so, wie wenn er irgendwo etwas mit Erdnuss erwischte. Aber das hatte er doch nicht, oder? Er rannte zum Haus der Cahulls und wummerte zitternd und verängstigt an die Tür. Marina, noch im Pyjama, öffnete mit Brille und besorgtem Blick die Tür. Sie war hochschwanger und hielt den kleinen Archie auf dem Arm.
»Danny Leavitt? Alles in Ordnung mit dir?«
Danny bekam die Worte kaum aus dem Mund.
»Da liegt jemand. Ich glaube, er ist mit dem Fahrrad von der Promenade ins Gestrüpp gestürzt. Er rührt sich nicht.«
Marina setzte ihren Sohn ab und rief nach ihrem Mann Mike.
»Komm erst mal rein. Mike und ich kümmern uns darum. Du bleibst einfach hier.«
Mike, in Jogginghose und einem vom Schlafen zerknitterten T-Shirt, eilte an ihnen vorbei nach draußen, um den Fund zu begutachten. Marina lächelte Danny beruhigend zu. Sie schwiegen eine Weile. Dann kam Mike zurück ins Haus. Er wirkte angespannt, so wie Dannys Vater, wenn er einen schlechten Tag in der Arbeit gehabt hatte.
»Bring Danny nach Hause und nimm Archie mit. Schaut die Leiche nicht an. Ich rufe die Polizei. Oder wen auch immer man hier draußen Polizei nennt.«
Die Leiche? Dieses Wort kannte Danny bisher nur aus Fernsehsendungen, die seine Eltern anschauten. Marina packte ihren sich sträubenden Sohn und führte Danny zu seinem Fahrrad, wobei sie ihn von der Leiche, wie Danny sie jetzt in Gedanken nannte, abschirmte. Sie sagte ihm, er solle schon mal nach Hause losradeln, setzte dann ihren Sohn in den Kindersitz ihres Fahrrads und fuhr hinter ihm her.
Den Trubel um den Fund, der darauf folgte, bekam Danny nicht mehr direkt mit, aber er durfte an diesem Tag noch mit zwei echten Polizisten sprechen und ihnen erzählen, was er gefunden und wie er es entdeckt hatte. Seine Eltern wirkten bestürzt; er bekam mit, wie sie sich laut flüsternd in ihrem Schlafzimmer unterhielten, nachdem die Polizisten wieder gegangen waren.
»Na toll, jetzt wird er hier das ›Kind mit der Leiche‹ – das wird das Gesprächsthema in ganz Dalton sein«, sagte seine Mutter Jessica.
»Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Gemeinde zu verklagen«, sagte sein Vater Max. »Ich bleche doch nicht zwei Millionen Dollar für mein Strandhaus plus fünfzigtausend Grundsteuer, damit mein Sohn dann eine Leiche findet. Irgendjemand muss dafür bezahlen.«
Aber im Großen und Ganzen fand Danny es eigentlich ganz gut, das allererste Mordopfer überhaupt in Salcombe gefunden zu haben. Er freute sich schon darauf, es all seinen Freunden im Camp zu erzählen. Wie cool war das denn?
Erster Teil
26. Juni
1
Lauren Parker
Lauren Parker hatte einen tollen Sommer bitter nötig. Der Winter war furchtbar gewesen. Erstens war es seit Dezember eiskalt, und Lauren hasste Kälte. Wenn sie nach Miami ziehen könnte, würde sie es ohne zu zögern tun – genau wie offenbar alle anderen, die sie kannte. Aber Jasons Firma war in New York, und er musste sich immer mal wieder im Büro blicken lassen. Schließlich war er der Chef. (»Aber warum kannst du als Chef nicht einfach die Ansage machen: ›Ich ziehe nach Florida‹?«, fragte Lauren immer mal wieder. »Im Sommer gehst du doch sowieso nie hin!« Die Antwort darauf bekam sie nie.)
Noch dazu war die Schule ihrer Kinder an der Upper East Side, die Braeburn Academy, in einen Skandal verwickelt, und seit Monaten gab es im Umkreis von zwanzig Blocks kein anderes Gesprächsthema.
Es hatte im Februar damit angefangen, dass der Vorstand der Schule eine anonyme E-Mail über Mr. Whitney bekommen hatte, seit zwanzig Jahren hochgeschätzter Schulleiter. Mr. Whitney war eine Institution an der Braeburn – ein Engländer, Ende sechzig, mit einem Hang zu Fliegen und Füllfederhaltern, der die Schule im Rating von den hinteren Rängen ganz weit nach vorne gebracht hatte. Braeburn war nun erste Wahl für die anspruchsvollsten Eltern in New York City, einschließlich der Parkers, die vor all ihren Freunden damit prahlten, dass Mr. Whitney dem sich allseits vollziehenden sozialen Wandel trotzte.
Deshalb schlug die E-Mail mit den Anschuldigungen auch wie eine Bombe an der Ninety-third Street Ecke Madison ein: Mr. Whitney war nicht der, für den er sich ausgab. Laut des vielfach weitergeleiteten Schreibens war er ein Hochstapler, ein Schulabbrecher sogar, der seine Vita vor zwanzig Jahren gefälscht und die Verwaltung der Braeburn mithilfe dieser Trickserei dazu gebracht hatte, ihn einzustellen. Sie waren also alle einem Betrüger aufgesessen, einem Kerl aus New Jersey, der sich als Engländer ausgab und eine Figur geschaffen hatte, die speziell und auf clevere Weise die Statusversessenheit der übertölpelten Eltern an der Upper East Side ausgenutzt hatte.
Die Geschichte sickerte sogar bis zum New YorkMagazine durch, das daraufhin mit der Story »Wie Francis Whitney New Yorks Oberschicht täuschte« titelte. Lauren und ihre befreundeten Mütter wären am liebsten im Erdboden versunken. Sie alle hatten große Anstrengungen unternommen, um ihren Kindern einen Platz an der Braeburn zu sichern, und pro Kind fünfzigtausend Dollar für dieses Privileg berappt. Dass sich all das nun als Betrug entpuppt hatte, wie der Rest der Privatschulwelt schadenfroh schmunzelte, war ein echter Tiefschlag.
»Ich fass es noch immer nicht, dass uns das passiert ist«, hatte Laurens Freundin Mimi kürzlich geseufzt. Sie hatten sich bei Felice an der Eighty-third Street auf ein Glas Wein getroffen. Mimi war gerade von einer Botox-Auffrischung gekommen, die Stirn übersät von roten Nadeleinstichen. »Ich für meinen Teil möchte keine Sekunde länger darüber reden. Gut, dass wir schon nächste Woche in die Hamptons verschwinden. Wann brecht ihr nach Fire Island auf?«
»Kommenden Samstag«, sagte Lauren. »Jason hatte mit der Firma so viel um die Ohren, dass wir es dieses Jahr nicht früher geschafft haben.«
»Wie läuft es denn bei euch beiden?«, erkundigte sich Mimi und schaute Lauren dabei mit einem Blick an, der, wie sie annahm, wohl »besorgt« wirken sollte, was das Botox jedoch vereitelte. Lauren hatte leichtsinnigerweise einmal bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung nach drei Gläsern Wein auf nüchternen Magen erwähnt, dass Jason sie überhaupt nicht mehr beachtete. Seitdem nervte Mimi sie damit.
Lauren hielt den Blick auf ihr Glas Chardonnay gesenkt. Sie war stets bemüht, das perfekte Bild von stilvoller Ungezwungenheit abzugeben; sich Probleme oder Verletzlichkeiten anmerken zu lassen, war für sie eine Schwäche, die es tunlichst zu meiden galt. Aber dieses Jahr hatte ihr übel mitgespielt, und zum ersten Mal in ihrem Leben fiel es ihr schwer, die Fassade aufrechtzuerhalten. »Gut, gut. Alles super«, erwiderte sie deshalb und wechselte dann schnell das Thema – mit Mimi konnte man zwar viel Spaß haben, aber sie traute ihr keine Handbreit über den Weg. »Ich will dieses Jahr am liebsten einfach abhaken«, fuhr sie fort. »Jetzt will ich nur noch am Strand sitzen, ein Buch lesen und das Wort ›Betrüger‹ nie wieder hören.«
Sie und Jason hatten überlegt, ihre beiden Kinder, Arlo, sieben, und Amelie, fünf, von der Braeburn zu nehmen, aber letztendlich konnte der Vorstand den Ruf der Schule retten, indem man den Schulleiter der Collegiate School, Mr. Wolf, abwarb, einen Veteranen des Bildungswesens, der sowohl Einfluss als auch Integrität mitbrachte. Niemand der Eltern beschwerte sich, dass das Schulgeld erhöht wurde, um Mr. Wolfs exorbitant hohen Gehaltsforderungen nachzukommen. Sie hätten jede Summe aufgebracht, nur damit dieser Albtraum ein Ende hatte. Mittlerweile hatten die Parkers die Anzahlung für das nächste Schuljahr von Arlo und Amelie bereits geleistet, und an der Upper East Side ging alles wieder seinen geregelten Gang.
In der Stadt wurde es langsam wärmer, und die Tulpen an der Park Avenue waren bereits wieder verblüht. Lauren konnte es kaum erwarten, endlich in ihr Strandhaus nach Salcombe auf Fire Island zu kommen, das seit dem Labor Day am 4. September letzten Jahres leer stand. (Salcombe, das nach einer Küstenstadt in England benannt war, wurde »Saul-com« mit stillem »b« und »e« ausgesprochen. Die Einwohner legten Wert auf den kultivierten Klang und machten sich darüber lustig, wenn Fremde es »Sal-com-BE« nannten.) Normalerweise verbrachten die Parkers ab April ihre Wochenenden dort, aber aufgrund einer Flut von Geburtstagsfeiern und Jasons vollem Terminkalender in der Firma waren sie dieses Jahr noch nicht dazu gekommen. In der Woche vor ihrer Ankunft hatte Lauren einen Putztrupp ins Haus geschickt, um alles herzurichten – den Staub eines ganzen Winters loszuwerden, die Fahrradreifen aufzupumpen und die diversen Lieferungen von FreshDirect und Amazon auszupacken sowie ihre Bestellungen – Käse, Oliven und Fleisch – von Agata & Valentina.
Sie würden den ganzen Sommer dort verbringen. Früher hatte sich Jason nur an den Wochenenden zu ihnen gesellt, aber in der neuen Weltordnung konnte jeder remote arbeiten, also würden auch alle Väter vor Ort bleiben (während die Ehefrauen vorgaben, von dieser Entwicklung begeistert zu sein). Die Kinder gingen ins Feriencamp, und Lauren brachte ihre Tage mit ihren Freundinnen auf dem Tennisplatz und am Strand herum – mehr gab es dort eigentlich nicht zu tun. Außerdem nahmen sie für den Sommer ihre Nanny Silvia mit, eine Philippinerin, die drei eigene Kinder großgezogen hatte. Das restliche Jahr arbeitete Silvia immer von acht bis neunzehn Uhr bei ihnen und pendelte dafür von Queens nach Manhattan. Hin und wieder fragte sich Lauren, ob Silvia, die genau die richtige Mischung aus selbstgenügsam und unaufdringlich war, es in Salcombe hasste. Aber sie dort dabeizuhaben, bedeutete für Lauren und Jason, dass sie mit Freunden ausgehen und ihre eigenen Pläne verfolgen konnten und sich nicht mit der lästigen Aufgabe herumschlagen mussten, Frühstück, Mittag- und Abendessen für die Kinder zuzubereiten, nicht mal an den Wochenenden.
In Wahrheit war es nicht Laurens Entscheidung gewesen, ein Haus auf Fire Island zu kaufen. Diese Insel und das Örtchen Salcombe waren Jasons Ding. Sein bester Freund aus Kindertagen, Sam Weinstein, hatte die Sommer von klein auf immer in Salcombe verbracht, und Jason hatte ihn oft monatelang dorthin begleitet. Er gehörte dann zur Familie als Spielkamerad für Sam, das Einzelkind, dessen Eltern sich am laufenden Band trennten und wieder versöhnten. Die Jungs hatten in Salcombe auch eine Gruppe von Freunden, mit denen sie sich herumtrieben, und Sam und Jason nutzten das Haus auch noch, lange nachdem Sams Eltern sich hatten scheiden lassen und getrennte Ferienhäuser in den Hamptons (Sams Vater) und Nantucket (seine Mutter) besaßen. Sam und Jason verbrachten noch als Jugendliche viele Sommer in dem Haus in Salcombe, wo sie als Feriencamp-Betreuer arbeiteten, sich nachts am Strand betranken, segelten und zum Spaß das Familiensegelboot namens Sunfish zum Kentern brachten. Lauren kannte die Geschichten alle.
Zwanzig Jahre später besaß Sam das Haus noch immer, ein Wahnsinnsding mit blauen Schindeln, Aussicht auf die Great South Bay und bestem Sonnenuntergangsblick weit und breit. Er, seine Frau Jen und die drei Kinder Lilly, Ross und Dara zogen im Juni ein und im September wieder aus, genau wie Lauren und Jason. Sam und Jason waren immer noch beste Freunde, obwohl Sam mittlerweile in Westchester County lebte (und zwar in Scarsdale, einem Ort für Karrieristen, aber mit den besten Schulen der Gegend) und Jason und Lauren in New York City. Aber Salcombe blieb ihr besonderer Ort.
Als die Kinder noch ganz klein waren und sich abzeichnete, dass Jason mit seiner Firma richtig Geld verdienen würde, begann er davon zu sprechen, etwas in Salcombe zu kaufen. Lauren hatte ihre Zwanziger praktisch auf Partys in den Hamptons verbracht, und all ihre Freunde hatten nach und nach Strandgrundstücke in East Hampton, Amagansett und Sag Harbor erworben. Sie sträubte sich gegen Jasons Idee, hatte keine Lust, die Sommer über auf Fire Island festzusitzen, wo sie niemanden kannte. Eines Abends, als die Kinder im Bett waren, war es zum offenen Streit darüber gekommen.
»Ich hab das Gefühl, du zwingst mir das auf, und ich will das nicht machen«, hatte Lauren zu ihm gesagt. Das alles lag zwei Wohnungen zurück, in dem bescheidenen Dreizimmerapartment Ecke Eighty-eighth Street und Third Avenue (inzwischen hatten sie fünf Zimmer an der Park Avenue).
»Lauren, hör dir mal selber zu«, hatte Jason ruhig geantwortet. Es ärgerte sie immer, wenn er ihrer Wut mit Beherrschung begegnete. »Ich hab dir gerade gesagt, dass wir uns ein Sommerhaus leisten können! Meine einzige Bitte ist, dass es an dem Ort sein soll, der in der Kindheit mein Ferienparadies war. Die Kinder werden es lieben, da bin ich mir hundertprozentig sicher.«
»Dein Ferienparadies war es ja nun nicht«, hatte Lauren zurückgefaucht. »Sondern Sams; du warst immer nur Gast.«
»Lauren, die Hamptons sind ein Albtraum. Das weißt du. Die Menschenmassen, die überteuerten Restaurants, die Staus bei der Anfahrt. Es ist, als würde man das Schlimmste der Upper East Side nehmen und drei Stunden nach Osten verpflanzen. Vier, wenn man den Long Island Expressway nimmt.«
»Ja, das ist mir bekannt, ich war schon eine Million Mal in den Hamptons. Und ich habe auch schon ein paar Sommer mit dir und Sam und Jen auf Fire Island verbracht. Ich langweile mich da! Was soll ich dort denn den ganzen Tag lang anfangen?«
»Das ergibt sich dann schon«, hatte Jason gesagt. »Du kannst Tennis spielen. Du wirst Freunde finden. Die Leute, die Häuser in Salcombe haben, sind genauso reich und mächtig wie deine Freunde in den Hamptons – sie laufen bloß barfuß rum.«
Lauren hatte gewusst, dass sie den Streit verloren hatte, bevor er überhaupt begonnen hatte. Und ihr war auch bewusst, dass sie sich wie eine verwöhnte Göre benahm. Aber sie hatte endlich Anschluss in ihrer Nachbarschaft gefunden; zu diesem Zeitpunkt war Arlo gerade im Kindergarten der Braeburn und Amelie in der Vorschule der Brick Church. Die Vorstellung, dass alle ihre befreundeten Mütter den Sommer gemeinsam ohne sie verbringen würden, verunsicherte sie und machte sie neidisch, und sie hasste es, dass Jason sie damit nervte. »Du musst aufhören, Dinge zu tun, nur weil alle anderen sie tun«, sagte er, wenn sie darauf bestand, an einen bestimmten Urlaubsort auf St. Barts zu fahren, den begehrtesten Nachhilfelehrer zu engagieren oder dem Golfclub in Westchester beizutreten, dem halb Braeburn angehörte. Nun war Jason selbst nicht gerade ein Rebell. Er war an der Upper East Side aufgewachsen und nach dem College nach New York City zurückgekehrt, er arbeitete im Finanzwesen und trug die gleichen Brooks-Brothers-Hemden wie alle anderen Väter. Wie kam er dazu, sie als Mitläuferin zu bezeichnen? Aber Jason hatte in dem Jahr einen üppigen Bonus bekommen, und damit hatte sich die Diskussion erledigt. Also kauften sie ein wunderschönes zweistöckiges Haus im modernen Stil in Salcombe, direkt am Meer. Lauren tat so, als würde sie sich darüber freuen. Und obwohl sie es nie offen zugeben würde, hatte Jason recht behalten. Mittlerweile liebte sie es dort.
Fire Island war nur ein schmales Stück Land vor der Südküste von Long Island. Eine Barriereinsel, die auf der einen Seite von der Great South Bay und auf der anderen vom Atlantischen Ozean flankiert wurde und sich über ungefähr achtundvierzig Kilometer erstreckte – an ihrer breitesten Stelle, zufällig auf Höhe von Salcombe, maß sie gerade mal knapp einen Kilometer. Überall auf der Insel gab es kleine Ortschaften, von denen Cherry Grove und Fire Island Pines die bekanntesten waren. Und wenn man nicht aus New York stammte, dann kannte man die Insel hauptsächlich als schwule Partyhochburg und wilden Sommerfrischeort für knackige homosexuelle Männer.
Jede Gemeinde auf Fire Island verfügte über ihre eigene Fährverbindung vom Festland aus – die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, weil Autos auf der Insel verboten waren – und über ihren eigenen Charakter. Ocean Beach war ein geschäftiges Städtchen voller Restaurants, Bars und Horden von jungen Leuten in ihren Zwanzigern, die sich Unterkünfte teilten. Point O’Woods war eine exklusive Ortschaft mit großen Anwesen, die von Generation zu Generation weitervererbt wurden. Dann war da noch Salcombe, ein winziger Familienort, in dem hauptsächlich Leute mit jüdischem, angelsächsisch-protestantischem und katholischem Hintergrund wohnten, die Erfolg und eine belesene, zurückhaltende Art verband. Wie der Rest der Insel war auch Salcombe zu neunundneunzig Prozent weiß (Lauren kannte in Salcombe nur einen einzigen Schwarzen, und der hatte, wie sie, dort eingeheiratet).
Salcombe war eine Ortschaft, die aus etwa vierhundert Häusern bestand, einige davon traditionelle Sommerhäuser aus den 1920er Jahren, andere, wie das von Lauren, Neubauten, modern und strandnah, mit offenen Grundrissen und Dachterrassen mit Meerblick. Jeder kannte jeden (und jeder war über die Angelegenheiten der anderen im Bilde). Es gab Achtzigjährige, die seit fünfzig Jahren in Salcombe Ferien machten, deren erwachsene Kinder, die schon ihr ganzes Leben hierherkamen, und die Enkel, die nun die Segelkurse und das Tagescamp besuchten. Man konnte ein kleines Gesicht auf dem Spielplatz sehen und allein an der Form der Nase oder der Stirnlocke erkennen, dass es zur Familie Rapner oder Metzner oder, Gott bewahre, zum bösen Longeran-Clan gehörte. Das Dorf bestand aus einem Netz von Bohlenwegen, die von überall aus zum Strand und zur Bucht führten. Alle fuhren mit dem Fahrrad – meist verrostete, quietschende Dinger –, um an ihr Ziel zu gelangen. Man hatte keine andere Wahl. Mit dem Rad dauerte es von der Bucht auf der einen Seite zum Strand auf der anderen keine fünf Minuten. Da es keine Autos gab, bis auf ein paar kommunale Pick-ups für den Transport von Paketen und Müllsäcken, konnten die Kinder von klein auf frei herumlaufen. Rudel von Sieben- oder Achtjährigen streunten auf eigene Faust herum, besuchten sich gegenseitig mit ihren Fahrrädern oder trugen Angelruten zum Kai, ohne dass ihre Eltern irgendwo in Sicht waren.
In Salcombe gab es genau einen Gemischtwarenladen, einfach nur »der Laden« genannt, in dem man Grundnahrungsmittel und Fertiggerichte kaufen konnte und der etwa das Doppelte von dem verlangte, was man auf dem Festland dafür zahlen würde. Jahrelang hatte der Laden die Bewohner mit seinen unverschämten Preisen in Geiselhaft gehalten, aber jetzt lieferten die großen Supermärkte auf dem Festland bis zur Fähre, sodass man sich zu einem vernünftigen Preis mit Lebensmitteln eindecken konnte, was Lauren und ihresgleichen auch taten. Es gab auch einen kleinen dazugehörigen Spirituosenladen, eine Art Abstellkammer voller Wein und Wodka, für diejenigen, die nicht über so viel Weitblick verfügten, genug Alkohol aus der Stadt mitzubringen. An der Broadway Road, der Hauptpromenade von Salcombe, stand das malerische weiße Rathaus aus Holz mit angrenzender Bibliothek, wo es nach Eiche und Staub roch und man abgegriffene Sommerlektüre und Kinderbücher aus den 1970er und 1980er Jahren ausleihen konnte. Etwas weiter Richtung Strand gab es ein Baseballfeld. Dort stiegen an den Wochenenden passionierte Spiele der Softball-Liga für Erwachsene, und unter der Woche fand dort das Kinderferiencamp statt. Dahinter lag ein kleiner Spielplatz mit einem klapprigen Klettergerüst, das wahrscheinlich nicht den aktuellen Sicherheitsstandards entsprach, und Schaukeln, die bei jedem Stoß ächzten.
Der einzige weitere Gemeinschaftsbereich der Stadt, eigentlich der Treffpunkt überhaupt, war der Salcombe Yacht Club, direkt an der Bucht in Nähe des Fähranlegers gelegen. Die Bezeichnung »Jachtclub« war in Wirklichkeit eine ziemliche Übertreibung. Er bestand aus einem kleinen Jachthafen mit etwa zwanzig Plätzen für Segel- und Motorboote sowie einem schmalen Strandabschnitt für Kajaks und Hobie Cats. Das Hauptgebäude des Jachtclubs auf der anderen Seite des Bohlenwegs sah aus wie ein großes Strandhaus und verfügte über zwei Innenräume: ein Restaurant mit einer Bar im vorderen Teil und ein größerer, offener Bereich im hinteren Teil mit einer kleinen Bühne, einem Billardtisch und genügend Platz zum Herumtollen für Kinder, während ihre Eltern zu Abend aßen. Es gab auch eine Außenterrasse mit Blick über die Bucht, ideal für Drinks bei Sonnenuntergang. Hinterm Haus befanden sich noch fünf Tennisplätze, alle mit Sandbelag, vier davon paarweise nebeneinanderliegend und ein Ausreißer näher am Clubhaus. Alles in allem war es eine unscheinbare Anlage, aber sie passte gut zum Shabby-Chic-Charme von Salcombe. Jeden Abend traf man sich dort auf Drinks und zum Essen, und tagsüber zum Tennis und Tratschen. Es gab Lauren ein gutes Gefühl, ihren Freundinnen in der Stadt erzählen zu können, dass sie den ganzen Sommer über in einem »Jachtclub« ein und aus ging. Sollten sie doch denken, was sie wollten.
Nun, Ende Juni, saß sie endlich auf einer blau gestrichenen Bank an Deck der Fire-Island-Queen-Fähre, die nach Salcombe übersetzte.
In der Woche zuvor war sie vollauf beschäftigt gewesen mit den Abschlussfeiern der Kinder, einem Friseurtermin bei Sally Hershberger, Waxing und Maniküre-Pediküre und hatte sich mit Freundinnen auf den einen oder anderen »Bis September«-Drink getroffen. Die Sonne schien auf die Great South Bay, und in der Ferne zeichnete sich der schwarz-weiße Leuchtturm von Fire Island ab, der die Parkers wieder in ihrem Sommerhaus willkommen hieß. Arlo hockte neben Lauren und spielte auf seinem iPad herum, während Amelie und Jason hinter ihnen saßen. Dann hatte Amelie Myrna, eine ihrer kleinen Freundinnen, entdeckt und darauf bestanden, dass sie sich zusammensetzten. Lauren hörte, wie Myrna und Amelie sich nach Fünfjährigen-Manier über die Namen ihrer Lehrer und ihre Lieblingstiere austauschten.
Lauren spürte, wie die Brise ihren frisch geschnittenen und gesträhnten blonden Bob zerzauste, und schloss hinter ihrer Sonnenbrille von Tom Ford die Augen. Sie hörte, wie Jason Myrnas Vater, Brian Metzner, begrüßte und wie Brian sich auf dem Platz neben Jason niederließ.
»Hey, Kumpel, wie läuft’s bei dir?«, fragte Brian und klopfte Jason zur Begrüßung auf den Rücken.
»Nicht schlecht«, sagte Jason. »Wie war euer Winter so? Habt ihr es dieses Jahr nach Aspen geschafft?«
Brian war ein bulliger Kerl. Seine karierten Hemden spannten am Bauch, und er rasierte sich die Haare ab, seit sie bei ihm mit Mitte zwanzig langsam schütter geworden waren. Er war Hedgefonds-Manager, und ein sehr erfolgreicher dazu. Ganz gleich, wovon er sprach, egal über welches Thema, er packte es in Begriffe aus der Finanzwelt.
»Oh, Mann, ja, wir hatten eine Top-Zeit in Aspen«, sagte Brian. »Erst dachte ich, wir würden nur marginale Erfolge einfahren, vor allem mit Myrna, aber schließlich haben wir sie dazu gebracht, sich richtig zu steigern, und dann hatte sie einen echten Lauf. Am Ende ist sie schwarze Pisten hinuntergesaust. Ihre Performance war mega, Mann.«
»Super«, sagte Jason unbeteiligt. Lauren hörte, wie es ihm vor dem Gespräch grauste, das ihm nun für die Dauer der gesamten Überfahrt blühte. Jason und Sam tolerierten Brian, mochten ihn aber nicht. Sie fragte sich, wo Brians Frau Lisa war. Lauren und Lisa waren befreundet – sie wohnten alle an der Upper East Side –, aber Lisas Kinder gingen auf eine andere Schule (die Horace Mann oben in der Bronx), und so kommunizierten sie im Winter hauptsächlich per Textnachricht, tauschten gelegentlich pikanten Klatsch und Tratsch aus und schickten sich gegenseitig Instagram-Posts, auf denen gemeinsame Bekannte fett oder alt aussahen. Lisa machte gerade eine »Weiterbildung« zum Life Coach, der neue Trendberuf für gelangweilte Hausfrauen und Mütter, die noch vor Kurzem vielleicht auf Interior- oder Handtaschendesignerin gemacht hätten. Lauren fand das lächerlich – welchen Rat könnte Lisa anderen denn schon geben? Reich heiraten? Lauren holte die AirPods aus ihrer Céline-Tasche. Sie würde sich einen True-Crime-Podcast anhören und Brian und Jason ausblenden. Doch bevor sie dazu kam, spürte sie, dass ihr jemand auf die Schulter tippte.
»Lauren, o mein Gott, hi! Ich liebe deine Frisur!«
Zu ihrer Rechten stand Rachel Woolf, schon ewig Ferienhausbesitzerin in Salcombe, die Lauren bei deren erstem Besuch auf der Insel ihre Freundschaft aufgenötigt hatte.
Rachels Familie besaß seit Urzeiten ein Haus in der Nähe des Jachtclubs, und sie hatte es vor ein paar Jahren von ihrer verstorbenen Mutter geerbt (ihr Vater war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als sie gerade mal ein Teenager gewesen war). Rachel war die amtierende Klatschkönigin von Salcombe, und man konnte sich nichts erlauben – ob es nun eine Affäre oder nur ein neuer Tennispartner war –, ohne dass sie davon erfuhr. Sie war zweiundvierzig und immer noch ledig, unfreiwillig, obwohl sie in ihrer Jugend mit halb Salcombe mal etwas gehabt hatte. Lauren vermutete sogar, dass sie irgendwann auch einmal mit Jason geschlafen hatte, aber falls das stimmte, wollte sie es nicht wissen.
Rachel war dünn, fast zu dünn, mit glattem braunem Haar und blauen Kulleraugen. Manche Männer hielten sie für attraktiv, vielleicht weil sie ins Kindchenschema passte, aber Lauren sah das nicht so. Auch wenn sie eigentlich eher nicht mit Rachel befreundet sein wollte, war es unmöglich, ihr aus dem Weg zu gehen. Rachel war auf jeder Party, schmiss viele davon selbst, und man musste sich gut mit ihr stellen, wenn man ein irgendwie geartetes soziales Leben in Salcombe haben wollte. Mit einem Klopfen auf den Platz neben sich bedeutete Lauren Rachel, sich zu setzen.
»Wie war dein Winter?«, erkundigte sich Lauren, als Rachel sich niederließ und ihre L.-L.-Bean-Tasche mit Monogramm unter den Sitz schob. Rachel war peinlich untrendy. »Warst du oft hier draußen?«
Obwohl fast alle Sommerbewohner von Salcombe in New York City lebten, sahen sie sich nur selten abseits der Insel. Die Beziehungen beschränkten sich hauptsächlich auf die Monate Juni bis September, und aufgrund eines unausgesprochenen Pakts beließ man es dabei. Rachel wohnte nur etwa zehn Blocks von Lauren und Jason entfernt in Manhattan, aber dort verkehrte Lauren nie mit ihr. Ihre Freundschaft existierte lediglich in dieser sehr speziellen Blase.
»Gut! Also na ja, okay. Ich war ungefähr sechs Monate lang mit diesem Typen zusammen. Geschieden, Anwalt, zwei Kinder. Aber wir haben uns letzten Monat getrennt. Er wollte nicht noch mal heiraten und, na ja, du weißt ja, wie ich darüber denke«, sagte Rachel.
Das wusste Lauren.
»Was ist mit dir?«, fuhr Rachel fort. »Ich habe da im New York Magazine etwas über die Schule deiner Kinder gelesen. Klingt nach einem wahren Albtraum.«
Lauren erschauderte bei dem Gedanken, dass Braeburns Blamage sogar bis zu der kinderlosen Rachel Woolf durchgedrungen war.
»Allerdings«, sagte Lauren. »Zum Glück liegt das alles hinter uns. Wir haben einen neuen Schulleiter, Mr. Wolf, und die Schule ist jetzt in guten und äußerst renommierten Händen.«
Die Fähre durchpflügte mit schäumendem Kielwasser die Wellen. Die Überfahrt von Bay Shore auf Long Island nach Salcombe dauerte etwa zwanzig Minuten, gerade genug Zeit, um von Stadt- auf Strandmodus umzuschalten. Brian quatschte noch immer von seinem Familien-Skiausflug, und Lauren sah sich nach Amelie um, die zufrieden schwieg, während Myrna belangloses Zeug quasselte. Wie der Vater, so die Tochter.
Rachel warf einen Blick auf ihr Handy, und Lauren glaubte, eine Dating-App zu erkennen – lächelnde Gesichter von Männern –, bevor Rachel es schnell wieder weglegte.
»Bist du viel zum Tennisspielen gekommen?«, fragte Rachel. Sie war sehr ehrgeizig, wenn es um Tennis ging, obwohl sie nicht besonders gut darin war, und wollte immer wissen, wer über den Winter wie viel trainiert hatte. Der Jachtclub veranstaltete alljährlich Doppel-Turniere für seine Mitglieder, und Rachel war jedes Jahr aufs Neue wild entschlossen zu gewinnen. Sie und ihre Tennispartnerin Emily Grobel schafften es in der Regel bis ins Halbfinale oder Finale, bevor sie von einem der stärkeren Teams aus dem Rennen geworfen wurden. Lauren war selbst keine überragende Spielerin, aber sie war auch nicht schlecht. Sie hatte in ihrer Highschool-Mannschaft gespielt und verfügte über eine ordentliche Rückhand und einen hervorragenden Lob. Rachel, die das ganze Jahr über trainierte, verübelte es Lauren insgeheim, dass diese nach Monaten Spielpause zum Schläger greifen und mühelos auf ihrem Niveau spielen konnte.
»Nicht wirklich«, sagte Lauren wahrheitsgemäß. In diesem Jahr hatte sie sich sehr für die Tracy-Anderson-Methode begeistert. Dafür musste sie regelmäßig den Weg in ein Studio in der Innenstadt antreten und hatte deshalb keine Zeit mehr für ihren Tennisclub auf Roosevelt Island gefunden. »Aber ich habe vor, diese Woche gleich ein paar Stunden zu nehmen, um wieder reinzukommen.«
»Es gibt einen neuen Tennislehrer im Club«, sagte Rachel. »Ich habe schon eine Stunde bei ihm genommen, als ich letztes Wochenende hier war. Er heißt Robert und ist total heiß.«
»Wer ist heiß?« Brian beugte sich vor, nachdem er wohl in einer kurzen Pause seines eigenen Monologs etwas von ihrem Gespräch aufgeschnappt hatte.
»Du natürlich, Brian«, sagte Rachel und kicherte. Alle Frauen hassten es, wie sehr Rachel mit ihren Ehemännern flirtete, aber niemand sprach es an.
»Ja, ich habe trainiert, bisschen körperliche Gewinnmaximierung betrieben und in mich selbst investiert«, sagte er. Lauren konnte nicht sagen, ob er bemerkt hatte, dass Rachel ihn aufzog. Brian wandte sich wieder an Jason und lag ihm erneut mit seiner Peloton-Besessenheit in den Ohren.
»Der Tennislehrer ist ein ehemaliger Profi und war vorher in irgendeinem schicken Country Club in Florida beschäftigt. Ich weiß auch nicht so genau, was ihn hierher verschlagen hat, aber er wird auf jeden Fall der Liebling aller Frauen werden«, sagte Rachel. »Außerdem hat er mir schon geholfen, meinen schwachen Aufschlag zu verbessern.« Rachel war für ihren lausigen Aufschlag bekannt.
»Freue mich drauf, ihn kennenzulernen«, sagte Lauren, gelangweilt von dem Gespräch. Warum nervte Rachel sie so sehr? Der Sommer würde lang und zäh werden, wenn sie nicht einmal eine Bootsfahrt mit ihr ertragen konnte. Rachel, die Laurens Desinteresse spürte, warf ihr ein Häppchen Klatsch zu, um sie wieder zu ködern.
»Hast du schon das von den Obermans gehört?« Rachel beugte sich näher zu Lauren und senkte ihre Stimme.
Lauren schüttelte den Kopf.
»Sie trennen sich. Anscheinend hatte Greg eine Affäre mit der Hundesitterin, und Jeanette ist ihm draufgekommen.«
»Mit der Hundesitterin? Wie krass«, sagte Lauren.
»Sie ist auch eine aufstrebende Schauspielerin, glaube ich«, sagte Rachel. »Wie auch immer, Jeanette wird mit den Kindern hier draußen sein, aber Greg muss den Sommer im Exil verbringen. Er ist bemüht, es wieder hinzubiegen, aber Jeanette will nichts davon hören.« Lauren hatte schon immer das Gefühl beschlichen, Jeanette und Greg würden sich insgeheim hassen. Anscheinend hatte sie da recht gehabt.
Die Fähre näherte sich schlingernd dem Anleger von Salcombe. Er ragte etwa hundert Meter aus der Bucht vor und bestand aus denselben Holzplanken wie das Wegenetz der Stadt. Am Ende des Stegs standen eine Reihe von altmodischen Handwagen, die darauf warteten, dass ihre Besitzer sie mit ihrem Sommergepäck beluden. Lauren verspürte Erleichterung. Sie hatte es geschafft.
Sie nahm Arlo das iPad ab (»Mom! Ich war noch nicht fertig!«). Jason half ihr, Amelie und den Rest der Taschen einzusammeln. Der Blick vom Bootsdeck reichte über den gesamten Küstenstrich von Salcombe. Man sah den Strandbereich der Bucht – ein Quadrat aus Sand, überragt von einem Rettungsschwimmerturm, ideal für kleine Kinder, um nach Krabben zu suchen und Schwimmunterricht zwischen Seetang zu nehmen – sowie den Jachtclub und die umliegenden Häuser am Ufer. Leute zogen Wagen hinter sich her oder fuhren mit Fahrrädern herum, und eine kleine Menschenmenge hatte sich versammelt, um die Neuankömmlinge zu begrüßen. Die Szene hätte sich so genauso gut 1960, 1990 oder 2022 abspielen können. Jason sagte, das sei es, was ihm an der Insel am besten gefalle, dieses Gefühl der Zeitlosigkeit, dass sich dort scheinbar nichts veränderte, dass die moderne Welt dort nicht existierte. Lauren war es recht, solange sie schnelles Internet und gutes Satellitenfernsehen hatten.
»Ich veranstalte heute Abend einen kleinen Umtrunk bei mir«, sagte Rachel, als sie von Bord gingen. »Habt ihr Zeit?«
»Klar«, sagte Lauren. »Klingt gut.« Am besten, sie riss das Salcombe-Pflaster mit einem Ruck gleich am ersten Abend ab. Silvia würde mit dem nächsten Schiff kommen, und Lauren musste es irgendwann sowieso hinter sich bringen. Als sie von der Fähre hinaus auf den Steg traten, zerrte Rachel energisch an Laurens Arm.
»Schau! Da ist Robert, der Ex-Tennisprofi«, flüsterte sie Lauren ins Ohr, zu laut, als dass es sonst niemand gehört hätte. Sie drehte Laurens Kopf eigenhändig in Richtung eines Mannes, der in weißem Poloshirt und khakifarbenen Shorts mit zwei Tragetaschen voller Lebensmittel ein Stück entfernt stand. Lauren konnte nur seinen Rücken sehen. Er war ungefähr so groß wie Jason, vielleicht einen Meter achtzig, und hatte kurz geschnittenes hellbraunes Haar. Er bewegte sich mit dem Körperbewusstsein eines Athleten. Lauren fiel auf, wie schön gebräunt seine Beine waren.
Jemand rief zur Begrüßung seinen Namen – Lauren konnte nicht sehen, wer –, und er drehte sich nach der Stimme um. Doch stattdessen traf sein Blick aus tiefblauen Augen den von Lauren. Seine Nase war gerade, und er lächelte mit strahlend weißen Zähnen. Sie wandte sich sofort ab, tat so, als würde sie etwas in ihrer Tasche suchen, und er ging über den Steg in Richtung Jachtclub davon.
»Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass er heiß ist«, sagte Rachel kichernd. »Er kommt heute Abend auch – da können wir mit ihm flirten.« Lauren spürte, wie ihre Wangen rot anliefen. Sie sah Rachel an, verdrehte scherzhaft die Augen und überlegte bereits, was sie anziehen sollte.
2
Robert Heyworth
Robert Heyworth war nicht so reich, wie er aussah. Er war in Tampa, Florida, aufgewachsen, als drittes Kind einer Familie mit drei Jungs, die alle sehr sportlich waren. Sein ältester Bruder Mack hatte Baseball gespielt und es bis in die Minor League geschafft, und sein mittlerer Bruder Charlie war Leichtathlet an der Universität von Florida gewesen. Mack war mittlerweile Bauunternehmer, verheiratet und hatte zwei kleine Töchter, Charlie Hypothekenmakler und ebenfalls verheiratet. Er hatte einen Sohn, und das nächste Kind, ein kleines Mädchen, war gerade unterwegs. Roberts Brüder und ihre Familien lebten noch in Tampa, ganz in der Nähe seiner Mutter, einer pensionierten Lehrerin. Ihr verstorbener Vater, der in seiner Jugend genauso gut ausgesehen hatte wie seine Söhne, war Polizist gewesen. Die Brüder waren alle großartig geraten – groß und schlank, mit blitzenden Augen.
Roberts Ding war Tennis, schon immer gewesen. Ganz in der Nähe seines Elternhauses, eines gepflegten weißen Bungalows mit Palmen davor, hatte es öffentliche Tennisplätze gegeben. Dorthin war er beinahe täglich gegangen und gegen jeden angetreten, der sich ihm anbot. Als er neun Jahre alt war, bemerkte ein Trainer, der dort einen reichen Jungen aus der Gegend unterrichtete, dass Robert über Talent verfügte, und nahm ihn in ein Programm auf, das täglich nach der Schule stattfand. Er gewährte Roberts Eltern einen Preisnachlass, einen ziemlich großen sogar, und von da an wurde Robert vom Tennisstrudel erfasst. Er nahm an USTA-Turnieren im ganzen Bundesstaat teil, zu denen seine Mutter ihn immer brachte. Alle seine Freunde spielten Tennis, genauso wie seine Freundinnen in der Highschool. Im Grunde hatte er nichts anderes im Kopf; abgesehen von Schularbeiten, hin und wieder, und Sex, ständig, beschäftigte ihn nichts anderes als Tennis. Mit siebzehn erreichte er seine persönliche Bestleistung, als er in Florida den dritten Platz in seiner Altersgruppe belegte. Er war gut, ja, aber nicht wirklich gut genug, um ein erfolgreicher Profi zu werden. Seltsamerweise war Robert trotzdem ganz zuversichtlich. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon zu viele Geschichten über routinierte ATP-Spieler gehört, die ihren Lebensunterhalt damit bestritten, bei Tennisturnieren auf der ganzen Welt zu verlieren, als dass er seinen Wunsch nach einem solchen Leben aufgegeben hätte. Er sah Tennis immer als Mittel zum Zweck, als einen Weg, um der Mittelschicht zu entfliehen. Er hielt seine Brüder für dumm, weil sie sich für Leichtathletik und Baseball entschieden hatten (und auch noch aus anderen Gründen); Leute, die Tennis spielten, hatten Geld, und er hatte keinerlei Interesse daran, Polizist zu werden wie sein Vater. Er liebte seine Eltern zwar, fühlte sich seiner Familie jedoch überlegen. Er war so gut aussehend, bewies so viel Talent in seinem Sport und gab für einen Teenager eine wirklich gute Figur ab. Er hatte schon immer das Gefühl gehabt, für etwas Höheres bestimmt zu sein.
Doch als er schließlich seinen Abschluss aus Stanford in der Tasche hatte, lief auch sein Vollstipendium aus, er konnte lediglich eine eher durchwachsene Erfolgsbilanz als Nummer fünf im Einzelspiel vorweisen, und nach seiner kürzlich erfolgten Trennung von Julie Depfee, auf deren gute Beziehungen er immer gesetzt hatte, war er auf einmal ratlos. Was nun? Er kannte nichts anderes als Tennis. Die Väter einiger seiner Tennisfreunde waren einflussreiche Männer in ihren jeweiligen Branchen, die Robert vielleicht einen Einstieg verschaffen könnten, wenn er sie fragen würde. Ansonsten war sein Hauptfach, Geschichte, ein Witz, wenn es um ein lukratives Auskommen für ihn ging. Er hatte geglaubt, Stanford würde seine goldene Eintrittskarte sein, aber er hatte es sich nicht früh genug zunutze gemacht; er hatte den Kopf in den Sand gesteckt und Tennis, Tennis, Tennis gespielt. Und dann war es vorbei. Anscheinend war er ebenso dumm wie seine Brüder. Der Gedanke setzte Robert so zu, dass es wehtat.
Julie hatte er kennengelernt, als sie beide im zweiten Studienjahr waren, und sie waren zwei Jahre lang zusammen gewesen. In dieser Zeit lernte Robert die Art von Reichtum kennen, von der man nichts ahnt, wenn man es sich nicht leisten kann, irgendwo anders als in Disney World Urlaub zu machen. Julies Vater war ein Risikokapitalgeber, der unter anderem bei PayPal, LinkedIn, Yelp und Uber früh eingestiegen war. Julies Familie besaß Häuser in Atherton, den Hamptons und Sun Valley sowie Wohnungen in London und Paris. Sie flogen im Privatjet. Sie hatten Personal. Julie war schön, blond und gertenschlank. Zwar hatte Robert nie Probleme gehabt, an Mädchen heranzukommen – sie liefen ihm in Scharen nach. Und Männer auch. Das lag nicht nur an seinem schönen Gesicht und Körper, er war auch stets gut gelaunt und locker, und er wusste, wie man Menschen ansieht, wirklich ansieht, und zwar so, dass sie dahinschmelzen. Aber selbst er war überrascht gewesen, als Julie es sich zur Aufgabe gemacht hatte, ihn für sich zu gewinnen und sicherzustellen, dass er zu ihr gehörte. Sie spielte in einer ganz anderen Liga.
Die beiden hatten sich auf einer Hausparty kennengelernt, einer der wenigen, die Robert besucht hatte – während der Tennissaison durfte er nicht trinken, also lohnte es sich für ihn kaum auszugehen. Aber sein Mitbewohner Todd hatte ihn hingeschleppt mit dem Versprechen, dass er dort die exklusiven Leute kennenlernen würde, die Rich Kids (in Stanford wimmelte es zwar nur so von Kindern reicher Eltern, aber das waren die wirklich reichen Kids). Julie war mit ihrem Hofstaat da gewesen, Kopien ihrer selbst, aber nicht ganz so hübsch wie sie, und als sie miteinander ins Gespräch kamen, oder besser gesagt, Julie mit ihm ins Gespräch kam, war Robert sofort ihrem Zauber verfallen. In dieser Nacht schliefen sie miteinander in ihrem Zimmer in einem Haus außerhalb des Campus, das um Längen schöner war als Roberts Elternhaus. Von da an waren sie unzertrennlich. Julie besuchte alle Turniere Roberts, und er verbrachte die Ferien und langen Wochenenden bei ihr. Im Sommer wohnten sie im Haus ihrer Eltern in den Hamptons, hingen am Pool herum und gingen mit der Kreditkarte ihres Vaters essen, bis Robert nach Kalifornien zurückmusste, um rechtzeitig wieder mit dem Training zu beginnen.
Robert dachte, dass sie vielleicht eines Tages heiraten würden. Er wusste zwar, dass es eine alberne Idee war, schließlich waren sie erst einundzwanzig, aber er liebte es, mit ihr zusammen zu sein, und was noch wichtiger war, er liebte ihr Leben. Es war so leicht. Er verstand sich mühelos mit ihren Freunden und ihrer Familie. Die meisten von ihnen hatten keine Ahnung, dass er nicht aus wohlhabenden Verhältnissen stammte. Für sie war er ein gut aussehender Tennisspieler aus Stanford; die Leute sahen, was sie sehen wollten. Und Julie gefiel es, dass er aus der Mittelschicht kam. Für sie war das interessant. Allerdings besuchten sie nie gemeinsam seine Familie. Er hätte Julie niemals in diesen kleinen Bungalow mitnehmen können. Das wäre viel zu peinlich gewesen.
Erst gegen Ende des letzten Schuljahres, als ihre Freunde entweder einen Einsteigerjob im Bankwesen oder einen Jura- oder Medizin-Studienplatz ergattert hatten oder von Google oder Apple angeworben wurden, dämmerte es Robert, dass er sich längst über eine Karriere jenseits des Tennis Gedanken hätte machen sollen. Julie hatte vor, nach New York zu gehen und dort ein Praktikum in einer Kunstgalerie zu absolvieren, deren Besitzerin eine Freundin ihrer Mutter war. Sie dachte, dass ihr Vater Robert vielleicht dabei helfen könnte, irgendeinen Job in einem gehobenen Finanzunternehmen zu bekommen, auch wenn Robert für eine solche Position völlig unqualifiziert war.
»Wir können im ersten Jahr zusammen in der Wohnung meiner Eltern leben«, sagte Julie, als sie gerade außerhalb des Campus in einem netten japanischen Lokal Sushi aßen. Wie immer übernahm Julie die Rechnung. Robert hatte erst kurz zuvor ein angespanntes Gespräch mit seinem Vater geführt, der ihn davor gewarnt hatte, sich zu sehr auf seine »reiche Freundin« zu verlassen. Danach hatte er mit einem flauen Gefühl im Magen aufgelegt. Er wusste, dass sein Vater in gewisser Weise recht hatte. Aber er wusste nicht, was er sonst anfangen sollte.
»Ich weiß nicht so recht«, erwiderte Robert auf Julies Vorschlag und beobachtete, wie sie sich ein ganzes Stück pikanten Thunfisch in den zarten Mund steckte. »John Badner geht für ein Jahr nach L.A., um in einem Club Tennis zu unterrichten. Er hat mir gesagt, dass er mir dort einen Job besorgen kann, wenn ich das möchte. Anscheinend trainieren dort viele Stars. Er meinte, er sei bereits gebucht worden, um Ashton Kutcher zu unterrichten.«
Julie starrte ihn entgeistert an, ein Stück Lachs blieb in der Luft hängen. »Ashton Kutcher? Pff. Warum solltest du das tun? Warum kommst du nicht mit mir nach New York und suchst dir einen richtigen Job?«
»Das ist ein richtiger Job«, wehrte Robert ab. »Vielleicht brauche ich die Hilfe deines Vaters ja gar nicht.« Er wusste nicht einmal, warum er das sagte – es entsprach doch gar nicht seinem Gefühl, oder? Aber als er die Worte erst einmal ausgesprochen hatte, war es zu spät, einen Rückzieher zu machen.
Sie verließen das Restaurant niedergeschlagen und hielten sich auf dem Weg zurück zu Julies Haus außerhalb des Campus nicht an den Händen. Eine Kluft hatte sich zwischen ihnen aufgetan, und Robert war sich ziemlich sicher, dass sie nicht mehr verschwinden würde.
An dieses Gespräch musste er zurückdenken, als er auf dem Oberdeck der Fähre nach Salcombe saß, dem verschlafenen Strandort auf Fire Island, wo er diesen Sommer arbeiten würde. Vor elf Jahren hatte er sich von Julie getrennt und war John Badner nach Los Angeles gefolgt, um als Profi im Brentwood Country Club zu unterrichten. Er blieb acht Jahre lang in L.A., und zu seinen Kunden zählten regelmäßig Schauspieler, Regisseure und namhafte Agenten. Er verdiente dort auch gutes Geld, sogar verdammt viel Geld für seine Verhältnisse, ein paar Hunderttausend im Jahr. Seine Eltern hatten nicht einmal zusammen so viel verdient. Und er besserte sein Gehalt sogar noch auf, indem er die Sprösslinge der Berühmtheiten privat unterrichtete, meist verwöhnte Gören, die beim besten Willen keine ordentliche Vorhand schlagen konnten, aber dessen ungeachtet auf wunderschönen Privatplätzen spielten. Die Frauen in L.A. waren schön und verfügbar, und er verbrachte seine Zwanziger damit, mit vielen von ihnen zu schlafen. Darunter waren sowohl die erwachsenen Töchter seiner Kunden als auch aufstrebende Schauspielerinnen, die im Club als Servicepersonal arbeiteten, aber auch die perfekt manikürten, wohlhabenden Frauen in den Dreißigern, die im Doppel spielten und von ihren älteren Ehemännern ignoriert wurden.
Er wohnte mit John in einem kleinen Bungalow in den Hügeln über L.A., und entweder waren sie am Arbeiten oder am Feiern. Hin und wieder wurde Robert von der Befürchtung heimgesucht, dass er »sein Potenzial nicht ausschöpfte«, wie seine Mutter es auszudrücken pflegte. Dann vermisste er Julie und ihr schickes Leben in New York zwischen all den Kunstsnobs und Finanzbossen. Er wollte doch nicht wirklich für den Rest seines Lebens ein Tennislehrer sein, oder?
Dann, als er neunundzwanzig war, wurde sein Vater plötzlich krank. Lungenkrebs im vierten Stadium, weil er sein ganzes gottverdammtes Leben lang Marlboro Reds geraucht hatte. Da fühlte sich alles plötzlich nicht mehr ganz so spaßig an. In L.A. herrschte außerdem zu viel Wettbewerb, und der Verkehr war nervtötend. Inzwischen war er seit acht Jahren im Brentwood Country Club als Tennislehrer tätig, und es gab dort nichts mehr für ihn zu erreichen – in gewisser Weise hatte er seinen Höhepunkt überschritten, es sei denn, er hätte der Chef des Tennisclubs werden wollen, um sich dann um den ganzen Verwaltungskram zu kümmern, aber das war nicht sein Ding.
Also kündigte er auf Drängen seiner Mutter und wider besseres Wissen kurzerhand und zog zurück nach Florida. Seine Kunden waren am Boden zerstört; sie hatten ihn allesamt angefleht zu bleiben, und ihm sogar mehr Geld geboten, damit er ihnen weiterhin Aufschlag, Volley und einhändige Rückhand beibrachte. Aber Robert war nach Hause zurückgekehrt. Nur wenige Wochen später starb sein Vater, schnell, verdammt schnell, und er blieb bei seiner Mutter und half ihr im Haushalt und beim Trauern.
Nach ein paar Monaten wurde es ihm jedoch langweilig. Dieses Leben war nichts für ihn. Er war es gewohnt, von gut aussehenden, wohlhabenden Menschen umgeben zu sein, und Tampa war voller Verlierer. Sein ältester Bruder Mack bot ihm einen Job in seinem Bauunternehmen an, einen Bürojob, bei dem er Papierkram erledigen und sich mit komplizierten und oft dubiosen Genehmigungsverfahren herumschlagen müsste. Seine Mutter bat ihn inständig, den Job anzunehmen, sich ein kleines Haus in der Nähe zu suchen und sich dort ein Leben mit ihnen aufzubauen. Er war gerade dreißig geworden; er solle doch langsam sesshaft werden, eine Frau finden und ein Kind bekommen.
Er hatte in Stanford studiert, verdammte Scheiße. Das fühlte sich alles total falsch an.
Aber Robert versuchte es dennoch, er versuchte es wirklich. Hauptsächlich, weil er keine besseren Optionen sah. Er stand jeden Tag auf und ging in Macks Firma, erledigte Papierkram, nahm Telefonate entgegen und schrieb E-Mails. Er mietete sich ein Apartment in einem Wohnkomplex zehn Minuten von seinem Elternhaus entfernt. Er fand es unerträglich. Er vermisste Tennis, er vermisste es, mit wichtigen, einflussreichen Leuten zu plaudern, und ihm fehlten die Blicke, die er immer von all den Frauen geerntet hatte.
Doch Robert zog es zwei lange, deprimierende Jahre lang durch – bis er mit zweiunddreißig einen Zusammenbruch erlitt. Er hatte etwas Geld – im Grunde seine gesamten Ersparnisse aus Brentwood – in ein Unternehmen investiert, das ihm sein Freund Todd Anderson aus Stanford empfohlen hatte, ein Start-up, das online Lebensversicherungen an Millennials vermittelte. »Eine Lizenz zum Gelddrucken«, hatte Todd ihm versichert. Todd lebte in San Francisco und arbeitete bei Facebook. Er hatte jede Menge Geld zu verplempern. Doch das Unternehmen, Lyfe, ging pleite. Wie sich herausstellte, hatte der CEO das beschaffte Kapital dazu verwendet, seine mehr als kostspielige OnlyFans-Sucht zu finanzieren, die offenbar darin bestand, dass er Frauen verrückte Summen zahlte, um sich von ihnen online beschimpfen zu lassen. Robert hatte alles verloren. Er hatte nichts mehr, was er für seine jahrelange Arbeit hätte vorweisen können, nur noch sein Gehalt von Mack, das alle zwei Wochen auf seinem Konto eintrudelte und ihn vor der Zwangsräumung bewahrte. Seine Mutter bot ihm an, ihm etwas Geld zu leihen, aber allein bei dem Gedanken hätte er sich am liebsten umgebracht. Stattdessen reizte er seine Kreditkarten bis zum Anschlag aus, um seine monatlichen Rechnungen zu begleichen, und teilte seiner Mutter und Mack schließlich mit, dass er seine Stelle bei der Baufirma kündigen und wieder als Tennislehrer arbeiten würde. Er gehörte dort einfach nicht hin.
Er fand auch schnell einen Job im Boca Country Club in Boca Raton. Der Club war nicht so schickimicki wie Brentwood – eher graue Eminenz als junger Hollywoodstar. Er blieb anderthalb Jahre dort und bewohnte ein Zimmer auf dem Gelände – der Tenniskomplex gehörte zum Waldorf Astoria, und den Angestellten wurden noble Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Dort atmete Robert endlich wieder auf. Er begann eine Affäre mit Taylor, einer der Kellnerinnen, die sich mit dieser Arbeit ihr Jurastudium finanzierte. Sie war superheiß und sehr abenteuerlustig im Bett. Aber er hatte immer das Gefühl, dass sich ein besseres Leben am Horizont für ihn abzeichnete. Ab und zu dachte er noch an Julie, die mittlerweile mit irgendeinem Hedgefonds-Typen verheiratet war und ihre Zeit zwischen ihrem Stadthaus im West Village neben Sarah Jessica Parker und einem Anwesen neben Tory Burch in Southampton aufteilte.
Er war an einen neuen Kunden namens Morty Friedman geraten, einen Investmentbanker im Ruhestand, der in den Achtzigerjahren einen Haufen Geld verdient hatte. Morty war ein miserabler Tennisspieler, er traf kaum den Ball, aber er liebte das Spiel und buchte Robert fast jeden Tag. Sie freundeten sich an, und Morty kümmerte sich väterlich um Robert und gab ihm während der Trinkpausen ungefragt Lebensratschläge.
»Du musst an die Ostküste, mein Sohn, wenn du es im Leben zu etwas bringen willst. Dort kannst du Leute mit Connections kennenlernen und in New York etwas Spannendes für dich finden. Du warst in Stanford! Du bist begabt, gut aussehend, klug. Florida ist eine Einöde. Ich werde dir helfen, dort etwas zu finden, das du als Sprungbrett nutzen kannst.«
Robert nickte höflich dazu. Ihm hatten schon viele Leute irgendwelche Versprechungen gemacht, aber aus Erfahrung wusste er, dass nur wenige sie auch wirklich hielten.
Doch bei Morty war das anders, und zwei Wochen später, vor Beginn einer besonders sinnlosen Rückhandstunde, machte er Robert einen Vorschlag.
»Hast du schon mal von Fire Island gehört?«, fragte er ihn. Er hatte lockiges grau meliertes Haar und große braune Augen hinter einer Metallgestellbrille.
»Ich glaube schon – das ist doch diese Schwuleninsel«, erwiderte Robert.
»Nein, nein«, entgegnete Morty. »Also, es gibt dort schon ein paar schwule Orte. Aber hauptsächlich kommen da Familien aus New York City hin. Leute wie in den Hamptons, nur etwas schrulliger. Es gibt dort ein kleines Städtchen namens Salcombe, in dem einer meiner früheren Partner ein Haus hat. Er hat mir erzählt, dass sie jemanden suchen, der das Tennisprogramm in ihrem kleinen Jachtclub leitet. Es ist nichts Nobles, aber die Gemeinde dort ist sehr tennisbegeistert, und sie sind bereit, viel Geld zu zahlen für jemanden, der ihren Tennisclub auf Vordermann bringt. Ich denke, so um die Hunderttausend für den Sommer, plus eine prozentuale Beteiligung am Erlös aller Privatstunden.«
Hunderttausend Dollar für drei Monate Arbeit? Damit könnte er seine Schulden abbezahlen und noch einiges mehr. Für Robert hörte sich das ziemlich gut an. Zu gut.
»Und wo ist dabei der Haken?«, fragte er Morty.
»Gute Frage«, entgegnete dieser. »Larry Higgins, mein ehemaliger Partner, ist ein netter Kerl. Seine ganze Familie fährt schon seit Jahrzehnten auf die Insel. Ich glaube, sie hatten bloß Schwierigkeiten mit dem letzten Tennislehrer – er hatte ein Alkoholproblem oder so. Wie auch immer, ich werde dich mit Larry in Kontakt bringen, in Ordnung?«
Robert nickte. »Und jetzt los, alter Mann, lass uns ein paar Bälle schlagen«, rief er und betrat den Platz, während ihm die Sonne Floridas unbarmherzig auf den bloßen Nacken brannte.
Er bekam den Job. Er bekam immer den Job. Taylor wollte eigentlich mit ihm kommen, aber er beendete es noch vor seinem Umzug. Er brauchte einen richtigen Neuanfang im Staat New York und hatte nicht vor, eine Freundin – eine Kellnerin – für den Sommer in diesen Strandort mitzunehmen. Der Jachtclub brachte ihn in einem kleinen Haus in der Nähe des Dorfspielplatzes unter, einem schäbigen Zweizimmerbungalow mit Ameisen in der Küche und einem Deckenventilator, der durchs ganze Haus ratterte. Dort wohnten die jeweiligen Tennislehrer jeden Sommer, und es fanden sich auch noch Überreste des früheren Bewohners, Dave, des Ex-Profis, dessen Alkoholproblem ihn diese bequeme Stelle gekostet hatte. Robert hatte ein gelb gestreiftes Strandtuch, ein Paar Nike-Shorts und eine alte Flasche Gin unter dem Waschbecken gefunden.
Er war bereits seit einer Woche in Salcombe und hatte die Insel erst einmal verlassen, um in Bay Shore Lebensmittel einzukaufen. Die Sachen im »Laden«, wie die Dorfbewohner das einzige Lebensmittelgeschäft vor Ort nannten, waren so überteuert, dass es Robert den Atem verschlagen hatte. Zehn Dollar für einen halben Liter Milch?
Als Robert nun auf dem Rückweg seiner Besorgungsfahrt wieder an Deck der Fähre nach Fire Island saß, erzählte ihm Larry Higgins, Mortys ehemaliger Partner und Leiter des Jachtclub-Tenniskomitees von Salcombe – offenbar eine angesehene Position in der örtlichen Hierarchie –, dass Dave während einer Gruppenstunde für Senioren dabei erwischt worden war, wie er Wodka aus seiner Wasserflasche trank. Daraufhin war er anonym – vermutlich von jemandem auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen ihn – angeschwärzt worden, und zwar bei Susan Steinhagen, der Frau, die das Tennisprogramm für die Mitglieder überwachte.
»Du hättest sehen sollen, wie wütend Susan war«, sagte Larry. »Ihr Kopf ist fast explodiert. Beim gemischten Doppel-Turnier machte sie ihn vor allen Leuten zur Schnecke. Ein Riesendrama, das die Stadt in Atem hielt.« Larry hatte eine schlaksige Statur und ausdrucksstarke buschige weiße Augenbrauen, die Robert an Pappelflaum erinnerten. Er war derjenige gewesen, der Robert eingestellt hatte, und dafür schätzte Robert ihn sehr. Nach dem Zwischenfall war sein Vorgänger Dave aufgefordert worden, sofort zu gehen, erzählte Larry weiter, und Susan hatte ihn vor aller Augen hinausgezerrt wie einen Schwerverbrecher.
Robert hatte diese Woche bereits das Vergnügen gehabt, Susan persönlich kennenzulernen. Sie war auf dem Platz vorbeigekommen, um sich vorzustellen und über das bevorstehende Rundenturnier zu sprechen. Sie war etwa Mitte siebzig, schätzte er, eine ehemalige Professorin für Rechnungswesen, die jetzt ihre ganze kinetische Energie darauf verwendete, dafür zu sorgen, dass die Tennisprogramme von Salcombe reibungslos abliefen (wie auch dafür, dass jeder wusste, wer hier das Sagen hatte). Sie war winzig, höchstens einen Meter sechzig, mit pergamentartiger Haut und großer Nase. Robert hatte noch nie jemanden kennengelernt, dessen Stimme eine solche Resonanz hatte. Sie schüchterte ihn ein wenig ein, und die Geschichte mit Dave verstärkte dieses Gefühl noch.





























