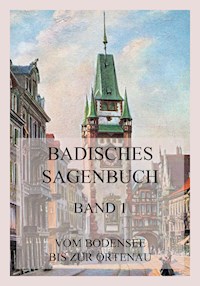
Badisches Sagenbuch, Band 1 E-Book
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In zwei Bänden, auf über 950 Seiten, hat August Schnezler eine Sammlung der schönsten Sagen, Geschichten, Märchen und Legenden des Badnerlandes aus Schrifturkunden, dem Mund des Volkes und der Dichter zusammengetragen. Das Ganze wurde versehen mit sehr vielen Fußnoten als historische und erklärende Anmerkungen und ergibt so ein für an Mythologie und Geschichte interessierten Lesern kaum mehr wegzudenkendes Referenzwerk – wobei sich das Land Baden an den Mitte des 19. Jahrhunderts gültigen Grenzen definiert. Insofern geht die märchenhaftes Reise vom Bodensee über Linzgau und Hegau, Rheintal, Albgau und die Waldstädte ins Breisgau und Kinzigtal, (Band 1) und von dort durch die Ortenau, das Renchtal, das Achertal, den Mummelsee, Bühl, Baden-Baden, das Murgtal, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg bis ins Neckar- und Maintal nach Wertheim (Band 2). Entdecken Sie viele, viele Hundert bezaubernde Sagen und Geschichten, die dieses wunderschöne "Ländchen in Gottes Hand" ausmachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Badisches Sagenbuch
Band 1: Vom Bodensee bis zur Ortenau
AUGUST SCHNEZLER (HRSG.)
Badisches Sagenbuch Band 1
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662370
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort des Herausgebers. 1
Baden. 4
Vorspiel. 7
Einleitung. 10
Entwicklungsbild der heimischen Sagenwelt. 10
Der Bodensee. 17
Die Schöpfung des Bodensees. 17
Die Prinzessin vom Bodensee.[1] 20
Conradin am See.[1] 23
Der Reiter und der Bodensee.[1] 27
Graf Gero von Montfort.[1] 29
Tegelstein. 31
Konstanzs Ursprung. 32
Der heilige Conrad und die Giftspinne. 33
Die Hand an Christi Nase. 34
Eine Wundergeschichte von vier Gerbern. 35
Eine ander Geschicht zuo Costanz beschechen. 35
Zur Geschichte der Judenverfolgung in Konstanz. 35
Am Rhein bei Konstanz. 36
Kaisers Wort, Gottes Wort.[1] 37
Johann Huß. 40
Johannes Huß. 42
Dr. Speth über Huß’ Ende. 45
Ein merkwürdiger Zweikampf 46
als Gottesurteil in Konstanz. 46
Der Fleischer von Konstanz.[1] 47
Ein hübsch Lied, genannt der Striegel, gar lustig zu singen und zu lesen in des Lindenschmidts Ton. 49
Die Jungfrau Maria, als Schützerin von Konstanz. 51
Ein Wogengrab. 52
Des Fischers Haus.[1] 53
Insel Mainau. 55
Die Maid von Bodman. 56
Das Kruzifix bei der Mainau. 62
Insel Reichenau. 62
Radolfzells Ursprung. 62
Einer wundertätigen Nonne wird das Handwerk gelegt. 63
Die Meeresburg.[1] 64
Johannes Heuglin in Meersburg. 66
Benno von Kirchberg.[1] 67
Überlingen. 68
Die Heidenhöhlen bei Überlingen. 70
Das Märchen von den sieben Schwaben. 71
Schwäbische Tafelrunde.[1] 75
Der schwäbische Heiland. 77
Über die Benennung „Seehasen.“. 77
Überlinger Judenmord. 78
Der kupferne Kessel zu Bodman.[1] 78
Entstehung der Burg Bodman. 81
Karl der Dicke zu Bodman. 82
Überraschende Hochzeit zu Bodman. 82
Linzgau. 83
Der rettende Brotlaib. 83
Viel Uebel um Äpfel. 84
Der in eine Wildgans verwandelte Gastwirt. 85
Das große Fass im Klosterkeller von Salem. 85
Vom großen Fass zu Salmannsweiler. 86
Hegau. 90
Sängergruß an Hohentwiel.[1] 90
Hohenkrähen. 94
Poppele von Hohenkrähen. 94
Die Zerstörung von Hohenkrähen. 95
Erste Sage. 95
Andere Sage. 97
Hohenfels. 101
Burg Randecks Fall. 101
Nellenburg. 102
Blumenfeld. Ein Seitenstück zur Weinsberger Weibertreu. 102
Rheintal 104
Der Gnom des Rheinfalls. 104
Stiftung des Klosters Allerheiligen bei Schaffhausen. 105
Das Fräulein von Randenburg. 106
Klettgau. 107
Der Alpenpfeifer. 107
Der letzte Küssaberger. 107
Die Burgfrau von Balm. 109
Tiengen. Ein freier Mann. 110
Albgau. 111
Vom Bauernkrieg. 111
Der kühne Sprung. 111
Gespenst bei Schwaningen. 112
Das Bonndorfer Glöckchen. 112
Die Frau von Weissenburg.[1] 114
Das Waldshuter Männlein. 115
Der Albkönig. 117
Die Kaisertanne im Schwarzwald.[1] 118
Die Brüder an der Alb. 120
St. Blasiens Reichtum. 122
Die dankbare Schlange. 122
Die rächende Hand. 122
Reiter ohne Kopf. 123
Gründung der Kirche im Todtmoos. 123
Gründung des Klosters Neuenzell. 125
Die Nixen vom Schluchsee auf der Hochzeit. 128
Der Hauenstein. 130
Die Burgfrau von Hauenstein. 131
Waldstädte und Umgebung. 136
Die Sage vom Schloss Wieladingen. 136
Hans zu der Gige. 137
Tänze auf Kreuzwegen. 138
Der Karsauer Wein.[1] 138
Die Wölfe.[1] 139
Der feurige Mann. 141
Der Schatz bei der Brunnenstube. 142
Der sich sonnende Schatz. 142
Der gespenstische Pfaff. 143
Der heilige Fridolin. 143
Fridolin. 145
Der tote Zeuge. 147
St. Fridolin und der Tote. 148
Der Breisgau. 152
Der Höllenhacken.[1] 152
Das Breisgau. 155
Die Wiese. 156
Die wunderbare Harfe. 163
Der wilde Jäger. 164
Die Irrlichter. 165
Der Fischer an der Wiese. 167
Der Schütze von Schopfheim. 171
Lörrachs Ursprung. 174
Burg Rötteln. 174
Riedligers Tochter. 176
Die Häfnet-Jungfrau. 179
Der Statthalter von Schopfheim. 182
Auf der Hebelshöhe bei Schopfheim. 188
Dorf Eichen und sein See. 190
Der Eichener See. 191
Der Lütplager. 193
Die Erdmannshöhle bei Hasel. 193
Die Erdmannshöhle. 195
Die gestörten Schatzgräber. 203
Eichsel, Amt Schopfheim. 203
Nonnenmattweiher.[1] 204
Schönau. 205
Der Wasserfall bei Todtnauberg. 206
Das Gespenst an der Kanderer Straße. 208
Istein.[1] 209
Bürgeln. 211
Sitzenkirch. 213
Eine der Ottiliensage verwandte Legende von Sitzenkirch. 213
Die Unterhaltung bei dem Judengalgen nächst Müllheim.[1] 214
Der Hausgeist Rüdy. 218
Der Ruedi. 219
Badenweiler. 226
Badenweiler. 228
Die Römerbäder zu Badenweiler.[1] 230
St. Trutbert im Münstertal.[1] 231
Schloss Staufen. 232
Dem Kaiserstuhl.[1] 233
Der Kellermeister und seine Frau. 234
Neun Linden.[1] 236
Die Katharinakapelle.[1] 238
Auf dem Hexenberge am Kaiserstuhl. 238
Der verräterische Kuchen. 240
Die Teufelsburg. 240
Das Brünnlein zu Bickensohl. 242
Das Brautbrünnlein, oder Hochmut kommt zu Fall. 243
Limpurg. 244
Wie Eckart von Breisach Dietrichen zu Hilfe ritt. 245
Der getreue Eckart. 249
Peter von Hagenbachs Ende.[1] 259
Ritter Peter von Hagenbach. 262
Wolfdieterich’s Buße in Burkheim.[1] 266
Die Silberglocke. 268
Die Glocke auf Lichteneck. 268
Das Christglöckchen. 269
Enderlins Grab. 272
Die Geschichte von der Frau Demut und von der Frau Hurrle. 272
Schloss Hachberg. 282
Der Ritter von Schwarzenberg. 283
Der Hirtenknabe am Kandel.[1] 287
Suckental. 290
Sage vom Suckental. 292
Von dem Ursprung der Hertzogen von Zeringen. 293
Zähringen’s Ursprung. 294
Ein Totenbaum.[1] 296
Ausgang des Hauses Zähringen. 297
Der versteinerte Herzog. 298
Friedrich von Baden.[1] 300
Freiburg. 304
Das Münster zu Freiburg.[1] 304
Der Herzog von Zähringen und der Herr von Kyburg. 306
Das goldene Kegelspiel auf dem Schlossberg. 306
Die Burgfrau. 306
Der unterirdische Gang in das Münster. 307
Der Brunnen mit dem Männlein. 307
Das Männlein am Geisbrunnen. 308
Drei Kirchlein unter einem Dach. 308
Konrads von Würzburg Tod.[1] 308
Berthold Schwarz.[1] 312
Der Fleischer von Freiburg. 315
„Heute Herr von Freiburg und nimmermehr!“. 315
Der böse Pfenning. 316
Die Totenglocke. 317
Der Fliegenwedel. 317
Hans Steutlinger. 317
Das Nonnenbild am Freiburger Münsterchor. 319
Jesuitentheater zu Freiburg. 320
Die Gebeine des heiligen Alexander. 320
Freiherr von Fahnenberg. 321
Sankt Loretto. 322
Der Kanonier von Freiburg.323
Güntherstal. 324
St. Ottilien. 325
Ottilie. 326
St. Ottilien. 329
Der Venusberg bei Ufhausen.[2] 330
Das Hexentälchen. 331
Der Springbrunnen zu St. Ulrich. 332
Die Dreisam. 333
Das Burgfräulein auf Wiesneck. 333
Himmelreich und Hölle.[1] 337
Herr von Falkenstein. 339
Sagen von der Burg Falkenstein. 340
Der Schwarzwald. 350
Der Schwarzwald - Ein Nachtstück. 352
Geisterbesuch auf dem Feldberg.[1] 354
Die Kinder im Stollenbach. 358
Feldberg. Der Jäger. 359
Feldsee. 360
Titisee.[1] 361
Sagen aus der Baar.[1] 362
Das Kolmen-Weibchen. 362
Das Jungfrauenkirchlein zu Vöhrenbach. 364
Die Entstehung der Wallfahrtskirche in Triberg. 365
Die sieben Höfe im Rittiswald. 366
Die Glocke zu St. Georgen. 366
Villinger Sagen.[1] 367
Das wilde Feuer. 367
Romeias, der Villinger Simson. 369
Das Rad auf dem Villinger Rathaus. 372
Der zauberische Pater. 372
Die Kreuzvögel. 373
Ruchtraut von Allmendshofen und die Kirche von Mistelbrunn. 373
Das Gespenst in Donaueschingen. 376
Der böse Graf von Neufürstenberg und der Esel im Wappen der Stadt Vöhrenbach. 377
Die Kreuzkapelle in Geisingen. 378
Die Schächerkatze. 379
Das Deckrischen-Elsele bei Hüfingen. 380
Das weiße Fräulein von Kallenberg. 381
Der Schwede zu Wildenstein. 382
Kinzigtal und Seitentäler 384
Wie der Teufel und ein Weib miteinander das Städtlein Schiltach verbrennen.[1] 384
Das Bergmännlein. 387
Burg Falkenstein im Schappacher Tal.[1] 387
Der Schlangenhof im Schappacher Tal. 388
Warnungszeichen. 390
Vom Seewenhof bei Rippoldsau. 390
Die Schwedenschanze.[1] 390
Spuk und Schatz. 392
Der weiße Mann und der Bauer. 393
Der Teufelsstein. 393
Sagen von Benau. 394
Hornberg im Gutachtal. 395
Das Felsenfräulein[1] bei Hornberg. 395
Das Hornberger Schießen. 397
Die seltsame Fahrt. 398
Das Geistermädchen. 398
Sagen vom Hausacher Schloss. 399
St. Gallus im Harmersbacher Tal. 399
Gengenbach durch einen Kanarienvogel vom Brande gerettet. 400
Vorwort des Herausgebers.
Ihr Entschluss, die mythischen und historischen Sagen des Badischen Landes, wie dieselben teils noch im Munde des Volkes fortleben, teils in metrischer und prosaischer Form von zahlreichen Schriftstellern dargestellt, teils in alten Chroniken, Kirchenbüchern und neueren Geschichtswerken etc. zerstreut sind, in eine geordnete Sammlung zu bringen und herauszugeben, wurde zunächst durch das Erscheinen des großen “Oberrheinischen Sagenbuches“, von August Stöber, (Straßburg, 1842. Verlag von J. Schuler.) hervorgerufen. War nun in diesem Werke der reiche Sagenschatz der einen Hälfte des Oberrheinischen Stromgebietes, des, seinen Stammwurzeln und Hauptzweigen nach, uns Deutschen noch immer geistig verbrüderten Elsasses, in ziemlicher Vollständigkeit durch seine und auswärtige Dichter herauf gefördert und in bunterlei rhythmischer Fassung vor den Augen der Lesewelt passend geordnet aufgereiht, – so musste wohl das Verlangen rege werden, auch die andere Hälfte dieses unvergleichlichen Tales, unser mit romantischen Reizen so gesegnetes Baden, im vollen Märchen-Zauberglanze seines allmählich aufgedeckten und zu Tage geschürften Sagenhortes leuchten und mit seinem transrhenanischen Nachbarn darin wetteifern zu sehen.
Bereits vor längerer Zeit aber war von den achtungswertesten Stimmen in einheimischen Zeitschriften, u. A. auch von Aloys Schreiber in der „Badischen Wochenschrift“ (1807), der Wunsch laut geworden, es möchte sich recht bald eine kundige Hand der Sammlung unserer Volkssagen unterziehen, ehe dieselben mit der älteren Generation, in deren Munde sie noch großenteils fortleben, zu Grabe sinken, oder von den politischen Stürmen neuerer Zeiten verweht, von den Lebensinteressen moderner Zustände verdrängt werden; eine Besorgnis, die auch mehrere Schriftsteller anderer deutschen Landesteile angetrieben zu haben scheint, die Sagen ihrer Heimat zu sammeln und durch den Druck vor dem Untergange zu retten. So erhielten wir, nach dem Vorgange von G. Grimms “Deutschen Sagen“, seit dem letzten Jahrzehnt eine schon bedeutende Anzahl von Sagensammlungen aus verschiedener Herren Ländern; von L. Bechstein und von J. R. Vogl sind Österreichs Sagen erschienen; Ersterer hat, außer diesen und seinem „deutschen Märchenbuche“ sich durch Herausgabe des „Türingischen Sagenschatzes“, ferner des von Franken, verdient gemacht; von Tettau und Temme wurden wir mit Preußens Volkssagen, von W. Ziehnert mit denen Sachsens, von Uhland, G. Schwab, J. Scherr etc. mit den schönsten Sagen Schwabens beschenkt, und erst neulich trat K. Müllenhoff mit denen von Schleswig-Holstein-Lauenburg, und Henninger mit den „Sagen und Geschichten von Nassau“, hervor. Sollte nun Baden, der schönste Garten unter deutschem Himmelsstriche, nicht auch seinen üppigen Sagenflor entfalten? einen Flor, in dessen Knospen eine Menge der schönsten Märchen und Legenden, die sich im übrigen Deutschland vorfinden, ja die bedeutendsten derselben, wie z. B. die vom treuen Eckart, vom Tannhäuser, vom wilden Heer, von der Melusine, der weißen Frau etc. im anmutigsten, nur mehr dem südlichen Lokal und Leben angepassten, Gewande sich wiederholen.
Der Erste, welcher Badische Sagen bei uns sammelte, war der verstorbene Oberst Medicus; eine schriftliche Sammlung derselben aus dem Munde des Volles von seiner Hand soll sich im Besitze S. K. H. des Großherzogs befinden. Herr Archivdirektor Mone veröffentlichte in seinem „Anzeiger für die Kunde der deutschen Vorzeit etc.“ und, in derselben Zeitschrift, Herr Finanzrat Bernh. Baader da hier, eine bedeutende Serie solcher Sagen; Aloys Schreiber gab eine ansehnliche Folge derselben in eigenen, zum Teil sehr gelungenen, novellistischen und metrischen Rahmen, in seinen „Sagen des Rheines, der Vogesen und des Schwarzwalds etc.,“ ferner in seinen „Sagen von Baden-Baden und der Umgegend,“ und in verschiedenen Zeitschriften und Almanachen; der treffliche Altertumsforscher Dr. Heinrich Schreiber in Freiburg bearbeitete mehrere der schönsten Oberländischen Volkssagen auf musterhafte Weise; dieselben bilden eine Hauptzierde unseres Buches. K. Simrock und K. Seib in ihren „Rheinsagen etc.“ mehrten den Vorrat durch manche neuen Beiträge aus dem Munde deutscher Dichter; in neuester Zeit erschienen die „Sagen der Pfalz, der Bergstraße und des Odenwaldes“ von Cand. jur. Bader, und das Werkchen von Eduard Brauer: „Sagen und Geschichten der Stadt Baden und ihrer Umgebung etc. in poetischem Gewande;“ lauter schätzbare Vorsammlungen zu dem einstweiligen Kapitalstocke, den ich hier zuerst dem Umfang des Landes nach ausgestellt, nach allen mit zu Gebote stehenden Mitteln vermehrt, und nun, wiewohl nicht ohne Schüchternheit, der noch ziemlich fühlbaren Lückenhaftigkeit seines Inhalts wohl bewusst, meinen lieben Landsleuten zu übergeben wage.
Während meines jahrelangen, mit Eifer und warmer Liebe betriebenen Sammelns gewährte mir eine Hauptaufmunterung der rege Anklang, den mein Unternehmen bei allen Denjenigen, welchen ich den Plan mitteilte oder Einladungen zu Beiträgen zustellte, gefunden hat. Von den achtungswertesten Seiten kamen mir reichliche Spenden an Materialien, Notizen und Quellenangaben zu; die Großh. Hofbibliothek und das General-Landesarchiv unterstützten mich aufs Bereitwilligste, und auch für den zweiten Band dieses Werkes, welcher zur nächsten Herbstmesse vollendet wird, sind mir noch mancherlei der schätzbarsten Originalbeiträge zugesichert worden.
Was, die verschiedenen Bearbeitungen anbelangt, welche das Badische Sagenbuch entält, so musste ich dabei möglichst darauf sehen, durch bunte Abwechslung in Form und Stilweise, in Versen und Prosa, und durch Vereinigung zahlreicher Schriftstellernamen das Eintönige zu vermeiden, welches gar oft den dauernden Genuss solcher Sammlungen entleidet und sie ermüdend macht, besonders wenn ihr Inhalt aus lauter Versen, worunter häufig ein großer Teil nur bloße Reimerei, besteht. Das „Badische Sagenbuch“ sollte, abgesehen von seinem Werte in poetischer und historischer Hinsicht als Erste größere Sammlung dieser Art, auch zugleich ein angenehmes Unterhaltungsbuch für Alt und Jung, für den mehr wie für den minder Gebildeten, so zu sagen eine romantische Hauspostille für unser Volk abgeben, die man, bald aus Ausflügen durch unsre reizenden Berg- und Talgegenden, bald an langen Winterabenden, gerne zur Hand nimmt, um sich nach ernsten Berufsarbeiten oder geistesanstrengender Lektüre gemütlich darin zu erholen. Bei der Wahl und Aufnahme der teils Büchern und Zeitschriften entlehnten Stoffe, teils eingesandt erhaltenen verschiedenen Originalbeiträge, namentlich bei der Ersten Aufstellung eines Werkes dieser Art, wo es vor Allem darauf ankommt, erst die Hauptgrundlage herbeizuschaffen und möglichst jeden einigermaßen namhaften Ort des Großherzogtums durch irgend eine Sage, Legende, oder romantische Geschichtsscene zu repräsentieren, war es übrigens nicht wohl ausführbar, eine so strenge Auswahl und Sichtung zu treffen, dass nicht auch manches Mittelmäßige und Gehaltarme, aus Mangel an Besseren, mit unterlaufen musste. Den Vorwurf jedoch, ich habe mich darauf beschränkt, durch bloßen Nachdruck von Sagen aus bereits vorhandenen Spezialsammlungen, Zeitschriften etc. ein gewöhnliches Kompilationswerk zu liefern, ohne Rücksicht auf äußere Form noch inneren Gehalt zu nehmen, wird mir gewiss kein unparteiischer Beurteiler meiner Leistung machen können. Im Gegenteil darf ich mit ruhiger Zuversicht behaupten, dass ich an jeden einzelnen Beitrag oder entlehnten Stoff, der mir es zu bedürfen schien, aufs Gewissenhafteste Hand angelegt habe, um ihn in angemessener Gestalt und würdiger, glattlesbarer Form auftreten zulassen. Man vergleiche nur z. B. die meisten anderen Werken entlehnten Sagen mit dem Originaltext, der gar häufig an Unklarheit der Sätze, schleppender Breite und manchen stilistischen Nachlässigkeiten leidet, und man wird sich leicht überzeugen, dass durch die hierin von mir, wenn gleich eigenmächtig, vorgenommenen Änderungen und Abkürzungen, das Gewand jener Sagen sich ihnen nur um so einfacher und vorteilhafter anschmiegt. Auch die metrischen Verstöße in manchen dichterischen Bearbeitungen suchte ich möglichst zu beseitigen, was mir hoffentlich von Seiten der Herrn Einsender nicht verargt werden wird.
So tritt nun deinen Gang an, Badisches Sagenbuch, durch die blühenden Gauen des lieben Vaterlandes! Sei dem sinnigen Wanderer willkommene Begleitung als freundlicher Wegweiser durch unsre zauberische Märchen- und Legendenwelt, und dem Lesefreund in Stadt und Dorf ein gemütlicher Abendgesellschafter, der ihn zur heiteren Erholung von häuslichen Sorgen oder politischen Wirrnissen mit dem poetischen Firnewein aus den Bergen und Tälern der eigenen Heimat bewirtet.
Baden.
Die Sonne lacht, wohin wir schauen,
Der Erde Gottes freundlich zu.
Wie herrlich glänzen deine Gauen,
O Vaterland, wie schön bist du! –
Am ausgeschmückten Seegestade,
Wo sich der Alpen Kette zeigt
Und blühend aus dem Wellenbade
Die wunderholde Mainau steigt; –
Wo Salems Friede lilienhelle
Aus einem Paradiese blickt;
Wo an der Donau Silberquelle
Die ährenblonde Baar sich schmückt,
Und, eine perlengleiche Gabe,
Die edelste der Würzen lacht,
Vom schöpferischen Zauberstabe
Des Zepters an das Licht gebracht; –
Wo in das Land der Alemannen
Der stolzen Eiche Wipfel weht,
Und, überschirmt von schwarzen Tannen,
Die wilde Pracht des Waldes steht.
Der uns des Weines gold‘ne Flamme
Voll Blumenduft entgegen hält,
Und manchen Ast dem Blütenstamme
Des edlen Vaters Rhein gesellt; –
Wo um die Reize stiller Auen
Die rasche Wiese zögernd schlüpft;
Wo durch des Felsentores Grauen
Die Dreisam in ein Eden hüpft;
Wo in des Himmels blauen Äther
Des Turmes Spitze sich verliert,
Der, schlank und kühn wie eine Zeder,
Des Münsters Kunstgebirge ziert; –
Am Kaiserstuhl, wo jeder Hügel
Im grünen Rebengürtel prangt,
Und in des Rheines klaren Spiegel
Der Limburg Efeu niederrankt,
Wo durch Gebirge, Tal und Haide
Der Kinzig Wellenmelodien
Ins lächelnde Revier der Freude,
Der Liebe und der Schönheit zieh‘n; –
Wo deine wärmste Segensquelle,
O Alemannia! entspringt;
Wo deiner Sprache Wohllautwelle
Am Blumenrand der Oos verklingt;
Der lieblichsten Natur im Schoße
In holder Anmut Baden blüht,
Frisch wie die junge Purpurrose
Am mütterlichen Zweige glüht; –
Wo aus des Waldes Dämmerungen
Die Murg die blauen Augen hebt
Und um ihr süßes Tal geschlungen
Beseligt jede Welle hebt;
Des Fürstenschlosses milder Schimmer
Sich über Rastatt freundlich neigt,
Und, der Erinnerung Heiligtümer,
Vergissmeinnicht und Lorbeer‘n zeigt; –
Am grünen Wald voll Nachtigallen,
Wo um der Kunstgebilde Pracht
Der Lustgebüsche Schleier wallen
Und eine Flur von Gärten lacht,
Die frischer Wohlgerüche Wogen
Der zierdereichen Hauptstadt bringt
Und einen bunten Regenbogen
Um ihren Sonnenfächer schlingt. –
Wo, freudestolz ob ihrem Ruhme,
Der Schwarzwald seine Pforte grüßt
Wo Mannheims holde Uferblume
Des Rheines edle Wogen küsst
Wo um erhabene Ruinen,
Des Lebens Frühlingskränze weh‘n,
Die schönsten Musenhaine grünen
Und liebend in den Neckar sehn.
Wo in des Odenwaldes Frische
Das sonnenwarme Leben ruht;
Wo Rebenhügel, Feld und Büsche
Sieh baden in der Tauber Flut;
Wo sie nach dem geliebten Maine
Errötend ihre Blicke hebt,
Und Werteims Bild im Wiederscheine
Der silberklaren Wellen schwebt.
Wie lächeln sich in holdem Bunde
O Baden, deine Gauen zu!
Wo blühet auf dem Erdenrunde
Ein Land, das schöner ist als du?
Entzückt von deinem Zauberglanze
Und deinen Reizen jubeln wir:
Heil dir, im deutschen Blütenkranze
Du schönste Rose, Baden, dir!
Kling’ aneinander, Gold der Rebe,
Welch’ grüner Busen dich auch trug!
Es wiederholet: Baden lebe!
Das Herz mit jedem Wonnezug.
Dies süße Wort tönt nah und ferne,
Der Freude Becher wird geleert,
Bis, angelacht vom Morgensterne,
Die gold‘ne Sonne wiederkehrt.
Heinrich Heß.
Vorspiel.
Kennt ihr den Wundergarten,
Den Götterhände warten,
Wo alles grünt und blüht
Und kaum den Gärtner müht?
Gesäumt vom Silberbande,
Vom Stolz der deutschen Lande,
Vom königlichen Rhein,
Ins fernste Blau hinein;
Und rechts von Berg und Talen
Voll gold‘ner Segensstrahlen,
Hercynia’s Hügelreih’n
Voll Frucht und edlem Wein!
Wie braust dort auf dem Strome
Vorüber Erwins Dome,
Dampfschnaubend aus dem Schlot
Das schmucke Räderboot!
Und vom Gebirge wieder
Wie jubelnd klingt hernieder
Des Hirtenknaben Sang!
Gelehnt auf grünen Hang,
Die Burgruinen schauen
Mit heiterem Vertrauen
Ins Aug’ der neuen Zeit,
Voll Friedensseligkeit!
In sommerlicher Schwüle
Wie labt der Wälder Kühle!
Wie lacht der Matten Grün
Mit glänzend fetten Küh’n!
Wie tröstlich weh‘n die Tannen,
Aus kranker Brust zu bannen
Mit ihrem Balsamhauch,
Was sie mag quälen auch!
Dort laden die Najaden
Zum Trinken oder Baden
An der Genesung Born
Aus ihrem Wunderhorn.
Es strotzen Felsenquadern
Von reichen Erzesadern,
Kein schlimmer Gnom verlacht
Des Knappen Fleiß im Schacht.
Und Städte rings voll Leben
Und schmucke Dörfer weben
Zum Himmel von Saphir
Die schönste Teppichzier.
Landbau, Gewerbe, Handlung,
In immer höh‘rer Wandlung
Und Kunst und Wissenschaft
Voll reger Triebe Kraft!
Des Volkes Herzen stammen
In Liebesglut zusammen
Für Freiheit, Licht und Recht;
Ein kerniges Geschlecht! –
Seis auf den glanzumgeb‘nen,
Goldährenvollen Ebnen,
Seis, wo der Wasserfall
Sich stürzt mit Donnerhall:
Millionen Reize laden
Zum Paradies von Baden
Der Gäste buntes Meer .
Aus Näh’ und Ferne her.
Doch ganz es zu genießen,
Lasst euch nun auch erschließen
Durch Sängers Zauberwort
Der Sagen Wunderhort!
Die Märchen und Balladen
Aus den geheimsten Pfaden,
Die Geister der Natur
Aus Berg- und Talesflur;
In Liedern und Romanzen
Umgaukeln und umtanzen
Sie jedes Sonntagskind,
Das nicht für Wunder blind.
Von steiler Klippe Stufen,
Aus tiefen Stromeskufen,
Aus felskristall‘nem Schacht,
Aus grüner Waldesnacht;
Aus blauen Sees Wellen,
Aus stillen Klosterzellen,
Zerfall‘ner Burgen Wall –
Sind sie berufen all’.
Sie singen Freud’ und Schmerzen
Tief aus des Volkes Herzen,
Und halten wach darin
Den kindlich frommen Sinn;
Mit Poesie durchweben
Sie manches arme Leben,
Und bieten ihm Ersatz
Für einen anderen Schatz.
Die Gnomen und die Elfen,
Sie kommen gern und helfen
Dem braven Bauer aus
In Feld und Hof und Haus.
Die Riesen und die Zwerge
Durchwandeln noch die Berge,
Die Nixen blüh‘n im See;
Doch tun sie niemand weh.
Ein heil‘ger Gottesfrieden
Hat allen Hass geschieden,
Und gute Geister nur
Umschweben unsre Flur! –
Drum lauscht nun gern den Sagen
Aus den vergang‘nen Tagen;
Dann erst im wahren Glanz
Erblickt ihr Badens Kranz!
A. Schnezler.
Einleitung
von Josef Bader.
Entwicklungsbild der heimischen Sagenwelt.
Die herrlichen, gesegneten, reichbevölkerten Gefilde am stolzen Rheinstrom, herab vom Bodensee zum Neckar, zum Main und weiterhin, die gleich einem prangenden Teppich seine Ufer schmücken und den Kranz der Vorhügel des Schwarzwalds und der Vogesen; diese Gefilde, wo alles in üppiger Fülle blüht und in buntgestaltetem, fröhlichem Leben sich bewegt – sie lagen einst als toter Grund tief unter weiten, ungeregelten Wassern, wie verdammt zum ewigen Flutengrab. Das Rheintal, das ganze, große, füllte ein einziger See, im Kreise kahler Berghäupter und düsterer Wälder.
Aber der mächtige Stromgott, der „am Busen der Gletscher-Ammen gesäugte“, fand kein Gefallen an der weiten Öde – er suchte das heitere Leben der Menschen. Da sanken die Wasser und teilten sich die Fluten. In immer engeren Schranken, immer geregelteren Betten, nahmen sie den Lauf. Breite Bergwände, zahlreiche Vorhügel, traten an den belebenden Sonnenstrahl, bedeckten sich mit munterem Grün und lockten aus dem dunklen Urwald – den Menschen herbei, den götterähnlichen.
Rhenus lächelte, und die Geister der Flüsse, der Bäche und Quellen, die das hercynische Waldgebirge ihm sendete und das vogesische, sie schwebten freudig von Ufer zu Ufer, wo der Mensch sich niederließ – schützende, pflegende, beglückende Genien.
Da milderte sich des Menschen Gemüt, erweiterte sich sein Aug, übte sich mannigfaltiger seine Hand. Die schirmende Hütte hatt’ er längst gebaut, und der schnelle Fuß trug ihn leicht zum befreundeten Nachbarn; aber jenseits der Fluten, am blauen, dämmernden Gestade – hatte dort sein Blick nicht gleiches Leben erspäht? Es regte sich die Sehnsucht – sie reichte weiter als die Kraft des Schwimmers, doch nicht weiter als der sinnende Kopf und die Kunst der geübten Hand. Bald befuhren Flöße und Kähne die Ufer und landeten am fremden Gestade, das dem kühnen Schiffer gastliche Ruhe bot und Erfrischung. Oder, hat auch damals schon die Habsucht den leichten Kahn mit blutiger Beute gefüllt[1]?
Dies war die Kindheit der Schiff-Fahrt aus dem Rheine, wo jetzt der stolze Dämpfer einherbraust und sich das schwere Frachtboot durch die Wogen drängt. Heute noch zeigt man längs der Vorhügel hin, hoch oben an Felswänden, die eingekeilten Eisenringe, welche einst statt des Ankers zum Anhacken der Schiffe gedient[2].
Rhenus, der menschenfreundliche, als er dies Gedeihen sah, drängte seine Fluten noch weiter zurück vom Talgelände, dämmte sie ein in noch engere Betten. Es verschwand der große See – nur blieb, zum ewigen Merkmal, das Becken des Bodensees[3].
Aus dem Schoß der Erde aber hatte Vulkan, kühn durch das Rheinbette herauf, den Kaiserstuhl getrieben, der – ein feuersprühender Inselberg, setzt mächtigeren Fuß in den Fluten fasste, bis seine Glut erloschen war und seine Wände sich begrünten, um das eine bald und bald das andere Ufer zu zieren.
Mehr und mehr, von frisch fließenden Wassern getränkt, von der Sonne Strahlen erheitert und erwärmt, von freundlichen Geistern gehütet, bedeckten sich die Ebenen des Rheintals mit dem Schmuck des Grases, des Strauches, der Eiche und Buche; üppige Wiesen und Wälder dehnten sich aus; der Talbewohner rückte seine Hütten und Dörfer bis an die Ufer vor – die Morgenröte freundlicherer Zeiten ging auf über das weite, im ersten Jugendtrieb schwellende Tal.
Der schwarzgelockte, leichte, gesellige Kelte aber war’s, ein Sohn des Morgenlandes, welcher zuerst an den großen Rhein-See gekommen, welcher ihn zuerst befahren, an seinen Ufern die ersten Dörfer und Städte gegründet, den Bergen, Flüssen, Forsten und Fluren die ersten Namen gegeben. Und mit ihm sind die Genien seiner Heimat eingezogen in das Rheintal, die unsterblichen Pfleger und Beschützer seines Erdendaseins, holde, zarte weibliche Wesen – die Göttin Berchte und jene wundersamen Feen, welche in Felsgrotten, an Seen und Quellen, auf lichten Hügeln und in dämmernden Hainen ihre Zauberschlösser und Wundergärten bewohnten.
So, unter dem Schirm seiner Götter und Genien, hatte der Kelte, mit erfinderischem Geist, mit betriebsamer, kunstfertiger Hand, das Rheintal bevölkert und bebaut – ungezählte Jahrhunderte lang. Und wie er nun gealtert war und geschwächt an Kraft, da trat aus den östlichen Wäldern ein Jüngling hervor, hochgewachsen, mit schwellenden Muskeln, von blondem Haar und blauem Aug, über der Schulter das Fell des erlegten Wildes, in der Faust den leichten Wurfspieß, neben sich den bejochten Ochsen und den getreuen Wind. Es gefiel ihm an den sonnigen Halden und Vorhügeln und Talgeländen, wo nie gesehene Pflanzstätten, Weiler und Dörfer, im Kranze zierlicher Garten und blühender Fruchtgefilde, seinem erstaunten Blick entgegen lachten.
Wir erkennen den blonden, blauäugigen Riesenjüngling – es ist der Germane, auch ein Sohn des Orients, aber rau geworden und abgehärtet auf der langen, gefahrvollen Wanderung. Üppiges Leben ist ihm fremd, und doch – in die finstern Wälder will er nicht mehr zurück. Er ringt mit dem Kelten um den Besitz des schönen Rheintals; er bewältigt und unterjocht ihn – er ist des Landes Herr, teilt und genießt die Früchte seines Siegs.
Aber so leichten Kampfes sollte ihm seine neue Heimat nicht zu Teil werden; ein zweiter, weit erfahrener, vielgeübter, listiger Kriegsmann erschien – der stolze Römer. Ihm gehorcht eine eroberte halbe Welt; wird die germanische Kraft, die jugendliche, ungelehrte, ihm widerstehen? Sie muss weichen, und der sieggewohnte Eroberer macht das schöne Rheintal mit dem friedlichen, fleißigen, dienstgewohnten Kelten, zu einem Vorlande seines Reichs.
Schnell mehrten sich fortan die Dörfer, die Städte; sichere Straßen, von Türmen und Kastellen beschützt, verbanden sie, prächtige Bäder und reiche Tempel schmückten ihre Umgebung. Denn neue, stolzere Götter und Genien herrschten jetzt. Hier durchzog Diana mit Pfeil und Bogen die Forste; dort, im Kriegslager, gebot Mars mit dem blinkenden Schwert, und in Städten und Dörfern lockte der geflügelte Merkur mit Stab und Säckel zu Handel, Gewerk und Künsten – zu wachsendem Gewinn. Ein großes, vielbewegtes, freudiges Leben durchströmte das Rheintal.
Und vertrauter näherten sich die Götter und Genien der Kelten jetzt den römischen; bald unterschied man sie nicht mehr, sah Berg und Tal froh bevölkert mit Feen und Elfen, Dryaden, Najaden und Nymphen. Ihre Unschuld aber war nicht mehr die reine, ihr Wesen nicht mehr das immer gute, menschenerfreuende. Wohl schützten sie das Volk ihrer Kreise noch, halfen ihm und beschenkten es; aber falsch auch und tückisch verlockten sie schmeichlerisch ihre Günstlinge zur Sünde, rissen sie bald in Gefahr und Verderben.
Und so war’s schlimmer geworden mit dem Menschen. Lüstern nach stets neuem Genuss, begann er selbst mit seinen Göttern zu buhlen. Was war ihm heilig noch, nachdem Merkur das Füllhorn seiner Schätze über ihn ausgegossen? Das Leben im Rheintal, jenem gleich in der römischen Weltstadt, versank in Reichtum und Üppigkeit; Übermut und Schwelgerei hatten es vergiftet und angefault – es verdiente den Untergang.
Abermals erschien jetzt der Germane, unverdorben noch und ungeschwächt, wie das erste Mal – doch reicher an Erfahrung und fester an Entschlossenheit. Denn des Römers Eroberungssucht hatte auch ihn aufgestört in seiner stillen Heimat, auch ihm das Joch der Knechtschaft geschworen. Mächtig jetzt und rachedürstend warf er sich dem Feind entgegen, dem unersättlichen, und es änderten sich die Geschicke.
Der Germane, gestärkt durch das alemannische Brüderband, geschirmt von seinem Wodan[4], seinem Tor, seinen Walküren, stand an den Pforten des Weltreichs. Was nützten die Mauern und Türme, womit der Römer das Rheintal umzogen? Sie fielen, und zu Ende war die stolze Herrschaft Roms an den Ufern des Rheines!
Nicht aber wurde das Land jetzt eine Wüste voll Blut und Asche. Die verhassten Zwingburgen, die schirmenden Städte, die üppigen Bäder und prächtigen Tempel allein wurden ein Raub der Zerstörung – die Hütte, der Pflug des Landbewohners blieben dem Sieger heilig, nur waltete fortan Er als Herr über Alles.
Und auch die alten Götter blieben dem Besiegten. Die Feen, die Nymphen, sie bewohnten ihre Felsen, Haine und Seen, wie zuvor. Im Rauschen aber der hohen Eiche, im Tosen des schäumenden Wassersturzes verkündete der alemannische Gott seine gewaltigere Majestät.
Doch, was sind alle die stolzen Götter der Heiden gegen den Gekreuzigten! Einzelne, arme, wehrlose Männer und Frauen, von jenseits des Meeres, von dem grünen Erin, von dem felsigen Scotien, kamen herüber an den Rhein, predigten die Lehre des Welteilands und besiegten die Herzen des Volks. Freilich erhoben sich verruchte Hände gegen die Frommen und röteten mit ihrem Blut den heimatlichen Boden. Aber die Grabstätten der Märtyrer verherrlichten sich durch heilige Wunder; gläubig wallfahrte das Volk zu ihnen und überbaute sie mit Kirchen und Klöstern[5].
Wo, war jetzt die alte Götter- und Genienwelt? Hatten sie die Berge verlassen, und die Felsgrotten, die Haine, die Seen und Flüsse? Nein; aber ein vernichtender Krieg aus der Zelle des Mönchs, aus der Höhle des Waldbruders erhob sich gegen sie. Sein Fluch verwandelte ihr einst heilbringendes, dann gefallenes Wesen in die Natur des Bösen, und von dem an spuckten aus ihnen überall teuflische Künste zur Verlockung und zum Verderben des Menschen. Verdrängt und gestürzt, hausen sie seither im Schacht der Berge, im Grunde der Seen – als heidnischer Hofhalt, als Gnomen und Zwerge, Mummler und Nixen[6].
So ist im Rheintal die Welt des Kelten und des Römers untergegangen. Nur Namen sind noch übrig von ihr, und Burgtrümmer, und verschüttete Städte, und vergrabene Schätze, die ein missgünstiger Dämon hütet, bis etwa der Pflug des Landmanns sie erreicht und zu Tage fördert. Reich und gewaltig war diese Welt; aber die neue des christlichen Deutschen wurde herrlicher.
Wer weiß es nicht, wie die Klöster geblüht an Gelehrsamkeit und frommer Zucht? Wie die Ritter geglänzt an Ehre und Tapferkeit, ihre Frauen und Töchter an Schönheit und keuscher Sitte? Wer hat nicht von den Liedern gehört, die auf Burgen, an Fürstenhöfen, an Kaiserlagern, die Harfe des Sängers begleitete? Und von der prangenden Waffenkunst des Turniers, und von den kühnen Heldentaten der Fahrten ins Heilige Land? Ja, die Begeisterung für den Gekreuzigten, und seiner unbefleckten Mutter inbrünstige Verehrung – sie schufen eine Welt voll reinen, hocherhabenen, wunderherrlichen Lebens!
Aber der Böse, mit den gestürzten Göttern und Genien der alten Welt, vergiftete dies Leben bald genug. Sie schlichen umher nach Opfern ihrer Rache. Da vergaß ein Mönch sich in den frevlerischen Gelüsten geheimer Wissenschaft[7], ein anderer dort mit der gottgeweihten Schwester in den Fesseln unreiner Liebe[8], und büßte dann dafür auf dem Scheiterhaufen oder lebendig eingemauert, oder stürzte sich herab von der Felsspitze in den wogenden Strom! Noch bezeichnet schauerliches Gestöhn zur Mitternachtsstunde die Todesstätten dieser Verführten.
Es überschüttete der Böse die Klöster mit der Fülle des Reichtums, auf dass er sie ablocke von der Dornenbahn strenger Zucht auf den schlüpfrigen Weg der Üppigkeit. Übermütige, schwelgerische Äbte, führten sie nicht das blutige Schwert, statt des friedlichen Krummstabs? Haben sie nicht zerstört, gesengt und gebrannt, anstatt aufgebaut und gesegnet? Und wie der Hirt, so die Herde. Wie manches Kloster, reichbegütert in den vaterländischen Gauen, lud Sünden auf Sünden und sank von seinem Reichtum in Armut und Verachtung! Jetzt liegen die Trümmer dieser einst geheiligten Mauern verödet unter Disteln und Dornen, und wenn die Nacht ihren schwarzen Schleier über sie ausgebreitet hat, erheben sich die Geister jener Äbte und Mönche aus den verschütteten Grüften und wandeln ewig büßend über den Schauplatz ihrer Frevel und Verbrechen hin[9].
Von den Klosterzellen aber schlich der Böse auf die Burgen der Ritter, in die Schlösser der Fürsten. Er fand Eingang leider, fast überall. An wie manche dieser stolzen, kühnen Bauten klebte das Blut und der Schweiß des armen, gepeinigten Volkes! Habt ihr nie die Ketten gesehen mit den vermoderten Knochen in aufgegrabenen Burgverließen, wo einst die gefangene Unschuld verkümmerte? Oder nie die blutbespritzte Stelle, wo die verfolgte Jungfrau, freiwillig herabgestürzt in die rettende Tiefe, ihren Geist verhauchte?
Ja, von Sünden und Lastern genug sind diese Burgen und Schlösser Zeuge gewesen. Noch sucht der Schatzgräber die Stellen aus, wo einst ein hartherziger Burgherr den Raub von Witwen und Waisen in eiserner Kiste unter das Erdreich seines Kellers verbarg. Noch zeigt man die dunkle Hohlgasse, wo einst der freche Junker mit seinen Gesellen auf Beute gelauert[10]. Keine Gegend könnt ihr nennen in unserem schönen Heimatlande, wo die Hand des Landmanns dem Wanderer nicht von einem Raubschloss die Trümmer weist. Und überall in finsterer Mitternacht gehen sie noch um, die Burggeister, denen der strafende Himmel keine Ruhe des Grabes gönnt.
Und die zarte, keusche, milde Frauenwelt in den Burgen und Schlössern? Den Ruhm der Sittsamkeit, der Frömmigkeit, der Treue, der Armenpflege hatten Frauen und Töchter in reichem Maß erworben, und er hatte sie verklärt wie ein Heiligenschein. Aber wie bald verblendete der eitle Stolz das junge Gemüt der Maid, wie bald der süße Reiz verbotener Liebe das Herz des Weibes! Vom Hunger verzehrt flehte der Arme – vergeblich, er ward mit Hunden von der Pforte getrieben. Und fand nicht der gläubige Ritter, heimgekehrt vom fröhlichen Waidwerk, sein Gemahl, zum Entsetzen – in des Buhlen Arm? Traf nicht der gläubige Ritter, zurückgekehrt von den Mühen der langen Kreuzfahrt – einen neuen Herrn seines Weibes, oder statt des eigenen Bluts, einen Bastard auf der heimischen Burg? Noch kennt der Landmann die Stelle, wo das treulose Weib, getroffen vom Schlage der reichenden Hand, jammervoll unterging[11].
So war auch diese Welt, die einst hochbelobte und herrliche der Klöster und Burgen, dahin gesunken in ein trauriges, schmachbedecktes Verderben. Aber eine neue hatte sich jetzt aufgetan, eine reiche, kräftige, strebende – die Welt der Städte. Diese, oft das Asyl des gedrückten, gehetzten Landmanns, immer die Freistätten des Handels, des Gewerbes, der Wissenschaft, der Kunst, die Besten des Rechts und der Freiheit – erzogen Bürger, welche stolz neben dem Ritter stunden, Männer, welche ruhmvoll kämpften für die geliebte Heimat auf dem Felde der Schlacht, wie im Rat der Fürsten. Mut und Fleiß, sie belohnten sich auch hier[12]. Was Prälat und Ritter seit Jahrhunderten eingebüßt, das gewannen die Städte.
Auch den deutschen Städten, wie vielen, wie herrlichen im schönen Rheintal! auch ihnen lächelte Merkur, wie einst den keltischen und römischen. Ihre Schätze häuften sich, aber verblendet dadurch vergaßen sie ihrer Brüder – des Landvolks, welches im Joch der Knechtschaft schmachtete. Der Böse verschloss ihr Herz – der wimmernde Klagelaut des Armen, er erscholl vergeblich. Da drückte die Verzweiflung dem Verlassenen das Schwert, die Brandfackel in die Faust – und durch ganz Deutschland wälzte sich eine schwere, schwarze, verderbenschwangere Wolke des Aufruhrs!
Wo am Rheine ist ein Gau, dessen Bewohner dir nicht zu erzählen weiß von den Gräueln des Bauernkriegs? Da und dort zeigt man die Trümmer noch von einst stolzen Burgen, welche durch die Faust der Empörung in Schutt und Asche versunken. Und noch traurigere Stellen – wo der arme Besiegte seine Verzweiflung büßte unter dem Henkerschwert.
Und die Frucht dieses Sieges – war es eine bessere, friedlichere Zeit? Der Böse grinste höhnisch über den Schauplatz des Menschentreibens hin, und unsere schöne Heimat ward ein Tummelplaz räuberischen, mordbrennerischen Gesindels. Der obdachlose Zigeuner, der gardende Landsknecht, der fahrende Adept, der hausierende Krämer, alle im Dienste des Bösen, und ausgerüstet mit höllischen Kräften und Künsten, trieben da ihr heillos Spiel.
Noch mehr aber übte Satan seine Tücke. Zu Mädchen und Frauen schlich er und lockte die Betörten in seinen Bund. Da, bei stürmischen Nächten, auf Besen reitend, mit gelöstem Haar und Gewand, flogen sie hinauf, wo die Orgie raste – nach des Blocksbergs qualmender Kuppe! Und gesättigt alsdann von diabolischen Genüssen, kehrten sie heim, um den Brei zu kochen, der mit Sturm und Hagel des Landmanns Hoffnung darnieder schlug – die blühende Saat, die sprossende Rebe.
Aber das Volk schrie Rache über den verderbensschwangeren Hexenzauber. Der Folterstuhl erpresste die Geständnisse des teuflischen Bundes, und nun fort zur Strafe mit den armen Besessenen, die der Böse zu Werkzeugen seines Menschenhasses gemacht – zur unerbittlichen Strafe! Da loderten durch alle Gaue der Heimat die Scheiterhaufen, um halbentseelte, folterbrüchige Leiber zu verzehren[13].
Endlich schmetterte durch das Prasseln dieser Sanbenito-Flammen hindurch, die Trompete des schwedischen Reiters. Eine andere Mordgeschichte rollte sich auf. Vom wilden Heere des Schweden erzählt das Landvolk noch mit Grausen, und vom Schwedenkrieg und Schwedentrunk[14]. Der Böse hatte sein Meisterstück vollbracht; es schließt sich damit die heimische Sagenwelt, welche mit den Werken guter segenbringender Götter und Genien so herrlich begonnen.
1.Vergleiche die Sage von den Seeräubern auf dem Turmberg, unter den Sagen von Durlach im zweiten Bande dieses Werkes. Anm. des Herausg.
2.Z. B. an den Felswänden beim Kuckucks-Bad, zwischen Bollsweil und Kirchhofen im Breisgau. An den Turmsteinen mehrerer Kirchen, die auf dem Hochufer des alten Rheinbettes liegen, will man ebenfalls solche Ringe gefunden haben. – – Uralte Sagen sprechen aber auch von einer Zeit, als lange, lange vor der Periode der Sündflut, in unseren Gegenden und bis in den tiefsten Norden hinab, ein Klima, wie das der üppigen südlichen Himmelsstriche, waltete, und mit den Blumen und Früchten jener glücklichen Zone auch unsere Heimat gesegnet war. Überreste von Palmen, Datteln und anderen tropischen Erzeugnissen, von Säugetieren und Amphibien, die wir jetzt nur noch im Süden finden, sind aus den Tiefen unseres Bodens zu Tage geschürft worden und geben uns dunkle Kunde von einer paradiesischen Vorwelt, die auch von einem götterähnlichen Menschengeschlechte bevölkert gewesen sein und erst durch die (von manchen Geologen angenommene) Verrückung der Erdachse sich in die uns bekannte, rauere Welt umgewandelt haben mag. Anm. des Herausg.
3.Siehe das schöne Gedicht von Gustav Schwab: „Die Schöpfung des Bodensees“, Seite 1 dieses Bandes.
4.Allmächtig, alles durchdringend und beherrschend thront Wotan über der germanischen Götterwelt; als Lenker der Schlachten und Erkämpfer des Siegs sprengt er auf sprühendem Wolkenross oder fährt auf rasselndem Wagen über die Kriegsstätten dahin; den nächsten Rang nach ihm nimmt der rotbärtige Tor, der Gott des Donners ein; einen wuchtigen Hammer schwingend schmettert er aus dem zusammengeballten Gewölk sengende Schlangenblitze hervor; Tyr, der germanische Mars, unterstützt den Wotan in der Lenkung der Schlachten; in seinem Gefolge die Schlachtenjungfrauen: die Walküren (aus deren Flügen über die Wahlstätte später wahrscheinlich die Sage vom wilden Heer sich gestaltete). Freyr, der Gott des Friedens, solchen Kriegsgöttern gegenüber, steht natürlich in schwächerem Lichte da; seine Schwester Freya, die germanische Diana, und Wotans Gattin Freya, (Hertha,) sind die weiblichen Hauptgottheiten. Der Raum verbietet uns, alle übrigen, dem hohen Norden entsprossenen, Göttergestalten der urgermanischen Welt hier vorüberschreiten zu lassen; wir erwähnen nur noch der Helden und weisen Frauen, denen, als Halbgöttern, heilige Verehrung erwiesen wurde, wie z. B. dem erdgeborenen Tuisko und seinem Sohne Mannus etc. von denen die beiden der Nibelungen und des Heldenbuches, Siegfried, Dietrich, Wieland, Eckart (siehe die Breisacher Sagen) u. s. w. abstammten, die Priesterinnen, Seherinnen, z. B. Belleda etc.
5.Der Germane bevölkerte die Wälder und Gewässer mit Druiden (Druten), Alraunen, Feien (Feen); die Gebirge mit Riesen, Zwergen, Kobolden und allerlei Gnomen, welche Letztere später, zum Teil bei Einführung des Bergbaus im Schwarzwalde, als Berg- oder Grubenmännlein, Verwandte des Erzgebirgsfürsten Rübezahl, auftreten. Der Lindwürmer, Drachen und anderer Ungeheuer, die zu bekämpfen waren, gab es in den Höhlen und Felsklüften die Menge. Anm. des Herausg.
6.Siehe die Sagen vom heiligen Fridolin, Trutbert, Landolin, etc. in diesem Bande.
7.Siehe z. B. die Sagen vom Venusberg bei Ufhausen und von der Haselhöhle in diesem Bande; sodann jene der Stadt Baden („Kellers Bild und Kreuz“), und die von Schiltach und Schappach im ersten, vom Mummel- und Wildsee im zweiten Bande. Anm. des Herausg.
8.Siehe z. B. Berthold Schwarz, S. 374 dieses Bandes.
9.Siehe z. B. die Sagen vom Höllenhacken, S. 172, und Nonnenmattweiher, S. 237 dieses Bandes etc. Von Tiefenau, im zweiten Bande etc. Anm. des Herausg.
10.Siehe z. B. die Sage von den Mönchen in Gottesau; Uhlands “Das versunkene Kloster“ etc. im zweiten Bande dieses Werkes.
11.Siehe z. B. die Sagen vom Falkenstein, S. 409 dieses Bandes, und andere. Anm. des Herausg.
12.Siehe z. B. die Sage von der Frau von Bosenstein, das Edelfrauenloch etc. im 2. Bande dieses Werkes.
13.Unser Buch enthält zahlreiche Sagen von den Ursprüngen Badischer Städte, von tapferen Taten ihrer Bürger, (z. B. „der Fleischer von Konstanz,“ Freiherr von Fahnenberg im ersten Bde. „Die vierhundert Pforzheimer“ etc. im zweiten Bde. etc.) von originellen Charakterzügen ihrer Bewohner; von derben Kerngesellen, (wie z. B. Romaias) u. s. w. Anm. des Herausg.
14.Hexentürme findet man noch in mehreren unserer Städte, z. B. in Burkheim, Bühl, etc. und Hexensagen überall in Menge.
15.Siehe z. B. die Schwedensagen im Albgau, in der Baar etc. Anm. des Herausg.
Der Bodensee
Die Schöpfung des Bodensees.
Als Gott der Herr die dunkeln Kräfte
Der werdenden Natur erregt,
Und zu dem schöpfr‘ischen Geschäfte
Die Wasser und den Grund bewegt:
Und als sich nun die Tiefen senkten,
Die Berge rückten auf den Platz,
Die Eb‘nen sich mit Bächen tränkten,
In Seen sich schloss der Wasser Schatz:
Da schuf sich auch die Riesenkette
Der Alpen ihrer Täler Schoß,
Da brach der Strom im Felsenbette
Aus seinem Eispalaste los.
Er trat heraus mit freud’gem Schrecken,
Er wallet hell ins off‘ne Land,
Und ruht in einem tiefen Becken
Als blauer See mit breitem Rand.
Und fort von Gottes Geist getrieben
Wogt er hinab zum jungen Meer,
Doch ist sein Ruhesitz geblieben,
Und Wälder grünen um ihn her;
Und über ihm hochausgebreitet
Spannt sich der heitern Lüfte Zelt,
Es spiegelt sich, indem sie schreitet,
Die Sonn’ in ihm, des Himmels Held.
Und wie nun auf den weiten Auen
Des ersten Sabbats Ruhe schlief,
Ließ sich der Bote Gottes schauen
Im lichten Wolkenkranz und rief.
Da scholl gleich donnernden Posaunen
Des Engels Stimme durch den Ort,
Es horchten Erd’ und Flut mit Staunen,
Und sie vernahmen Gottes Wort:
„Gesegnet bist du, stille Fläche,
Vor vielem Land und vielem Meer!
Ja rieselt fröhlich nur, ihr Bäche,
Ja ströme, Fluss, nur stolz einher!
Ihr hüllet euch in einen Spiegel,
Der große Bilder bald vereint,
Wenn Einer, der der Allmacht Siegel
Trägt auf der Stirn – der Mensch, erscheint.
Erst lebt ein dumpf‘ Geschlecht, vergessen
Sein selbst, im Walde mit dem Tier;
Dann herrscht ein Fremdling stolz, vermessen,
Ein Sieger mit dem Schwerte hier;
Er zimmert sich den Wald zu Schiffen,
Eröffnet Straßen, haut ein Haus;
Dann hat ihn Gottes Hand ergriffen,
Und schleudert ihn zum Land hinaus.
Und führt den Stamm mit gold‘nen Haaren,
Mit blauem Aug’ ans Ufer her;
Er hat noch Nichts vom Herrn erfahren,
Sein Gott ist Eiche, Fluss und Meer;
Doch schläft im tüchtigen Gemüte
Noch unerweckt des Ew’gen Bild,
Ein Strom der höchsten Kraft und Güte
In seinen vollen Adern quillt.
Der Himmel wird ihm Boten senden,
Die sagen ihm von Gottes Sohn,
Die bauen mit getreuen Händen
In dichten Wäldern seinen Thron.
Dort wird das Licht des Geistes leuchten,
Von dorther der Erkenntnis Quell
Der Erde weites Feld befeuchten,
Dort bleibt’s in tiefem Dunkel hell.
Dann werden sich die Haine lichten,
Wie sich der Menschen Herz erhellt,
Dann prangt ein Kranz von gold‘nen Früchten
Um dich, du segensreiches Feld!
Die Rebe strecket ihre Ranken
In deinen hellen See hinein,
Und schwer belad‘ne Schiffe schwanken
In reicher Städte Hafen ein.
Und die des Höchsten Krone tragen,
Statthalter seiner Königsmacht –
An diesen Ufern aufgeschlagen,
Sonnt oft sich ihres Hofes Pracht.
Und Völker kommen aus dem Norden
Und aus dem Süden, See, zu dir;
Du bist das Herz der Welt geworden,
O Land, und aller Völker Zier!
Drum sind dir Sänger auch gegeben,
Zwei Chöre, die mit deinem Lob
Die warme Frühlingslust durchbeben,
Wie keiner je sein Land erhob:
Das eine sind die Nachtigallen,
Auf Wipfeln jubelt ihr Gesang,
Das andre sind in hohen Hallen
Die Ritter mit dem Harfenklang.
Wohl ahnst du deinen Ruhm, du wallest
Mit hochgehob‘ner Brust, o See!
Doch dass du dir nicht selbst gefallest,
Vernimm auch deine Schmach, dein Weh!
Es spiegeln sich die Scheiterhaufen
Der Märtyrer in deiner Flut,
Und deine grünen Ufer traufen
Von lang vergoss‘nem Bürgerblut.
Sei nur getrost! du blühest wieder,
Du wischest ab die Spur der Schmach,
Und große Sagen, süße Lieder,
Sie tönen am Gestade nach.
Zwar dich verlässt die Weltgeschichte,
Sie hält nicht mehr an deinem Strand
Mit Schwert und Wage Weltgerichte,
Doch still Genügen wohnt am Rand.
Der Hauch des Herrn treibt deine Boote,
Dein Netz soll voll von Fischen sein,
Dein Volk nährt sich von eignem Brote,
Und trinkt den selbstgepflanzten Wein.
Und unter deinen Apfelbäumen
Wird ein vergnügt Geschlecht im Glück
Von seinem alten Ruhme träumen;
Wohlan, vollende dein Geschick!“
Der Engel sprach’s, der Sabbat endet,
Der Schöpfung Werktag hebt sich an,
Es rauscht der See, die Sonne wendet
Ihr Antlitz ab, die Wolken nah‘n;
Die Stürme wühlen aus den Schlünden
Den trüben Schlamm ans Licht heraus,
Der Strom hat Mühe sich zu münden,
Und sucht durch trägen Sumpf den Lauf.
Doch webt und wirkt im inneren Grunde
Der schwer arbeitenden Natur
Das Wort aus ihres Schöpfers Munde,
Sie folgt der vorgeschrieb‘nen Spur.
Von Licht verklärt, von Nacht verhüllet,
Sein bleibt das Wasser, sein das Land,
Und was verheißen ward, erfüllet
Der Zeiten Gang aus Flut und Strand.
Gustav Schwab.
Die Prinzessin vom Bodensee.[1]
Es sah die Insel aus dem See,
Mit weißer Brust zur blauen Höh’;
Sie spiegelt sich im Wellenbade,
Sie winkt hinüber zum Gestade:
„Mein ist des Sees Diamant,
Wer mag ihn holen sich im Land?“
Und wie er glänzt vom Söller her,
Macht jedes Herz die Liebe schwer:
„O Fürstenkind der Alemannen,
Wer darf dein schlankes Bild umspannen?“
Das darf die keusche Luft allein,
Der Wellen froher Silberschein.
Sie lächelt in das schöne Land:
„Wer freit die stolze Fürstinhand?
Mein ist der freie Inselhügel,
Mein dieses Meeres weiter Spiegel,
Mein ist der hohe Jugendleib;
Wo blüht umher ein reicher Weib?“ –
Der See umwallt sie meilenweit,
Und höhnt der Freier heißes Leid.
Da reitet von den Alpenhöhen
Ein welscher Graf, sie zu erflehen.
Als Bote zieht sein Hund voraus,
Er schwimmet zu der Fürstin Haus.
Er beut ihr dar den Liebesbrief:
„Sind deine Wellen trüglich tief,
Und kannst du treu und tiefer lieben,
So rüst’ ich dir die Barke drüben,
Die hole dich zum Land so hold,
Zum Marmorschloss voll Lust und Gold!“
Sie knüpft ihr Wort dem Boten an:
„Dein Leib sei deiner Hoffnung Kahn,
Dein Segel sei die Lieb’ alleine,
Dann will ich folgen als die Deine.“ –
Er reitet fort mit Spott und Scham:
„Nimm einen Fisch zum Bräutigam!“
Eine Taube fliegt auf ihre Hand
Und beut ein stehend Busenband:
„Auf meinen grünen Schweizerauen
Lass uns die Bundeshütte bauen;
O komm zu mir, du Himmelslicht!
Ein treuer Herz beglückst du nicht!“ –
Die Taube kehrt zum Alpensohn:
„Was sucht der Hirt den Fürstensohn?
In meinen grünen Wellengründen
Magst du die Bundeshütte finden.“ –
Da sinkt er in den tiefen See,
Mit seiner Liebe tiefem Weh. –
Es lagert im verheerten Feld
Ein Werber neu, der Frankenheld:
„Ich habe ihrer Väter Marken,
Will nun im schönem Sieg erstarken.
Mein Edelfalke trage hin
Den Brautring meiner Königin!“
Hoch schwebt der Falk und unsichtbar,
Was schimmert durch die Luft so klar?
Es fällt mit stummen Siegergrüßen
Ein Diamantring zu ihren Füßen;
Sie steckt ihn sinnend an die Hand
Und schaut errötend nach dem Strand.
Dann kränzt sie ihren Ahnensaal
Und füllt den gastlichen Pokal;
Sie lässt den Pfad voll Blumen säen,
Die Tore auseinander gehen;
Sie sieht im bräutlichen Talar,
Den Myrtenzweig im blonden Haar.
Und dort beschwört den See der Held:
„Besitzen will ich ihre Welt!
Sei mein, du frohes Reich der Wellen!
Ihr sollt euch meiner Liebe stellen,
Versäumt die Untertanenpflicht,
Ihr hellen Geister, drunten nicht!“
Er schickt sich rasch zur Reise an,
Und furcht der Wogen klaren Plan,
Da summt und quillt es aus den Tiefen,
Als ob ihn Geisterstimmen riefen.
Er bannt sie mächtig aus der Gruft,
Denn droben ist, die ihn beruft.
Die Geister heben ihn empor;
Er tritt, den Blick voll Liebe, vor.
Er schreitet auf den Blumenwegen
Der Herrin durch das Tor entgegen.
Sie reicht ihm des Willkommens Trank
Und küsst vom Mund der Liebe Dank.
Sie blüh’n, ein friedlich Fürstenhaus,
Das dehnt sein Reich in Liebe aus. –
Die Wassergeister mit den Grotten,
Die Burgen und die Heldenflotten,
Die Insel, ihres namens Klang, –
Verschwanden längst im Zeiten Drang.
Georg Rapp.
1.Als die Bewerber um die Hand der lieblichen alemannischen Prinzessin, als welche hier der Bodensee mit seinen umliegenden Gauen allegorisch dargestellt wird, denkt sich der Dichter wahrscheinlich unter dem welschen Grafen die Römer, unter dem Alpensohne die Helvetier, und unter dem Frankenhelden das Haus der jetzigen Herrscher.
Conradin am See.[1]
Kaum ist der Frühling im Erwachen,
Es blüht der See[2], es blüht der Baum,
Es blüht ein Jüngling dort im Nachen,
Er wiegt sich in der Wellen Schaum.
Wie eine Rosenknospe hüllet
Ein junges Purpurkleid ihn ein,
Und unter einer Krone quillet
Sein Haar von güldenerem Schein.
Es irret auf den blauen Wellen
Sein sinnend Auge, wellenblau,
Der Leyer, die er schlägt, entschwellen
Gesänge von der schönsten Frau.
Des ersten Donners Stimmen hallen,
Im Süden blitzt es blutig rot;
Er lässt sein Lied nur lauter schallen,
Ihn kümmert nichts, als Liebesnot.
Und wenn er Minne sich errungen,
So holt er sich dazu den Ruhm,
Und herrscht, vom Lorbeerkranz umschlungen,
In seiner Väter Eigentum.
Kind! wie du stehst im schwanken Kahne,
So rufet dich ein schwanker Thron,
Vertrau’ dem Schatten nicht, dem Ahne,
Verlaß‘ner, armer Königssohn!
Du bist so stolz und unerschrocken,
Du sinkest, eh’ du’s nur geglaubt,
Die Krone sitzt auf deinen Locken,
Als träumte nur davon dein Haupt! –
Er höret keine Warnungsstimme,
Schwimmt singend auf dem Abgrund hin,
Was weiß er von des Sturmes Grimme?
Nach Lieb’ und Leben steht sein Sinn.
So gib ihm Leben, gib ihm Liebe,
Du wonnevolles Schwabenland!
Verdopple deine Blütentriebe,
Knüpf’ ihm der Minne selig Band!
Es hat zu leben kurz der Knabe;
Hauch’ ihm entgegen Lebensluft,
Durchwürze jede kleine Gabe
Mit ew’ger Jugend Blütenduft!
Mach’ ihm den Augenblick zu Jahren,
Den er an diesen Ufern lebt,
Dass er mit ungebleichten Haaren
An Freude satt gen Himmel schwebt!
Was ist’s? Er lässt die Leyer fallen,
Er springt ans Ufer, greift zum Schwert;
O seht ihn über Alpen wallen
Mit treuen Männern, hoch zu Pferd!
Der Lust, der Liebe Lieder schweigen,
Er glüht von edlerem Gelüst;
Er will der Väter Thron besteigen –
Und wandelt auf das – Blutgerüst.
Was willst du mit der Blumen Kranze,
Du grünes, seebespültes Land?
Was willst du, Luft, mit blauem Glanze?
Was willst du, leerer Kahn, am Strand?
Ihr wart geschmückt zu Freud’ und Wonne,
Dem letzten Staufen dientet ihr:
Verhüllet euch, o Erd’ und Sonne!
Denn es ist aus mit eurer Zier!
Gustav Schwab.
1.Vom herrlichen Stamm der Hohenstaufen war zuletzt nur noch ein schwaches Reis übrig: Friedrichs II., des größten Kaisers Enkel, Konrads IV. Sohn: Conradin, den ihm Elisabeth von Bayern, die Schwester Herzogs Ludwig des Strengen, zu Landshut geboren hatte. Mit dem Titel „König in Jerusalem und Sizilien und Herzog in Schwaben“ erwuchs er länderlos am Hof der Herzoge von Bayern, indessen Fürsten und Reichsvasallen dem reichen Richard von Cornwallis, Bruder des Königs von England, zu Worms huldigten, der zugleich mit Kaiser Philipps Enkel, Alphons von Kastilien, die gierigen Hände nach Schwaben ausstreckte (1259 n. Ch.). Erst als die Beiden, doch nur Schattenkönige, vom Schauplatz abgetreten waren (1260), erhoben sich die Freunde der Staufen wieder und einige echt deutsch Gesinnte fassten nochmals den Gedanken, den letzten Hohenstaufen auf den Thron zu setzen. Vergebens schleuderte Papst Urban Verbote und Gegenerklärungen. Eberhard Truchsess von Waldburg, Bischof von Konstanz, hatte sich erkühnt, die Vormundschaft und den Schutz Conradins zu übernehmen. Mit kleinem Gefolge war der elfjährige Knabe in sein väterliches Erbe gekommen. Seine Freunde hatten ihn zu Ulm und Rottweil Fürstentage halten lassen. Dann lebte er einige Zeit in Ravensburg und stieg endlich herab an die Ufer des Bodensees. Zeitgenossen schildern ihn als einen lieblichen und wunderschönen Jüngling von gebildeter Erziehung und der lateinischen Sprache so kundig, dass er sich aufs Vollkommenste darin auszudrücken wusste. Seinen edlen Geist entwickelte das tragische Schicksal seines Hauses, die Freundschaft, die Natur, deren heitere und belebende Einwirkung der zarte Jüngling an den blühenden Ufern des Sees tief empfand, und welche ihn vielleicht hier zu den, Jugendlust und doch ahnungsvolle Trauer atmenden Frühlingsgesängen in seiner schwäbischen Muttersprache begeisterten, wie wir sie gleich zu Anfange die Manessische Minneliedersammlung schmücken sehen. So zog er in seinem väterlichen Herzogtum umher, um aus den Trümmern des Hohenstaufischen Erbes Mittel zu seinem italienischen Kriegszuge zu sammeln. In Arbon, dicht am Gestade des Sees, verlebte er ein halbes Jahr und verlieh, „wegen der langen Gegenwart Unsrer Diener und Unsrer Hoheit,“ den Bürgern das Gericht und den Blutbann. Armer Conradin! was für süße Hoffnungen sprossten damals in deiner jungen Brust auf, als du um diese Zeit, bei der kleinen Stadt Engen im Hegau, dem Grafen Rudolf von Habsburg die Anwartschaft auf die Kyburgischen Reichslehen gabst, „wenn du erwählt und ernannt, die höchste Stufe, den Thron des römischen Reichs erstiegen haben würdest!“ Diesem Rudolf, der wenig Jahre nachher, auf dem Schutte der Hohenstaufen, sich und seinem Hause einen länger dauernden Thron errichtete; aber die Stufen, die du erstiegst, königlicher Jüngling, führten dich zu dem Mordblocke, auf welchem dein edles Haupt fiel! (Aus des Freiherrn von Laßberg’s Bildersaal, II. S. 89.)
2.Das Blühen des Sees hat derselbe wohl mit mehreren Landseen gemein. Im März sind nämlich oft ganze Strecken seines Wassers mit einem gelben Staube bestreut, der sich bald schleimig zusammenhängt, und erst nach tagelangem Umherschwimmen verschwindet. Diese Erscheinung kann nicht vom Blähen der Wasserpflanzen herrühren, da der See deren nur wenige hat; es ist vielmehr nichts anders, als der männliche Samenstaub der an den Ufern wachsenden Obst- und Waldbäume. (siehe Gustav Schwabs: „Der Bodensee und das Rheintal etc.“)
Friedrich Otte, der Elsässische Dichter, besingt dies Blühen wie folgt:
Wenn von dem Himmel nieder die Abenddämm‘rung steigt
Und sich das Haupt der Blume zu sanftem Schlummer neigt,
Da fängt, wenn alles feiert, wenn Schiffer ruht und Kahn,
Im See ein andres Leben, ein andres Blühen an.
Die Welle, die so fröhlich das Ufer erst bespült,
Sie legt sich leise nieder, vom Abendwind gekühlt.
Und dunkle Purpurröte steigt aus der Tiefe Quell
Und macht die Seeflut glänzen gleich einer Rose hell.
Gleich einer Rose duftig, von zart gewob‘nem Schein,
Es strahlen die Zauberfarben weit in die Nacht hinein.
– Das ist ein Werk der Feyen tief in des Wassers Grund;
Die treiben da ihr Wesen in stiller Abendstund’.
Beim hellen Sonnenschimmer kann nicht ihr Werk gedeih’n,
Der Mond in stillen Nächten begünstigt sie allein.
Da springen auf die Pforten des Schlosses von Kristall,
Es heben sich aus den Tiefen die leichten Wesen all;
Laut jubeln sie und schlingen den Reigen strandentlang
Und freuen sich des Zaubers, der ihnen gut gelang;
Kaum aber ruft den Morgen der muntre Wächter an,
Da fängt die schimmernde Rose sich zu entfärben an;
Und wenn der Alpen Stirne im Morgenstrahl erglüht,
Da feiern die Nixen wieder, da ist der See verblüht
(Siehe Gedichte von Friedrich Otte. Basel, 1845. Schweighauser. S. 157.)
Der Reiter und der Bodensee.[1]
Der Reiter reitet durchs helle Tal,
Aufs Schneefeld schimmert der Sonne Strahl.
Er treibet im Schweiß durch den kalten Schnee, –
Will heut noch erreichen den Bodensee;
Noch heut mit dem Pferd’ in den sichern Kahn
Will drüben noch landen vor Nacht er an.
Auf schlimmem Weg, über Dorn und Stein,
Er braust auf rüstigem Ross feldein.
Aus den Bergen heraus, ins ebene Land,
Weit sieht er sich dehnen das Schneegewand.
Weit hinter ihm schwindet so Dorf wie Stadt,
Der Weg wird eben, die Bahn wird glatt.
In weiter Fläche kein Bühl, kein Haus,
Die Bäume gingen, die Felsen aus;
So flieget er hin eine Meil’ und zwei,
Er hört in den Lüften der Schneegans Schrei;
Es flattert das Wasserhuhn empor,
Nicht andere Laute vernimmt sein Ohr;
Keinen Wandersmann sein Auge schaut,
Der ihm den rechten Pfad vertraut.
Fort geht’s wie auf Samt, auf dem weichen Schnee;
Wann rauscht denn das Wasser? wann glänzt der See?
Da bricht der Abend, der frühe herein,
Von Lichtern blinket ein ferner Schein.
Es hebt aus dem Nebel sich Baum an Baum,
Und Hügel schließen den weiten Raum.
Er spürt auf dem Boden Stein und Dorn,
Dem Rosse gibt er den scharfen Sporn.
Die Hunde bellen empor am Pferd,
Und es winkt im Dorf ihm der warme Herd.
„Willkommen am Fenster, Mägdelein,
An den See, an den See, – wie weit mag’s sein?“
Die Maid, sie staunet den Reiter an:
„Der See liegt hinter dir und der Kahn.
Und deckt ihn die Rinde von Eis nicht zu,
Ich spräch’, aus dem Nachen stiegest du.“
Der Fremde schaudert, er atmet schwer:
„Dort hinten die Eb’ne, die ritt ich her!“
Da recket die Magd die Arm in die Höh’:
„Herr Gott! so rittest du über den See!
„An den Schlund, an die Tiefe bodenlos
Hat gepocht des rasenden Hufes Stoß!
„Und unter dir zürnten die Wasser nicht?
Nicht krachte hinunter die Rinde dicht?
„Du wardst nicht die Speise der stummen Brut?
Der hungrigen Hecht’ in der kalten Flut?“ –
Sie rufet das Dorf herbei zu der Mähr,
Es stellen die Knaben sich um ihn her;
Die Mütter, die Greise, sie sammeln sich:
„Glückseliger Mann, ja, segne du dich!
„Herein zum Ofen, zum dampfenden Tisch,
Brich mit uns das Brot und iss vom Fisch!“
Der Reiter erstarret auf seinem Pferd,
55
Es stocket sein Herz, es sträubt sich sein Haar,
Dicht hinter ihm grinset noch die Gefahr.
Es sieht sein Blick nur den grässlichen Schlund,
Im Geist versinkt er im schwarzen Grund.
Im Ohr ihm donnerts, wie krachend Eis,
Wie die Well’ umrieselt ihn kalter Schweiß.
Da seufzt er, da sinkt er vom Ross herab,
Da ward ihm am Ufer ein – trocken Grab.
Gustav Schwab.
1.Bekanntlich ist der Bodensee, bei all seiner großen Tiefe, schon mehrmals in strengen Wintern gänzlich zugefroren. Man berichtet solches von den Jahren 1277, 1435, 1560, 1573, 1587, 1695, 1788 und 1830. Diese Gelegenheiten benützte man oft zu ausgedehnten Lustpartien auf dem Eise; so hielten 1573 zweihundert Konstanzer Bürger zu Fuß und zu Pferd die Aschermittwochschlacht auf dem See. Im Jahr 1695 gab die Stadt Arbon ein Freischießen auf demselben. Auch im Jahr 1830 fanden mehrere Belustigungen darauf Statt; Krämerbuden, Schenkzelte waren aufgeschlagen, Musikbanden spielten auf, Kegel wurden geschoben und eine Menge Leute lustwandelten sorglos auf der glatten Fläche hin und her.
Graf Gero von Montfort.[1]
Von Montfort war’s der greise Graf,
Gesättigt von dem Leben,
Der sah den blauen See im Schlaf,
Und stille Kähne schweben,
Auf Wasser, Erd’ und Himmel Ruh’;
Da flog sein Herz dem Frieden zu.
Und als vom Traum er aufgewacht,
Da ruft er seine Knechte,
Hat sie belobt und gut bedacht,
Nimmt Abschied vom Geschlechte,
Verlässt die Herrschaft und das Schloss,
Und zieht zum fernen Strand zu Ross.
Wie nun er an das Ufer trabt,
Hört guten Wind er sausen,
Und trifft am Strand den frommen Abt
Vom heiligen Petershausen,
Dazu ein Schiff, die Segel voll;
O wie sein Herz von Sehnsucht schwoll!
Sankt Peters Haus, die stille Statt,
Von Wellen leis bespület,
Sein Geist sich ausersehen hat
Vom Ird’schen abgekühlet;
Dort will er dienen Gott dem Herrn,
Von Lust und Pracht der Erde fern.
Den Abt erquickt der heil’ge Sinn,
Er hebt ins Schiff den Grafen;
Wohl bringt dem Kloster das Gewinn
Sie stoßen ab vom Hafen.
Schon schwimmt das Schiff auf blauer Flut –
Wie wird dem Greise da zu Mut!
Er spricht gerührt: „O fühltet Ihr,
Herr Abt, was ich empfinde!
Es blickt das Wasser auf zu mir,
Wie Mutter nach dem Kinde!
Denn wisst, bei jenes Hornes[2] Riff
Geboren ward ich einst im Schiff.
Und wenn ich in dem Nachen drin
So sanft geschaukelt liege,
Wird mir wie einem Kind zu Sinn,
Als ruht’ ich in der Wiege;
Die Mutter lispelt in mein Ohr
Und singt ein Schlummerlied mir vor.“
Derweil sie segeln frisch nach vorn,
Da übermannt’s den Grafen;
Sie sind nicht ferne mehr vom Horn,
So hebt er an zu schlafen,
Und bei der Ruder gleichem Schlag
Er schlummernd auf dem Schiffe lag.
Und wie das Schiff vorüberzieht,
Dort, wo er ward geboren,
Da tönt das süße Wiegenlied
So hell in seinen Ohren;
Er schlug die Augen auf und rief:
„O Mutter, wie so tief ich schlief!“
Er schließt die Augen wieder zu,
Noch tiefer fortzuschlafen:
Steh, Nachen, still! nicht eile du!
Dein Gast ist schon im Hafen.
Der Abt zu seinen Füßen kniet,
Ihn mit dem letzten Trost versieht.
Bringt ihn zum heil’gen Haus hinab,
Legt in den Chor den Frommen;
Dort rauscht die Flut, die einst ihn gab,
Und die ihn jetzt entnommen;
In süßem Frieden, frei von Harm,
Ruht er der Welle dort im Arm.
Gustav Schwab.
1.Graf Gero, der Familie von Montfort angehörig und Herr von Pfullendorf, beschloss im höheren Alter, der Welt zu entsagen und in dem Kloster Petershausen dem Himmel zu leben. Voll Sehnsucht nach dieser Ruhestätte entdeckte er am See, auf einer Reise begriffen, sein Vorhaben dem Abte jenes Klosters; setzte sich mit ihm zu Schiffe und segelte dem Hafen zu; aber ihn sollte noch eine stillere Ruhestätte aufnehmen. Er ward noch auf der Fahrt schwer krank; und an der schmalen Landzunge, die unweit Konstanz sich ins Wasser streckt und schon damals das Eich-Horn hieß, starb der Greis im Schiffe, das jetzt den Toten wiegte, wie es einst den Säugling gewiegt hatte; denn er war zu Schiff auf dem Bodensee geboren. Seine Hülle ward an der Stätte seiner Sehnsucht, zu Petershausen, bestattet. (Siehe Gustav Schwab: „Der Bodensee nebst dem Rheintale etc.“)
2.Horn heißt am Bodensee so viel wie Landzunge.
Tegelstein.
Auf der Burg Tegelstein am Bodensee lebte einst eine reiche Witwe, Anna von Tegelstein, mit ihrem Sohne und drei Töchtern. Sie war eine überaus stolze Frau und gönnte den Armen kaum die Luft und das Brot. Eines Tages kam auf die Burg eine Pächterin aus der Gegend, in Trauer gekleidet und sprach zur Edelfrau: „Gnädige Frau, gestern ist meine einzige Tochter gestorben; sie war erst achtzehn Jahre alt und die Freude meines Lebens. Nun möcht ich gern um ihre schwarzen Locken einen Kranz von weißen Rosen flechten, da sie doch eine Braut des Himmels geworden. Vergönnt mir, dass ich welche in Eurem Schlossgarten breche, wo sie so schön und reichlich blühen!“ – „Was da!“ – fuhr sie die stolze Frau an – „einen Kranz von Nesseln magst du für dein Mädel binden! Rosen geziemen sich nicht für so gemeines Volk; die sind nur für unsers Gleichen!“ „Nun,“ – versetzte mit feierlichem Tone und einem klagenden Blick zum Himmel die arme Pächterin – „so mögen denn Eure Rosen zu Totenkränzen für Eure Töchter werden!“ – und verließ das Schloss. Aber ihren Wunsch hatte Gott vernommen. Noch vor Ablauf eines Jahres starben alle drei Töchter der Edelfrau, und jede trug im Sarg einen Kranz von weißen Rosen aus dem Burggarten. Und so lange das Geschlecht der Tegelsteiner[1] blühte, sah man jedes Mal, wenn der Tod eines weiblichen Abkömmlings der Familie nahe war, den Geist der hochmütigen Frau Anna um Mitternacht im Schlossgarten sitzen und einen Kranz von weißen Rosen flechten.
(Aus Al. Schreibers: „Sagen aus den Rheingegenden etc.“)
1.Wo ihr Schloss am Bodensee liegt oder lag, habe ich nirgends auffinden können; vielleicht ist Tegelstein nur ein willkürlich ersonnener Name, wie eben in Bezug auf Lokalitäten H. Aloys Schreiber es nicht besonders strenge zu nehmen pflegte. Der Herausgeber.
Konstanzs Ursprung.
Der Syndicus Dr. J. F. Speth beginnt seine unter dem Titel „Der in der Constantinisch-dreybogigen Ehrenporte Constantzisch- mit dreifachem Ruhm prangend- Glor- Sieg- und Ehr-reiche Creutz-Schild. Oder Dreiteilige Beschreibung der, nach Alter Red-Arth Beständig in der Tat, Edlen, Vöst- und Ehrsamen Stadt Constantz, etc. etc. erschienene Geschichte von Konstanz folgendermaßen:
“Es ist zwar freylich kein Kinderspihl, wann ein altes Weib tantzet! Allein wann ein alter Mann nicht von älteren Sachen, als er selber ist, zu reden weist! so stehet er gleichsamb noch in Kinder-Schuechen, dann, wie Cicero de orat. perf. recht und wohl gesprochen, “nescire, quid ante te actum sit, est quasi semper puerum esse.“ –
Hierauf beweist unser geschmackvoller Chronist durch Citate aus Gabriel Buccelinus Descript. Constant. und anderen Quellen, „dass die Stadt Constantz ihre erste Aufferbauung urspringlich von des Noë Enklen nicht lange Zeit nach dem Sündfluss und allgemeinen Welt-Überschwämung herleiten, folglich einer weit älteren Herkunft, als die sonst älteste Städte in deutschen Landen, sich rühmen möge etc.“ „Genug ist es,“ – fährt Dr. Speth, (Seite 7) fort – „dass die Stadt Constantz bereits schon in dem Jahr nach Erschaffung der Welt 3820, von denen benachbart-Allemanischen Völckeren, Harudes genannt, nicht nur den Namen “Harudopolis“ getragen, sondern auch von dem negst-anligent-, damals sogenandt Moësischen See (Bodensee) “Moësopolis,“ und ferners von dem Röm. Heers-Führer Valerio eine geraume Zeit lang “Valeria,“ alsdann aber “Vitodurum,“ auch “Gannodurum“ und endlich von einer auff der negst angelegenen Insul deß Rheins, nach einer von denen Römern zur Erhaltung deß eroberten Volcks und Lands erbauten Burg, worinnen die Römische Landpfleger residierten und der H. Pelagius seiner Zeit gefangen lag, „Nider- oder Wasser-Burg“ benamset worden, welchen Namen sie nebst dem Schild oder Wappen, welches eine Burg vorstellte, so lang behalten, bis der Römische Kayser Flavius Constantius, mit dem Bey-Namen Chlorus, im Jahr n. C. G. 297 wider die aufgestandene Deutsche, so damahlen gegen die Römer sich empöret und die Stadt Constantz oder noch sogenandte Stadt Niderburg nebst der umliegendten Landschafft Alemannia dazumahls erschröcklich verherget hatten, einen herrlichen Sieg allernegst bei der Stadt Constantz erfochten, in welchem 60 biß 70,000 Deutsche auff dem Platz gebliben, und lange Zeit hernach die Felder mit Toten-Cörperen also angehaüffet waren, dass von denselben die Erden, wie mit einem Schnee bedeckt, und in späteren Zeiten sowohl in der Petershauser Vorstadt, als in dem Ziegelgraben zu Constantz eine große Menge zerhauener Haupt-Schidelen und Menschen-Gebeiner in Nachgrabung zu denen Fundamenten, samt einigen Römischen, des Kaysers Constantii Regierung andeutenden Müntzen, gefunden wurden. Derohalben ist zu ewiger Gedächtnuß dises Siegs, und in Ansehung der so rar- als annemlichen Orths-Situation auff die Rudera der von denen Deutschen zerbrochenen uralten Stadt Amtodurum (das ist anjetzo Constantz) von Constantius nicht nur eine neue Römische Reichs-Stadt gebauet, sondern auch dieselbe mit eingeführter Colonia einiger auserleßenen edlen Römeren besetzet, und nach seinem Namen Constantia genennet worden.“
Den Grundstein zum Dome dieser Stadt soll Kaiser Karl der Große gelegt haben.
Dr. Speth.
Um die Mitte des neunten Jahrhunderts starb zu Neidingen der deutsche König Carl der Dicke, der für Konstanz mit besonderer Vorliebe eingenommen war und öfters in dieser Stadt oder auf der Insel Reichenau sein Hoflager aufschlug, in welcher letzteren er auch begraben liegt. Der Chronikschreiber Buccelinus meldet, Carls Leichnam sei von Neidingen (an der Donau) aus, von vom Himmel herabgeschwebten Lichtern bis in die Reichenau begleitet worden.
Dr. Speth.
Der heilige Conrad und die Giftspinne.
Dieser H. Conrad, ein „geborener Graf von Altdorf,“ – erzählt Dr. Speth





























