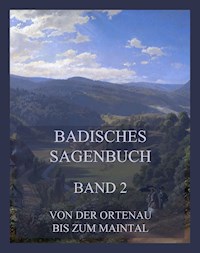
Badisches Sagenbuch, Band 2 E-Book
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In zwei Bänden, auf über 950 Seiten, hat August Schnezler eine Sammlung der schönsten Sagen, Geschichten, Märchen und Legenden des Badnerlandes aus Schrifturkunden, dem Mund des Volkes und der Dichter zusammengetragen. Das Ganze wurde versehen mit sehr vielen Fußnoten als historische und erklärende Anmerkungen und ergibt so ein für an Mythologie und Geschichte interessierten Lesern kaum mehr wegzudenkendes Referenzwerk – wobei sich das Land Baden an den Mitte des 19. Jahrhunderts gültigen Grenzen definiert. Insofern geht die märchenhaftes Reise vom Bodensee über Linzgau und Hegau, Rheintal, Albgau und die Waldstädte ins Breisgau und Kinzigtal, (Band 1) und von dort durch die Ortenau, das Renchtal, das Achertal, den Mummelsee, Bühl, Baden-Baden, das Murgtal, Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg bis ins Neckar- und Maintal nach Wertheim (Band 2). Entdecken Sie viele, viele Hundert bezaubernde Sagen und Geschichten, die dieses wunderschöne "Ländchen in Gottes Hand" ausmachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Badisches Sagenbuch
Band 2: Von der Ortenau zum Maintal
AUGUST SCHNEZLER (HRSG.)
Badisches Sagenbuch Band 2
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849662387
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Das Rheintal. 1
Ortenau. 3
Die erlöste Schlange. 3
St. Landolins Bad. 3
Das Kruzifix von Wittenweier. 4
Lahrs Ursprung. 4
Ursprung von Hohengeroldseck. 5
Walther von Geroldseck.[1] 6
Kloster Schuttern. 10
Offenburgs Ursprung. 10
Ritter Peter von Stauffenberg und die Meerfeye. 11
Ritter Staufenberg. 19
Melusine im Stollenwald. 27
Der Teufelsstein auf der Schiehald. 28
Der Schatz im Stollenberg. 28
Der Fuß in der Wand. 29
Hanauer Ländchen. 32
Sage vom Korker Waldgericht. 32
Bischofsheim, 33
Der Leichenzug zu Scherzheim und das wilde Heer. 33
Renchtal und Seitentäler. 34
Der Bannacker. 34
Der Ring. 35
Allerheiligens Stiftung.[1] 36
Allerheiligens Ende.[1] 37
Die Felsenkirche. 39
Der Reitersprung. 40
Der Zigeunerwald. 40
Achertal und Seitentäler. 42
Turennes Fall.[1] 42
Das Brigittenschloss.[1] 43
Brigitta von Hohenrode. 45
Das Brigittenschloss. (Hohenrode) 46
Der Burggeist auf Rodeck. 52
Der Retter von Rodeck. 53
Die Klosterruine zu Seebach.[1] 56
Die Helden vom Kappler Tal. 57
Das Bergweiblein. 58
Die Frau von Bosenstein.[2] 60
Die drei Jungfrauen aus dem See. 64
Die drei See-Schwestern.[1] 65
Mummelsee und Nachbarseen. 68
Zehn Romanzen vom Mummelsee im Schwarzwald.[1] 68
Die Geister am Mummelsee. 84
Der Jäger am Mummelsee. 85
Der Jägersmann. 86
Mummelsees Geschenk. 87
Eine Wanderung nach dem Mummelsee. 88
Die Braut vom Bergsee. 96
Der Ritter und das Seefräulein. 97
Die guten Seejungfrauen. 99
Aus dem „Simplicissimus.“. 100
Das Mümmelchen. 101
Der Wildsee. 102
Das Männlein vom See. 102
Der Nonnensee. 105
Die Nonnen singen nicht mehr. 106
Der Nixe Wechselbalg. 107
Anmerkungen zu den Mummelsee-Sagen. 107
Bühl und nächste Umgebung. 112
Der Hexenturm in Bühl.[1] 112
Der Hexenturm bei Bühl. 113
Die Narrenzunft in Bühl. 114
Das Lindenkirchlein. 115
Die Lindenkirche. 115
Der ausgelieferte Schatz. 116
Hexenbutter. 117
Des Affentalers Ursprung.[1] 117
Sagen von der Burg Windeck. 119
Die Jungfrau auf Burg Windeck. 120
Der lange Gang. 121
Das Huhn zeigt den Kirchenplatz. 121
Der Hennegraben. 121
Der treulose Schreiber. 124
Das Burgfräulein von Windeck. 124
Hugo von Windeck. 125
Das Fräulein von Windeck.[1] 127
Die tote Braut. 128
Die Jungfrau auf Burg Lauf. 130
Garlinde. 131
Der nächtliche Tanz. 133
Die Hub.[1] 134
Erwin von Steinbach.[1] 136
Erwins-Bild. 139
Die Kröte. 142
Luftritt. 142
Oosgau, Baden-Baden und Umgebung. 143
Baden-Baden. 143
Die Sage von Baden’s Ursprung. 145
Das alte Schloss zu Baden. 149
Die graue Frau von Hohenbaden. 150
Das Femgericht in Baden. 153
Christoph von Baden. 154
Ludwig von Baden. 156
Noch einige Sagen vom alten Schloss zu Baden. 159
Silbergrube. 160
Der Hungerberg. 161
Das Kreuz auf dem Friedhof. 161
Das Kreuz auf dem Friedhof. 162
Kellers Bild und Kreuz. 165
Kellers Bild. 166
Der Lindenschmidt. 168
Der versunkene Wagen. 170
So fährt man zum Teufel. 170
Ein Gespenst liest Messe. 171
Das Reh im Steinwäldchen. 171
Die Sage vom Baldreit. 172
Fremersberg. 173
Der Ahornbaum. 176
Die Altenburg. 177
Schlage deine Mutter nicht! 178
Kloster Lichtental. 179
Aus Lichtental. 180
Lichtental. 181
Die Rettung des Klosters Lichtental. 183
Die Stiftung des Waisenhauses in Lichtental. 186
Der Wasserfall von Geroldsau. 187
Die Hütte zu Ebersteinburg. 190
Sagen von der Burg Alt-Eberstein. 190
Die Belagerung von Alt-Eberstein.[1] 191
Graf Eberstein. 192
Das Kloster bei Eberstein. 193
Die Hauenebersteiner Glocke. 195
Riesen im Wasser. 195
Die Geister führen irre. 195
Die Drei-Eichenkapelle. 196
Sagen von der Yburg. 198
Die Yburg. 198
Das goldene Kegelspiel. 199
Yburgs Fall.[1] 200
Die böse Müllerin von Zell. 204
Fortunat von Baden. 204
Das Blutfeld. 207
Die Teufelskanzel. 209
Die Teufelskanzel und Kloster Engelsburg. 211
Die Wolfsschlucht. 212
Die Wolfsschlucht. 213
Anmerkungen zu den Sagen von Baden. 215
Murgtal 229
Die Wolfsschlucht und die Waldkapelle bei Selbach. 229
Die Hölle. 231
Die Teufelsmühle. 232
Der Klingel. 233
Sagen von der Klingelkapelle und vom Schloss Eberstein. 233
Der Koch zu Eberstein. 237
Die Belagerung von Neu-Eberstein. 240
„Von den Grafen von Eberstein. 242
Der Grafensprung. 243
Der Grafensprung bei Neu-Eberstein. 244
Das Rockenweibchen. 244
Des Nesselhemd. 246
Die Gräfin im Rockertwald. 248
Gaggenau. 248
Die Geisterhöhle. 250
Hilpertsloch. 250
Die Elisabethsquelle zu Rothenfels. 251
Die drei Schwestern. 253
Muckensturm.. 255
Markgraf Ludwig von Baden, der Türkenbezwinger. 255
Das Rastatter Schloss. 257
Albtal 262
Die Entstehung von Herrenalb.[1] 262
Die Stiftung von Frauenalb. 263
Johann von Hohenwart. 266
Fürstenzell.[1] 270
Die umgehenden Feldmesser. 272
Der Ring am Ettlinger Kirchturm.[1] 273
Streit zwischen Ettlingen und Frauenalb. 273
Das Rad von Malsch. 274
Karlsruhe und nächste Umgebung. 275
Karlsruhe. 275
Die Gründung von Karlsruhe. 276
Die weiße Frau. 279
Kunde von Jenseits. 279
Die Hexenwäsche. 281
Carl Friedrich im Jahre 1806. 281
Die hohe Ruhe. 282
Gottesaue. 283
Die Geister zu Gottesau. 288
Die Kirche von Hagsfeld. 289
Die beschirmten Kronen. 290
Rüppur. 290
Die Wallfahrtskirche von Bickesheim. 291
Durlacher Sagen. 292
Durlachs Namensursprung. 292
Die Paulwirtin. 292
Herzog Konrad von Schwaben in Durlach. 292
Der Markgraf und die Mönche. 295
Geld sonnt sich. 297
Sagen vom Turmberg bei Durlach. 297
Sagen von Wolfartsweier. 300
Glocke läutet von selbst. 301
Sagen vom Turmberg bei Wolfartsweier. 301
Das Dorftier. 303
Der verfahrene[1] Schüler. 303
Das freigebige Erdmännlein. 305
Erdmannskuchen. 305
Sagen von der Barbarakirche bei Langensteinbach.[1] 305
St. Barbara. 307
Die weiße Frau bei Langensteinbach. 308
Der Rothackergeist und der wilde Jäger. 311
Junker Marten und der wilde Jäger. 311
Pforzheim und Umgegend. 312
Das von den Juden getötete Mägdlein. 312
Die vierhundert Pforzheimer. 312
Die Pforzheimer Bürger. 316
Triumphzug kindlicher Liebe. 319
Die Pest in Pforzheim. 321
Die Toten wollen Ruhe. 323
Der böse Hausgeist Blaserle. 324
Hausgeist Blaserle. 324
Die Nonnen zu Weißenstein. 325
Der nächtliche Schlachtlärm. 326
Der bestrafte Sakramentschänder. 326
Der feurige Mann. 326
Kraichgau und Elsenzgau. 328
Die kleine Fürstengruft. 328
Der Rekrut auf Philippsburg. 328
Das Gnadenbild zu Waghäusel. 330
Die Kapelle zu Waghäusel. 330
Der enteiligte Gürtel. 331
Teufelskutschen. 331
Das mildtätige Männlein. 332
Das Hündchen von Bretten. 332
Der wachsende Stein.[1] 336
Der Schwabe vor Bretten. 337
Ein Gespenst pflügt. 338
Gespenst ins Haus gebracht. 338
Die übel belohnte Hexe. 339
Arbeit in der anderen Welt. 339
Schatz in Flehingen. 339
Sage vom alten See. 340
Tiefenau. 340
Die See-Nonnen von Tiefenau. 341
Das versunkene Kloster. 344
Der Nixenquell. 345
Die schöne Buche. 346
Der Metzger bei der Hexenversammlung. 346
Der dreifüßige Hase. 347
Der Gänsberg. 347
Der Teufelsbeschwörer. 348
Das behexte Kind in Nußloch. 348
Mannheim und nächste Umgegend. 349
Mannem. 349
Mannheims Ursprung. 351
Die weiße Dame. 351
Der Rheingeist. 352
Der Gast in der Rheinmühle. 352
Das Feuer und der Trappgaul. 353
Die Teufelskarosse. 353
Die Hexe und der Mühlknecht. 355
Der Rosengarten. 355
Das Teufelsloch. 361
Das Geläute von Ladenburg.[1] 362
Pfälzer Bergstraße. 363
Der Edle von Handschuchsheim. 363
Gertraut von Gemmingen zu Handschuchsheim. 368
Die Toten wollen begraben sein. 369
Wein aus den Brunnen. 369
Sage vom Schloss Windeck.[1] 369
Der Spruch auf der Burg Windeck. 373
Der Hexenturm in Weinheim. 374
Der Geist des Burgkochs auf Windeck. 375
Die zwei letzten Burgherren. 375
Das Burgfräulein von Windeck. 376
Die Stiftung von Heiligkreuz. 377
Heidelberg und nächste Umgebung. 380
An Heidelberg. 380
Heidelbergs Ursprung. 381
Die Heidelberger Ruine. 382
Neckarsage. 384
Der Pfalzgraf am Rhein.[1] 385
Eberhard der Heilige. 387
Herzog Otto der Erlauchte und die schöne Welfentochter. 388
Ludwig der Strenge. 395
Friedrichs I. Rettung aus Weiber- und Pfaffenlist. 396
Derbe Warnung. 397
Das Lied der Markgrafen. 397
Kurfürst Friedrich der Sieghafte von der Pfalz. 402
Das Mahl zu Heidelberg. 409
Trutzkaiser. 413
Pritschen-Peter. 415
Konrad Pocher. 416
Ein Schreckenstag. 417
Heinrich von Valois, Herzog von Anjou. 418
Mäßigkeitsvereine. 421
Des Pfalzgrafen hölzerner Dom. 422
Hans von Handschuchsheim Tod[1]. 424
Die Ahnung. 427
Der Pfalzgraf.[1] 429
Der Blitz. 430
Auf dem Schloss zu Heidelberg. 432
Der Hexenbiss. 436
Der Riesenstein. 437
Der Wolfsbrunnen. 439
Die Sage vom Wolfsbrunnen. 440
Der Wolfsbrunnen bei Heidelberg. 443
Am Wolfsbrunnen bei Heidelberg. 446
Der Jettabühl. 446
Der Königsstuhl.[1] 448
Der Heiligenberg. 449
Puncker von Rohrbach. 449
Neckartal und Odenwald. 451
Der Ritter von Angeloch.[1] 451
Dilsberg. 454
Die Hochzeitfeier. 454
Ritter Landschaden. 458
Die heilige Hildegunde zu Schönau.[1] 459
Der falsche Eid. 462
Reiter ohne Kopf. 463
Die weiße Frau. 463
Gespenstischer Hund. 463
Burg Stolzeneck. 464
Jukunde von Stolzeneck. 467
Die heilige Notburga. 468
Sagen vom Minneberg. 471
Der Minneberg. 473
Der getreue Hirsch. 476
Das Lied vom Hornberg. 478
Der Michaelsberg. 479
Kloster Himmelreich. 480
Der fromme Lukas. 483
Die weiße Frau zu Guttenberg. 485
Die Kapelle bei Dallau.[1] 486
Die Nonne zu Dallau. 487
Die Nonne. 489
Odenwäldisches Bauland. 490
Doktor Faust zu Boxberg. 490
Warum der Schillingstädter Schulze zu spät vor Amt kommt. 490
Wölfingen. 491
Von der Burg zu Boxberg. 491
Die meineidige Hochzeit. 492
Rosenberg.[1] 493
1. Der Überfall. 493
2. Ritters Frevel. 494
3. Ritters Strafe. 496
Buchens Hochmut und Strafe. 497
Die Lappe. 498
Das strafende Madonnabild. 498
Die gemiedene Kanzel. 498
Die Entstehung der Wallfahrtskirche zu Walldürn. 499
Sagen von der Jörgenburg. 499
Der Marsbrunnen und die Meerweiblein. 500
Taubergrund und Maintal 502
Hammerwurf des Riesen. 502
Die Riesen und die Menschen. 502
Der Bildstock mit der Näherin. 502
Die Zerstörung von Oberlauda. 503
Die Niederlage der Bauern in der Schlacht bei Königshofen. 504
Ein zweiter Geßler. 505
Die heilige Lioba zu Bischofsheim. 505
Von der Christnacht. 506
Spinne nicht im Mondschein! 506
Der schützende Stein. 506
Schätze in und bei Reicholzheim. 507
Sagen aus der Gegend um Wertheim.. 508
Vorzeichen eines gesegneten Herbstes. 508
Der Sichelesacker. 508
Die Kreuze oberhalb Reicholzheim. 508
Der Streitacker. 509
Der Freijäger. 510
Die Wettenburg. 510
Andere Sagen von der Wettenburg. 511
Der Kürlesgarten bei Bischofsheim. 512
Das Schaf fängt den Wolf. 515
Die Leiten. 516
Von der Burg zu Wertheim. 516
Die Kapelle im Haslocher Tal. 516
Sage aus dem Waldsassengau. 517
Doktor Luther in Wertheim. 517
Die ähnlichen Frauen. 517
Der Hirsch zu Wertheim. 517
Die rettende Glocke. 518
Die Gräfin zu Werteim. 520
Das Rheintal.
Strom der Heimat, mir so lieb! hast Jahrtausende gesehen,
Die nicht auf den Tafeln stehen, welche die Geschichte schrieb.
Doch verzeichnet sind sie dort in den wild getürmten Schichten;
Was die Berge uns berichten, ist ein unvergänglich Wort.
Eine neue Sonne scheint, seit die treuen Heliaden
An den öden Schilfgestaden um des Bruders Tod geweint.
Haben nicht den Dattelwein fromme Völker hier getrunken?
Doch die Palmen sind versunken und ihr Mark gefror zu Stein;
Und des Ölbaums heilig Laub, das des Markwalds Höhen schmückte,
Das der Schlangentöter pflückte, wurde des Gewässers Raub.
Ja, ein Eden hat geblüht in des Rheines mildem Tale,
In des Himmels erstem Strahle, eh’ der Kaiserstuhl geglüht;
Eh’ noch Jovis Sternenring sich zum festen Kern verdichtet,
Eh’ ein Gott die Welt gerichtet, und die Nacht den Styr umfing.
Ach, in dunklen Sagen nur hat sich jene Zeit erhalten,
Und des Nordes Stürme walten auf der Paradieses-Flur.
Das dämonische Geschlecht, dessen Hüften wir entsprungen,
Spie zum Himmel Lästerungen, trotzend auf ein Götterrecht.
„Menschen, unsre Kinder, ihr mögt die Erde von uns erben,
Jenes bessre Reich erwerben über Sternen wollen wir.“
Und sie klimmen keck hinan zu dem hohen Wolkensitze,
Und sie achten nicht der Blitze auf des Kampfes luft’ger Bahn.
Aber plötzlich braust das Meer, Feuerbäche gießen nieder,
Über der Titanen Glieder wälzen sich die Berge her.
Eine Wüste steigt empor: Lavafelsen aus den Gluten,
Knochenberge aus den Fluten – Sinnend steht der Mensch davor;
Wohl, die Toten schweigen nicht, reden müssen, die verwesen,
In der Asche kann er lesen, in den Gräbern brennt ein Licht.
Bald auch regen ihm die Hand Kräfte seiner Riesen-Ahnen,
Stimmen hört er, die ihn mahnen an sein altes Vaterland.
Und zum Kampfe fasst er Mut, zwingt die Erde, ihm zu dienen,
Weiß die Gottheit zu versühnen, muss es sein, mit eig‘nem Blut.
Und des Rheines öder Grund wandelt sich zum Blumengarten,
Und die Hände, die ihn warten, schlingen sich zum Freiheitsbund;
Städte spiegeln sich im Strom, Schönheit waltet in dem Leben,
In die Wolken hoch erheben muss sich Erwins stolzer Dom.
Und in Ton und Farb’ erblüht, was kein ird’scher Sinn vernommen,
Was von oben nur gekommen in das liebende Gemüt. –
Schönes Tal am blauen Rheine, mit versunk‘nen Heldenmalen!
Herrlich wird dein Name strahlen bis zum letzten Sternenschein.
Deiner Söhne heil’ge Schar, nimmer wird sie Nied‘res dulden,
Was die Zeiten auch verschulden, löst sie fromm am Blutaltar.
Aloys Schreiber.
(In Bezug auf vorstehendes Gedicht, welches uns wieder in das lachende Rheintal einführt, vergleiche die zweite Note zu Jos. Baders Einleitung im ersten Band.)
Ortenau
Die erlöste Schlange.
Einer hochschwangeren Frau von Kippenheim, die mittags in den dortigen Weinbergen schlief, kroch eine Schlange in den offenen Mund. Ihr Töchterlein, welches neben ihr saß und dies bemerkte, wollte die Schlange noch am Schwanze packen und zurückziehen; es war aber zu spät, sie schlüpfte der Frau ganz die Kehle hinunter in den Leib, wo sie sich ruhig verhielt und der Schwangeren keine weitere Beschwerde verursachte. Als aber die Frau bald darauf ein Kindlein gebar, hatte sich ihm die Schlange so fest um den Hals gewickelt, dass man sie nur durch ein Milchbad davon losbrachte. Sie wich aber nicht von des Kindes Seite, lag stets bei demselben im Bett und fraß aus seiner Schüssel. Weil sie dem Kinde dabei nichts zu leide tat und von ihm sehr geliebt wurde, ließen die Eltern beide ungestört beisammen. Sechs Jahre waren so verflossen, als einst die Schlange die allzu großen Brotstücke in einer Milchsuppe nicht fressen wollte und dadurch das Kind so böse machte, dass es ihr den Löffel auf den Kopf schlug mit den Worten: „Friss auch Mocken, (Brocken) nicht lauter Schlappes!“ (Brühe.) Von diesem Augenblick an wurde die Schlange ganz traurig und verschwand nach einiger Zeit ganz aus dem Hause. Man suchte sie überall von Dach bis zu Keller, endlich in dem großen Steinhaufen, der seit dem Schwedenkrieg unerforscht im Hofe gelegen. Darin fand man unten einen Kessel voll Goldstücke und daneben die Schlange tot liegen. Auf einmal war sie weg und an ihrer Stelle stand ein schneeweißer Mann und sprach: „Ich war die Schlange, und das Kind zu meiner Erlösung bestimmt; nun habt ihr das Geld und seid reich, ich aber gehe ein in die ewige Freude.“ – Nach diesen Worten war er verschwunden.
(Nach mündlicher Überlieferung mitgeteilt v. Bernhard Baader in Mones Anzeiger für teutsche Vorzeit. Jahrg. 1839.)
St. Landolins Bad.
Aus Schottland kam der Missionair Landolin in diese Gegend. Damals standen bloß einige Hütten daselbst und in einer derselben wohnte ein redlicher Mann, Edulf genannt, mit Weib und Kindern. Der gab dem Pilgrim ein Obdach, bis er ausgerastet hatte. Nachdem Landolin ihm dafür mit Erteilung seines Segens gedankt, zog er weiter hinauf und suchte ein abgelegenes Plätzchen zu seiner Niederlassung. Ein solches fand er in dem friedlichen Waldtale, wo der Lautenbach und die Unditz sich vereinigen und baute sich daselbst eine Klause. Selbst das Wild des umliegenden Forstes schien von der Sanftmut und Frömmigkeit des Einsiedlers bezaubert, kam oft vertraulich aus seiner Hand zu essen, und rettete sich in seine Hütte, als in die sicherste Freistätte vor den Verfolgungen der Jäger. In geringer Entfernung von der Stelle, wo Landolin wohnte, hatte sich ein Häuptling der Gegend, namens Gisok, auf den Trümmern eines Römerkastells eine Burg erbaut, deren Reste noch heutzutage die Gisenburg heißen.[1] Ein Jäger Gisoks traf den frommen Mann, als er eben ein Fleckchen Feld bei seiner Klause urbar machte und erschlug ihn, teils aus Grimm, dass so vieles Wild sich in dessen Freistätte flüchtete, teils bloß von roher Mordlust getrieben. Da entsprangen aus dem Boden, den das Blut des Märtyrers überströmt hatte, fünf Heilquellen, die jetzt St. Landolins Bad heißen und noch häufig besucht werden. Edulf und die Seinigen ahnten nichts Gutes, als sie so lange Zeit ihren alten Gast nicht mehr im Tale sahen. Sie gingen aus, ihn aufzusuchen und fanden seinen blutigen Leichnam, den sie unter heißen Tränen und unter Verwünschungen des Mörders begruben. Auf dieser Stelle bauten sich nachher Mönche ein Kloster und der Ort erhielt den Namen Mönchszell.
1. Im achten Jahrhundert wurde sie zerstört und die Steine später zum Bau des Klosters Ettenheimmünster verwendet; den Platz, wo das Schloss stand, deckt nun Wald, man nennt aber die Stätte noch jetzt Heidenkeller.
Das Kruzifix von Wittenweier.
Nachdem die Bewohner des Dorfes Wittenweier zum Luthertum übergetreten waren, schafften sie von ihrem Kirchhofe das steinerne Kruzifix weg, fanden es jedoch am nächsten Morgen wieder am selben Platze aufgerichtet. Noch zweimal taten sie es hinweg, allein es kehrte jedes Mal in der Nacht dahin zurück, während die Wachen, die man auf dem Gottesacker aufgestellt hatte, in unbezwingbarem Schlafe lagen. Hierauf warfen die Wittenweierer das Kreuz in dem Rhein, und aus dem kam es nie wieder heraus. Seitdem aber riss der Rhein, der vorher dort ganz friedlich floss, das diesseitige Ufer stückweise weg, so dass Wittenweier schon dreimal musste zurückgebaut werden.[1]
(S. Mones Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit. Jahrg. 1839.)
1. Diese und ähnliche Sagen gehen auf die Bilderstürmerei des 16. Jahrhunderts zurück.
Lahrs Ursprung.
Ihren Namen soll die Stadt von den Gewerben haben, die auch jetzt noch in ihr blühen: von den Lohgerbern. Man nannte nämlich den Ort Anfangs „In der Loh“ wegen den Lohmühlen und Gerbehäusern an der Schutter, aus welchen wahrscheinlich nach und nach sich eine Dorfgemeinde bildete, woraus zuerst der Flecken Lohr und später das Städtchen Lahr entstand. Die Grafen von Geroldseck erbauten sich hier ein Schloss und eine Linie nannte sich von Geroldseck-Lahr. Ein Unglück war es für die Stadt, dass diese Grafen ausstarben und die Herrschaft unter weit entfernte Gebieter kam: die Grafen von Mörs und später an die von Nassau. Im dreißigjährigen, ferner im französischen Raubmordkriege unter Ludwig XIV., litt auch Lahr sehr viel und brannte im Jahr 1677 ganz ab. Es lebten damals zweiunddreißig adelige Familien dort, die sich von dieser Zeit an alle hinwegzogen. Später, unter Nassauischer Herrschaft in den glücklichen Zeiten des Friedens, fing die Stadt wieder an aufzublühen und der Haupt-Marktplatz für das Schuttertal und das Ried zu werden. Gerberei, Weberei, Garn- und Leinwandhandel, Krämerei aller Art bildeten die vorherrschendsten Gewerbe. Die Leute vom Land fanden hier ihre Bedürfnisse und eine Menge kleiner Krämer ihren Unterhalt. Und
Klein auf Klein
Baut sein Nest das Vögelein
Aus den Krämern wurden endlich wohlhabende, ja reiche Kaufleute und Fabrikbesitzer In der Zeit des französischen Revolutionskrieges, in den neunziger Jahren, wo der Rhein und Straßburg gesperrt waren, zogen die betriebsamen Lahrer den Speditionshandel von Straßburg und Kehl größtenteils in ihre Stadt. Seitdem blieb ihr Flor immer in steigender Zunahme und jetzt ist sie nach Mannheim die bedeutendste Handelsstadt des Großherzogtums.
D. F.
Ursprung von Hohengeroldseck.
Links ab von der schönen Straße, welche von Lahr in das Kinzigtal führt, nicht weit von Biberach, liegen auf einer Anhöhe die Trümmer des einst für unüberwindlich gehaltenen Schlosses Hohengeroldseck. An Alter und Wechsel der Schicksale übertrifft vielleicht kein edles Haus auf dem weiten Gebirge den Stamm der Geroldsecker, und in Zeiten, in welchen wir gewohnt sind, unsre Sagenkreise zu finden, lebte hier schon eine ältere Sagenwelt in dem Munde der Edlen. Als Pippin der Kurze – so erzählen sie – der König der mächtigen Franken, all’ seine Mannen aufbot, um jenseits der Alpen die stolzen Langobarden und ihren König Astolf zu bändigen, folgte ihm auch Marsilius, ein Herzog vom Schwabenlande. Seine treuen Dienste machten ihn bald zum Liebling des Frankenkönigs, und als ihm Regarda, die Tochter Hildebrands von Andechs, des Grafen über Bayern, einen Sohn gebar, gab er ihm, nach einer Straße in Rom, den Namen Geroldseck. („De platea in Roma Geroltzeck, ibi dicta stirps est progressa;“ dies soll die Umschrift eines alten Steines in der Empfinger Kirche gewesen sein.) Dieser Gerold war folglich der Bruder der Hildegarde, der Gemahlin Karls des Großen. Ihm übertrug deswegen dieser Kaiser die herzogliche Würde in Bayern, das Markgrafentum in Österreich und die Grafschaft in der Reichenau. Dem Heerbann leistete Gerold jederzeit treulich Folge; in den Sachsenkriegen erschlug er mit eigener Hand den weitgefürchteten Wittekind und gegen die Allesverheerenden Hunnen schützte ein herrlicher Sieg seine Markgrafschaft. Allein er verfolgte den Feind mit allzu großem Eifer; die Heiden wandten sich plötzlich gegen ihn, denn er war nur noch von weniger Mannschaft begleitet, und erschlugen den Tapferen. Seine Leiche wurde nach der Reichenau geführt und im Chor des Münsters auf der rechten Seite des Hochaltares begraben. Der Märtyrertag Gerolds ist der zweite Oktober des Jahres 799.[1]
(S. Max von Rings „Malerische Ansichten der Ritterburgen Teutschlands.“ Sektion Baden. 1tes Heft der 2ten Abteilung.)
1. An diesen Gerold, als Erbauer von Geroldseck, soll die Inschrift eines Steines erinnern, der zu Ende des vorigen Jahrhunderts aus den Trümmern der Burg hervorgezogen worden ist:
„Hohen Geroldseck mich bawen ließ
Herr Gerold mit Namen hieß
Dem großen Karlo werdt
In viel Ritterlichen Taten bewerdt
Ward Markgroff in Oestereich
In Schwoben Herzog zugleich etc. etc.
Das Haus Geroldseck besaß eine Menge Herrschaften und Lehen: die Burgen Schenkenzell, Romberg, die Städte Mahlberg und Lahr, im Elztal die Schwarzenburg; in den benachbarten Tälern des Kinzigtals die einst blühende Münzstätte Prinzbach, Selbach mit ergiebigen Silberwerken, und auf der Höhe dem Schimberg gegenüber die Burg Lützelhardt. (S. für letztere die folgende Sage.) Prinzbach ist jetzt nur noch ein Weiler; der Verfall des einst reichen Städtchens wird in das elfte Jahrhundert hinaufverlegt und den Freiburgern zugeschrieben, welche am Karfreitag (1001) heimlich die Mauern erstiegen und die Wohnungen ausplünderten. Münzen und Mauertrümmer, die man am Orte findet, weisen indessen auf eine römische Pflanzstadt hin, die dort gelegen haben mag.
Walther von Geroldseck.[1]
Ritter Diebolt, genannt Geroldseck, weil er das Schloss dieses namens bewohnte, stammte aus einer Nebenlinie des Geroldseckischen Hauses ab. Er war ein böser, neidischer und rachgieriger Mann, der aber seine Tücke gar meisterlich zu verbergen wusste. Drei Jahre lang trug er einen heimlichen Groll gegen Ritter Walthern, den Burgherrn zu Hohengeroldseck, im Herzen, weil dieser ihn bei einem Schimpfspiel vom Rosse geworfen, und bald darnach, als Schiedsmann seines Widerparts, in einer ungerechten Sache gegen ihn gesprochen hatte.
Eines Tages ging Herr Walther ganz allein, bloß von seinem Hund begleitet, auf die Jagd. Er durchstrich die Waldungen, die sich, von dem Fuße seiner Burg an, Meilen weit durch das Tal erstreckten, und gedachte nun, da er kurz zuvor das Lager einer trächtigen Hindin ausgespürt hatte, seinen Junkern mit einem kleinen Reh eine Kurzweil zu machen. Diebolt hatte einen Buben, der ein gar schlauer Wicht war, und viele Tage lang, als ein Betteljunge verkleidet, um das Schloss Geroldseck her strich, damit er den Augenblick, da Walther allein ausgehen oder ausreiten würde, ablauschen und seinen Herrn davon benachrichtigen könne. Dieses war in langer Zeit nicht geschehen, und als ihm der Bube die Botschaft brachte, freute er sich so sehr darüber, dass er ihm einen Goldgulden schenkte. Hierauf nahm er vier handfeste Männer von seinen Leuten zu sich, mit denen er in den Forst eilte, wo er Walthern zu finden hoffte. Er und seine Gefährten waren vermummt, und er hatte ihnen den strengsten Befehl gegeben, kein Wort zu sprechen. Mehr als eine Stunde lang durchstreiften sie das Dickicht, ohne den Ritter anzutreffen; endlich fanden sie ihn am Fuße einer Eiche sitzend, wo er einen Kuchen verzehrte, den seine Gemahlin, Frau Hedwig, des Abends zuvor gebacken und ihm in seine Jagdtasche gesteckt hatte. Als der Hund in dem Gebüsch ein Geräusch vernahm, sprang er auf und fing an zu bellen; einer von den Knechten aber schoss ihm einen Bolzen ins Herz, dass er tot zu Boden stürzte. Alsdann fielen sie alle über Walthern her, warfen ihn nieder, bevor er sein Waidmesser ziehen konnte, und banden ihm die Hände auf den Rücken, nachdem sie ihm das Wams vom Leibe gerissen hatten. Hierauf steckten sie ihm einen Knebel in den Mund, verbanden ihm die Augen, und führten ihn mit sich fort. einer von den Knechten besprengte das Wams mit dem Blut des Hundes, und ließ es am Fuße des Baumes liegen. In diesem Zustand schleppten die Räuber ihren Gefangenen etliche Tage lang umher, nachts in verborgene Hecken und Felsen ihn versteckend, wo sie ihm Speise und Trank reichten, und sodann wieder mit ihm fortzogen, so dass der Ritter wähnte, dass er in ein fremdes Land hinweggeführt würde. In der vierten Nacht brachten sie ihn auf das Schloss Lützelhardt, warfen ihm einen schmutzigen Kittel um, und legten ihn, mit Ketten beschwert, in einen finstern Turm. Frau Hedwig erwartete ihren Herrn vergebens mit dem Mittagsmahl, und als er auch die Nacht über wegblieb, sandte sie des folgenden Morgens alle ihre Knechte aus, um ihn zu suchen. Diese fanden seinen Hund und das blutige Wams nebst dem Waidmesser unter der Eiche, und dachten nicht anders als, ihr Herr sei von Mördern erschlagen und eingescharrt worden. Vergebens suchten sie sein Grab oder seinen Leichnam, und kamen des Abends mit dem Gewehr und dem Kleide traurig nach Hohengeroldseck zurück. Als Frau Hedwig die grauenvolle Nachricht vernahm und das blutige Wams erblickte, das einer von den Knechten unter seinem Kittel hervorzog, sank sie ohnmächtig nieder und musste zu Bette getragen werden. Drei Wochen konnte sie das Lager nicht verlassen, und Jedem, der ihren Jammer mit ansah, brach fast das Herz. Ritter Walther war ein eben so guter Herr, als er ein guter Gemahl und Vater war; er wurde von Alt und Jung beweint, und mehrere von seinen Bauern machten sich freiwillig auf, um Kundschaft über ihn einzuziehen; sie kamen aber alle unverrichteter Sache wieder zurück, und niemand zweifelte mehr an seinem Tode.
Unterdessen lag Herr Walther immer in seinem Gefängnis auf der Burg Lützelhardt, ohne dass er wusste, wo er war. Der Turmwart brachte ihm täglich zu essen und einen Krug Wasser; wenn er aber von ihm angeredet wurde, so gab er dem Gefangenen keine Antwort. – Wisst Ihr, wen Ihr so grausam behandelt? – fragte einst Walther voll Verzweiflung. – Ich will es nicht wissen, – erwiderte der Mann, – und habe Befehl, Euch zu töten, sobald Ihr Euren Namen aussprecht. – Der Ritter glaubte nicht anders, als dass er von fremden Räubern, die ein schweres Lösegeld für ihn verlangten, in ein fremdes Land geführt worden, und wunderte sich oft, wie seine gute Gemahlin und seine Freunde ihn so gar verlassen konnten. Zwei Jahre schmachtete er in diesem Kerker, ohne ein einziges Mal die Sonne zu sehen, oder die freie Luft zu athmen. Nur wurde bisweilen in der Höhe ein Loch geöffnet, um den faulen Dünsten einen Ausgang zu verschaffen, da dann einige Lichtstrahlen in diese Wohnung des Grauens herabglitten. Bei dieser Gelegenheit vernahm einst der Gefangene den lauten Schall eines Hornes, der ihn aufmerksam machte. Es dünkte ihm, diese Musik schon irgendwo gehört zu haben; er wusste sich aber des Ortes nicht zu erinnern. Einige Zeit hernach, als es wieder, und zwar in dem Augenblick erscholl, da ein anderer Wächter, der ihn erst seit drei Monden bediente, ihm zu essen brachte, erkühnte sich Walther, ihn zu fragen, wo doch dieses große Horn geblasen würde? Der Knecht gab ihm zwar keine bestimmte Antwort; dennoch aber glaubte Walther, aus einigen Reden, die jener fallen ließ, und aus verschiedenen kleinen Umständen, die er damit verglich, den Ort seiner Gefangenschaft erraten zu haben. An einem anderen Tag fragte Walther diesen Knecht nach seinem Namen und nach seinem Vaterlande. Er musste diese Fragen mehrmals und auf verschiedene Weise wiederholen, eh’ er ihm die Antwort ablockte, dass er aus dem Lützeltal, Geroldseckischer Herrschaft, gebürtig sei, und dass sein Geschlecht den Namen Rublin führe. Nun zweifelte Walther nicht mehr, dass er auf der Burg Lützelhardt gefangen läge, und entdeckte zugleich in diesem Rublin einen seiner leibeigenen Dienstleute. Er trug daher kein weiteres Bedenken, sich ihm zu erkennen zu geben, und tat es mit der rührenden Würde der bedrängten Unschuld. Er beschwur ihn bei Eid und Pflicht und unter den vorteilhaftesten Verheißungen, das Werkzeug seiner Befreiung zu sein. Rublin hatte seinen Gefangenen nicht gekannt, und von seinem Herrn, als er ihm die Stelle des verstorbenen Turmhüters übertrug, das Verbot erhalten, sich bei Lebensstrafe in kein Gespräch mit ihm einzulassen. Als er nun vernahm, dass er, ohne es zu wissen, der Kerkermeister seines Herrn gewesen, fiel er ihm zu Füssen, bat ihn um Vergebung, und versprach, ihm herauszuhelfen. Wäret Ihr, sprach er – nicht mein natürlicher Herr, so würde kein Geld noch Gut mich bewegen, Euch zu Willen zu leben. – Nun erwartete Walther mit Ungeduld den Tag seiner Erlösung, der nicht lange mehr ausblieb.
An dem hl. Pfingstfeste, da Ritter Diebolt abwesend und der größte Teil der Burgleute nach Selbach in die Kirche gegangen war, kam Rublin in das Gefängnis, nahm Walther seine Ketten ab, und entschlüpfte mit ihm in einen entlegenen Winkel des Zwingers. Hier klommen sie auf die Mauer, woran er ein starkes Hasengarn befestigte, das die Stelle einer Strickleiter vertrat, an welcher Beide sich glücklich hinunterließen.
Walther war einem Totengerippe ähnlich; seine Beine konnten ihn kaum tragen und hatten fast das Gehen verlernt. Dieses bewog seinen Retter, den gebahnten Weg zu verlassen, wo man sie wegen der Langsamkeit ihres Zuges leicht hatte einholen können, und sich seitwärts in eben die Waldungen zu schlagen, durch welche der Ritter einst so lange herumgeschleppt wurde. Sie wanden sich durch die wildesten Hecken und durch das unwegsamste Dickicht, und erquickten sich von Zeit zu Zeit mit dem Wein und den Speisen, die Rublin mit sich genommen hatte. Endlich erreichten sie um Mitternacht das Burgtor von Hohengeroldseck. Walther hatte vier zum Teil erwachsene Söhne zurückgelassen; diesen wollte er sich zuerst entdecken, um zu verhüten, dass sein plötzliches Erscheinen und seine armselige Gestalt seiner Gemahlin einen Schrecken verursache. Als ihn daher der Torwart nach seinem Namen fragte, gebot er ihm, den vier Junkern zu sagen, sie möchten herunterkommen, indem sie ein Fremder einer wichtigen Kunde wegen insgeheim sprechen wolle. Nach einigen Minuten erschienen die vier Jünglinge, mit Dolchen bewaffnet, vor der Pforte, und fragten den Fremdling, wer er wäre? – Euer Vater! – schluchzte Walther, indem er seinem Erstgebornen in die Arme stürzte. Die Jünglinge umringten ihn und einer von ihnen hielt ihm ein Licht vor das Gesicht; keiner aber konnte seinen Vater erkennen, da ihn der feuchte Kerker und die kümmerliche Nahrung gänzlich entstellt hatten. – Ihr seid ein Betrüger! – riefen sie – unser Vater ist schon zwei Jahre tot; er wurde im Forst auf der Jagd erschlagen. – Ihr wollt mich nicht erkennen, – sprach Walther weinend, – freilich hat man Euch betrogen. Allein der Betrüger war Der, welcher die Nachricht von meinem Tode aussprengte. Diebolt von Lützelhardt war es, der mich zwei Jahre lang in der härtesten Gefangenschaft hielt. – O, nun sehen wir’s, – riefen die Söhne – dass Ihr ein Betrüger seid! Ritter Diebolt ist selbst mit seinen Knechten ausgezogen, um die Mörder unseres Vaters aufzusuchen, und hat bei unserer Mutter über dessen Tod Tränen vergossen. – Dieser Zug, – rief Walther, – fehlte noch, um ihn zum Teufel zu machen. Nun so holet mir Eure Mutter, diese wird mich nicht verkennen! – Die vier Brüder verkündigten ihrer Mutter, die unruhig ihre Rückkunft erwartete, dass ein Mann, der sich fälschlich für ihren Vater ausgebe, sie zu sprechen verlange. Frau Hedwig besann sich einige Augenblicke; dann dachte sie bei sich selbst: vielleicht haben meine Kinder den Fremden missverstanden, und er hat ihnen von dem Tode meines Gemahls, oder von den Urhebern desselben, Kundschaft zu geben. – Sie stieg daher hinunter an die Pforte und hieß ihre Söhne im Hof sie erwarten. – Wo ist der fremde Mann? rief sie beim Heraustreten. – Hier ist er, dein Gemahl, dein Walther! Meine Söhne haben mich verkannt; wird auch mein Weib mich verkennen? – Eure Züge, – sprach Hedwig, – sind nicht Walthers Züge; aber Eure Stimme, wiewohl sie schwach und heiser tönet, hat Ähnlichkeit mit der seinigen. – Dein Ohr, dein Auge, – versetzte Walther, – mag dich täuschen; aber dein Herz, das Herz meiner Hedwig wird mich nicht verläugnen! Gewiss hat es jenen Abend nicht vergessen, da sie mir zum ersten Mal ihre keuschen Arme öffnete; da ich ihr den Halskoller löste, und die Erdbeere, die ich auf ihrer Brust entdeckte. Bevor er ausreden konnte, hing schon Hedwig an seinem Halse und überströmte seine bleichen Wangen mit ihren Tränen: Du bist es, ja du bist mein Gemahl! – rief sie mit gebrochenen Worten, – Gott hat dich mir wieder gegeben! – Walther drückte sie mit zitternden Armen an sein Herz und teilte dann seiner Gattin noch verschiedene geheime Wahrzeichen mit, welche alle ihre Zweifel gehoben hätten, wenn ihr noch einer übrig geblieben wäre.
Nun rief Hedwig ihre Söhne herbei: Umarmt Euern Vater! Er ist es, ich schwör’ es Euch bei meinem Mutterherzen! – Die Söhne warfen sich ihrem Vater zu Füßen, und baten ihn um Verzeihung. Walther hob einen nach dem anderen von der Erde, umschlang ihn mit seinen Armen und drückte seine Lippen auf dessen Mund. Dann führte Hedwig ihren Gemahl, von seinen Söhnen umgeben, in die Burg, wo er ihnen die Verräterei seines Vetters Diebolt und seine Befreiung durch den getreuen Rublin erzählte. Des folgenden Morgens war großer Jubel im Schloss: das gesamte Hofgesinde drängte sich herbei, um seinen guten Herrn zu bewillkommen. Walther reichte ihnen seine abgezehrte Hand, an der noch die Malzeichen der Fesseln zu sehen waren. alle küssten und netzten sie mit ihren Tränen. Nach etlichen Tagen schrieben die Söhne einen Brief an alle Verwandte, Freunde und Lehensleute ihres Vaters, und klagten ihnen, wie ehrlos Diebolt von Lützelhardt an ihm gehandelt, wie er ihn heimlich entführt und in einen schrecklichen Kerker geworfen habe, um ihn darin verschmachten zu lassen. Sie forderten alle diese Männer im Namen der Ehre und der Freundschaft auf, mit ihnen auszuziehen, um diese Unbill zu rächen. Die nächste Woche darauf erschienen die Freunde des Herrn von Geroldseck mit 200 Reisigen auf seiner Burg und rückten gegen das Schloss Lützelhardt, das sie zehn Tage lang belagerten. Diebolt wehrte sich anfänglich mit dem Mute der Verzweiflung; als aber die Lebensmittel ausgingen und er seine Leute, anstatt liebreich sie zu trösten, täglich grausamer behandelte, so wollten sie ihn zwingen, die Veste zu übergeben. Da entfloh der Ritter des Nachts durch einen unterirdischen Gang, und Niemand wusste, wo er hingekommen war. Das Schloss aber ergab sich am folgenden Morgen, und wurde gänzlich zerstört, wie man solches noch an dem Burgstall sieht.
Der biedere Rublin wurde von Ritter Walther mit seinem ganzen Geschlechte von der Leibeigenschaft losgesprochen, und mit schönen Gütern und stattlichen Freiheiten begabet, die er auf seine spätesten Enkel vererbt hat.
G. C. Pfeffel.
(S. dessen „Prosaische Versuche.“ V. Th. Tübingen 1811.)
1. S. Bernhard Herzogs Elsässer-Chronik, Straßb. 1592. 5tes Buch, S. 120 ff.
Kloster Schuttern.
An der Schutter, zwischen Offenburg und Lahr, liegt das ehemalige Benediktiner-Kloster Schuttern. Nach der Sage soll dasselbe seinen Ursprung einem ehemaligen englischen König, Offo, verdanken. Es ist wahr, dass das Kloster Schuttern in alter Zeit den Namen Offenzell führte, und dass die Stadt Offenburg, welche den nämlichen englischen König zu ihrem Gründer haben soll, ehemals einen Engel auf ihre Münzen prägte; was, wie die Engel auf den Zinntellern, wohl etwas Englisches bedeuten kann, aber nicht immer wirklich bedeutet. Es ist ferner wahr, dass es einen König Offa von Mercien in England gegeben hat, welcher Thron und Gemahlin verließ, nach Rom pilgerte und dann irgendwo ein Mönch wurde; aber das geschah im Jahr 707, und das Kloster Offenzell ist schon wenigstens hundert Jahre vorher gestanden. Der Gründer von Offenzell, wie von Offenburg, scheint ein Adeliger der Gegend, mit Namen Offo, gewesen zu sein.
Z. L. B.
Offenburgs Ursprung.
Offenburg soll von Offo,[1] einem Britannischen Fürstensohne, ums Jahr Christi 600 gegründet worden sein. Er bekehrte in diesen Gegenden die wilden Alemannen zum Christentum, stiftete das Kloster Schuttern und nahm als Statthalter des Königs der Franken in Offenburg seinen Sitz. Man gibt in dieser Stadt noch die Gegend an, (bei dem Gasthaus zum Ochsen) wo sein Schloss gestanden haben soll. Auch zeigt man noch Münzen, von denen man behauptet, dass er sie habe schlagen lassen. Später hielten hier die von den deutschen Königen und Herzogen von Schwaben bestellten Grafen der Ortenau ihren Hof und ihre Gerichte.
L. H. B.
1. S. obige Sage.
Ritter Peter von Stauffenberg und die Meerfeye.
In sieben Romanzen.
(„Wahrhafte Geschichte Herrn Peter v. Stauffenberg.“), (Straßbg. bei B. Tobias Erben 1595.)
I.
Vorüber zieht manch edler Aar.
Herr Peter ein teurer Ritter war,
Er war so keusch, er war so rein,
Wie seines Antlitzs edler Schein,
Er war bereit zu jeder Zeit,
Zu Schimpf, zu Ernst, zu Lust, zu Streit.
In junger Kraft, in fremdem Land,
Sein Mannheit machte ihn bekannt,
Als er nach Hause kehrt zurück,
Bedenkt in sich sein hohes Glück,
Langsam zur Burg hinauf tut reiten,
Was sieht sein Knecht zu einer Seiten?
Er sieht ein schönes Weib da sitzen,
Von Gold und Silber herrlich blitzen,
Von Perlen und von Edelstein,
Wie eine Sonne reich und rein,
Der Knecht winkt seinen Herrn zu sich:
„Gern diente dieser Frauen ich!“
Der Ritter grüßt in großer Zucht,
Er drückt an sich die edle Frucht. –
„Ihr seid es Ritter, edler Herr!
Das Wunder das mich treibet her,
In allen Landen, wo Ihr wart,
Hab’ ich euch glücklich stets bewahrt.“ –
„Kein schöner Weib hab’ ich erblickt,
Ich lieb euch wie es aus mir blickt.
Ich sah euch oft im tiefsten Traum,
Jetzt glaub ich meinen Sinnen kaum,
Wollt Gott, ihr wärt mein eh‘lich Weib,
In Ehren dient ich eurem Leib.“
„Nun so wohl hin!“ sprach da die Zart:
„Auf diese Red‘ hab ich gewart‘,
Ich zog dich auf mit Liebeskraft,
Die alles wirkt, die alles schafft,
Ich bin die Deine, ewig Dein,
Doch musst du auch der Meine sein!
Nie darfst du nehmen ein ander‘ Weib,
Dir eigen ist mein schöner Leib
In jeder Nacht, wo du begehrst,
Und Macht und Reichtum dir beschert,
Ein ewig endloses Leben,
Will ich durch meine Kraft dir geben.
Unangefocht wirst du nicht bleiben,
Man wird dich treiben, dich zu weiben.
Wo du’s dann tust, red‘ ich ohn‘ Zagen,
So bist du tot in dreien Tagen;
Sieh weg von mir und denke nach,
Was dir dein eignes Herze sagt!“ –
„Nun, herzig‘s Weib, ist dem also,
So werdet meiner Treue froh.
Was soll ich für ein Zeichen haben,
Dass Ihr von mir wollt nimmer lassen?“ –
„So trag von mir den gold‘nen Ring,
Vor Unglück schützet dich der Ring.“
Mit spielendem Kuss er Abschied nahm,
Nach Nußbach er zur Messe kam,
Da ging er mit den Kreuzen auch,
Und nahte sich dem Weiherauch,
Sein Leib und Seel er Gott befahl,
Er sollt ihn schützen überall.
II.
Als er auf Stauffenberg nun kam,
Schnell ab sprang da der edle Mann,
Ein jeder wollt ihn sehen, hören,
Ein jeder wollt ihn höher ehren.
Von seinen Dienern große Eil,
Von Frau‘n und Mädchen groß Kurzweil.
Zu Bette trachtet nur der Herr,
Nach seiner Frau verlangt er sehr,
Viel herrlich Rauchwerk ward gemacht,
Das Bett verhängt mit großer Pracht,
Den Dienern bald erlauben tät,
Dass sie sich legten all zu Bett.
Er zog sich ab, setzt sich aufs Bett,
Und zu sich selber also red‘t:
„O hätt‘ ich sie im Arm allein,
Die heut ich fand auf hohem Stein!“
Als er die Worte kaum noch sprach,
Die Schöne er mit Augen sah.
Viel froher Minne sie begeh‘n,
Sie mochten einander ins Herze sehn,
Wenn einer tät dem nachgedenken,
So möchte ihn wohl die Sehnsucht kränken.
Als er erwachte, glaubt ers kaum,
Er fand den Ring, sonst wars ein Traum.
III.
„Ihr wisset nun zu dieser Frist,
Dass unser Geschlecht im Abgang ist,
So nehmt ein Weib, berühmt und reich,
Ihr seid schon jedem Fürsten gleich,
Wir bringen euch viel Fräulein schön,
Die euch gar gerne alle sehn.“
Herr Peter war erschrocken sehr,
Sein Bruder schweigt, da sprach der Herr:
„Ich dank euch edle Brüder mein,
Doch kann es also noch nicht sein,
Zur Kaiserkrönung geh ich hin,
Nach Ruhm und Ehre steht mein Sinn.“
Die Meerfey gab ihm diesen Rat,
Sie hat es ihm voraus gesagt,
Sie gibt ihm Gold und edlen Schmuck,
Wie keiner ihn so herrlich trug,
Sie küsset ihn und warnet ihn,
Dass er sich nicht gab Weibern hin.
IV.
Der Zierlichste meinte ein jeder zu sein.
Der Stauffenberger zog auch ein,
Seins Gleichen war zugegen nicht,
Der so zierlich einher ritt,
Der König nahm sein eben wahr,
Dazu die Frauen ernsthaft gar.
Trompeten fingen an zu blasen,
Die Pferde fingen an zu tosen,
Da lustig ward so Ross als Mann,
Wie das Turnier gefangen an,
Herr Peter alle darnieder rennt,
Er macht dem Rennen bald ein End‘.
Als nun der Abend kam herbei,
Von neuem ging Trompetenschrei,
Als sie zu Hof gegessen hatten,
Den fürstlichen Tanz sie allda taten,
Des Königs Base schön geziert,
Den ersten Dank in Händen führt.
Von Gold und Perlen diesen Kranz,
Dem Ritter setzt sie auf zum Tanz,
Tät auf das gelbe Haar ihm setzen,
Tät freundlich ihm den Finger pfetzen,
Gab ihre Lieb ihm zu versteh‘n,
Durch manchen Blick schön anzuseh‘n.
V.
Der König lag in seinem Bett,
Des Nachts seltsam Gedanken hätt,
Und seine Gedanken gingen ein
In seiner Base Schlafkämmerlein,
Und immer schwerer kamen wieder,
Wie Bienen zieh‘n vom Schwärmen nieder.
Am Morgen schickt er seinen Zwerg,
Zu Peter Herrn von Stauffenberg:
„Die Base mein von hoher Art,
Die Fürstin, jung und reich und zart,
Die will ich geben Euch zum Weib,
Mit ihrem Kärntnerland und Leut.“
Kein Wort kam aus des Ritters Mund,
Erschrocken stand er da zur Stund‘;
„Mein Red‘ halt mir für keinen Spott,
Und nimm hiermit zu Zeugen Gott,
Dass es mein ew’ger Ernst fürwahr,
Dass Euer die Fürstin ganz und gar.“
Herr Peter sprach mit großen Treuen,
Der hohe Lohn könnt’ ihn nicht freuen,
Wie er der Meerfey schon verlobt;
Der Untreu sei der Tod gelobt,
Sonst sei er frei von Not und Leid,
Mit Gut und Geld von ihr erfreut.
„Weh Eurer Seele an dem Ort!
Sie ist verloren hier und dort,
Seht Gottes Auge nimmermehr,
Wenn Ihr Euch nicht von ihr abkehrt;
Sollt Ihr ’nen Geist zum Weibe haben,
Nie werden euch die Kinder laben.
Dem Teufel seid ihr zugesellt,
Ihr armer Mann! Ihr teurer Held!“
So sprach der Bischof und der König,
Der Ritter sagt darauf zum König:
„Es geht mir tief zu meinem Herzen,
Und Gottes Gnad‘ will nicht verscherzen.“
Herr Peter ward verlobt sogleich,
An Gold und edlen Steinen reich,
O heller Glanz der Jungfrau fein,
Wie strahlt er ihm mit Freudenschein!
Nach Stauffenberg sie ziehen fort,
Zu feiern ihre Hochzeit dort!
Ihr düst‘ren Wälder auf dem Wege,
Was streckt die Äste ihr entgegen,
Viel froher Scharen ziehen ja,
Mit hellem Klange fern und nah,
Mit bunten Bändern, Scherz und Streit,
Ist alles Lust, ist alles Freud.
VI.
Auf Stauffenberg zur ersten Nacht,
Zur schönen Frau sein Herze dacht,
Alsbald an seinem Arme lag,
Die sein mit steten Treuen pflag,
Sie weinte, sprach: „Nun wehe dir!
Du folgtest gar zu wenig mir,
Dass du ein Weib nimmst zu der Eh,
Am dritten Tag lebst du nicht mehr,
Ich sag dir was geschehen muss:
Ich lasse sehen meinen Fuß,
Den sollen sehen Frau und Mann,
Und sollen sich verwundern dran.
So nun dein Aug den auch ersieht,
So sollst du länger säumen nicht,
Denn es sich immer anders wend‘t,
Empfang das heil‘ge Sakrament,
Du weißt, dass ich dir Glauben halte,
Auf ewig sind wir nun zerspalten.“
Mit nassem Aug sie zu ihm sprach:
„Herr denket fleißig nach der Sach‘,
Ihr dauret mich im Herzen mein,
Dass ich nicht mehr kann bei Euch sein,
Dass mich nun nimmer sieht ein Mann,
Ich fall in ew’ger Liebe Bann.“
Dem Ritter liefen die Augen über:
„Soll ich denn nie dich sehen wieder,
So sei‘s geklagt dem höchsten Gott,
Der ende balde meine Noch,
Ach dass ich je zu Ruhm gekommen,
Dass mich ein fürstlich Weib genommen!“
Sie küsste ihn auf seinen Mund,
Sie weinten beide zu der Stund‘,
Umfingen einander noch mit Lieb,
Sie drückten zusammen beide Brüst‘:
„Ach sterben das ist jetzt Euer Gewinn,
Ich nimmermehr wieder bei Euch bin!“
VII.
Kein Hochzeit je mit solcher Pracht,
Gehalten ward bis tief in die Nacht,
Viel Lieder und viel Saitenspiel,
Man hörte in dem Schlosse viel,
Und alles bei dem Tische saß,
Man war da fröhlich ohne Maß.
Sie saßen da im großen Saal,
Alsbald da sah man überall,
Die Männer sahen‘s und die Frauen,
Sie konnten beide es anschauen,
Wie etwas durch die Bühne stieß,
Ein Menschen-Fuß sich sehen ließ.
Bloß zeigt er sich bis an das Knie,
Kein schöner‘n Fuß sie sahen nie,
Der Fuß wohl überm Saal erscheint,
So schön und weiß wie Elfenbein,
Der Ritter still saß bei der Braut,
Die schrie bald auf und schrie gar laut.
Der Ritter, als er den Fuß ersah,
Erschrak er und ganz traurig sprach:
„O weh, o weh, mir armem Mann!“
Und wurde bleich von Stunde an.
Man bracht ihm sein kristall‘nes Glas,
Er sah es an und wurde blass.
Er sah in dem Kristall-Pokale,
Ein Kind, das schlief beim lauten Mahle,
Es schlief vom Weine überdeckt,
Ein Füßchen hat es vorgestreckt,
Doch wie der Wein getrunken aus,
So schwand das Kindlein auch hinaus.
Der Ritter sprach: „Der großen Not!
In dreien Tagen da bin ich tot.“
Der Fuß, der war verschwunden da,
Ein jeder trat der Bühne nah,
Wo doch der Fuß wär kommen hin,
Kein Loch sah man da in der Bühn‘.
All Freud und Kurzweil war zerstört,
Kein Instrument wurd‘ mehr gehört,
Aus war das Tanzen und das Singen,
Turnieren, Kämpfen, Fechten, Ringen,
Das alles still darnieder leit‘,
Die Gäste flieh‘n in die Felder weit.
Die Braut nur bleibt bei ihrem Mann,
Der Ritter sieht sie traurig an:
„Gesegne dich du edle Braut,
Du bleibst bei mir, hast mir vertraut.“ –
„Durch mich verliert Ihr euer Leben,
In geistlichem Stand will ich nun leben.“
Das heil‘ge Oel empfing er dann,
Nach dreien Tagen rief der Mann:
„Mein Herr und Gott in deine Händ‘,
Ich meine arme Seele send,
Mein Seel tu ich befehlen dir,
Ein sanftes Ende gibst du mir.“
Ein Denkmal ward ihm aufgericht‘,
Von seiner Frau aus Liebespflicht,
Dabei sie baut die Zelle klein,
Und betet da für ihn so rein;
Oft betend kam auch die Meerfey hin,
Sie sprach mit ihr aus gleichem Sinn.
(Siehe „Des Knaben Wunderhorn etc.“ Bd. 1.)
Staufenberg, ein noch wohl erhaltenes, von Otto von Staufenberg, Bischof von Straßburg, erbautes und neuester Zeit von S. K. H. dem Großherzog geschmackvoll hergestelltes Schloss, liegt auf einem Hügel bei Durbach, 2 Stunden nordöstlich von Offenburg.
Die Sage nach dem Volksmunde, aus welcher Fouqué das Original zu seiner „Undine“ gezogen haben soll, ist auch von Aloys Schreiber bearbeitet worden. Sie steht in dessen „Sagen aus der Umgegend von Baden“ und, in gebundener Darstellung, im Jahrgang 1819 der Cornelia.
Siehe ferner: „Der Ritter von Staufenberg,“ ein altdeutsches Gedicht von Egenolt. Mit kritischen Bemerkungen herausgegeben von Engelhard. Straßburg 1823.
Ritter Staufenberg.
(Andere Version.)
In reicher Flur, auf waldumbüschten Höhen,
Wo stolz der Rhein begrüßt die Ortenau,
Sieht man der Burg bemooste Trümmer stehen,
Von ferne schon, auf Felsen steil und rau:
Dort tönt es in der Morgenwinde Wehen
Oft süß, wie Harfenklang – im Abendtau
Erhebt sich neu die schaurig – milde Weise,
Und Geistertritte wandeln ernst und leise.
Dort wohnte Staufenberg, ein edler Ritter,
Mannhaft und kühn, wie Richard Löwenherz;
Groß war sein Mut im Schlachtenungewitter,
Und Lanzenbrechen war ihm Spiel und Scherz.
Der Liebe Reiz auch kannt’ er, süß und bitter,
In mancher Wonn’, in manchem wilden Schmerz,
Und bleiben soll, weil ihn ein Weib betrogen,
Sein Sinn allein der freien Lust gewogen.
Einst kehrt mit seiner Schar aus Tal und Sträuchen
Der Ritter von der Jagd im dunkeln Hain,
Und als das Dörflein Nußbach sie erreichen,
Lässt er die Knappen vor, und bleibt allein:
Nah’ ist ein Quell, umweht von alten Eichen,
Und glänzend nun im gold‘nen Abendschein;
Hier weilt er oft, und lässt in Traum und Sehnen
Auf seiner Laut’ ein Minnelied ertönen.
Wie staunt sein Blick, als er an dieser Quelle
Jetzt eine wunderschöne Jungfrau fand:
Sie schaut mit Lächeln auf die Silberwelle,
Ihr blondes Haar umschlingt ein Rosenband;
Mild ist ihr Angesicht, wie Frühlingshelle,
Und weiß wie Schnee ihr schimmerndes Gewand.
Er grüßt: die Maid erhebt sich aus dem Grünen
Und danket ihm mit sittig holden Mienen.
Und als mit Namen sie darauf ihn nennet,
Verwundert sich darob der Rittersmann:
„Es scheint, o Fräulein, dass Ihr schon mich kennet?“
Die Schöne sagt: „Mein Sitz ist neben an;
Ich seh’ Euch oft, wenn Ihr im Fluge rennet
Dem Walde nach feldab und hügelan;
Und schöpft ihr dann den Trunk am Quell der Wiesen,
Hör’ ich die Jäger Euch mit Namen grüßen.“
Sie spricht noch mehr in himmlisch holden Tönen;
Der Liebesgöttin gleicht sie von Gestalt.
Der Ritter fühlt ein unnennbares Sehnen,
Es hält ihn fest mit zaub‘rischer Gewalt.
Er horcht der feinen Sprache dieser Schönen
Entzückt; doch ach! die Stunde flieht zu bald;
Da geht er bei des sanften Mondes Blicke,
Und kehrt beim nächsten Abendrot zurücke.
Er setzt sich hier auf einen Felsen nieder,
Schaut in das Feld, auf die kristall‘ne Flut;
Ein süßer Schauer wallt durch seine Glieder,
Und in dem Herzen brennt der Liebe Glut.
Doch warten ist umsonst, sie kehrt nicht wieder:
Er schleicht zur Burg; ihm sinken Kraft und Mut –
So kommt er jeden Abend her und klaget,
Dass ihm nicht mehr erscheint die holde Maget.
Am sechsten Tag, im späten Dämmerlichte,
Harrt Staufenberg und seufzt: „Ach! wie so lang!
Will denn mein Los, dass ich auf sie verzichte?“
Da tönt ein leiser, lieblicher Gesang.
Er horcht, und späht bis in des Haines Dichte.
Doch schien’s, dass aus dem Quell die Stimme drang;
Da sitzt, als nun sein Schritt zum Wasser eilet,
Die Jungfrau auf dem Stein, wo er geweilet.
O welches Glück! Er hat sie nun gefunden!
Schon lächelt ihm der schönsten Träume Ziel:
Doch soll sein Fragen nichts von ihr erkunden,
Und lächelnd scherzt sie nur im Wörterspiel.
Ach! süß betäubt, zu mächtig überwunden,
Bekennt er nun sein liebendes Gefühl;
Sie sinnt voll Ernst und spricht: „An dieser Stelle
Seid morgen früh, noch vor des Tages Helle!“
Und eh’ die Stern’ entfloh‘n auf andre Bahnen,
Erscheinet, kaum der Wonne sich bewusst,
Der Held, es weh‘n des Morgens lichte Fahnen,
Da steht die Reizende vor ihm, o Lust! –
Umkränzt ihr Haar von bläulichen Zyanen,
Geschmückt mit jungen Rosen ihre Brust.
Sie sieht ihn an mit unschuldvollen Blicken,
Und Worte kaum vermag er auszudrücken.
Sie winkt zum Sitz: er folgt ihr glutbeseelet,
Fasst ihre Lilienhand und sagt dabei,
Wie stets um sie die Flamme noch ihn quälet;
Die Maid antwortet: „Eine Wasserfei
Bin ich – von solchen wird ja oft erzählet –
Auch Menschen lieben wir; doch redlich sei,
Wer ein Verlangen fühlt, um uns zu werben;
Sonst wird uns tiefe Qual, und ihm – Verderben.
Gern, Ritter, sah ich Euch an dieser Stelle;
Drum, wenn Ihr mein Gemahl zu sein begehrt,
Bleib’ Eure Treu’ so rein, wie meine Quelle,
Und dauernd, wie der Stahl an Eurem Schwert!
Doch wenn sich von Erlinen je der schnelle
Und leichte Sinn zu andren Frauen kehrt,
Wird Not und Fall sich über Euch vereinen,
Und nur mein Fuß zum Zeichen noch erscheinen.“
Er ruft: „Ha! ohne dich ist mir kein Leben,
Und ewig feste Treue schwör’ ich dir!“
Sie eilt errötend ihm ein Pfand zu geben:
Es ist ein Ring von Demant und Saphir.
Er drückt sie an die Brust mit süßem Beben
Und spricht: „Ach! welche Wonne finden wir,
Nicht mit dem Gold der Erde zu erkaufen,
Auf holder Flur in meiner Burg zu Staufen!“
Es wird bestimmt, dass mit dem jungen Strahle
Des vierten Tags die Trauung soll gescheh‘n.
Als dieser naht, und setzt auf Flur und Tale
Der Morgen steigt herab von Purpurhöh’n
Da eilt aus dem Gemach zum hohen Saale
Der Ritter schon, und sieht drei Körbchen steh‘n,
Recht künstlich fein, geweiht dem Minnesolde,
Und voll von Silber, Edelstein und Golde.
Bald öffnen sich des Marmorsaales Türen:
Erlina tritt im Hochzeitsschmuck herein;
Sechs Mädchen folgen noch aus den Revieren
Des Quellenreichs, Undinen, blond und fein.
Schon sieht das Volk zur Burgkapelle führen
Die Glücklichen, wo, ihren Bund zu weih’n,
Der Priester harrt, und bald dem edlen Paare
Den Segen spricht am heiligen Altare. –
Wie selig fühlt sich an Erlinas Wangen
Der Ritter nun! Wie dünkt ihm öd’ und rau
Die stürm’sche Lust der Welt! Sie ist vergangen,
Sein Herz schlägt nur der häuslich-milden Frau.
In sanfter Schönheit lockt sie sein Verlangen,
So wie den regen West die Blumenau:
Ein Jahr entfloh, da lacht – o süße Gabe
Des Bundes! – ihr im Schoß ein holder Knabe.
Jetzt hört man, dass dem Frankenkönig dräuet
Mit starker Macht ein Feind von Süden her,
Und dass der Held die edlen Scharen reihet,
Der Grenze nah’, zur tapf‘ren Gegenwehr.
Schon ordnet rings im Waffenglanz und freuet
Sich auf den Streit das sieggewohnte Heer;
Auch Ritter von dem rechten Rheingestade
Betreten kühn mit ihm des Ruhmes Pfade.
Und Staufenberg? – das rüstige Beginnen
Entflammt auch ihn zu neuer Rittertat:
Er will zur Liebe neuen Ruhm gewinnen,
Wiewohl er Lorbeer‘n schon errungen hat;
Und vor die Gattin tritt, nach langem Sinnen,
Der Rittersmann, fragt zärtlich sie um Rat,
Wie er soll tun; weil Angst und Kummer litte
Ihr Herz vielleicht, wenn er zum Kampfe ritte.
Da fließt, der Perle gleich an Sabas Strande,
Ein Tränchen von Erlinens Angesicht;
Sie fasst sich und erwidert: „Heil’ge Bande,
Wie unsre, tilgen Zeit und Ferne nicht.
Geliebter, eile denn zum Schutz der Lande!
Nicht hemmen werd’ ich deine Ritterpflicht;
Nur, bis dich gute Stern’ uns wieder schenken,
Woll’ treulich mein und deines Kinds gedenken!“
Der Ritter schwört es ihr bei Heil und Leben,
Drückt sie ans Herz, und bald im Morgenschein
Zieht er, vom Trupp der Reisigen umgeben,
Durch heim’sche Fluren fort und über’n Rhein.
Wo Herzog Otfrieds Banner sich erheben,
Reiht er sich schnell mit seinen Kämpfern ein;
Dann eilt das Heer fernhin, auf manchen Wegen
Zu Ross und Fuß, dem wilden Feind entgegen.
Nicht lange drauf erschallt die hohe Kunde:
„Im Pyrenä’ngebirg war eine Schlacht,
Auf Felsenhöh’n und in des Tales Schlunde;
Bald wich, bald drang voran des Königs Macht.
Es schlug der Kampf wohl manche heiße Stunde –
Doch plötzlich ward ein heft’ger Stoß gebracht
Des Feindes Heer’, es fielen alle Schranken,
Die Heiden floh‘n, und Sieg umweht die Franken.“
So ist es. Doch wer brach im Schlachtgewühle
Der Gegner Mitte nun? Wer hat erhellt
Dem tapf‘ren Heer die Bahn zum frohen Ziele?
Vor allen Staufenberg, der kühne Held:
Das erste Treffen lenkt’ er, und noch viele
Der Kämpfe sehn Berg, Haine, Tal und Feld,
Bis sich des Feindes Kräfte ganz ermüden,
Und glorreich schließt mit ihm der König Frieden.
Ach! süße Tön’ in Leid und Sorgen waren
Erlinen dies; schon lächelt Wiedersehn!
Bald hört man, dass der Krieger tapf‘re Scharen
Nach ihrer Heimat im Triumphe geh‘n;
Doch hat vorher noch Staufenberg erfahren,
Wie Geist und wack‘re Tat den Mann erhöh‘n:
Der König lässt ein gold‘nes Schwert ihm reichen,
Und Michaels geweihte Ordenszeichen.
Auch Otfried, Herzog in dem Rheinschen Franken,
Will ihn, der ruhmvoll seine Schar geführt,
Vor dem der Sarazenen Banner sanken,
Hoch ehren, wie dem Helden es gebührt,
Und möcht’ ihm gern auf würd’ge Weise danken:
Da, wo sein Hof des Rheines Gauen ziert,
Lädt er in einen Kreis erhab‘ner Gäste
Den Rittersmann zum hohen Siegesfeste.
Wie glänzt der reiche Saal in stolzer Feier!
Wie wird beim Mahl die Freude hoch und laut!
Der Minnesang ertönt zur gold‘nen Leier,
Und an der Fürstentochter Seite schaut
Man Staufenberg, der allen wert und teuer;
Ein Flüstern geht: „Nur er verdient die Braut!“
Auch spricht er gern zur schönen Adeline;
Gern lauscht sie ihm mit Huld und sanfter Miene.
Als froh der zweite Tag in Schatten sinket,
Da tritt in sein Gemach ein Höfling ein,
Und spricht: „Ihr wünscht, o Herr, wie uns bedünket,
Der reizenden Prinzessin euch zu weih’n,
Auch sie – vernehmt, wie Glanz und Wonne winket!
Scheint nicht dem Helden abgeneigt zu sein.
Drum, wollet mir nur Eure Wünsche nennen,
Der Herzog wird Euch gern als Sohn erkennen!
Und Staufenberg versetzt in Glut und Beben:
„Nicht jetzt – doch morgen sei mein Wunsch erklärt!“
Er fühlt in sich der Ehrsucht hohes Streben
Und dass sein Herz die Liebliche begehrt;
Als des Gewissens Schauer sich erheben –
Denkt er: „Wer ew’ge Treu’ der Gattin schwört,
Sollt’ eben so die heil’gen Worte brechen,
Wie ihm ein falsches Weib? – Gott wird es rächen!“
In wankendem Entschluss, in Not und Tränen,
Geht ihm die schlummerlose Nacht vorbei.
Zu Otfried eilt er, als die Vögel tönen
Ihr Morgenlied, und sagt ihm endlich frei,
Nach der Erhab‘nen stehe nur sein Sehnen,
Doch knüpf’ ihn schon das Band an eine Fey.
Der Herzog staunt ob solchen Wunderdingen
Und meint, dies werd’ ein böses Ende bringen.
Er sinnt vergebens, ob ein Rat sich fände;
Darum befragt er seinen Hofkaplan.
Der spricht: „Erlauchter Fürst, der Himmel wende
Das Unheil ab von dieses Edlen Bahn!
Nur wenn sich eine Gattin ihm verbände,
Die Lehr’ und Taufe, so wie er, empfah’n,
Könnt’ er des Spuks verworf‘ne Bande lösen
Und sich befrei’n von dem Gespensterwesen.“
Der Rittersmann entschließt sich: ach! er trauet
So bald dem gleisnerischen Priesterwort!
Der Bund, auf den er stolze Plane bauet,
Die neue Glut, reißt ihn gewaltsam fort.
Als auf die Flur der dritte Abend tauet,
Sieht man verlobt am glanzerfüllten Ort
Den tapf‘ren Staufenberg mit Adelinen;
Rings tönts: „Ein schönes Paar! – Heil, Heil sei ihnen!“ –
Sie schauen soll der zwölfte Tag verbunden;
Da langt zuvor ein Knecht von Staufen an.
Der Ritter stutzt, und fragt ihn, welche Kunden
Er melden soll? Hierauf versetzt der Mann:
„Herr! mit dem Kind ist Euer Weib verschwunden
So schnell, dass Niemand es begreifen kann;
Dies war am Abend der Verlobungsfeier.“
„Seltsam, ruft Staufenberg, und nicht geheuer!“
Es war, – so denkt er – jener Bund geschlossen,
Wenn christlich, doch in schlimmer Geister Sinn;
Wohl mir, dass sich das wahre Licht ergossen!
Und leichten Muts geht er zur Trauung hin.
Schon lacht der Mai und milde Bächlein flossen
In dem Gefild‘; es blüht der Hain, worin
Des Fürsten hohes Lustschloss sich erhebet,
Von Dienern und von Zofen neu belebet.
Dort, als vollbracht die kirchlichen Gebräuche,
Empfängt die Tafel rund im Rittersaal
Den Hof, auch viel der Großen aus dem Reiche,
Der Herrn und Damen zu dem Hochzeitmahl.
Horch! Hörnerschall! die Braut, die göttergleiche,
Beut lächelnd ihrem Lieben den Pokal,
Er nimmt ihn, blickt empor – wird wie versteinet,
Weil – an der Wand ein Frauenfuß erscheinet.
Kalt fährt es ihm und heiß durch alle Glieder;
Nur er kann sehn den niedlich-schönen Fuß;
Der schwindet nun: Der Ritter fasst sich wieder,
Trinkt rasch und murmelt: „Geh’s denn, wie es muss!“
Man will, da schon die Sonne steigt hernieder,
Zur Hofburg zieh‘n noch vor des Tages Schluss.
Doch Staufenberg? – – Man sieht, er kann nicht hehlen,
Dass plötzlich ihn geheime Schauer quälen.
Die Wagen geh‘n im stolzen Pomp zurücke;
Mit Knechten folgt zu Ross der Bräutigam;
Er tauscht mit seiner Holden Liebesblicke,
Und birgt nach aller Macht den inn‘ren Gram.
Im off‘nen Feld erscheint die Bogenbrücke,
Und während jetzt der Zug hinüberkam,
Will durch den seichten Fluss vor seinen Knappen
Der Ritter schnell, und lenkt hinein den Rappen.
Doch in der Mitte schnaubt das Ross – nicht weiter
Will es voran; nichts helfen Sporn und Hand;
Es bäumt und überschlägt sich mit dem Reiter –
Ha! dieser fällt, der Hengst entspringt ans Land.
Schnell wächst der Strom, ergießt sich wild und breiter,
Und überflutet schon den hoben Strand;
Er rauscht, die Wellen türmen sich voll Grausen
Hochauf, der Donner hallt und Stürme sausen.
Wie lässt sich laut der Frauen Klage hören!
Ja, auch den Männern sinkt der tapf‘re Mut;
Ach! die Vermählte bebt in heißen Zähren –
Da sieh! mit einmal weicht der Stürme Wut;
Neu will die Au‘n der Sonne Schein verklären,
Das Wasser fällt und sanft hin wallt die Flut;
Die Lerche singt, des Zephirs Hauche wehen –
Jedoch der Ritter ward nicht mehr gesehen.
Karl Geib.
(Aus Geibs „Volkssagen des Rheinlandes etc. etc.“ Heidelb. 1828. Vergl. mit: „Ritter Peter von Stauffenberg und die Meerfeye“ in des Knaben Wunderhorn. (S. die vorige Sage im Volkston.)
Melusine im Stollenwald.
Im Durbacher Tal sieht man noch im großen Stollenwald die Trümmer einer alten Burg; am Eingang des Tales aber erhebt sich links das Schloss Staufenberg. Von jener alten Burg geht folgende Sage:
Einst wohnte ein Amtmann zu Staufenberg, der hatte einen Sohn, namens Sebald. Dieser liebte den Vogelsang und begab sich im Herbst oftmals an den Fuß des großen Stollenwaldes, um Maisen zu kloben. Da hört’ er einmal vom Berg herab so lieblich singen, dass er hinauf ging, um zu sehen, was es wäre. Auf dem Gipfel des Stollenberges ward er in einem Gebüsche ein wunderschönes Weib gewahr, das zu ihm sagte: „Erbarme dich meiner und erlöse mich; ich bin verwünscht, und harre seit langer Zeit auf dich; erhöre meine Bitte, du darfst mich nur dreimal dreifach küssen, so bin ich erlöst.“ Sebald fragte sie, wer sie denn sei? und sie gab zur Antwort: „Ich bin Himmel-Stollens Tochter, und heiße Melusine;[1] ich habe einen großen Brautschatz, und wenn du mich erlösest, so bin ich und der Schatz dein eigen. Du musst mich drei Morgen nacheinander, um neun Uhr in der Frühe, auf beide Wangen und auf den Mund küssen, dann ist die Erlösung vollbracht. Fürchte dich nicht, besonders nicht am dritten Tag.“ Sebald betrachtete Melusinen, die aus dem Busche hervorkam, sehr genau. Sie war blond, hatte blaue Augen und ein schönes Angesicht, aber an ihren Händen keine Finger, sondern eine trichterartige Höhlung, und statt der Füße einen Schlangenschwanz. Sebald gab ihr die ersten drei Küsse, worüber Melusine sehr froh war und ihn bat, am zweiten und dritten Tag wieder zur rechten Zeit da zu sein. Sie kroch in ihren Busch zurück und sang: „Komm und erlöse deine Braut, – hüte dich wohl, zu erschrecken,
Sebald, nimm dich wohl in Acht!
Einmal war es recht gemacht.“
Da versank sie rasch in die Erde und Sebald ging heim. Am anderen Tage kam er zur rechten Zeit wieder in den Stollenwald und hörte sie auf der Höhe singen. Dieses Mal hatte sie Flügel und einen Drachenschweif, aber Sebald nahte sich ohne Furcht und gab ihr die drei anderen Küsse. Sie sang ihm wieder dankbar zu, wie am ersten Tage und bat ihn, wieder zu kommen, worauf sie abermals in die Erde verschwand. Sebald konnte die Nacht über nicht ruhen und ging früh wieder in den Stollenwald und hörte Melusinens Lied, wie an den vorigen Tagen. Aber diesmal hatte sie einen Krötenkopf und der Drachenschwanz umschlang furchtbar ihren Leib. Es grauste Sebald vor dieser giftigen Gestalt und er sprach zu ihr: „Kannst du dein Antlitz nicht entblößen, so kann ich dich nicht küssen.“ „Nein!“ rief sie, und streckte mit einem lauten Schrei ihre Arme nach ihm. Die Angst ergriff den Sebald, er sprang den Berg hinab und gerade schlug es neun Uhr, als er im schnellsten Lauf in der Burg bei seinem Vater ankam und Diesem erzählte, was ihm begegnet war. Er ward jedoch über seine Furchtsamkeit von dem Vater gescholten, der die Geschichte zum ewigen Angedenken aufschreiben ließ, wodurch sie bis auf den heutigen Tag bekannt ist.
So vergingen zwei Jahre. Sebald besuchte nicht mehr den Stollenwald und dachte wohl manchmal daran, dass er die Melusine betrogen habe. Doch war ihm seitdem nichts geschehen. Als er nun den Dienst seines Vaters bekommen sollte, so sah sich dieser um eine Frau für seinen Sohn um, und gab ihm die Tochter eines Amtsvogtes. Bei der Hochzeit im Schloss Staufenberg war alles recht fröhlich am Tische, als auf einmal die Decke des Saales einen Spalt bekam, woraus ein Tropfen in den Teller Sebalds fiel, der, ohne dies zu wissen, von der Speise aß, augenblicklich aber tot niedersank. Man sah zu gleicher Zeit einen kleinen Schlangenschweif sich in die Decke zurückziehen. Noch ist die Geschichte in Stein gehauen auf dem Staufenberg zu sehen.
(Nach mündlicher Überlieferung mitgeteilt von Bernhard Baader in Mones „Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit.“ Jahrg. 1834. S. 88)
1. Ein Ritter Hans Stoll von Staufenberg kommt in Sachs’ Bad. Gesch. II. 246, vor.
Der Teufelsstein auf der Schiehald.
Nicht weit von den zwölf Steinen ist ein Berg, der heißt die Schiehald, da steht der größte Stein. Den hat einst der Teufel dahin getragen, und wollte damit die St. Wendelinus-Kirche im Tal zerschmettern. Er nahm ihn von den zwölf Steinen weg, ging damit durch das große Rappenloch und kam bis auf die Mitte der Schiehald, wo er den Felsen ablegte und ausruhen wollte. Nachher konnte er aber den Stein nicht mehr aufheben, da dieser mit dem spitzigen Ende im Berg stecken blieb, und noch sieht man daran das runde Loch, welches die Schulterknochen des Teufels hineingedrückt haben, als er den Stein hertrug. Noch steht er auf der Schiehald und heißt der Teufelsstein, und so blieb die Kirche verschont. Der Teufel fährt aber manchmal auf jenem Platze mit sechs Geißböcken herum und man hört ihn um Mitternacht mit der Peitsche knallen. Es ist nicht gut, nachts an jenem Orte vorbeizugehen, selbst mit Fackeln nicht, denn sie werden Einem ausgelöscht und die Leute dann in der Irre herumgeführt.
(Nach mündlicher Überlieferung, mitgeteilt von Bernhard Baader in Mones „Anzeiger zur Kunde der teutschen Vorzeit.“ Jahrg. 1834. S. 88.)
Der Schatz im Stollenberg.
Im Jahr 1779 diente ein fünfzehnjähriges Hirtenmädchen, welches die Melusine oft gesehen hat, zu Durbach auf dem Eisenbühl. Ein Platz hinter dem Stollenwald heißt „bei den zwölf Steinen,“ da erschien Melusine dem Mädchen und führte es beim Wolfsloch in den offenen Stollenberg hinein. Da lagen am Eingang drei ungeheure Riesen, mit Speer und Harnisch bewaffnet, und schliefen. Als sie weiterkamen, sahen sie große Kisten und auf jeder saß ein schwarzer Hund. Vor der Melusine sprang aber jeder Hund gehorsam herab und sie öffnete die Kisten mit ihrem Schlüsselbund. Es waren sechs, alle mit Geld angefüllt, welches Melusine dem Mädchen versprach, wenn es sie erlösen wollte. Die Kisten wurden wieder geschlossen und die Hunde sprangen darauf, um sie zu bewachen. Sie gingen nun zu den zwölf Steinen zurück und der Berg schloss sich bei ihrem Ausgang wieder zu. Dort erzählte Melusine dem Hirtenmädchen: „Wenn du 18 Jahre alt bist, kannst du mich erlösen, denn ich bin verwünscht, und will dir all das Gold geben, das du gesehen hast. Schon lange hab’ ich auf dich gewartet und geschlafen bis zu deiner Ankunft. Hier bei diesen Steinen musste erst ein doppelter Tannenbaum aus einer Wurzel sprossen, und als er hundert Jahre alt war, mussten ihn zwei ledige junge Leute am Wunibaldstage umhauen. Der stärkste Stamm wurde auf einem Schlitten hinab ins Tal geführt auf Dagobertstag, und aus den Brettern dieses Stammes deine Wiege gemacht.“ – Noch oft kam Melusine an diesem Ort mit dem Mädchen zusammen und man sprach im ganzen Tale davon, dass die Verwünschte erlöst werden sollte. Viele Leute gingen zu dem Mädchen und gaben ihm Geschenke zur Aufmunterung, bis endlich der Pfarrer die Leute abmahnte und dem Mädchen mit Kirchenbußen drohte. Da kam die Erlösung nicht zu Stande; wer aber von Sünden rein ist, wird doch zuletzt die Melusine mit ihren Schätzen erlösen.
Das Hirtenmädchen nähte in ihrem späteren Alter um Lohn bei den Leuten und lebte noch zu Anfang dieses Jahrhunderts sehr still, ließ sich aber nicht mehr ein, diese Geschichte ihrer Jugend zu erzählen. – Bei den zwölf Steinen sind noch zwei Tannen zu sehen, die aus einer Wurzel entsprosst sind und damals hundertjährig waren. Man heißt sie Melusinen-Baum.
(Mitgeteilt von Bernhard Baader in „Mones Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit.“ Jahrg. 1834.)
Der Fuß in der Wand.
(Nachträglich zu den zwei anderen Bearbeitungen derselben Sage.)
Der Staufenberger ritt zu seiner Burg geschwinde;
Wie bald entließ der Graf sein lästig Jagdgesinde!
Zur Ruhe sehnt er sich, er war so müd’ geritten;
Er dachte: „Lieb, o Lieb!“ – Da kam sein Lieb geschritten.
Sie gab ihm Kuss auf Kuss die kurze Nacht voll Wonne,
Er meint, es wär’ der Mond, da schien die lichte Sonne.
Er sprach: „Du bist so schön, wie könnt’ ich dein vergessen?
Den lockt kein ander‘ Weib, der solch ein Glück besessen!“ –
„So leicht ist Treue nicht, schlau wird man dich umgarnen,





























