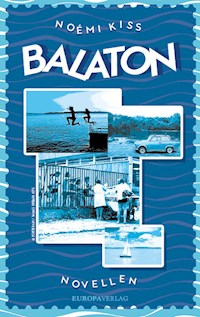
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ungarn in den 1980er-Jahren: Der Balaton, oder Plattensee, ist ein beliebtes deutsch-deutsches Urlaubsziel. Hier liegen Ost- und Westdeutsche einträchtig nebeneinander am Strand, durch den Mauerbau getrennte Familien machen gemeinsam Ferien. Es ist ein Ort der gelebten Wiedervereinigung, lange bevor die Mauer fällt. Aber das scheinbare Idyll hat auch Schattenseiten. Während "die Badewanne Ungarns" für die Besucher aus der BRD ein billiges Urlaubsvergnügen ist, müssen die DDR-Bürger jede Mark zweimal umdrehen und verpflegen sich überwiegend aus von zu Hause mitgebrachten Lebensmittelvorräten. Dennoch ist der Balaton für viele von ihnen ein Sehnsuchtsziel, ein erster Schritt in Richtung Freiheit – von der ihre ungarischen Gastgeber gleichermaßen träumen. Noémi Kiss fängt in ihren Novellen die besondere Stimmung dieser Zeit vor dem totalen Umbruch ein, lässt ihre angespannte, abwartende Stille geradezu greifbar werden. Auf fast beiläufige Art gewährt sie tiefe Einblicke in die sozialistische Welt jener Jahre an diesem Fleck Ungarns, und immer vermischt sich die Spannung des Entdeckens mit dem aufwühlenden Gefühl der Beklemmung. Ist die oberflächliche Sommerfreude auch noch so ausgelassen, das Wasser schwemmt immer wieder entglittene Schicksale, Verbrechen, Geheimnisse und Lügen ans Ufer. Oder warum heißt es, der alte Botlik sei beim Schwimmen ertrunken, obwohl jeder weiß, dass kein Anwohner des Plattensees freiwillig in der August-Mittagshitze in den See steigen würde?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOÉMI KISS
BALATON
Novellen
Aus dem Ungarischen von Eva Zador
Es war einmal vor langer, langer Zeit, als hier noch keine Ungarn lebten,oder vor noch längerer Zeit, da wohnten im Bakony-Gebirge zweiRiesenfamilien. Eines Tages gerieten die Familienoberhäupter in Streit.Die Frauen versuchten, sie voneinander zu trennen, doch als dieMänner nach den Knüppeln griffen, da erschraken sie sich so sehr,dass sie an den Rand des Bakony-Waldes flohen.Voller Schmerz begannen sie zu weinen.Aus ihren Tränen entstand eine große Pfütze.Und aus dieser Pfütze wurde ein See.
Die Originalausgabe ist 2020 unter dem Titel
Balaton: novellák im Magvető Verlag, Budapest, erschienen.
1. eBook-Ausgabe 2021
© 2020 Noémi Kiss
© der deutschsprachigen Ausgabe:
2021 Europa Verlag in Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Bildes von © Fortepan/Tamás Urbán, 1975
Lektorat: Palma Müller-Scherf, Berlin
Layout und Satz: Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-364-7
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
Honeckerlatschen
Turner
Egel
Stella
Am Steg
Und Tante Klára lag auf ihrer Matratze
Die Flugbegleiterin
Der Zeichner
Frost
Segel im Wind
Hamburger
Die Schneckensammlerin
Das Mädchen aus dem Kanal
Angelhaken und Dämonen
HONECKERLATSCHEN
Mit der DDR verschwand auch der Balaton. Das Augustgewitter blies den Geruch des heißen Langosch von unserem Strand fort. Die Wolken hockten wie ausgefranste, weiße Papierservietten über dem wogenden Wasser. Alles war wild und so verdammt vergänglich. Als das Donnern vorbei war, hörte es auch auf zu regnen. Meine Eltern und ich gingen über die Gleise und ließen die Schranke am Balaton hinter uns. Wir zogen uns in die Deckung, in die Stadt zurück. Wen interessierte schon der kalte See am Sommerende, der Augenblick, in dem der Balaton grau wurde und der heulende Wind die Kiesel am Ufer in alle Himmelsrichtungen trieb.
Das Ufer war menschenleer. Niemand lag auf seiner zerschlissenen Decke unter der Trauerweide, mit Sonnenbrand und sich am Rücken schälender Haut. Der Liegestuhl aus Kunststoff war leer, das Eisenrohr am Steg eiskalt. Verschwunden waren die auf dem Rasen aufgespannten Leinenzelte, in den Reifenspuren der Wohnwagen sammelte sich der Schlamm. Ein Paar gelbe Badelatschen lagen am Strandzugang. Ich ahnte, wer sie dort zurückgelassen hatte. Der Balaton meiner Fantasie zog für den Winter in unser Kinderzimmer ein, und wir konnten es kaum erwarten, dass es wieder Sommer wurde. Ich mochte den See nicht nur, weil wir dort badeten, uns im Schlamm suhlten und Köderfische fingen, sondern auch, weil ich endlich deutsche Mädchen treffen konnte. Das deutsche Mädchen kam mit einem Wartburg oder Trabi, seine Eltern schauten Fußball, und sie aßen Unmengen an Melonen. Auf ihren Dachgepäckträger waren fünf Kilo Kartoffeln geschnallt, immer und überall hatten sie belegte Brote dabei, sogar für die Toilette waren ihnen die paar Forint zu schade, die sie für ihre Mark bekommen hatten. Die Ostdeutschen fuhren frühmorgens zum Pullovermarkt nach Kiliti, wohin uns keine zehn Pferde brachten.
Im Laufe der Achtzigerjahre wurden es immer mehr, in Massen belagerten sie die Ferienhäuser und die Datschen. Sie wohnten in Schuppen, übernachteten im Schlafsack auf dem Steg oder erjammerten sich ein Zimmer in einem Ferienheim der Gewerkschaft. Sie lagen auf karierten Wolldecken, ihre geklebte, rissige Luftmatratze – von der wir stundenlang ins Wasser sprangen – leuchtete von Weitem. Ständig hatte sie ein Loch, dann flickten wir sie, doch schon kam ein neues zum Vorschein. Wir wetzten sie vollkommen durch. Sie schwammen in Trainingshosen, in Turnhemden und Turnhosen, weil sie einen Sonnenbrand hatten, meine Mutter schmierte ihnen den Rücken mit saurer Sahne ein. Ein anderes Mal nackt, weil sich die deutschen Mädchen – im Gegensatz zu uns – überall auszogen. Sie schämten sich nicht, verstanden auch gar nicht, warum wir im Sommer so viel Kleidung trugen. Stundenlang saßen sie ohne Bikini auf einem Ast oder spuckten am Fuße eines Baumes Melonenkerne aus. Sie waren fremd, sonderbar, manchmal auch beängstigend, dennoch bewirtete sie jeder gern. Mein Vater erklärte immer, dies sei wegen des Kriegs so, wovon ich zwar kein Wort verstand, aber ich hörte ihm gern zu.
Die Ostdeutschen aßen im letzten Jahr schon kein Fleisch mehr, auch Brot kaum. Sie sagten, wenn der Herbst da wäre, würden sie nach Wien flüchten. Dieses Herumalbern, das bei uns des Sommers im Garten ablief, oder das Abpulen der Blutegel im Uferschlamm, das reichte ihnen nicht. Für sie war die westliche Welt die Freiheit, und die Freiheit lebte dort, jenseits des Eisernen Vorhangs. Sie sparten die ganzen Ferien hindurch. Sie wurden klapperdürr, damit sie auf die andere Seite des Stacheldrahts gelangen konnten.
Das Radio meiner Mutter weckte uns laut. Es ist der 11. September 1989, morgens sechs Uhr. Kakao und Hefezopf mit Margarine. Ich muss los in die Schule, liege aber nicht allein unter der Decke. Neben mir Heidi, meine sommersprossige Freundin aus Jena, die ich vom Balaton kenne. Heute will ihre Familie versuchen, über die Grenze zu fliehen. Reglos, mit geschlossenen Augen bleiben wir liegen. Die Stimme meiner Mutter empfinden wir als schrecklich störend. Heidi flüstert mir zu, sie werde ganz sicher nirgendwohin gehen. Lieber springe sie aus dem Fenster. Sie zittert. Wie feige, denke ich, aber insgeheim freue ich mich auch, dass sie neben mir im Bett bleibt. Heidi raunt mir ins Ohr, sie gehe zurück an den Strand, in ihren Wohnwagen, dort wolle sie leben, sie könnte ja Gärtnerin auf dem Campingplatz werden. Mach die Augen zu, sage ich zu ihr. Wir ziehen uns die Decke über den Kopf. Ich drücke sie an mich, wir bauen uns eine eigene Höhle. Und schon sitzen wir im Wohnwagen, draußen brennt die Sonne, auf dem Campingtisch kleben wir die Sticker unserer Lieblingsbands in die Zeitschrift. Zu Abend gibt es Himbeersirup und Kirschlutscher. Heidi beginnt zu summen und wackelt mit dem Hintern hin und her. Ihr Zittern ist vorbei. Sie singt immer lauter, ihre Stimme ist sehr schön. Nur, dass meine Mutter schon wieder schreit.
Los, eins, zwei, drei, Zähne putzen! Am Nachmittag habe ich Training, ob meine Sportsachen eingepackt seien: weiße Socken, Schienbeinschoner, Wechselschuhe, Laufhose. Wenn ich mich bewegen wollte, dann höchstens, um Heidis Flucht zu verhindern. Ich hasse es, zweimal am Tag zum Training zu müssen. Ungarisch, Chemie und Mathe hasse ich auch, allein Physik mag ich, weil der Lehrer ein schöner Mann ist, mit roten Haaren und muskulös. Die Schule ist ein Gefängnis. Nicht die DDR ist das Gefängnis, sondern Kind zu sein, sagt Heidi, und wir lachen. Wien hasse ich einfach, weil es mir die Freundin nehmen will. Wie beschissen muss der Westen doch sein, von dem Heidis Eltern so schwärmen, es reicht, sie nur anzusehen, und schon vergeht mir die Lust auf den Hefezopf. Ihr Vater schwitzt immerzu, redet nie ein Wort mit mir. Ihre Mutter sieht aus wie ein Frosch, ihr Körper bläht sich manchmal so sehr auf, dass sie Medikamente nehmen muss.
Die Familie von Heidi Müller hatte in jenem Sommer ihren gesamten Hausrat zu uns gebracht. In ihrem Auto und dem winzigen Wohnanhänger hatte alles Platz gefunden. Sie parkten vor unserem Haus in der Gépmadár-, der Blechvogel-Straße. Damals wohnten wir am Örs-vezér-Platz. Nur ihre Koffer hatten sie in den achten Stock hochgebracht, wir trugen sie in die Loggia, wo sie an einem Abend vom Regen klatschnass wurden. Tagelang wohnten wir zusammen. Sie fuhren jeden Tag in den Bezirk Zugliget, wo sie als Kopfration vom Malteser Hilfsdienst umsonst Suppe mit Grießknödeln bekamen. Meine Mutter arbeitete den ganzen Tag in der Schule, sie hatte keine Zeit, sie zu bekochen. Heidi ist übrigens in den Abendnachrichten im Fernsehen gewesen, erzählte mein Vater. Uns zwei interessierte die Begeisterung meiner Eltern jedoch kein bisschen, wir schlossen uns in meinem Zimmer ein und hörten unter der Bettdecke Musik, das war die schönste Septemberwoche meines Lebens.
Die Straßen von Buda und Pest waren im Herbst 1989 monatelang voller parkender Dacias, Trabis, Wartburgs und Ladas mit dem Aufkleber DDR. Sie durften überall stehen bleiben. Sie füllten die Straßen des Arbeiterviertels Kőbánya, benannt nach den einstigen Steinbrüchen hier, den Stefánia-Weg, die Strecke entlang der Straßenbahnlinie 13, sogar im Wäldchen wohnten Ostdeutsche. Wochenlang warteten sie, damit jemand in der Botschaft der Bundesrepublik sagte, man würde die Grenze öffnen und sie bekämen eine Ausreisegenehmigung. Es gab Innenhöfe, wo vollgepackte Koffer über Monate warteten. Zusammengerollte Teppiche, Kinderräder und Töpfe standen in den Treppenhäusern der Plattenbausiedlungen herum. Verlassene Zelte, Haushaltsgeräte. Hochstühle, Decken, Windelpackungen, na und die Pantoffeln. Ein besonderes Merkmal der Ostdeutschen waren diese Holzpantoffeln mit der massiven Sohle. Honeckerlatschen nannten sie meine Eltern. Sie steckten ihre Füße unter einen Lederriemen mit Schnalle, wodurch sich ihr Gang vollkommen veränderte. Wenn die Latschen zu klein waren, störte sie das nicht sonderlich, mit den Zehenspitzen schleiften sie über den Boden, und ihre Fersen hingen auf den Gehweg. Sie liefen, rannten keuchend in ihren Latschen zum Eisernen Vorhang, um bei Hegyeshalom oder am Neusiedler See ins Burgenland zu fliehen. Als ich in der achten Klasse war, bekam ich zu Weihnachten auch ein Paar Honeckerlatschen. Das wurden meine Wechselschuhe. Ich war die Erste in der Klasse, die etwas Deutsches hatte. Beliebt machte mich das nicht. Ein Paar federleichte Adidas-Schuhe wäre viel besser gewesen, aber die hatte nur einer, und das auch nicht bei uns, sondern in der 7 B. In der großen Pause gingen wir sie anschauen. Tamás Nagy nahm Geld dafür; wenn wir ihm einen Fünfer gaben, durften wir sie anprobieren. Mit Schaumstoff gefüttert, dickerem Absatz, bis zu den Knöcheln reichend, durch die Löcher konnte man zwei Schnürsenkel auf einmal fädeln. Seitlich leuchteten die drei Streifen in Neongrün. Wenn ich jemandem mit den DDR-Latschen auf die Füße trat, dann tat das höllisch weh, ich liebte es, mit meinen Schritten Angst und Schrecken zu verbreiten.
Mein Vater kochte auf kleiner Flamme Kesselgulasch. Der Rauch verschwand zwischen den Blättern der Pappeln, wir saßen im Garten unserer Datsche auf Holzstümpfen. Er würzte mit viel Paprika, denn so hatten es die Deutschen bestellt. Aber sie mussten es gar nicht sagen, er wusste auch so, was die Deutschen haben wollten. Früher hatte er in Jena als RGW-Austauscharbeiter gearbeitet.
Westdeutsche und Ostdeutsche. Sie versammelten sich auf der Terrasse um den großen Tisch. Schlugen nach den Mücken, die Fliegen belagerten das Fleisch. Manchmal kamen ihnen vor Lachen die Tränen, aber wirklich ausgelassen lachten sie nur selten. Die Ostdeutschen sind so angespannt, so steif, als hätten sie einen Stock verschluckt, sagte mein Vater. Ja, sie waren angespannt, manchmal zitterten sie auch, taten aber so, als wäre das egal. Hin und wieder legten sie all das völlig ab, wer konnte da schon schlau aus ihnen werden. Am Balaton wurden sie zu anderen Menschen, sagte man, sie waren wie ausgewechselt. Sie tauten auf, lachten laut. Waren aufgeschlossen. Ständig riefen sie mich zum Spielen: Kommahea, Kommahea! Die deutschen Mädchen waren die ersten Ausländer, mit denen ich als Kind spielte, bis dahin hatte ich keine Ahnung, dass Fremde überhaupt existierten.
Am Abend kamen die Deutschen zu uns zu Besuch. Sie brachten eine Flasche Bier mit. Auch Westdeutsche kamen, mit mehreren Kisten Dosenbier, Schweizer Schokolade und der Bravo. Trotzdem wurden nicht sie unsere Freunde, wir spielten eher mit den Ein-Bier-Deutschen. Eigentlich nutzten wir die Wessis aus, wir brauchten sie nur wegen der Geschenke. Mochten sie wegen der Fa-Seife, dem Donald-Kaugummi, der Lindt-Schokolade und der Dosen-Fanta. Warum hätte Heidi schon auswandern wollen, wenn es für uns kein besseres Leben hätte geben können, als uns am Balaton im Schlamm zu suhlen und die Ringelnattern im Schilf zu zählen, die Blutegel zu zertrampeln und einer schwanzlosen Eidechse den Bauch aufzuschlitzen.
»Die ungarische Regierung hat am Morgen des 10. September trotz des Protests der DDR vorübergehend die Ausreise von mehr als sechstausend DDR-Bürgern genehmigt. Damit hat sie einseitig die Punkte des ungarischdeutschen Abkommens in Bezug auf den Grenzübertritt außer Kraft gesetzt. Bis Anfang Oktober, in nur fast einem Monat, ist es mehr als fünfunddreißigtausend ostdeutschen Staatsbürgern gelungen, in die Bundesrepublik Deutschland auszureisen. Die letzten Flüchtlinge verließen das Lager im Budapester Bezirk Zugliget am 14. November 1989. Die Grenzöffnung wurde zu einem Meilenstein des osteuropäischen Systemwandels und des deutschen Wiedervereinigungsprozesses.«
Mit geschlossenen Augen lagen wir im Bett und lauschten. Dem rhythmischen Singen meiner Mutter, ihren Drohungen. Immer wieder rief sie nach uns. Heidi umarmte mich, ich erinnere mich, wie wehmütig sie sagte, wie viel lieber sie mit mir in die Disco käme, die meine Freundinnen aus dem Sportverein und ich zum Schuljahresanfang in einer Garage in Kőbánya organisieren wollten. Meine Mutter polterte gegen die Tür meines Zimmers, also krochen wir schließlich aus dem Bett und gingen uns die Zähne putzen.
Heidi und ihre Familie haben sich nur in einem Pullover zu Fuß auf den Weg nach Wien gemacht, erzählte mein Vater den Nachbarn. In Wahrheit trug Heidi eine Jeans, stonewashed, und ein T-Shirt.
Gemeinsam verließen wir den achten Stock in der Blechvogel-Straße. Wir begleiteten Heidi und ihre Eltern zum Örs-vezér-Platz. Am Abend zuvor hatten sie ihren Wohnwagen unweit vom sogenannten Pilz, dem Fahrkartenschalter der öffentlichen Verkehrswerke, an der Endstation der S-Bahn geparkt, nur dort war noch ein Platz frei gewesen. Ihre ganzen Sachen waren noch da. Sie sollten etwa ein Jahr später wiederkommen, um sie zu holen. Heidi sah ich das letzte Mal, als sie mich an jenem warmen, gelb schimmernden Septembermorgen beim Schalter-Pilz umarmte. Ihre blonde, kräftige Mutter riss sie mir nervös aus den Armen. Komm, wir müssen los! Heidi kehrte mir den Rücken zu, ich sah, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie hatte nicht die geringste Lust auszuwandern. Sie hatte zu nichts Lust, was die Eltern ihr aufzwangen. Sie brüllten sie an, verpassten ihr sogar eine Ohrfeige. Heidi verstummte, wie ein Roboter, so schritt sie in ihren Latschen voran und drehte sich nicht mehr um.
Sie sind in einem Lager gelandet, das war alles, was meine Mutter an Weihnachten erzählte, aus Tirol hatten sie uns die letzte Nachricht geschickt. Sie wünschten uns frohe Weihnachten, baten uns, auf ihre in Budapest zurückgelassenen Töpfe aufzupassen und auf ihre Campingausrüstung, die könnten sie noch gebrauchen, denn im Westen hätte man viel mehr Urlaubstage. Wenn wir wüssten, was für wundervolle Seen, Berge und Häuser da auf uns warteten, dann würden wir keinen Augenblick länger im Ostblock bleiben. Schade, dass wir nicht über die Grenze kommen könnten.
Heidis Unterschrift fehlte auf der Postkarte. So eine Enttäuschung. Ich drehte und wendete sie, suchte ihren Namen, forschte nach einem Zeichen, vergebens. Seitdem habe ich ihren Namen auch nicht gegoogelt. Einmal werde ich vielleicht Lust dazu haben und versuchen, sie aufzuspüren. Jetzt habe ich keine. Heidi soll so bleiben, zitternd, ängstlich, mit eingecremtem Rücken, wie ich sie das erste Mal beim Schilf am Strand gesehen habe. Mit einem cremeverschmierten Küchentuch auf dem Rücken. Nackt, ohne Höschen saß sie auf ihrer Luftmatratze in Siófok in der prallen Sonne und spielte Rommé.
TURNER
Im Ferienort gab es zwei enge, geschotterte Straßen. In der Szegfű-Straße wohnten im Sommer die Fußballer, in der Parallelstraße, der Bethlen-Gábor-Straße, die Schwimmerfamilien. Generationen, die im Wasser aufgewachsen waren. Wenn sie mit dem Sport aufhörten, wurden sie Trainer, besuchten die Universität, ohne eine Aufnahmeprüfung. Sportärzte, Zeitnehmer, Schiedsrichter.
Die Familienmitglieder des Olympiasiegers Novák verbrachten ihren Urlaub in dem Haus an der Ecke. Das Haus, mit Arkaden und Veranda, war knallgelb gestrichen, die drachengrünen Fensterläden öffneten sie nie, damit es drinnen auch bei größter Hitze kühl blieb. Ihr schattiges, längliches Grundstück war voller Tannenzapfen, überall klebte Harz. Die Badeanzüge hängten sie im hinteren Teil des Gartens am Pflaumenbaum auf. Sie hängten sie nach dem Schwimmen mit Wäscheklammern an die Leine, es blieben nur ein paar Stunden, damit sie bis zum nächsten Training trockneten. Neben dem Pflaumenbaum standen eine Holzbank und eine Truhe, in der wurden die Schwimmflossen und die Bojen aufbewahrt, die Pumpe und die Schwimmbrillen, die Decken und die zerschlissenen Bastmatten. Hier turnten sie manchmal im Schatten, Bauchpressen, Klimmzüge. Wenn es sich ergab und am Vorabend im Radio gutes Wetter vorausgesagt wurde, dann gingen sie am frühen Morgen durch den Wald zum Ufer hinunter. Sie schmierten sich mit Fett ein und schwammen nach Almádi hinüber, um dann mittags mit dem Schiff nach Siófok zurückzukommen. Den Fahrplan hatten sie sich ausgerechnet.
Zum Aufwärmen machten sie am Steg vierzig Liegestütze. Das seichte Wasser am Schilf war frühmorgens ziemlich kalt, fast eisig. Kalt, aber klar, nahezu durchsichtig. Man konnte gut sehen, wie die Aale an den Ufersteinen auf Jagd gingen, etwas tiefer die Zander. Es dämmerte noch. Die Sonne war rot, die Planken des Stegs feucht vom Dunst. Warm wurde es erst gegen elf. Dann bedeckten die Mückenlarven den See, und am Steg schäumte das Wasser. Bis dahin hatten sie schon vier Kilometer zurückgelegt, gekrault, der Vater und die beiden Novák-Schwestern. Dass sie hinausgeschwommen waren, wusste man, weil ihre zerschlissenen Bastmatten im Gras lagen, sie hatten Steine darauf geworfen, damit der Wind sie nicht davonblies, ihre Trainingsanzüge lagen beim Zugangssteg.
Wenn man den Goldstrand entlangspazierte, ganz bis zum FKK-Teil am Strand von Sóstó, sah man lauter mollige Körper auf Handtüchern und Luftmatratzen. Die Körperhaufen zeichneten Kugeln auf den seidigen Sandboden des Strandes. Wenn sie sich umdrehten, blieb auf ihren Rücken der Abdruck der Luftmatratze zurück. Geröstete Wangenbraten schnappten nach den nächsten Bissen. Hautsülzen wabbelten bei der kleinsten Bewegung. Vormittags legte sich häufig eine sonderbare Ruhe über den Strand, nur Essensgeräusche durchbrachen das leise Plätschern des wogenden Wassers. Das Auspacken und Rascheln der Plastiktüten, das Schlucken des schäumenden Biers, das Krachen der Melonenschalen. Später waren von weiter weg, vom Anglersteg her, die spitzen Schreie der Badenden zu hören. Als wollte der Großteil der Feriengäste sich seine störenden Gedanken mit Gewichtszunahme vertreiben. Auch ihre Fehler und Lügen verwandelten sich in fettiges Fleisch. In gebratene Hähnchenkeulen, mit Nuss gefüllte Palatschinken.
Gegrillt und gekocht der rohen Zeit entfliehen.
Wie die Mutlosigkeit des Meisters nach dem Wettkampf. Keiner feiert ihn mehr, der hymnische Augenblick der Siegerehrung ist vorbei. Es folgt die Zeit des Aufbautrainings. Beschimpfungen, Verrat, Druck. Die wortkarge und harte Trainingsarbeit. Schläge und Rangeleien wegen der Wettkämpfe, wegen der Ausreise. Wer ist es, der das Land wenigstens für ein paar Tage verlassen kann? Je mehr Zeit vergeht, desto schwerer ist es, wenn sich keine Ergebnisse zeigen. Wenn kein Sieg zu verzeichnen ist. Selbst dann, wenn einem eingeredet wird, später auch mal faul am Ufer des Balaton oder im Garten der eigenen Datsche herumliegen zu können. Dass man dafür hart arbeitet, bis zum letzten Atemzug für die Volksrepublik kämpft. Ohne Luft zu holen. Doch es werde alles gut, die wohlverdiente Zeit des Ausruhens komme. Man habe Rechte, Einkünfte und die Möglichkeit, auszubrechen.
Was blieb, war das reglose Herumliegen. Die Krise und die Stille der Ohnmacht. Die unterdrückte Anspannung, die zusammengebissenen Zähne. Der Rausch lebt im Fleisch, in der Haut. Zwischen den Speckfalten.
In der Szegfű-Straße wohnte ein Ersatzspieler der Goldenen Elf. Den grünen schmiedeeisernen Zaun zierten gelbe Blumen. Am Kirschbaum hingen zwei riesige Haken, daran hängte er die Aale. An den Stamm gelehnt stand der Fischgreifer, mit dem er den Aal am Kopf packte, um ihn dann mit einer einzigen Bewegung zu häuten. Er riss ihm die graue, schleimige Haut ab, warf das Fleisch in eine Schüssel, die Katzen leckten den Rest vom Boden auf. Seine Frau kochte im Kessel ein Aalgulasch, sie war Turnerin, zweifache Landesmeisterin am Schwebebalken. Wenn sie zu viele Aale gefangen hatten, gaben sie den Ostdeutschen welche ab, die sie dann genüsslich verspeisten. Seine Frau brachte sie zu den Nachbarn hinüber, wenn sie die Schüssel hochhob, blieb ihr die glitschige Haut am Arm kleben, glitzerte in der Sonne. Im Winter heizten sie mit dem Ölofen. Der Fußballer verbrachte seine Zeit als Rentner ausschließlich mit Angeln. Mehrere Hundert Meter vom Ufer entfernt hatte er einen Steg in den See gebaut. Schon bei leicht diesigem Wetter war er, rauchend und mit seinem breitkrempigen Hut dasitzend, unsichtbar. Er angelte ganze Tage und Nächte lang, sogar im November ruderte er noch auf den See hinaus und nahm dazu seine sechs Ruten mit. Der Nebel wallte, die Sonne zeigte sich erst gegen Mittag. Dieses unsichtbare Leben liebte er.





























