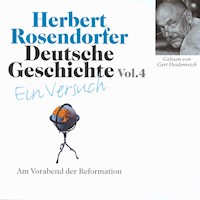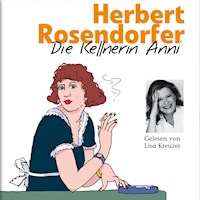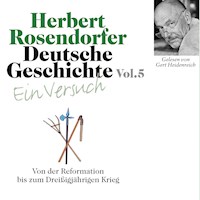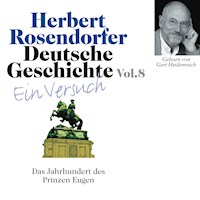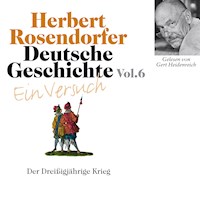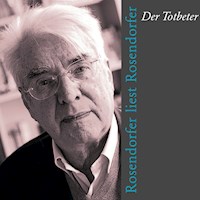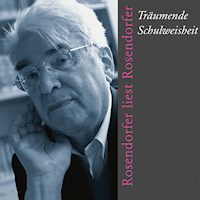7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schwalben in Armagnac: Consommé Pelikan und flambierte Pferdeohren - das Gastmahl im Hause des Herrn von Thod illustriert die Vorliebe Herbert Rosendorfers für Skurrilitüten, Sonderlinge und exotische Schauplätze,die sein gesamtes erzählerisches Werk durchzieht.Seine unglaubliche Phantasie und Fabulierlust kennzeichnen auch diesen Erzählband, in dem der Autor seine Geschichten nach Farben geordnet hat. So gibt es durchsichtige, weiße, blaue, rote, grüne, schwarze und gelbe Geschichten, die für innere und äußere Welten gleichzeitig stehen können. Jede Farbe weist auf die Form oder den gemeinsamen Ausgangspunkt der ihr zugeschriebenen Stücke hin. Dämonen und andere Fabelwesen mischen sich unter die Menschen, der Leser folgt ihnen in aberwitzige und in komische Situationen, man möchte eigentlich gar nicht aufhören zu lesen. (DIE ZEIT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Herbert Rosendorfer
Ball bei Thod
Eine Farbenlehre
LangenMüller
Die Originalausgabe erschien 1980 in derNymphenburger Verlagshandlung GmbH, München
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die erweiterte Neuausgabe: 2011 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München © für das eBook: 2011 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung:Wolfgang Heinzel Umschlagmotiv: Felix Weinold, Augsburg Satz: Ina Hesse eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7844-8035-0
Dem Andenken meiner Mutter,Johanna Rosendorfer, gewidmet.
Inhalt
Ich habe die Geschichten nach Farben geordnet. Farben haben Bedeutungen. Ich versuchte, die Bedeutungen der Geschichten den einzelnen Farben zuzuordnen. Nicht alle Farben sind vertreten. Braune Geschichten schreibe ich nicht.
Durchsichtige Geschichten
Durchsichtig ist nicht farblos. Durchsichtig, gläsern ist eine Farbe. Nicht weiß ist das Gegenteil von schwarz, sondern durchsichtig.
Ball bei Thod
Jupiters letztes Abenteuer
Zehn literarische Selbstbildnisse im Kostüm
Kurtz’ Geschichte
Weiße Geschichten
Weiß ist die heidnische Farbe. Weiß ist eine Morgenfarbe. Weiß ist die Farbe, der die Experten den Farbcharakter absprechen wollen, vielleicht, weil es eine heidnische Farbe ist.
Der Besuch
Norwegische Rhapsodie
Registerarie für Leporello
Gelbe Geschichten
Gelb ist die vielleicht geheimnisvollste Farbe. Sie ist gottgefällig und oft einsam. Nur unter Beobachtung größter Vorsicht habe ich einige wenige gelbe Geschichten geschrieben.
Das Frühlingsgedicht
Corrida
Die springenden Alleebäume
Blaue Geschichten
Blau ist einerseits eine betriebsame, geschäftige Farbe, andererseits – in der Variante Stahlblau – eine sehnsüchtige Farbe. Heimweh ist blau. Nicht umsonst ist die romantische Blume blau.
Keine Spur von Kyselack
Der Friseur
»Anna Z., wo sind Sie?«
Die wahre Geschichte von Tibo, dem Hehlerkönig
Blaßlila Briefe. Eine Erzählung des alten Oberstaatsanwaltes F.
Die Seele der Prinzessin
Eine Zigeunergeschichte
Der erste Kuß
Rote Geschichten
Rot ist eine direkte, eine unmittelbare Farbe. Rot ist eine vordergründige, oberflächliche Farbe, kann aber in bestimmten Schattierungen auch mysteriös und geheimnisvoll sein, namentlich in der Variante Ziegelrot.
Eine Krone für die Armen der Welt
Wie war das mit dem lieben Gott?
Olympisches Feuer
Was trägt der Mann von Welt auf dem Denkmal?
Boulevard-Komödie
Grüne Geschichten
Grün ist – obwohl keine primäre Farbe – die eigenständigste Farbe. Grün kann eine Welt für sich sein. Grün ist eine schnelle Farbe, sie eilt über die Welt, und es ist schwer, sie zu erfassen.
Hauptbuch des Verführers
Föhn
Die Insel
Das verhängnisvolle Violinkonzert
Eichenlaub und Judenstern
Schwarze Geschichten
Schwarz ist eine weithinreichende Farbe. Schwarz ist fast so direkt wie Rot. Auch der Farbe Schwarz wurde – wohl aus Angst – von den Experten Unrecht getan, indem sie ihr den Farbcharakter absprachen.
Bilanz
Eine Begegnung im Park
Bénédiction de Dieu dans la Solitude
Die letzte Attacke
Nachwort
Lesetipp
Durchsichtige Geschichten
Ball bei Thod
I
Herr Anastasius von Thod empfing seine Gäste an der Treppe im inneren Schloßhof. Es lag tiefer Schnee, und es war sehr kalt. Herr von Thod trug deshalb eine Pelzpelerine aus Bisamfellen. Zwei Diener stützten ihn, weil die Bisamfelle so schwer waren. Herr von Thod stand drei Stufen über den Dienern, die ihn stützten, er war nämlich sehr klein. In Kreisen seiner Schneider wurde von 1 Meter 51, gelegentlich von 1 Meter 49 gemunkelt. Herr von Thod pflegte, wenn er von seinem zwergenhaften Wuchs sprach, was selten genug der Fall war, sich mit dem berühmten König Vittorio Emanuele III. von Italien zu trösten, für den – wußte von Thod zu berichten – das Mindestmaß für die Armeetauglichkeit von 1 Meter 50 auf 1 Meter 47 herabgesetzt werden mußte, weil sonst er, der König und verfassungsmäßige Oberbefehlshaber der italienischen Armee, mit seinen 1 Meter 48 überhaupt nicht Soldat hätte sein können. Vittorio Emanuele III. habe dann die überlange – und mit den Jahren dann auch ziemlich dicke – Prinzessin Helene von Montenegro geheiratet. Montenegro war gerade noch standesgemäß, gerade noch. Aber Helene war die größte aller damals heiratsfähigen Prinzessinnen, etwa 1 Meter 90 groß, und das war für Vittorio Emanuele III. ausschlaggebend, denn, so hoffte er, den Fortbestand des altedlen Hauses Savoyen mit Prinzen und Prinzessinnen von normaler Größe zu sichern. Bei der Trauung in der Hauskapelle des Quirinals war die Braut im Knien so groß wie der stehende Bräutigam. Einmal habe er, erzählte Herr von Thod in solchen gelösten Stunden, das Hohe Paar in Florenz gesehen. Die große, dicke Königin habe, über die Mode der Zeit hinaus, mit Vorliebe enorm breitrandige, überladene Schleierhüte getragen. Der König wirkte neben ihr wie ein Maikäfer unter einem Fliegenpilz.
Es hatte aufgehört zu schneien, einige kalte Sterne kamen heraus. Der innere Schloßhof war hell, weil alle Fenster des Schlosses erleuchtet waren. Herr von Thod hatte, wie er so auf der dritten Stufe der inneren Schloßhoftreppe stand, die Fersen an die vierte Stufe gestellt. Dennoch ragten seine Füße zu mindestens einem Drittel über die Stufe, auf der er stand, hinaus. In seinen enormen Lackschuhen spiegelten sich die Lichter des Festsaales. Herr von Thod hatte Schuhgröße 48. Wie Ghandi, pflegte Herr von Thod zu sagen (aber nicht viel öfter, als er über seine Körpergröße sprach); der große indische Weise und Staatsmann habe Schuhgröße 49 gehabt. Einmal sei Ghandi eine Kutsche über die Zehen gefahren. Der Mahatma habe fürchterlich geflucht, aber der Kutscher habe gar nicht verstehen können, daß er dem Staatsmann über die Zehen gefahren sei. Ghandi habe doch so weit weggestanden. Ghandi zeigte nur stumm dem Kutscher seine gewaltig großen Füße. Da habe der Kutscher bedauernd genickt. Schuhgröße 49 – wegen der Schwierigkeit, passende Schuhe zu bekommen, habe Ghandi dann die Sandalen vorgezogen oder sei überhaupt barfuß gegangen. Dennoch sei er ein großer Staatsmann gewesen, pflegte Herr von Thod zu sagen, und ein großer indischer Weiser. Überhaupt seien Menschen mit großen Füßen in der Regel beseelter, verinnerlichter; vermutlich, weil das Blut besser abkühlt. Nero, weiß man, habe sehr kleine Füße gehabt und sei, wie nun unstreitig, eine welthistorische Null gewesen.
Es kamen sieben Gäste in sieben Wägen. Der erste Wagen war blutrot, der zweite türkisfarben, der dritte schwefelgelb, der vierte aschengrau, der fünfte pechschwarz, der sechste giftgrün und der siebte braun. Von den Gästen sah man kaum etwas, denn die Diener hoben nur große, unförmige Bündel von Pelz aus den Wägen und setzten sie auf die erste Stufe der Treppe, wo sich die Bündel alsbald nach oben in Bewegung setzten. Herr von Thod nickte jedem Pelzbündel zu und ging dann hinter dem siebten Bündel ebenfalls die Treppe hinauf. Die sieben stacheligen Bündel und dann der Hausherr in der Bisampelerine verschwanden im Tor. Die Diener schlossen die Türflügel. In dem Moment, als der zweite Flügel ins Schloß fiel, setzte im Festsaal Musik ein.
II
Die Speisenfolge war äußerst feinsinnig und, für einen Außenstehenden gar nicht erkennbar, auf die Gäste abgestimmt:
Taubenpastete in gedünstetem Löwenzahn
Geräucherte Pfauenschenkel
Consommé Pelikan
Spanelefant vom Rost mit verschiedenen Gemüsen
und Pommes dauphins
Schwalben in Armagnac mit Kirschen
Flambierte Pferdeohren
Glace Lion – Maisgefrorenes
Mokka – Zigarren – Likör
Heddesheimer Honigberg Spätlese 1964
Chateau de Mouton – Rothschild 1959
Heidsieck dry
Intrada, drei Divertimenti und Cassation in B-Dur
für 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, Pauken
und Streicher op. 132 von Xaver Popradac
Die Caprice des Herrn von Thod, auf der Menuekarte auch die dargebotene Tafelmusik zu vermerken, war man schon gewohnt. Zwischen den Schwalben in Armagnac und den flambierten Pferdeohren ließ sich der Hausherr dann herbei, einen »Marche nocturne silencieuse« für Harfe solo des einstmals weltberühmten, später in Madagaskar bei Motivsuche verschollenen und nun zu Unrecht völlig vergessenen Komponisten Otto Jägermeier zu spielen. Höchst selten spielte der Hausherr in Gegenwart Dritter Harfe, obwohl er das Instrument mit unstreitbarem Geschick handhabte. Nach seinem Vortrag kündigte Herr von Thod das für neun Uhr vorgesehene Auftreten des Künstlers Alaska Lurchy an.
III
Die Tischdame des Herrn von Thod war, wie nicht anders zu erwarten, Frau Libussa Rozkos Edle von Chlipnost. Die Edle von Chlipnost trug ein streng geschnittenes Complet aus taubengrauer Seide, hochgeschlossen mit vielen Knöpfen und so gut wie durchsichtig. Ihre Brüste waren kunstvoll mit Szenen aus dem Leben des heiligen Simeon des Einsiedlers bemalt (von der Hand des ehemaligen kgl. rumänischen Hofmalers Constantin Coban), ihr außerordentlich ansehnliches Gesäß trug zwei – in der Manier holländischer Fliesen Blau in Weiß gehaltene – symbolische Darstellungen von Andachtsübungen sowie den über dem Ganzen sich hinziehenden »Triumph der Keuschheit« von einem unbekannten Monogrammisten H. A. N. Die zuletztgenannten Malereien hatten auf Grund ihres Platzes den Nachteil, daß sie nur richtig betrachtet werden konnten, wenn Frau von Chlipnost auf dem Bauch lag.
Neben Frau von Chlipnost – auf der anderen Seite, links saß ja Herr von Thod – saß Emil Ohnvogel Freiherr Livor von Neidenlust, der bekannte Transvestit, der heute eine aparte Nonnenkutte trug (genauer gesagt: die Tracht des mittlerweile nahezu ausgestorbenen Calasanctianerinnen-Ordens mittlerer oder ungarischer Observanz) – weiß mit gelben Ärmeleinfassungen. Die gelben Ärmeleinfassungen waren eine elegante modische Zutat des Barons, die allerdings kaum jemand zu würdigen wußte, weil so gut wie niemandem die Originaltracht der Calasanctianerinnen mittlerer Observanz aus dem Gedächtnis gegenwärtig war. Der Baron, sonst ziemlich empfindlich, war auch gar nicht böse darüber. Er erzählte zum vierhundertsten Male die Schnurre, wie er es nannte, vom schlauen Griechen. »Ich gebe zu«, sagte Baron Livor, »daß meine Schnurre vom schlauen Griechen, die ich heute genau zum vierhundertsten Male erzähle, den einen oder anderen inzwischen ermüdet. Jedennoch darf man nicht übersehen, daß nicht jeder mit andauernd neuen Einfällen gesegnet ist. Ich bin nun fast neunzig Jahre alt. Im Lauf dieser Jahre ist mir leider nur diese eine einzige Schnurre eingefallen. Ich muß befürchten –ich sehe das völlig nüchtern –, daß sie auch die einzige bleiben wird. Also muß ich sie notgedrungen immer wieder erzählen, wenn ich nicht darauf verzichten will, zur Unterhaltung der Gesellschaft beizutragen. Und so unhöflich will ich nicht sein.«
Die Schnurre vom schlauen Griechen handelte davon, daß in den späten sechziger Jahren ein griechischer Gastarbeiter in München sich trotz völlig fehlender physiognomischer Ähnlichkeit, aber mit der charakteristischen Brille versehen, als Aristoteles Onassis ausgab. Als der von Berufs wegen ziemlich leichtgläubige Gesellschaftsjournalist H. auf den Schwindel hereingefallen war und einige Kolumnen über ihn veröffentlicht hatte, konnte der schlaue Grieche ein Mannequin engagieren, das er für Jackie Kennedy ausgab, und eine Public-Relation-Agentur beauftragen, die die Theresienwiese und ein Zirkuszelt mietete. Sechs Stunden täglich (vormittags von zehn bis eins, nachmittags von drei bis sechs, am Mittwoch auch abends von acht bis zehn Uhr) konnte die Bevölkerung um einen Eintrittspreis von zwei Mark, Kinder und Jugendliche sowie Studenten eine Mark, Onassis und Jackie anschauen. Die Leute kamen in Massen. Der schlaue Grieche und das Mannequin saßen je auf einem Gartenstuhl. Vor ihnen war ein Seil gespannt. Hinter dem Seil defilierten die Zuschauer vorbei. Die Sache war für den schlauen Griechen zwar langweilig, aber lohnend. Ein Reporter fragte einmal den Public-Relation-Manager, wie es denn komme, daß Onassis so viel Zeit habe, da er doch Reeder sei, ein Wirtschaftsimperium verwalte usw. Das habe, sagte der Manager, Onassis in aller Stille aufgegeben. Nun sei er nur noch Onassis und lasse sich als solcher gegen Geld sehen. Er verdiene mehr dabei als vorher als Reeder.
Als der Schwindel aufflog, bekam der schlaue Grieche vier Monate Gefängnis mit Bewährung. Das Mannequin wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Public-Relation-Manager wurde freigesprochen, weil er sich damit herausredete, er habe selber an die Echtheit des falschen Onassis geglaubt. Das Gericht legte dem Public-Relation-Manager nahe, das nächste Mal eine Expertise eines Sachverständigen über die Echtheit eines allenfalls auftauchenden Onassis beizuziehen. Das Ausländeramt sah entgegenkommenderweise davon ab, den schlauen Griechen aus der Bundesrepublik abzuschieben. Er befürchte politische Schwierigkeiten in seiner Heimat, sagte der schlaue Grieche. Später ließ sich der schlaue Grieche in einem kleineren Zelt, in kleineren Städten als »der Grieche, der sich als Onassis hat sehen lassen«, sehen. Die Eintrittspreise wurden auf zwanzig bzw. zehn Pfennig gesenkt. Die Einnahmen waren nicht hoch, aber der schlaue Grieche konnte immerhin so recht und schlecht davon leben.
Das ist die Schnurre vom schlauen Griechen, die Baron Livor zum vierhundertsten Mal erzählte.
Der Hausherr brachte bei dieser Gelegenheit einen Toast aus und erklärte, er hoffe, der Baron werde die Schnurre noch recht oft zu Gehör bringen.
IV
Es waren mehr Damen unter den Gästen des Herrn von Thod als Herren, außer dem Baron Livor nämlich nur noch ein Herr: Lord Covet Hoarding, ein langer, sehr dürrer Mensch mit einer runden Nickelbrille, der einen braunkarierten Knickerbocker-Anzug trug und darüber ein ziemlich schäbiges Löwenfell mit filziger Mähne. Der aufgesperrte Rachen des Löwen diente dem Lord – nach Art der Herkulesdarstellungen – als Kopfbedeckung. Da Lord Covet draußen aber dennoch an den Ohren gefroren hatte, trug er dazu gestrickte Ohrenschützer von starker roter Farbe. Ohne den Rachen des Löwen zu entfernen, konnte der Lord die Ohrenschützer nicht abnehmen. Das Löwenfell aber war durch ein kunstvolles System von Nadeln und Häkchen am Knickerbocker-Anzug festgemacht. Lord Covet, der sich keine Bedienten hielt, hatte das Löwenfell zunächst am Anzug festgenestelt, dann erst den Anzug angezogen. Er hätte sich also, um die Ohrenschützer abzunehmen, nahezu ganz entkleiden müssen. Selbstverständlich verbot ihm das der Anstand. Er behielt also die Ohrenschützer an. Da sie aus sehr dicker Wolle gestrickt waren, war es dem Lord fast gänzlich verwehrt, der Konversation zu folgen. Lord Covet Hoarding hörte also nichts. Seine Nachbarin zur Linken, die Contessa Maria Annunziata Agostina Lucretia Isabella Athenais etc. etc. de Borioso de Santa Fastidia Superba, Sternkreuz-Ordens-Dame, Grandin I. Klasse von Spanien und Erb-Oberst-Galoschenbewahrerin des Lateinischen Kaiserreiches von Byzanz etc. etc., konnte nichts sehen. Sie trug eine mit bunten schillernden Pfauen bestickte klassische Toga, die eine ihrer ziemlich großen und bereits recht faltigen, stark mit Pigmentfehlern behafteten Brüste freiließ, hatte eine äußerst kostbare Binde um die Augen und einen alten Infanteriesäbel in der linken, eine gußeiserne Küchenwaage mit Kupferschalen in der rechten Hand. Diese beiden Attribute zwar legte sie zum Essen ab, nicht aber die Binde. Sie redete ununterbrochen auf Lord Covet ein, der ihr – er aß Unmengen und hatte stets den Mund voll – mit den Händen bedauernd durch Gesten klarzumachen versuchte, daß er nichts hören konnte, was aber wiederum die Contessa nicht sah.
»Hatte dann«, fragte die Marquise de Dommonecois, die wegen ihrer bei sonstiger normaler, ja eher überdurchschnittlicher Körpergröße ganz erstaunlich kurzen Beine stets eine kleine Leiter bei sich trug, um auf den Stuhl hinaufzukommen, »hatte dann der König Vittorio Emanuele III. normal große Kinder?«
»Ich verstehe, daß gerade Sie das interessierte, ma chere marquise«, sagte Herr von Thod süffisant, »ja, er hatte Kinder von normaler Größe, darunter einen Sohn, den Kronprinzen Umberto, der später als Umberto II. König von Italien wurde. Während seiner Regierungszeit, die nicht länger als ein paar Tage im Mai und Juni 1946 umfaßte, wurde die Insel Sardinien von einer Heuschreckeninvasion heimgesucht. König Umberto II. eilte sofort – er war ja während des Krieges auch Marschall von Italien gewesen – an die Heuschreckenfront. Er besah sich den Schaden, den die Tiere anrichteten, konnte aber auch nichts helfen. Ich weiß nicht, ob er deswegen dann gleich abgesetzt wurde. Jedenfalls blieb das Betrachten des von den Heuschrecken angerichteten Schadens die einzige Regierungshandlung dieses letzten italienischen Königs. Aber von normaler Körpergröße war er, durchaus.«
Die Marquise de Dommonecois tat so, als habe sie den anzüglichen Ton in Herrn von Thods Rede überhört. Sie hüllte sich in ihren kostbaren, bodenlangen, aus puren Goldfäden gehäkelten Shawl, so daß er ihr schlangenbalgartiges grünglitzerndes Kleid nahezu gänzlich verbarg.
Der Herr von Thod ging in den Tanzsaal voraus. Als die Diener die Türen zu dem mit gut und gern zwölf Kristallüstern erleuchteten grünen Saal aufrissen, spielte die Musik einen sehr lauten Tusch, später, auf ein Zeichen des Hausherrn hin, erklang die leider selten gespielte, temperamentvolle und vor allem lang andauernde Polonaise aus dem zweiten Akt der Oper »Ein Leben für den Zaren« von Michael Iwanowitsch Glinka. Xaveria Immaculata Prinzessin Obmysl, eine so dürre Person, daß sie bereits durchscheinend wirkte – sie trug ein elefantengraues Kleid, an beiden Armen ein schlangenhaftes Geschmeide, das sich von den Gelenken bis zu den faltigen Schultern hinaufwand –, näherte sich dem Herrn von Thod von hinten und kratzte ihn mit einer besonders wertvollen altchinesischen Läusegabel aus Elfenbein zwischen den Genickfalten. Der Griff der Läusegabel stellte übrigens eine sich in einen Elefanten verwandelnde Hyäne dar, ein sehr seltenes, bis heute noch nicht vollständig geklärtes buddhistisches Symbol. Herr von Thod erschrak fürchterlich und bekam einen so heftigen Schluckauf, daß er die Polonaise hüpfend zu Ende tanzen mußte, denn das krampfhafte Aufstoßen der Luftröhre lupfte den sehr kleinen und schmächtigen Hausherrn jedesmal ungewollt um eine Elle von der Erde. Die auffallendste Erscheinung auf dem Parkett aber war die Herzogin Lucretia de Babylon. Die Herzogin, eine junge Frau von blendender Figur, war in ein enges schwarzes Trikot gekleidet – so eng, daß später gemunkelt wurde, sie sei ganz nackt, aber mit schwarzer Farbe angemalt gewesen – und führte stets zwei Lichttrabanten mit sich. Die Lichttrabanten waren ältere, aber noch rüstige Herren aus dem babylonischen Landadel. Jeder der beiden trug eine starke Laterne. Mittels eines ziemlich komplizierten, aber sinnreichen Mechanismus wurden in regelmäßigem Wechsel vor das Glas der Laternen verschiedene gefärbte Gläser geschoben, so daß das Licht der Laternen abwechselnd bald tiefblau, bald rosa, bald goldfarben erstrahlte. Die Lichttrabanten richteten die Laternen von beiden Seiten stets genau auf die Herzogin, mußten also alle ihre Bewegungen, jeden Tanzschritt mitmachen, was mitunter bei den beiden älteren Würdenträgern nachgerade possierlich wirkte. Sei es – unterstellt, die Herzogin trug ein Trikot –, daß der Stoff mit reflektierenden Fäden versetzt war, sei es – nimmt man an, die Herzogin sei nackt und bemalt gewesen –, die schwarze Farbe habe reflektierende Partikel enthalten, durch den Strahl der Laternen schimmerte die Herzogin im harmonischen Wechsel in Blau, Rosa und Gold. Leider wurde diese feenhafte Erscheinung dadurch etwas getrübt, daß ja elektrische Zuleitungen zu den Laternen notwendig waren. Weitere Kammerherren, Leibjäger und zahlreiche Lakaien der Herzogin waren damit beschäftigt – der Tanzschritt der Polonaise setzte sich dadurch quasi bis ins letzte Glied fort –, die beiden Kabel den Lichttrabanten nachzuschleppen. Dennoch ließ es sich nicht vermeiden, daß stets andere Tänzer über die Kabel stolperten oder in diese verwickelt wurden. Der elektrische Strom wurde in einem dampfgetriebenen Generator erzeugt, der auf den Schultern von achtzehn Leibeigenen der Herzogin ruhte. Auch diese Leibeigenen waren durch die Polonaise gezwungen, mit ihrem Dampfgenerator in groben Zügen dem Tanzgeschehen zu folgen. Ein neunzehnter Leibeigener war ständig damit beschäftigt, den tanzenden Generator nachzuheizen. Aus dem Kamin des Generators entquoll ziemlich dicker schwarzer Qualm, der bisweilen die Sicht im Saal etwas trübte. Abgesehen davon aber war die Erscheinung der Herzogin, wie gesagt, absolut feenhaft.
VI
Auf der Galerie, die etwa in halber Höhe den Ballsaal umlief, saßen der Almosenier und der Hauskaplan der Herzogin von Babylon und betrachteten das Deckengemälde. Der Almosenier, ein hagerer, finster blickender Mann mit starken schwarzen Locken und geradezu lockigen Augenbrauen, saß auf dem Schoß des Hauskaplans, eines eher dicken Prälaten mit einem fast strahlenden, ja leuchtenden kleinen blonden Schnurrbärtchen. Die Haltung der in ein theologisches Gespräch vertieften Geistlichen erinnerte entfernt an die bekannte Darstellung der Hl. Anna Selbdritt von Leonardo, wobei – anstelle des Jesuskindes – der Irish-Foxterrier Kleopatra (den sein Herr aber scherzhaft Cagofuego, d. i. Feuerkacker, nannte) des Almoseniers die Gruppe aufs vorteilhafteste ergänzte.
»Man sieht«, sagte der Hofkaplan und streichelte über die Brokatsoutane des Almoseniers, »daß dieser Herr von Thod ein Neureicher ist. Er hat dieses Palais hier gekauft, mit allem, was darin steht und liegt, und schmückt sich nun mit einem fremden Wappen.« Der Hofkaplan deutete auf das Deckengemälde. »›Der Triumph des heiligen Amintianus‹. Keine schlechte Arbeit. Aber ich möchte wissen, was St. Amintianus mit Herrn von Thod zu tun hat. Der heilige Dongo, der Patron der Zwerge, ja – der wäre angebracht, aber der heilige Amintianus …« Der Almosenier blickte gelangweilt auf. »Das ist der heilige Amintianus?«
»Freilich«, sagte der Hofkaplan sanft, »man erkennt ihn unschwer an seinem Attribut: einer Bettflasche. Er wurde früher gern gegen kalte Füße und Zehenkrämpfe angerufen. Man darf ihn nicht mit dem heiligen Frigidianus von Aumale verwechseln, dem auf bildlichen Darstellungen zwei Bettflaschen, allerdings mit dem Hals nach unten, beigegeben werden. Leider gibt es schlampige Maler, die glauben, es mit den Bettflaschen nicht so genau nehmen zu müssen, oder zu faul sind, die zweite Bettflasche des heiligen Frigidianus zu malen. Dadurch entsteht oft Verwirrung. Für mustergültig halte ich Bolzaninos spätbarockes Sgrafitto im unteren Badezimmer der Villa Campo Sant’Angeli in Sezze, wo St. Frigidianus die beiden Bettflaschen etwa so hält …« Der Hauskaplan schob den Almosenier sachte von seinem Schoß, stand auf und zeigte mittels zweier Weinflaschen, wie Bolzanino den Heiligen dargestellt hatte. Der Almosenier blickte gelangweilt.
»St. Frigidianus«, fuhr der Hauskaplan fort, nachdem er sich wie vorher gesetzt und den Almosenier wieder auf seinen Schoß gezogen hatte, »ist nämlich der Schutzheilige der Schwitzbäder, vielmehr: einer der Schutzheiligen, der andere ist, was fast niemand weiß, der heilige Kilma-o-Enmranagh, ein Ire – die Schwitzbäder sind ja bekanntlich irischen Ursprungs –, der häufig zusammen mit einem anderen irischen Heiligen, dem heiligen Mohill, abgebildet wird, dessen Tag der 29. Oktober ist und den man anruft, wenn die Tischmesser stumpf sind.« – »29. Oktober«, sagte der Almosenier gedehnt und gähnte. »Ich meine, da wäre Narzissus und Ermelinde.« – »Ja, richtig, und St. Mohill, außerdem ist das der Tag des heiligen Petroleus, der bei hartnäckigem Bettnässen an ungeraden Tagen angerufen wurde und als Patron der linkshändigen Zinngießer galt.«
»Galt?« sagte der Almosenier, »gilt nicht mehr?« – »Auch er«, seufzte der Hauskaplan, »ist jüngst von der Riten-Kongregation abgeschafft worden. Aber im christkatholischen Volk lebt er weiter. Gott sei Dank. Wie auch St. Celsius und St. Reaumur, die bei zu großer Kälte respektive Hitze immer noch angerufen werden; oder die besonders in angelsächsischen Ländern verehrte heilige Fahrenheit. Auch der heilige Bedemund, obwohl von der Ehre der Altäre wieder herabgestoßen, hat im gläubigen Volk seine Anhänger behalten – ich erinnere dich etwa an die gut zweitausend Mitglieder zählende St. Bedemundi-Erzbruderschaft im Berchtesgadener Land, deren Prior der verewigte Kronprinz von Bayern war. St. Bedemund, der Patron des außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Eine hochinteressante Reliquie wurde im Dom von Grado aufbewahrt, jetzt befindet sie sich, da profaniert, in einer schwedischen Privatsammlung. Oder der hl. Oblongius, der Schutzheilige aller Parallelogramme, die rechte Winkel haben, er wurde in der Regel mit einem Schröpfstiefel dargestellt, zuweilen auch mit einem Regenschirm, denn er wurde in manchen Gegenden bei plötzlichen Wetterumschlägen angerufen, oder mit einem Schuhlöffel, denn er steht bei zu engen Schuhen bei, so wie er auch als Helfer bei schwierigen Kreuzworträtseln verehrt wird.« Die Musik wurde lauter. Eine Cracovienne begann. Der Dampfgenerator der Herzogin stieß neuen Qualm aus, der sich in länglichen, scharfen Schwaden vom Plafond bis zur Höhe der Galerie herunter sammelte. Der Triumph des heiligen Amintianus war fast nicht mehr zu sehen.
»Und wir müssen hier sitzen und zuschauen«, raunzte der Almosenier und zupfte weinerlich am Ohrläppchen des Hauskaplans.
»Was möchtest du denn da unten?« sagte der Hauskaplan. »Auch so herumhupfen? Ich kann keinen Sinn in diesem Herumhupfen erkennen. Ich wundere mich, daß sich die Leute nicht komisch vorkommen, wenn sie so herumhupfen.« – »Ball bei Thod«, sagte der Almosenier und gähnte. »Die Wollust als Keuschheit verkleidet, der Neid als Caritas, der Geiz als Tapferkeit, die Hoffart als Gerechtigkeit, die Lüge als Treue, die Arglist als Tugend und die Verzweiflung als Hoffnung … die sieben Todsünden in der Maske der sieben Cardinaltugenden tanzen auf dem Ball des Narren, der sich als Tod kostümiert.« – »Laß das«, der Hauskaplan wehrte den Almosenier ab, »du weißt, ich mag nicht, wenn man mich an der Nase zupft.«
VII
Die Lichter im Saal wurden verdunkelt. Die Lichttrabanten der Herzogin von Babylon löschten ihre Laternen aus. Der Dampfgenerator wurde gedrosselt und stieß nur mehr kleine, dünne weiße Wölkchen aus. Die Gäste des Herrn von Thod und auch der Hausherr nahmen auf einer Reihe von Stühlen Platz, die die Diener, kaum daß der letzte Ton der Musik verklungen war, mit offenbar einexerzierter Geschicklichkeit in Windeseile aufgestellt hatten. Dann wurde der Vorhang vor der kleinen Bühne des Saales aufgezogen. Auf der Bühne stand der Künstler
Alaska Lurchy.
Alaska Lurchy trug eine kreisrunde Nickelbrille und einen fast bodenlangen Mantel aus geflicktem Leder – »So das Übliche«, sagte die Herzogin von Babylon –, die vordere Hälfte des Schädels hatte Lurchy kahlgeschoren, auf der hinteren Hälfte wucherte das Haar lang und strähnig nach allen Seiten. »Er sieht aus wie ein Eichhörnchen, in dessen Schwanz von hinten der Wind fährt«, sagte die Prinzessin Obmysl. »Das ist doch wohl ein etwas weit hergeholter Vergleich, ma chere princesse«, sagte Herr von Thod.
Ansprache des Künstlers Alaska Lurchy:
Durchlauchtigste Herzogin, Herr von Thod, meine Idiotinnen und Idioten.
In jedem Zweig der Künste wurden in den letzten zehn Jahren unbestreitbar größere Fortschritte erzielt als in der gleichen Anzahl Jahrzehnte vorher. Der Fortschritt der letzten Jahre ist nicht auf die immer raschere Entwicklung neuer Stilrichtungen beschränkt. Den Fortschritt kennzeichnet vor allem die Emanzipation der Künste vom Material. Ich nenne einige Beispiele:
Es gibt Musikstücke, die nur mehr aus einem einzigen, lang ausgehaltenen Ton bestehen. Die Musik hat sich damit weitgehend von Melodie, Harmonie und Rhythmus emanzipiert. Es gibt Bilder, die nur mehr aus unbemalter Leinwand bestehen. Die Malerei hat sich damit weitgehend von Farbe und Gestaltung emanzipiert.
Es gibt Plastiken, die nur mehr aus einer Ansammlung alltäglicher Gegenstände – etwa leeren Flaschen – bestehen. Die Bildhauerkunst hat sich damit von den Fesseln der Form befreit. Es gibt lyrische Gedichte, die nur mehr aus einer Anzahl zusammenhangloser Konsonanten bestehen. Die Literatur hat sich damit endlich von den Vokalen befreit.
Es gibt Kunstwerke, die in keine Kunstgattung mehr einzuordnen sind, etwa ein »Loch in einer Museumswand«. Die Kunst hat sich damit fast schon vom Material gelöst und ist in den rein theoretischen Raum vorgedrungen.
Aber damit ist es noch nicht genug. Um die Kunst endgültig der gesellschaftlichen Korrumption zu entziehen, muß sie die Materie verlassen. Was Sie jetzt sehen werden, ist ein materiefreies Kunstwerk, ein Triumph des Fortschritts. Ich führe Ihnen nämlich nichts vor. Sie sind gehalten, dieses Nichts-Vorführen als Kunstwerk zu verstehen. Ich danke Ihnen.
Der Vorhang fiel.
»Köstlich«, sagte die Marquise de Dommonecois.
Dann verabschiedete Herr von Thod seine Gäste.
Jupiters letztes Abenteuer
I. Monolog des olympischen Hausmeisters
Jetzt ist der gnädige Herr das eintausendvierhunderteinundsiebzigste Jahr in Pension.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!