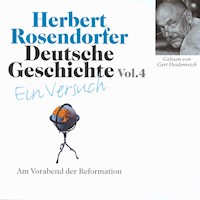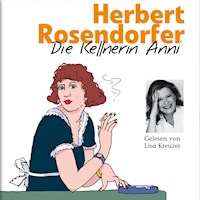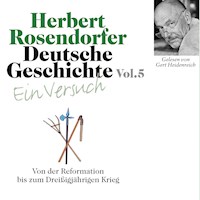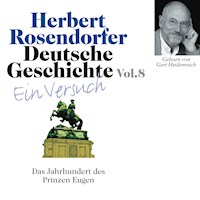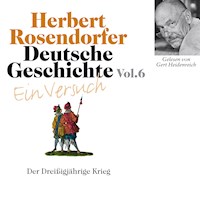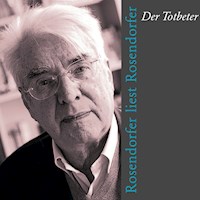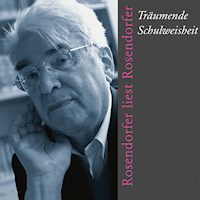9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nein, das ist kein Leben", dachte Martha oft, "nur ein schadhaftes solches. Wo ist der Bruch? der Knick ? – die Großmutter ? – oder die Dämonen aus dem Stein oben?" War das Marthas geheimer Lebensplan, der sich zwangsläufig erfüllte wie der Ablauf der Zeit? Während die Welt sich dreht – im Südtirol der Nachkriegszeit wird um Autonomie gekämpft, in München vertreibt freie Liebe den Mief der Adenauerzeit – bleibt Martha davon seltsam unberührt. Sie nimmt wenig Notiz von der Geschichte, ebenso wenig wie sich die Geschichte um Martha zu kümmern scheint. Angefangen hatte alles in Tschagoi, einem Dorf im Oberen Vinschgau. Dämonen, steinerne Urmenschen, bevölkerten die kleine Bergwelt. Auch die Großmutter war so ein böser Geist, der Martha niemals loslassen sollte, ganz gleich, wohin sie auch ging. Ebenso wie all die anderen, vor denen es scheinbar kein Entrinnen Gab … Ein fesselnder Roman, der vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die 90er-Jahre führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Da Herbert Rosendorfer bei seinen Publikationen die alteRechtschreibung bevorzugte, wurde dies im vorliegenden Roman ebenso gehandhabt.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook:
2014 LangenMüller in der
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München.
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: mauritius images, Mittenwald
Satz und eBook-Produktion:
Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
www.Buch-Werkstatt.de
ISBN 978-3-7844-8193-7
»Et je me demandai pourquoi l’on est ici…«
Victor Hugo
(Aus: »Ce qu’on entend sur la montagne«)
I
So kam es, daß der Pinggera nicht optierte.
»Optieren« eigentlich in Anführungsstrichen, mehr als nur ein Fremdwort, das der Pinggera erst kennenlernte, als es darum ging, zu »optieren« oder nicht zu »optieren«. Dazwischen ein Abgrund, ein Riß zwischen diesen und jenen, ein Riß durch die Seele, durchs Land. »Optanten« und »Bleiber«. Das war eine Entscheidung, die einen beutelte und dahin riß oder dorthin, und es gab kein Zurück. Meinte man.
Der Pinggera »optierte« nicht.
*
Pinggera mit Betonung auf dem »e«. Serafin mit Vornamen. Zwei Ziegen, eine Kuh, vierzig Hühner. Ein Stück Wald, ein paar Flecken von Wiesen, zwei Äcker, auf denen Erdäpfel und Buchweizen, den sie dort »Schwarzplent« nennen, wuchsen. Weizen gedieh dort oben nicht.
Tschagoi– nachdem die Italiener gekommen waren–, nein, da hinauf kamen »die Italiener« nicht, da kam höchstens irgendwann irgendeine Kommission von unten herauf, sprach Italienisch, kein Mensch in Tschagoi verstand es, wechselte das Ortsschild aus: Ciagoio. Doch, herumgesprochen hatte es sich schon, daß man jetzt, seit der Krieg verlorengegangen war, zum »Regno d’Italia« gehörte, zum Königreich Italien. Schließlich waren ihrer zwölf, fünfzehn aus dem Dorf, alle zwischen achtzehn und zweiundzwanzig, eingezogen gewesen. Kaiserjäger-Regiment No. 4. Galizien. Wo ist Galizien? Das hatte bis dahin keinen in Tschagoi interessiert.
Später dann, so im 15er-Jahr, waren nochmals welche eingezogen worden– Kaiser-Schützen. Hatten droben in Fels und Eis nicht hauptsächlich gegen die Italiener, sondern gegen die Kälte, den Schnee, die Gletscherspalten und die Lawinen gekämpft. Zum Glück hatten die Italiener die gleiche Kälte, den gleichen Schnee, die gleichen Gletscherspalten und die gleichen Lawinen. Vielleicht ein kleiner Vorteil »für die unseren«, daß den Italienern die Kälte ärger zusetzte als den Kaiser-Schützen, die sozusagen nichts Besseres gewohnt waren.
Aber den Krieg trotzdem verloren. Sehr viel änderte sich in Tschagoi nicht, vorerst. Der Kaiser abgedankt? Aha. Auch recht. Einen König haben wir jetzt? einen italienischen vulgo »walschen«? Auch recht. Soll ein Liliputaner sein. Einen Meter vierzig groß. Auch recht.
Nicht alle waren wieder heimgekommen. »Und findest du einst Gräber / im Sand, die niemand kennt, / das sind die Kaiserjäger/ vom vierten Regiment.« In Galizien, es waren auch einige aus Tschagoi dabei dort in den Gräbern im Sand in Galizien. Und die, die heimkamen, erzählten nicht viel, nur allerdings, daß der Krieg verlorengegangen sei. Leider.
Es kam dann doch ein Italiener. Ein Italiener, nämlich der Herzog von… ja, von wo? von irgendwo. Ein Bruder vom Liliput-König oder Vetter oder was. »Er nimmt Besitz von unserem Land, das ihm die Engländer geschenkt haben«, sagte der Pfarrer, Hochwürden Raich, ein eher Junger, blond und »wie Blut und Milch«, eine gesunde Farbe, immer fröhlich. Raich mit »a-i«, wäre auch unangebracht von dieser Pfarre da oben in Tschagoi, wenn es sich »Reich« schriebe, mit »e-i«, wie »reich«.
»So. Aha. Nimmt Besitz. Der König selber nicht?« (In der Sprache dort: »D’r Keenigg selm nett?«)
»Nein, der König selber nicht«, sagte der Pfarrer, »der will wahrscheinlich nicht so weit herauffahren.«
Es war eine große Aufregung. Erst kamen, ein paar Tage zuvor, zwei Italiener mühsam mit Fahrrädern aus dem großen Tal unten herauf, mußten zum Schluß schieben. Sie hatten große Ballen Stoff auf den Gepäckträgern ihrer Räder: Fahnen. Grün-Weiß-Rot. Mit irgendwas auf dem Weißen, ein kleines Kreuz, eine Krone. Noch nie gesehen.
Der Pfarrer Raich konnte Italienisch– Latein sowieso, er war eine Zeitlang Kooperator in Lavis gewesen, in Welschtirol, im Trentino. »Die bringen Fahnen«, sagte der Pfarrer. »Die sollt ihr aufhängen, wenn der Herzog kommt.«
»Ist der auch ein Liliputaner?«
»Ich weiß es nicht«, sagte der Pfarrer.
Der Herzog war kein Liliputaner. Sehr groß war er nicht, aber Liliputaner war er keiner. Schade. Die Leute von Tschagoi hätten gern einmal einen Liliputaner gesehen.
»Aj, aj, aj– i woaß ned– ich weiß nicht«, sagte die alte Niederkalmsteinerin mit den drei Zähnen, »ich weiß nicht, ob das nicht womöglich Unglück bringt. Mit die Zwerg kommen die Unwetter, sagt man.«
Es kam kein Unwetter, es kam kein Zwerg, es kam der Herzog. Vier Autos hintereinander, der Staub unsäglich. Der Herzog war ganz grau im Gesicht, als er ausstieg, »um Tschagoi für den König von Italien in Besitz zu nehmen«. Nur dort, von wo er die große Autofahrerbrille nach oben über den Schirm seines hohen, röhrenförmigen Käppi schob, war kein Staub. Ausgespart, sah aus wie noch eine Brille.
Der Herzog schaute sich um. Offenbar war er nicht angetan von der Gegend. Er trug Wickelgamaschen, was zur italienischen Uniform gehörte. Wer wickelt die ihm? die Herzogin? Oder sind das scheinbare Wickelgamaschen, so zusammengenäht, daß es nur aussieht wie Wickelgamaschen? Sehr große Füße– lange, schmale Füße in blitzblanken Schnürschuhen– sehr lang, förmlich Hasenläufe. Sehr schöne Schnürschuhe. »Ja, in Schuhen sind sie unübertroffen, die Italiener«, sagte Pfarrer Raich.
Er schaute sich um, der Herzog. Dann fragte er, wo er auf den Abort gehen könne.
»Wie seinerzeit der Erzherzog gekommen ist, der Franz Ferdinand, den sie dann in Sarajewo ermordet haben, auch im Auto und auch mit einer Autofahrerbrille, die er dann auf den Tschako geschoben hat, hat er Zehnkreuzerstücke, händevoll, hinausgeworfen für die Dorfjugend.«
»Ja, das war halt noch etwas anderes.«
*
Die Fahnen durften die Leute von Tschagoi behalten. Ein Geschenk der neuen Regierung. Die Weiber nähten Schürzen daraus oder Unterhosen für die Kinder.
*
Der Hof hätte die Familie nicht ernährt, der Untere Gruiner zu Tschagoi dort oben, wo die alten Unheimlichen noch hausen in den Spalten der Felsberge und in den Rauhnächten zwischen Weihnachten und Dreikönig mit grausigem Geheul durch die verkrüppelten Fichten fahren.
»Geh ja nicht hinauf«, sagte die alte Ahn zur kleinen Martha. »Erst wenn die Heiligen Drei König kommen, vertreiben die sie für ein Jahr. Einmal ist einer hinauf in den Rauhnächten, weil er unbedingt hinüber wollte in die Schweiz–«
»Warum wollte er hinüber in die Schweiz?«
»Warum wohl?« wischte die Alte die Frage mit ihren Knochenhänden weg. »Warum wohl? So wie alle hinüber wollen in die Schweiz, durch die Schrunden, auf dem Weg, den die Finanzer nicht kennen. Aber nicht in den Rauhnächten. Haben keine Angst vor den Finanzern– aber man soll respektieren, daß man nicht hinaufgeht und hinüber in den Rauhnächten. So wie der Schluiferer Toni. Frag nicht, wie der zugerichtet war, wie sie ihn gefunden haben.«
Der Untere Gruinerhof lag aber nicht beim Wald oben, sondern, wie die Bezeichnung schon sagt, weiter unten, gegen den Bach zu. Es kam wenig Sonne hin, und es war feucht. »Deswegen sind die Kinder alleweil so grünlich im Gesicht.«
»Ich will nicht grünlich im Gesicht werden«, sagte die Martha schon als kleines Kind und bevor sie in die Schule kam. Sie war immer schon anders.
Aber nicht nur vor denen da oben, der Wilden Jagd, warnte die Ahn, auch vor den Wasserfräulein, die im Nebel daherkommen…
»Erzähl dem Kind keinen solchen Unsinn nicht«, sagte der Untergruiner, der Pinggera, zu seiner Mutter.
»Daß du dich nicht der Sünder fürchtest!« brummte die Alte und spritzte ihm Weihwasser ins Gesicht aus dem »Weichbrunnkrügel«, das in jedem Haus neben der Tür hing.
Das, was am Hof mit dem wenigen Vieh und den steinigen, steilen Äckern erwirtschaftet werden konnte, war, wie man so sagt, zum Leben zu wenig und zum Sterben zuviel. An vier Tagen in der Woche ging daher der Untergruiner, der Pinggera Serafin, um fünf Uhr früh hinaus ins große Tal und zu den Marmorbrüchen. Eine schwere Arbeit, bis der wunderweiße Marmor, der weißeste aller weißen Marmorsteine, in großen Blöcken heruntergezogen, aufgebockt, verladen war. Ein gequetschter Finger wurde nicht beachtet. Ein zerquetschter Arm grade noch–
Die Marmorbrüche. Man muß sie gesehen haben. Der Erzherzog Franz Ferdinand (oder war es ein anderer Erzherzog?) hat sie gesehen. (Der walsche Herzog nicht.) Hat sich eigens hinfahren lassen mit seinem langen, schönen Auto Marke Gräf & Stift– wenige Jahre später in genau so einem Wagen in Sarajewo… man weiß.
Man muß sie gesehen haben. Tief in den Berg hineingeschnitten. Geschnitten wie mit einem Messer, scharfkantig und weiß, meterhoch, Dutzende Meter hoch, lauter gewaltige weiße, rechte Winkel, weiß wie Schnee und hart, hart-weiß, rauh-glänzend, in großen Stufen kantig herausgeschnitten– rechts weiß, links weiß, unten weiß, hoch oben, zehn, zwanzig Meter hoch: weiß. Eine viereckige weiße Kathedrale. Auf großen Kufen wurden die herausgeschnittenen Blöcke hinuntergelassen ins Tal und dann abtransportiert, weiß Gott, wohin.
Vielleicht ist in einem dieser Blöcke eine schöne, nackte Nymphe drin, die ihre Brüste zeigt? oder ein segnender Christus? oder– ja, oder der Erzherzog, nachdem ihn eine Kugel aus der Thronfolge geworfen hat? Der Pinggera Serafin würde es nie sehen, was immer es sein mochte.
*
Es war sieben Uhr abends, wenn der Pinggera dann endlich wieder daheim war. Dann melken, füttern, ausmisten. Kein sehr bequemes Leben. Der Herzog mit seinen Wickelgamaschen hatte es vermutlich bequemer.
Warum? Warum der Herzog dort und der Untere Gruiner-Bauer und marmorgeschundene Hilfsarbeiter hier? Warum? Wer hat das so eingeteilt? Manchmal dachte der Pinggera darüber nach, bevor er einschlief auf seinem harten Bett. Immerhin kein Strohsack mehr wie noch beim alten Pinggera Michl, dem Vater. Der hatte auch noch hinters Haus geschissen. Im Haus nur die Weiber, daß die Versitzgrube nicht so schnell voll wurde. (»Von wegen der Landluft«, sagte der Pfarrer Raich, als er einmal das Vieh segnen gekommen war, hielt sich die schöne rosarote Nase zu.)
Warum? Der Pinggera schlief ein, bevor er eine Antwort fand, sofern es überhaupt eine Antwort gab auf diese Frage. Schlief tief und schwarz und traumlos, mußte ja um fünfe wieder heraus.
Nicht im Winter. Da gab es keine Arbeit im Marmorbruch, alles metertief verschneit. Wenn nicht bis in den Herbst ein gewisser Vorrat in der Kammer hinten angesammelt war, kam der Hunger. Zu verdienen gab es kaum etwas. Nicht um die Langeweile in den finsteren Tagen von November bis März zu vertreiben, nicht, weil man nicht immer nur schlafen konnte– obwohl: wer schläft, ißt nichts–, machten sie Rosenkränze. Die Männer, die Weiber, die Kinder– überall in den kleinen hölzernen Häusern saßen sie und peckten aus den Marmorresten, faustgroße Trümmer, die der Vater mit heimgebracht hatte, runde Kügelchen (»Grallelen« heißen sie dort). Sie bohrten Löcher hinein, fädelten auf, immer in regelmäßigen Abständen ein größeres »Grallele« zwischen den kleinen, bis der Rosenkranz fertig war. Alle vierzehn Tage stapfte der Oberpertinger Luis aus Prad herauf, aus dem großen Dorf am Ausgang des engen Tales, und nahm die Rosenkränze mit, zahlte ein paar Lire.
Lire: seit dem Krieg, früher Kreuzer und Kronen, Münzen, auf denen der Kaiser abgebildet war, dessen Bart ein jeder kannte. Jetzt der Zwergen-König, dem man aber natürlich auf den Münzen das nicht ansah, daß er ein Zwerg war. Nicht zu verwechseln mit dem Laurin, dem eigentlichen Zwergenkönig, der ja auch immer noch in seinem Rosengarten herrrschte, der bei Sonnenuntergang rot und glühend übers Land leuchtete. Aber das war weiter weg, von Tschagoi aus nicht zu sehen. Er wäre den Leuten von Tschagoi aber lieber gewesen, der Zwergenkönig Laurin als der andere Zwergen-König, der auf den Münzen abgebildet war.
*
Wie die Leute von Tschagoi früher gelebt hatten, in den Jahrhunderten, in denen es nichts gegeben hat außer den paar Halmen Schwarzplenten auf den steil-schrägen Äckern und den mageren Kühen? Die Frau vom Pinggera Serafin, die Martha, lediger hieß sie Jochberger, stammte von weit her, von Stilfs. Von weit her! Vielleicht vier Kilometer. Es könnte sein, daß er, der Serafin, der erste Pinggera war, der eine von »auswärts« geheiratet hatte. Sonst hatten alle nur im Dorf herum geheiratet. »Wenn nicht anno 1701 die Kirche und der Widum abgebrannt wären«, sagte der Pfarrer Raich, »und damit die Tauf- und Sterberegister, könnte man nachlesen, daß es immer schon nur sechs oder sieben, vielleicht acht Familiennamen gegeben hat, bis in die tiefste Zeit hinunter. Und dann weiß man, warum es soviel Dorfdeppen gibt.«
»Obwohl«, sagte er ein anderes Mal, »es eher fast schon ein Wunder ist, daß es nicht noch mehr Dorfdeppen gibt. Nur einen zur Zeit bei uns.«
Bartl hieß er, war Epileptiker und durfte am Sonntag die Glocken läuten. Die Kommunion gab ihm der Pfarrer nicht mehr, seit ihn der Bartl einmal dabei in die Hand gebissen hatte. Getauft: Bartholomäus– hieß auch Pinggera, weitschichtiger Vetter. Er wußte aber nicht, daß er Pinggera hieß, und wenn man ihn fragte, wie er heiße, sagte er: »Frnzfrdnand«. Er hatte damals ein paar von den Zehnkreuzerstücken ergattert.
Der Serafin Pinggera hatte nur noch zwei Kinder. Man paßte halt doch schon ein bißchen auf. Er selber war eins von mehreren Kindern, man zählte nicht so genau. Im Taufregister hätte man selbstverständlich nachschauen können, aber wer wäre auf so eine Idee gekommen! Vier überlebten, Serafin als der älteste. Alle im September, Oktober oder November geboren. Die langen Winterabende! Unterm Jahr? nach der knochen- und auch alles andere ermüdenden Arbeit: pflügen und eggen und das Heu auf den steilen Wiesen mähen und in Bündeln auf dem Buckel wackelnd in den Stadel tragen, und das Vieh: vom Melken bis zum Kalben, das heißt, zum Helfen dabei, wenn das Kalb nicht heraus wollte, und die Kuh, die ein Vermögen bedeutete, umzustehen drohte. Ja. Und das Holzmachen im Wald, das Bäumeziehen mit dem Zappín, dem einarmigen Pickel, ins Tal herunter, und klein schneiden und den Zaun ziehen, Pfosten einschlagen, die Steinbrocken im Acker einsammeln, die immer wieder rätselhaft auftauchten– (»Die Nörggelen«, sagte die Ahn, »die Nörggelen, die machen das. Als Strafe.«– »Für was Strafe?«– »Die Sünden. Und weil du ihnen in der Nacht keine Milch vor die Tür gestellt hast.«)
»Ja. Da weißt du am Abend, was du getan hast. Da hängen dir die Händ’ schwer bis zu die Knie herunter.« (So hätte der und jener und eigentlich alle von den Leuten von Tschagoi geredet, wenn sie geredet hätten. Sie redeten aber nicht. Nur die Weiber redeten.) »Da kommt dir kein Gedanke an dies und jenes. Da fällst du ins Bett, läßt noch einen Wind fahren und schläfst. Und überhaupt. Also, solang sie jung ist und einen weißen, runden Hintern hat– da ja, da. Aber mit dreißig– spätestens– mit dreißig, der Hintern faltig wie ein Pfannenkratzer, da mußt du schon, wie sagt man, kräftige Gefühle haben, daß du–« und so fort. (Hätte der Pinggera Serafin gesagt, wenn er erstens darüber nachgedacht und zweitens geredet hätte. Tat er aber, wie gesagt, nicht. Warum auch?)
Vier überlebende Kinder des alten Michael Pinggera: zwei Buben, zwei Mädchen. Der älteste, der Serafin, wie schon bekannt, kriegte den Hof, als der alte Bauer »übergab« und »in Austrag« ging, das heißt, er saß seitdem nur noch auf der Bank vor dem Haus und rauchte seinen »Reggl«, die lange Pfeife mit »Landtabak Knüll– Schnitt«, gegen den sogar der Geruch der Versitzgrube nicht aufkam. Freilich, ab und zu mußte er auch noch heran, bei leichten Arbeiten, die er noch schaffte. Sah es ein, machte es nicht ungern, war noch zu etwas nutz. Nachdem der Serafin vom Militärdienst und vom Abessinienkrieg heimgekommen war, wo er für den Mussolini, »den politischen Hanswursten« (so der neue Pfarrer), die nahezu wehrlosen Abessinier abstechen helfen mußte, hatte der Alte »übergeben«. Der Serafin mußte sich jedesmal fast übergeben, aber anders, wenn er an die Sache damals dachte, wo sie in Abessinien ein Dorf erstürmt hatten. Und die Gasbomben geworfen hatten, und die Weiber von den Abessiniern und die Kinder waren davongelaufen, und dann hatten sie sie mit den Maschinengewehren–
»Nein«, sagte der Pinggera Serafin, »ich schwör’s dir, Vater, ich hab’ nicht geschossen. Nur den Patronengurt gehalten.«
»Es waren Christen«, sagte der Vater.
Für die Heldentat wurde der Serafin zum Caporale befördert.–
Vier überlebende Kinder der alten Pinggera: Der älteste übernahm den Hof; was passierte mit den zwei Schwestern und dem Bruder? Agnes, Maria und Anton? Über das, was mit den jüngeren Kindern in den alten Zeiten dort oben in den Tälern passierte, wo man sozusagen erst unlängst zur Errungenschaft des aufrechten Ganges gelangt war, wollen wir nicht nachdenken. Nicht gerade ausgesetzt worden sind sie und im Wald verhungert, aber– noch nie etwas von Schwabenkindern gehört? Nicht Schabenkinder, wie Schaben, Ungeziefer, nein: Schwabenkinder. Nicht schwäbische Kinder, Kinder aus Schwaben, sondern solche, die ins Deutsche (»ins Deitsche«) hinausgeschickt wurden. »Schwaben« war nur der allgemeine Begriff fürs Deutsche. Nach Schwaben eigentlich selbstverständlich schon auch, aber auch ins Bayrische, oder weiter ins Rheinland, bis auf das Elsaß hinaus. Ganze Gruppen, ihrer fünfzehn, zwanzig sind zusammengetrommelt und hinausgetrieben worden ins Deutsche. Dreijährige noch nicht, auch nicht Vierjährige, die wären zu langsam gewesen und hätten den Zug aufgehalten. Fünfjährige schon. Angeführt hat meist eine Zwölf- oder Dreizehnjährige. Eine. Die Mädchen sind erwachsener in dem Alter. So im März, wenn der ärgste Schnee weggetaut war, sind sie losgeschickt worden…
Schulpflicht? »Was ist das?« (In der Landessprache: »Was isch des epper?«)
Draußen hat es so Leute gegeben, mit finsteren Hüten und engen Augen, die haben die Kinder dann verteilt: in eine Knopffabrik, oder wo Garn zu spinnen war, zum Kühehüten, oder wo Ziegel zu tragen waren. Im Herbst dann zurück. Nein, nein, da hat der mit dem finsteren Hut und den engen Augen schon dafür gesorgt, hat sie zusammengesammelt. »Sind alle da? Nein? nur zwölfe? nicht fünfzehn? Wir können nicht ewig warten.« Kann auch gewesen sein, daß ein paar auf der Strecke geblieben sind beim Zug nach Hause. Sind zu Hause niemandem abgegangen. Natürliche Auslese nennt man das.
»Es ist so«, sagte Pfarrer Raich, »daß das Menschliche, Sie verstehen, das Mitgefühl, die… ja, die Wärme, die Liebe hier noch quasi unausgegoren ist, vielleicht der Kern vorhanden, aber noch nicht entwickelt. Die Not– man muß das auch verstehen. Die Not, das nackte Überleben. Da bleiben viele Späne beim Hobeln. Wenn man jedem Span nachweinen möchte, der da wegfliegt, wäre man selber bald nur noch so ein Span. Die Menschlichkeit ist ein kostbares Gut. Verstehen Sie? Kostbar. Sie kostet etwas. Und das kann man sich hier heroben in diesen Tälern nicht leisten. Die Leute sind– ich möchte nicht sagen: wie Tiere. Aber noch nahe dem Neandertaler.«
»Ich verstehe«, sagte der Professor. Er war von Innsbruck heraufgekommen, interessierte sich für die Soziologie der Bergbauern, schrieb ein Buch darüber. »Und die Religion?« fragte der Professor.
Der Pfarrer seufzte.
*
Aber es war nicht mehr ganz so, als der alte Pinggera den Hof übergab. Anton, der jetzt Antonio heißen mußte, so war es vorgeschrieben, bekam vom älteren Bruder eine Abfindung. Es war hart. Serafin quetschte unten in Prad in der »Cassa Rurale«, wie es jetzt schon länger hieß, die letzten Lire heraus und gab sie dem Toni. Der stieg dann in Mals in den Zug, der hinunterschepperte Richtung Meran. Einmal kam eine Karte. Der neue Briefträger, ein Italiener, brachte sie aus Prad herauf. In Tschagoi gab es kein Postamt. Serafin drehte die Karte hin und her, auf der einen Seite ein Palazzo oder irgendwas mit einem Denkmal davor. Auf der anderen Seite mit einer Schrift, die eigentlich zu groß für den wenigen Raum war: »Bin gesunt. Habe Arbeid, nemlig Fabbrick von Auto grüß dich dein Bruder Pinggera Antonio.«
Der Pinggera Toni war zwar kein Schwabenkind– soviel zur Orthographie des Postkartentextes–, die gab es in den Zwanziger-/Dreißigerjahren nicht mehr, aber großgeschrieben wurde die Schulbildung immer noch nicht, zumal in der Volksschule in Prad, in die mehr oder weniger die Kinder aus Tschagoi gingen (zwei Stunden Weges), plötzlich die Lehrerin weg war, das »Fräulein«, die quasi offizielle Anrede für Lehrerinnen, die im alten Österreich unverheiratet sein mußten, und stattdessen eine Italienerin am Pult stand. Daß sie eine grün-weiß-rote Fahne an die Wand nagelte, bemerkten die Kinder ohne größere Gemütsbewegung, und daß sie ein Bild des Zwergen-Königs (den kannten sie ja von den Lire-Stücken) und eins von einem glatzköpfigen Finsterblicker mit einem Kinn wie eine Schublade danebenhängte, berührte sie auch kaum. Wohl aber, daß sie auf Italienisch zu unterrichten begann.
Es war eben die Pinggera Maria, die Schwester, die »Lötze« (die Kleine), die »Gitsch« (das Mädchen) des Untergruiner, die aufzeigte und sagte: »Fräulein, wir verstehen Sie nicht.« Das verstand aber wiederum die Lehrerin nicht.
»Die Bewohner des Alto Adige müssen Italiener werden, aus dem einfachen Grund, weil sie Italiener sind«, sagte jener mit dem Schubladenkinn. Eine eigenwillige Logik.
Mit der Zeit verstanden die Kinder– lernen ja schnell– die italienische Lehrerin so ungefähr. Die Lehrerin die Kinder nie. War sie böse? eine böse »Walsche«? Das war nicht zu erkennen. Zu erkennen war, daß sie eine unglückliche »Walsche« war. Sie ging ins Café– soweit man das Café nennen konnte: ein Eck mit drei Tischen und ein paar Stühlen im Bäckerladen. Sie bestellte einen »Caffè latte«.
»I verstea di ned«, sagte die Bäckerin und warf einen Blick auf die »Walsche«, der nicht weit vom Anspucken entfernt angesiedelt war.
Die Lehrerin stand auf und ging. Weinte sie? Das war der Bäckerin gleichgültig, ob eine »Walsche« weinte oder nicht. Am Samstag nachmittags fuhr die Lehrerin mit dem Zug nach Bozen, das jetzt »Bolzano« hieß, und wo jetzt viele Italiener wohnten. Ob sie, wenn sie dann am Sonntag abends in die Kälte zurückkehren mußte, ihren »Duce« da auf dem Bild mit einem Blick bedachte, der nicht viel anders war als der der Bäckerin?
Die Qualität des Unterrichts kann man sich ausmalen. Sie führte zu ebenjener Orthographie des Postkartentextes. Allerdings lernten die Burschen dann zwangsweise ganz gut Italienisch, zumindest sprechen: beim Militär. Beide Untergruiner-Buben kamen, wie fast alle »Altoatesini«, zu den Alpini-Einheiten, und zwar schon aus Schikane weit hinunter ins Walsche. Nach Perugia der Serafin (Serafino), nach Aosta der Antonio. »Pinggera« ging ja einigermaßen, da brach sich der Unteroffizier nicht die Zunge. Aber einer seiner Kameraden hieß Tschaguler, ein anderer Gschnitzer. Unteroffiziere und Feldwebel sind per se unappetitliche Charaktere, ob italienisch oder deutsch oder österreichisch und wahrscheinlich japanisch und chinesisch auch. Was da ein Tschaguler, ein Gschnitzer zu leiden hatten, weil sich der Feldwebel fast die Seele aus dem Leib hustete, wenn er den Namen auszusprechen versuchte, kann man sich denken. (Es ging aber auch andersherum. Um Gemeindesekretär bleiben zu können, mußte der Ochsenreiter Lorenz seinen Namen »bereinigen« lassen, hieß dann Lorenzo Cavallcavò.)–
Die Maria Pinggera traf es gut. An eine Aussteuer war in den schlechten Zeiten nicht zu denken, aber der Pfarrer Raich nahm sie sozusagen unter seine Fittiche, in allen Ehren, denn erstens war er nicht so, und zweitens damals schon gut in den Jahren. »Ein gescheiter Mann, ein guter Hirte«, hatte es geheißen, »der wird noch Bischof.« Ja– hast du was– wenn einer den Fehler begangen hat, sich zum Pfarrer am– salva venia– Arsch der Welt, nämlich in Tschagoi, machen zu lassen, ist er von der Karriereleiter schon an der untersten Sprosse abgerutscht. Der wird nichts mehr. Er konnte damit leben, der Pfarrer Raich. Er war es, der die Intelligenz der Maria Pinggera erkannte, er lehrte sie Deutsch schreiben, erzählte ihr dies und jenes von der Welt und verschaffte ihr, als sie neunzehn Jahre alt war, den Posten einer Pfarrhäuserin in Schlanders, was förmlich gegen Tschagoi eine Großstadt ist. Später dann leitete sie sogar die ganze Wirtschaft in einem kirchlichen Internat.
Die andere Tochter allerdings, die Agnes, kümmerte als Dienstmagd bei verschiedenen Bauern im Tal unten dahin, bekam mit knapp vierzig ein uneheliches Kind von einem deutschen Motorradfahrer, der, wie viele seiner Menschensorte, die hervorragenden Kurven der neuerdings asphaltierten Bergstraßen schätzte und sich, wenn der Hintern sich erholen mußte, so oder so unterhielt. Um genau zu sein: reichsdeutscher Motorradfahrer. »Deutsch« hieß: ein Südtiroler, der kein Italiener war, trotz Mussolinis Logik, »reichsdeutsch« war einer aus dem Reich… das bald eine gewisse Bedeutung auch für die Leute von Tschagoi bekam, weil da einer ans Ruder kam, von dem sich mancher erwartete, daß… ja, was »daß«? Daß er die in den Nächten heulenden heidnischen Dämonen vertrieb? Daß er die aufgeblähten Kleindämonen vertrieb, die mit ihren Wickelgamaschen das Land zuferkelten? »›Wickeln‹nennt man hierzuland ›fatsch’n‹«, sagte Pfarrer Raich jenem schon erwähnten Professor, »und das ist klarerweise aus dem Lateinischen oder dem Rätoromanischen eingedrungen: ›fasces‹, das eingewickelte Beil.« Sie, diese Krummbeinigen, oft nicht viel größer als ihr zwergenwüchsiger König, liefen in sozusagen metaphorischen Wickelgamaschen herum; in Fatschen-Gamaschen, die sie im Hirn trugen.
Aber jener dort draußen, dessen Bild in so mancher Stube jetzt im Herrgottswinkel neben oder womöglich anstatt des heiligen Joseph hing, war selber ein Dämon. Ein Pantoffel-Dämon mit seinem lächerlichen Bärtchen, das sich sträubte wie ein Stachelkäfer, der Angst hat. Das auf und ab hüpfte, wenn der Pantoffel-Dämon von den Germanen bellte oder von »Teuttschlantt« und Größe und so. Der Pantoffel-Dämon, der den Wohnküchengeruch nie los wurde, den Mief des Männerübernachtungsheimes, dem er entstammte.
»Daß das niemand merkt?« seufzte Pfarrer Raich.
»Nicht einmal die deutschen Bischöfe«, sagte der Professor.
Die Wickelgamaschen konnten nicht gut etwas dagegen sagen, daß, zum Beispiel, der Pinggera Serafin das Bild von dem Wohnküchen-Dämon aufhängte und nicht, schon gar nicht und nie das Bild von dem mit dem Schubladenkinn. »Ist doch ein enger Freund von eurem Duce?« Obwohl, das war nicht zu übersehen, dieser Duce auf den Hügeln an den Talengen Bunker und Befestigungen anlegen ließ, deren Schießscharten nach Norden gerichtet waren. Traute er, der Gefatschte Dutsche, seinem Spießgesellen nicht? Nahm er das Maß von den eigenen Schuhen?
II
Sie war nicht einverstanden. Sie hatte für ihren Sohn, den Serafin, eine andere im Auge gehabt, nämlich die Wirtswitwe vom Bruckwirt unten. Die war erstens ein Patenkind von einer Cousine von der Mutter der Alten und zweitens schwer von Geld. In den Maßen halt, wie man da oben schwer von Geld sein konnte. Ein gewisses Unterfutter halt, nicht das von der Hand-in-den-Mund-hinein-Leben wie oben in dem krähennestigen Tschagoi, das da am Hang klebte. Oft wieselte die Alte zur Bruckwirtin hinunter, bekam immer einen echten Kaffee »von bloß Kern«, nicht Marke Andreas-Hofer-Feigenkaffee oder Marke Franckh. Einmal zischte die Bruckwirtin, die Paula (Thöny schrieb sie sich, lediger hat sie Trafoier geheißen): »Kimm!« und führte die Alte nach hinten und zeigte ihr die Truhe mit der Bettwäsche. So viel Bettwäsche hatten die ganzen Hungerleider oben in Tschagoi miteinander nicht, oder kaum.
Der Bruckwirt war ein paar Jahre zuvor verunglückt. Balthasar Thöny hat er geheißen, er ruhe in Frieden, obwohl nicht ganz klar war, wie das passiert war. Es könnte sein, der Schnaps, den der Thöny, der Bruckwirt, selber gebrannt hat, schwarz, versteht sich– wer wird den walschen Finanzern irgendwelche Gebühren zahlen wollen?– möglich, daß dieser Schnaps, aus Vogelbeeren, irgendwie mißlungen war, irgend etwas hineingeraten war. Der Bruckwirt Balthasar hat sich gedreht wie eine Spindel, fast so schnell. Es war zu Felix und Naborvorletztes Jahr (»vorferten« heißt das in der Sprache dort: »ferten«bedeutet »voriges Jahr«, »vorferten« eben »vor-voriges«, analog zu »gestern und »vorgestern«), und da hat er gestöhnt: »Ich seh alles blau, alles blau« und hat sich gedreht und gedreht– »Fang nicht zu spinnen an!« hat die Wirtin gesagt, die Paula–, und dann hat er sich aus dem Haus hinausgedreht wie ein Kreisel und ist in den Bach gefallen, und unten, schon am Ausgang vom engen Tal, ist er an einem Felsblock hängen geblieben, war tot, logisch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!