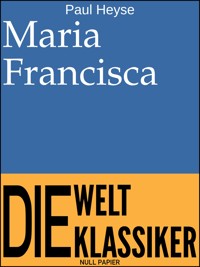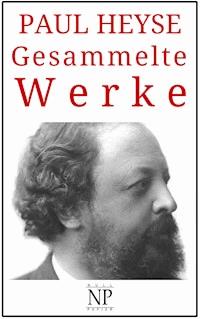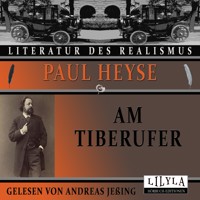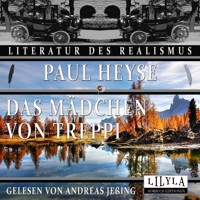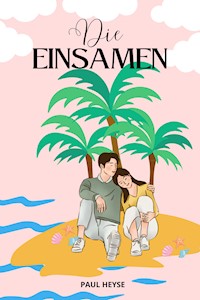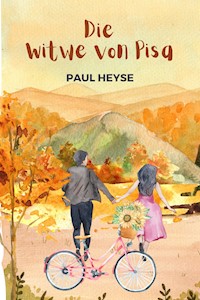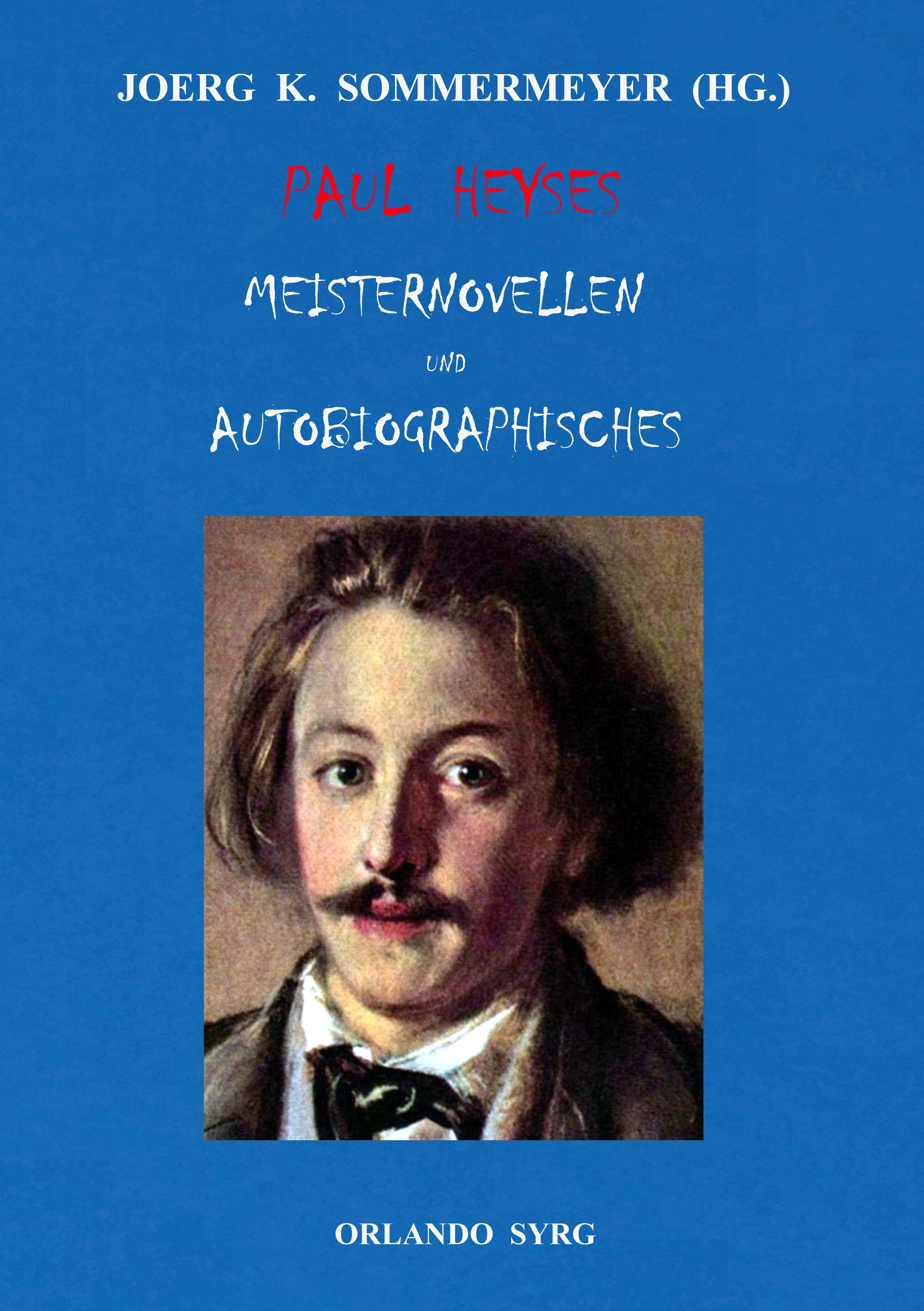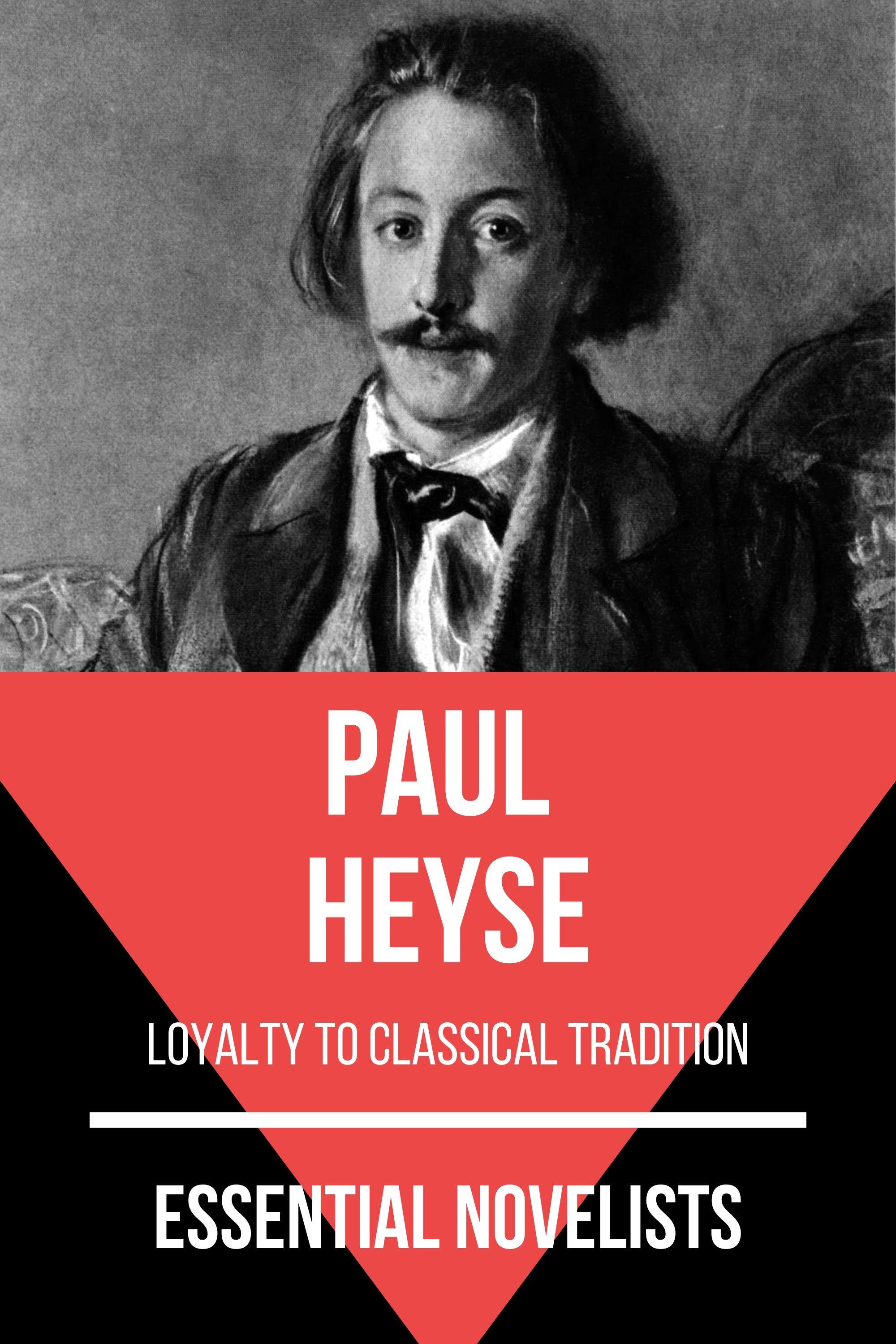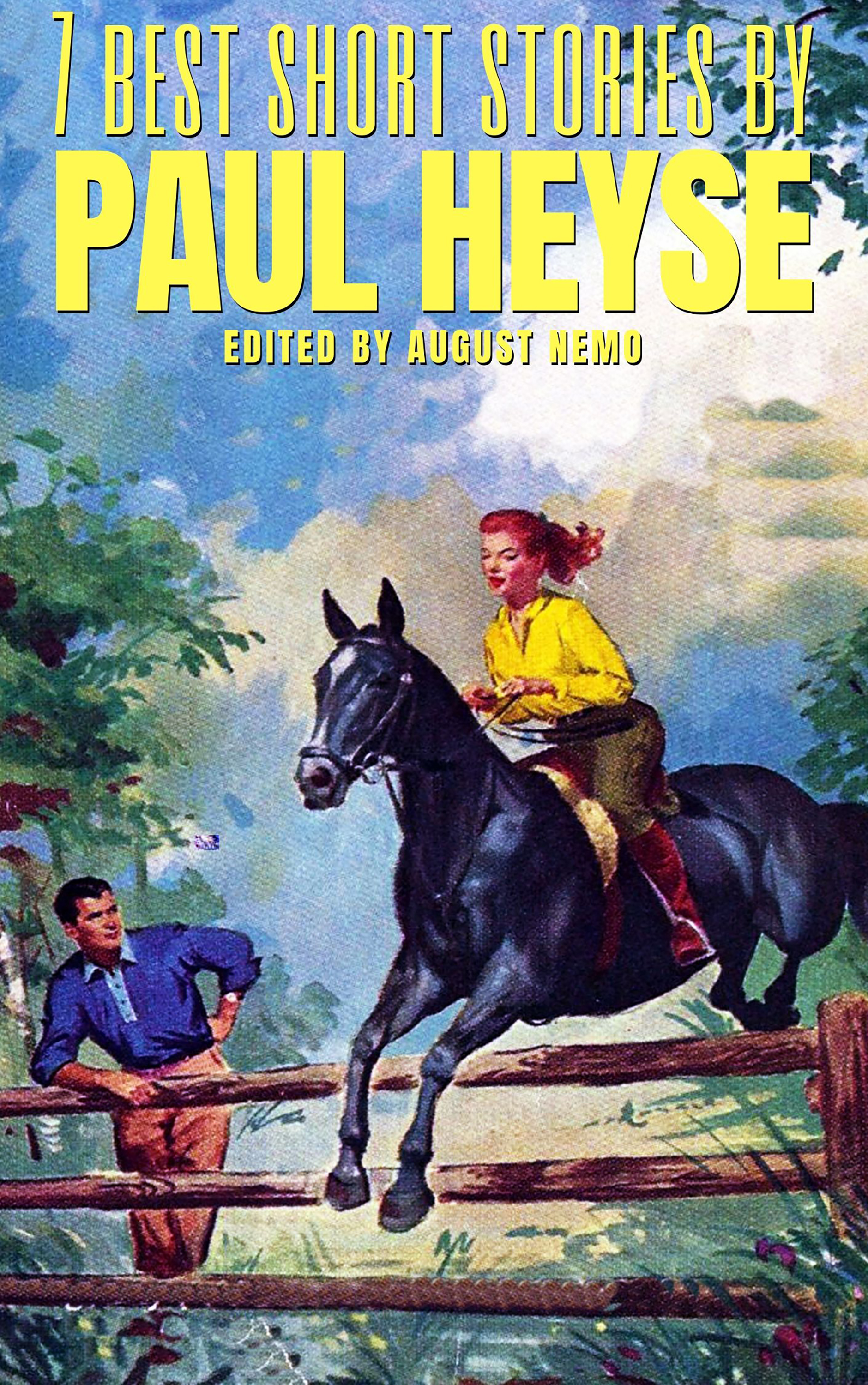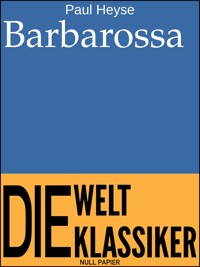
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Barbarossa
Paul Heyse
Barbarossa
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-13-6
null-papier.de/angebote
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Barbarossa
(1869)
Nur einen Tag hatte ich droben in den Bergen bleiben wollen, und aus dem einen Tag wurden zwei Wochen, die mir in dem hochgelegenen, verfallenen Nest auf der Grenze des Albaner- und Sabinergebirgs – den Namen darf ich nicht nennen – rascher vergingen, als oft im bunten Getümmel großer Städte. Was ich eigentlich den lieben langen Tag anfing, wüsste ich kaum zu sagen. In Rom hatte mich ein Heißhunger nach Einsamkeit überfallen; den konnte ich hier stillen, nach Herzenslust. Es war im ersten Frühling, das Laub der Kastanien glänzte in der üppigsten Frische, die Schluchten waren voll Vogelgesang und Quellenrauschen, und da erst kürzlich eine große Räuberbande, die diese Wildnis unsicher gemacht, zum Teil aufgehoben, zum Teil in die Abruzzen gejagt worden war, konnte ein einsamer Wanderer die verlorensten Klippenwege sorgenfrei erklettern und sich ungestört den tiefsinnigsten Betrachtungen hingeben.
Mit den deutschen Malern, die in ansehnlicher Zahl die beiden elenden Herbergen des Städtchens bevölkerten, hatte ich jeden Verkehr von vornherein vermieden, und das Bedürfnis, dann und wann seine eigene Stimme zu hören, das auch den Einsiedler treibt, mit seinen Haustieren zu plaudern, befriedigte ich zur Genüge im eigenen Hause. Ich wohnte nämlich bei dem Apotheker des Ortes, der mit meinem sehr mangelhaften Italienisch die größte Nachsicht hatte. Er entschädigte sich freilich für seinen Aufwand an Geduld, indem er die meinige häufig missbrauchte; denn bald nachdem die erste Fremdheit überwunden war, schüttete er ein reiches Füllhorn eigener Verse über mich aus und gestand mir, dass er trotz seiner Fünfundfünfzig noch immer diese Kinderkrankheit nicht ganz loswerden könne. Was wollt Ihr? sagte er. Wenn ich Abends so ans Fenster trete, und der Mond kommt über die Felsen herauf, und die Leuchtkäfer fliegen über mein Gärtchen – eine Bestie müsste ich sein, wenn ich nicht zu dichten anfinge! – Er war auch sonst durchaus keine Bestie, der gute Signor Angelo, den seine Freunde wegen einer natürlichen Tonsur, eines Kranzes schwarzer Härchen, der auf dem spiegelblanken Kahlkopf stehen geblieben war, scherzweise Fra Angelico nannten. Aus seinem Geburtsort war er freilich nur zweimal in seinem Leben hinausgekommen, beide Mal nur bis Rom. Aber Rom ist die Welt, pflegte er zu sagen. Wer Rom gesehen hat, hat Alles gesehen. Und so sprach er denn auch über Alles, teils nach der sehr bunt zusammengewürfelten Kenntnis, die er einigen zufällig erwischten Büchern verdankte, teils mit der Kühnheit einer ungezügelten Dichterfantasie. Von den Honoratioren, die sich nach echt italienischem Brauch gegen Abend in seiner Apotheke zu versammeln pflegten – der Pfarrer, der Schulmeister, der Chirurg, der Steuereinnehmer und einige amtlose Benestanti, denen man die reiche Oliven- und Weinernte des letzten Jahres am Gesicht ansah – von all diesen Biedermännern widersprach Niemand dem Fra Angelico, zumal wenn er, ehe er eine längere Rede hielt, seine große silberne Brille am Rockärmel putzte und dann anfing: Ecco, signori miei, die Sache verhält sich so! – Bei alledem war er die beste, harmloseste Seele von der Welt und der liebenswürdigste Hauswirt, den man nur wünschen konnte, wenn man keine Wünsche hatte, die über ein hartes Bett und zwei wackelbeinige Rohrstühle hinausgingen. Mich liebte er, obwohl – oder vielleicht weil er keine Ahnung hatte, dass er einen Bruder in Apoll beherbergte. Ich war so klug, für ihn nichts weiter als ein dankbares Publikum zu sein und erst beim vierundzwanzigsten Sonett ihm sanft die Hand auf den Arm zu legen und zu sagen: Bravo, Sor Angelo! Aber ich fürchte, es wird des Guten zu viel. Eure Poesie, wisst Ihr, ist stark und steigt zu Kopf. Morgen füllt Ihr mir ein neues Fiasko aus Eurer Hippokrene. – Worauf er jedes Mal mit der gutmütigsten Miene sein Heft zumachte und sagte: Was hülfe es auch, wenn ich Euch ein Jahr lang Nacht für Nacht in Schlaf läse? Ich würde doch nicht fertig. Hier steckt noch ein Perù! – Und dabei schlug er sich gegen die blanke Stirn, seufzte, bot mir eine Prise an und wünschte mir gute Nacht.
Die meisten dieser Gedichte waren natürlich verliebter Art, und wenn der kleine Mann sie mit funkelnden Augen und dem ganzen Pathos seiner Landsleute rezitierte, vergaß man leicht seine fünfundfünfzig Jahre. Dennoch lebte er als Junggeselle mit einer alten Magd und einem Burschen, der ihm bei seinen Salben und Tränkchen an die Hand ging, und es musste auffallen, dass er, bei seiner Neigung zu allem Schönen und seiner Wohlhabenheit, weder, wie ich hörte, jemals verheiratet gewesen war, noch jetzt, in der Nachblüte seiner Herbsttage, geneigt schien, das Versäumte nachzuholen. Als ich ihn eines Abends, da wir bei einem guten Landwein rauchend beisammensaßen, scherzhaft um die Ursache befragte, weshalb er es mit seinem mönchischen Spitznamen so ernst nehme, und ob keines der schönen Mädchen, die täglich an seinem Laden vorbeigingen, sein Herz zu rühren vermöge, sah er plötzlich mit einem eigentümlichen Ausdruck vor sich hin und sagte: Schöne Mädchen? Nun ja; sie mögen nicht so übel sein. Und auch der Ehestand mag besser sein, als sein Ruf. Aber ich bin zu alt für eine Junge, und für eine Alte noch zu jung, will sagen, zu sehr Poet. Je älter der Vogel ist, desto ungerner lässt er sich rupfen. Und dann seht, Freundchen, ich hab’ einmal Eine mächtig gern gehabt, die mich nicht gemocht hat, Eine, sag’ ich Euch, wie keine wieder kommt. Nun bin ich denn auch zu stolz, oder wie soll ich’s nennen, so bloß vorlieb zu nehmen, wenn mich eine Geringere möchte, von denen eben zwölf ein Dutzend machen. Lieber träume ich mir so in Versen ein Glück zusammen und fantasiere mir eine vollkommene Schönheit vor aus hundert mangelhaften, wie der griechische Maler – Apollines hieß er ja wohl? – der zu seiner Venus von dieser Nachbarin die Augen, von jener die Nase und so fort sich überall das Beste stückweise zusammensuchte. Die aber, die das Alles vereinigte und so schön war, dass Ihr’s gar nicht glaubt, wenn ich’s Euch sage, die hat ihre Schönheit schwer bezahlen müssen, und Wenige wissen die Geschichte so genau, wie ich, obwohl jeder von den älteren Leuten hier im Ort, den Ihr nach der Erminia fragen mögt, mir bezeugen wird, dass sie ein Wunder der Welt war, und dass in den zwanzig Jahren, die seitdem verflossen sind, nichts vorgefallen ist, was solches Aufsehen gemacht hätte, wie ihr Schicksal und was damit zusammenhängt. Kommt, ich will’s Euch erzählen, da Ihr ja ohnehin schon die Sonette an sie kennt; Ihr entsinnt Euch, die fünfundsiebzig, die ich in dem blauen Umschlag verwahre, von denen Ihr noch sagtet, sie seien wahrhaft petrarchesk, die stammen alle aus der Zeit, wo die Wunde noch frisch war, und wenn ich Euch die Geschichte erzählt habe, könnt Ihr sie noch einmal lesen; Ihr werdet sie dann erst ganz verstehen.