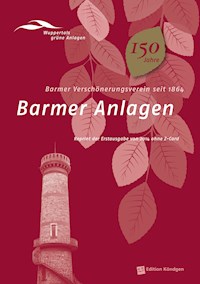
Barmer Anlagen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Wuppertal Grüne Anlagen
- Sprache: Deutsch
Barmer Anlagen - Barmer Verschönerungsverein seit 1864 ist gleichzeitig die Festschrift des Barmer Verschönerungsvereins, der 2014 sein 150. Jubiläum feierte. In sechs umfangreichen Kapiteln spannen die Autoren einen Bogen vom bürgerschaftlichen Engagement über die Beschreibung der einzelnen Areale sowie bedeutender Persönlichkeiten bis hin zu Bauwerken und Denkmälern dieser großartigen Parkanlage. Ein Blick auf die zukünftigen Aktivitäten des Barmer Verschönerungsvereins rundet die Chronik ab. Eine besondere Ehre wurde den Barmer Anlagen erst kürzlich zuteil: Sie wurden in das Europäische Gartennetzwerk (EGHN) aufgenommen. 2015 wurde das Buch, welches jetzt auch als E-Book vorliegt mit dem 3. Platz in der Kategorie "Bestes Buch über Gartengeschichte" des Deutscher Gartenbuchpreis ausgezeichnet. Beim Titel 978-3-948217-13-6 handelt es sich um einen Nachdruck der Ausgabe von 2014 ohne die Z-Card und auf anderem Papier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grußworte
Peter Jung, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Barmer Anlagen,
der Barmer Verschönerungsverein feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum: Vor 150 Jahren wurde er von zwölf engagierten Bürgern des Wuppertals mit dem Ziel gegründet, eine grüne Lunge für Barmen zu erhalten. Es entstand ein wunderbarer Park mit abwechslungsreichem Profil.
In all den Jahren, in denen sich die Mitglieder des Barmer Verschönerungsvereins für ihren Park stark machten, ist einiges passiert. Es wurde gebaut und erweitert, Gebäude entstanden, Denkmäler wurden errichtet. Im Jahr 1888 wurde das Wahrzeichen der Barmer Anlagen eingeweiht, der Toelleturm.
Die Barmer Anlagen haben wechselhafte Zeiten erlebt. Zeiten, in denen immer Neues dazukam und Zeiten, als der Krieg einiges zerstörte. Doch die Mitglieder ließen sich nicht entmutigen und arbeiteten weiter an der Verwirklichung ihres gemeinsamen Traums vom Erholungspark im Barmer Süden.
Wir verdanken es dem Engagement vieler Wuppertaler Bürger, dass wir heute diese wunderbare Grünanlage zu Wuppertals Schätzen zählen dürfen. Unzählige Arbeitsstunden und Spenden haben es ermöglicht, die Barmer Anlagen zu einem Paradies für Spaziergänger und Erholungssuchende zu machen.
Ich bin sehr stolz, dass sich so viele Menschen für ihr Umfeld und ihre Mitbürger einsetzen. Ihnen allen gilt mein Dank: In den 150 Jahren ist etwas Großes und Schönes geschaffen worden, was uns alle bereichert. Und ich hoffe für uns alle, dass der Barmer Verschönerungsverein noch viele weitere Jubiläen feiern wird.
Oberbürgermeister Peter Jung
Liebe Mitglieder des BVV, liebe Wuppertaler, lieber Leser!
Kurt Rudoba, Peter Prange, André Bovenkamp
Kürzlich ist Wuppertal in der Presse als die Großstadt mit dem größten Grünflächenanteil in Deutschland ausgezeichnet worden. Dies ist kein Zufall, sondern Folge weitsichtigen und nachhaltigen Handelns der Wuppertaler Bürger an vielen Stellen der Stadt. So erkannte man bereits 1864 die Notwendigkeit, Teile Barmens nicht zu bebauen und so eine „grüne Lunge“ bis ins Tal langfristig zu erhalten.
Der BVV war und ist bis heute ein bürgerschaftliches Projekt im besten Sinne: Privates Engagement von Bürgern für Bürger haben aus ihm ein Naherholungsgebiet gemacht, welches weit hin seinesgleichen sucht.
Wenn Sie sich durch dieses Buch in die Historie des Vereins einführen lassen, sind wir glücklich. Wenn es Sie zu einem Spaziergang in die Anlagen animieren würde, wären wir froh. Sollte es gar Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft oder Unterstützung des Vereines wecken, hätte sich jede Anstrengung dafür gelohnt.
Besonders bedanken möchten wir uns bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die uns mit Ihrem Wissen sowie Rat und Tat bei der Erstellung dieser Seiten geholfen haben, aber natürlich auch bei den Sponsoren, ohne die so ein Projekt nicht denkbar wäre. Und natürlich bei den vielen Mitgliedern, die sich seit langen Jahren ehrenamtlich einsetzen und seit nunmehr 150 Jahren dafür sorgen, dass dieses (er) lebenswerte Stückchen Wuppertal sprichwörtlich so gut „wächst und gedeiht“!
Peter Prange
André Bovenkamp
Kurt Rudoba
Geschäftsführender Vorstand des Barmer Verschönerungsvereins (BVV)
Barmer Anlagen
Vereinsgeschichten 150 Jahre bürgerschaftliches Engagement
Chronik des Barmer Verschönerungsvereins K.-G. Conrads
1864-1889 Gründung und Aufbau
1889-1914 Glanzzeit und Ausbau
1914-1939 Von Krieg zu Krieg
1939-1964 Zerstörung und Wiederaufbau
1964-1989 Bewahren und Pflegen
1989-2014 Alt und Neu
Zukünftige Aktivitäten A. Bovenkamp
Anlagengeschichten Denkmäler, Teiche, Parkräume
Untere Anlagen I. Löw
Obere Anlagen I. Löw
Ringeltal I. Löw
Fischertal K.-G. Conrads
Barmer Wald K.-G. Conrads, A. Dinnebier
Ehrenfriedhof Barmen A. Dinnebier
Gartendenkmal im Europäischen Gartennetzwerk D. Fischer
Gartengeschichten Direktor, Inspektor, Gartenarchitekt
Joseph Clemens Weyhe (1807-1871) R. Vogelsang, A. Dinnebier
Oskar Hering (1814-1881) I. Löw
Peter Schölgen (1840-1924) K.-G. Conrads
Artur Stüting (1872-1927) A. Dinnebier
Naturgeschichten Bäche, Heide, Forst
Erd- und Landschaftsgeschichte M. Lücke
Waldwirtschaft A. Vosteen
Baumschätze
Bürgergeschichten Mäzene, Macher, Seifenflocken
Barmen 1864 U. Eckardt
Friedrich Wilhelm Dörpfeld (1824-1893) U. Eckardt
Ernst von Eynern (1838-1906) U. Eckardt
Ludwig Ringel (1808-1881) U. Eckardt
Emil Rittershaus (1834-1897) U. Eckardt
Adolf Werth (1839-1915) U. Eckardt
Pauline Luhn (1841-1911) E. Brychta
August Bredt (1817-1895) H. Heidermann
Baugeschichten Häuser, Türme, Sternenhimmel
Stadtentwicklung und Barmer Anlagen H. J. de Bruyn-Ouboter
Barmer Stadthalle H. J. de Bruyn-Ouboter
Barmer Luftkurhaus H. J. de Bruyn-Ouboter
Kriegerdenkmal K.-G. Conrads
Toelleturm K.-G. Conrads
Barmer Bergbahn J. Eidam
Barmer Planetarium U. Lemmer
„Colonie“ und „Königshof“ K.-G. Conrads
Anhang
Plan
Literaturverzeichnis
Impressum
Vereinsgeschichten
150 Jahre bürgerschaftliches Engagement
Chronik des Barmer Verschönerungsvereins
(Antonia Dinnebier)
1864–1889 Gründung und Aufbau
Wie jedes Jahrhundert sein eigenes Gesicht prägt, so brachte das 19. Jahrhundert in seiner zweiten Hälfte grundlegende Änderungen mit sich. Die Industrialisierung führte zu nie dagewesenem Bevölkerungswachstum und Flächenbedarf. Auch Barmen, diese 1850 noch idyllisch an der Wupper gelegene Stadt der Bleicher und Färber, kam bei dem sprunghaften Anstieg der Bevölkerung mit seiner Talniederung zu beiden Seiten des Flusses nicht mehr aus. Die Bleichwiesen entlang der Wupper mussten Fabriken, Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuden weichen. Die zunehmende Besiedlung schob sich aus dem engen Tal an den Hängen hinauf, wo sie die landwirtschaftlichen Höfe allmählich verdrängte. Das für den Bau von Produktionsstätten und Wohnhäusern benötigte Material wurde aus den heimischen Wäldern geholt. Wertvoller Baumbestand ging verloren, so dass der Barmer Busch schließlich nur noch aus Stockausschlag und baumloser Heide bestand.
Es fanden sich vorausschauend denkende Bürger, die eine Wiederbewaldung der Kahlflächen und öden Bergrücken einleiteten. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde durch großflächige Aufforstung wieder ein Hochwald geschaffen.
1864: Gründung des Barmer Verschönerungsvereins
Anfang der 1830er Jahre siedelte sich ein Bürger in dem im Süden der Stadt auf den Höhen gelegenen Barmer Wald an. Er rodete einen kleinen Teil des Waldes aus und begann Ackerwirtschaft. Nach und nach wurden durch die Stadt weitere Flächen durch Arbeitssuchende urbar gemacht. Dieser von Wald und Buschwerk gesäuberte Raum brachte Wilhelm Werlé auf die Idee, dort einen Park anzulegen. Wenn auch dieser Plan mit Lächeln aufgenommen wurde, ließ sich Werlé nicht beirren und traf mit seinem Traum durch die Unterstützung seiner Freunde und Mitbürger auf reges Interesse. Ihre Namen stehen für frühes Bürgerengagement für Grün in Barmen: Robert Barthels, Oberbürgermeister Geheimrat August Bredt, August Engels, Emil Blank, Friedrich von Eynern, Adolf Schlieper, Karl Wolff, Johann Wilhelm Ostermann, Karl Theodor Rübel, Oskar Schuchard, Emil Wemhöner, Wilhelm Werlé. Manchem dieser Herren wurde später zur Erinnerung eine Straße gewidmet, innerhalb der Anlagen ein Denkmal gesetzt oder es wurde ein Weg nach ihm benannt.
Am 8. Dezember 1864 gründeten diese Honoratioren den Barmer Verschönerungsverein. Mit einem Startkapital von 1.200 Goldmark (Taler) wurden erste Waldgrundstücke gekauft. Das Ziel war klar: Schaffung einer umfassenden Parkanlage zur Erholung, der Ausrodung des Waldes entgegenwirken, Lust zu neuen Anpflanzungen erzeugen. Die Bürger, ob berufstätig oder nicht, sollten aus der Enge ihrer Stuben, aus der schlechten Luft der Betriebe, herauskommen und sich in der grünen Natur an der Schönheit der Anlagen erfreuen, auch Kraft für den Alltag schöpfen. Der Vorsitzende des Elberfelder Pendants, des 1870 gegründeten Verschönerungsvereins, August von der
Werlédenkmal (Wolfgang Nicke)
Heydt (1851-1929), formulierte den Bedarf einmal so: „Wälder reinigen die Luft, gewähren Schutz vor Stürmen, stärken und kräftigen, wenn wir durch ihre Hallen wandern. Waldungen sind das edelste Erbteil, das wir unseren Nachkommen hinterlassen können.“
Wilhelm Werlé: Vorsitzender 1864-1880
Wilhelm Werlé war der erste Vorsitzende des BVV und prägte dessen Frühzeit von 1864 bis 1880. Er wurde am 26. September 1804 in Wetzlar geboren. 1846 gründete er in seiner zweiten Heimat die „Barmer Gaserleuchtungsgesellschaft“ und leitete sie auch nach Besitzübernahme durch die Stadt Barmen. Darüber hinaus war er Vorsitzender der „Deputation der Aktionäre der Bergisch-Märkischen Eisenbahn“. Politische Aktivitäten entfaltete er als Mitglied der Barmer Stadtverordnetenversammlung (1846-75), Beigeordneter (1840-46), Deputierter des Frankfurter Vorparlamentes (ab 1848) und liberales Mitglied im preußischen Abgeordnetenhaus (1856-62). Soziales Engagement zeigte er in der Armenverwaltung und im Vorstand der „Anstalt für verlassene Kinder“, die ihr Domizil auf dem Grundstück des heutigen Altenheimes an der Oberen Lichtenplatzer Straße hatte. Der Barmer Verschönerungsverein erinnert sich gerne an seinen ersten, am 28. August 1880 verstorbenen Vorsitzenden: oberhalb des ehemaligen Schwanenteiches fand am 21. August 1881 ein Denkmal zu Ehren Werlés seinen Standort. Die überlebensgroße Marmorbüste, geschaffen von dem Berliner Bildhauer Bernhard Afinger, steht auf einem zwei Meter hohen Sockel. Das als Einfassung gedachte kunstvolle Eisengitter ging im Zweiten Weltkrieg verloren. Nach Wilhelm Werlé wurde später in Heckinghausen eine Straße benannt.
1865: Anlage an der Lönsstraße
Neben dem Dörpfelddenkmal ist der Wasserfall zu erkennen. (Antonia Dinnebier)
1865 wurde im Vorstand der Vorschlag erörtert, möglichst nahe der Stadtmitte eine größere Anlage zu schaffen. Zum Zweck des Erwerbs von Grundstücken sollte nicht mehr als die Hälfte der Vereinsmittel zur Verfügung stehen. Zuerst wurden Grundstücke von Johann Engelbert Becker, Carl Heinrich Riese und Friedrich Wilhelm Zöller zwischen der alten Kohlen- und Lichtenplatzer Straße, am Oberheidt, gekauft. Das erforderliche Kapital wurde durch Aktien von je 100 Talern aufgebracht, welche zu 4,5 Prozent verzinst und nach und nach amortisiert werden sollten. Die Keimzelle der Barmer Anlagen ist die Anlage mit den beiden in einem alten Hohlweg angelegten Teichen zwischen Löns- und Schubertstraße, die 2012 nach P. Peter Muckenhaupt benannt wurde.
Die Gestaltung des Parks begann am Forsthaus mit der Anlage von drei Teichen, von denen der abgebildete später zugeschüttet wurde. (Wolfgang Nicke)
Zur Gestaltung und Versorgung des Parks, vor allem des Ringeltales und der Unteren Barmer Anlagen war Wasser unverzichtbar. Deshalb wurde 1870 ein 63 Meter langer Wasserstollen gebohrt, dessen Schachteingang unterhalb des heutigen Unteren Teiches hinter Rhododendren verborgen ist. Das kühle Nass wird als „Bach in den Barmer Anlagen“, so die städtische Katasterbezeichnung, unterirdisch zum Ringeltal geführt. Neben dem Dörpfelddenkmal sprudelte das Nass früher über einen Wasserfall talwärts, speist den Seerosenteich und fließt unter der Erdoberfläche Richtung Untere Anlagen, wo drei künstliche Teiche auf Befüllung warten. Von dort führt das Wasserrohr unter dem Mittelstreifen der Heinrich-Janssen-Straße, biegt dann links ab, unter der Saarbrücker Straße her, quert in Höhe einer Privatschule die Bahngleise und führt westlich der Rolingswerther Brücke in die Wupper.
Am 6. März 1866 wurde der aus Kaufleuten und Fabrikanten bestehende Vorstand durch vier weitere Mitglieder auf 12 Personen erhöht. Gewählt wurden am 18. Februar 1867: Wilhelm Werlé, Emil Blank, Robert Barthels, Rudolf Greeff, Karl F. Imler, Franz Könen, Hermann von Lohr, Hugo Schuchard, Otto Schüller, E. W. Trappenberg, Karl Wolff und Emil Wemhöner. An die Stelle von Trappenberg rückte 1868 Heinrich Eisenlohr (später Barmer Ehrenbürger) nach. Nach Ausscheiden von Karl Wolff übernahm am 27. Januar 1870 Otto Schüller die Kassengeschäfte des Vereins und konnte am 2. Oktober 1872 wieder auf ein glänzendes Resultat bei einer Verlosung zurückblicken, die den großen Überschuss von 54.000 Mark ergab. Der erfolgreiche Umgang mit Geld drückte sich in dem Beispiel aus, dass verausgabte Aktien mit 4,5 Prozent verzinst wurden.
Der von Ludwig Stüting fotografierte „Laubgang“ mit der Brücke befand sich in den Oberen Anlagen oberhalb des Ringeldenkmals. (BVV)
1869-1870: Aus einem Kerbtal wurden die Unteren Anlagen
Der wertvollste Grundstückskauf gelang am 4. Juni 1869, als für 40.000 Mark das fünf Hektar große „Lehmbachsche Feld“ zwischen Gewerbeschulstraße und Lichtenplatzer Chaussee von Abraham Beckmann erworben wurde. Zur Beschaffung der nötigen Mittel fand am 5. Oktober 1869 mit Genehmigung der Behörde eine Verlosung statt, die einen außerordentlich hohen Überschuss von 66.258,21 Mark ergab. Speziell war an dem günstigen Abschluss der damalige Kassierer Otto Schüller beteiligt, der nach dem Grundstückserwerb noch einen beträchtlichen Überschuss von 27.000 Mark verkündete. Mit der Planung der Unteren Anlagen konnte nun begonnen werden.
Uferterrasse am Unteren Teich (Antonia Dinnebier)
Stadtbaumeister August Fischer gestaltete das sich talwärts anschließende Areal durch die Anlage Ottostraße (Ausbau 1894) und Augustastraße (heute Heinrich-Janssen-Straße), Ferdinand-Thun-Straße und Kampstraße (heute Saarbrücker Straße) so, dass ein bequemer Zugang zu den Unteren Anlagen möglich wurde. Es wurden unterschiedliche Straßenbreiten zwischen 30 und 60 Fuß festgelegt. Die Heinrich-Janssen-Straße wurde als Mittelallee mit einer Breite von 60 Fuß ausgebildet.
Als die Bauarbeiten für die Drei-Teiche-Kombination begonnen hatten, reagierte der Vorsitzende Wilhelm Werlé beim Anblick emotionsgeladen: „Will der Kerl (damit war der aus Düsseldorf gekommene königliche Hofgartendirektor Joseph Clemens Weyhe gemeint) die Teiche in die Luft bauen?“ Solche Wunder hat es in den Barmer Anlagen nie gegeben... Einen Höhepunkt bildete die große Fontäne in der Teichmitte. Schwäne wohnten früher dort, heute sind es Enten. Auf einer noch erhaltenen Terrasse oberhalb des Ufers fanden in den Sommermonaten Sonntagskonzerte statt.
Der Obelisk war das erste von drei Kriegerdenkmälern in den Barmer Anlagen außerhalb des Ehrenfriedhofes und erinnert an die Gefallenen von 1864 und 1866. (Antonia Dinnebier)
Eine Pflanzliste von 1870 aus der Baumschule Weyhes gibt über das Gestaltungsmaterial Auskunft: 32 verschiedene Baum- und Straucharten, davon 12 Baumarten mit 1.100 Stück, zu einem Gesamtpreis von 1.142 Talern. Die Weyhe-Pläne setzte der von ihm nach Barmen beorderte Obergärtner Peter Schölgen um. Er kehrte nicht an den Rhein zurück, sondern blieb von 1870 bis 1920 fünfzig Jahre in den Diensten des Verschönerungsvereins. Der erste Hochbau des Vereins entstand 1872 auf dem Plateau als Restaurationsgebäude.
1873: Verein als juristische Person
Die Barmer Firma Gebrüder Brill schenkte dem BVV 1886 einen Rasenmäher. Schon 1881 berichtete dieser, dass „die Rasenflächen nunmehr wie in anderen Parks mit der Maschine geschnitten und stets kurz gehalten werden können, wodurch eine wesentliche Verbesserung erzielt worden ist.“ (Antonia Dinnebier)
Die außergewöhnliche Stellung des Vereins wurde am 17. Mai 1873 verdeutlicht, als ihm durch allerhöchsten Erlass, gezeichnet von Kaiser Wilhelm I., die Rechte einer juristischen Person verliehen wurden. Ein Vereinsregister gab es damals noch nicht.
Das Hauptgeschäft des Vorstandes bestand aus An- und Verkäufen, Grundstückstauschgeschäften, Parkgestaltung, Aufforstung, Landschaftspflege, Errichtung von Gebäuden, Reparaturen. Einnahmen kamen aus Basaren, Lotterien, Verkäufen, Beiträgen, städtischen Zuschüssen, Stiftungen, testamentarischen Zuwendungen und Vermächtnissen.
Als weiteren Ausdruck der engen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Barmen und dem Verein überwies die Stadtverordnetenversammlung 1880 dem BVV 3.000 Mark zur Beschäftigung Arbeitsloser. Die Handelskammer gab weitere 9.000 Mark. 1881 beschäftigte der Verein rund 80 Arbeiter, 1882 noch 40 Arbeiter. Es wurden 27.000 Mark an Löhnen gezahlt.
1876 erwarb der Verein das Gut Fischertal, eine Fläche vom Fischertal hinauf bis Kohlen- (Löns-) und Hohenstaufenstraße.
Otto Schüller: Vorsitzender 1880-1899
Schüllerdenkmal (Verschönerungsverein 1914)
Bis zu seinem Tode am 28. August 1880 hatte Wilhelm Werlé den Verschönerungsverein durch 16 ereignisreiche Jahre geführt. Die Nachfolge trat Otto Schüller an. Er blieb bis zu seinem Tod am 30. November 1899 Vorsitzender. Er war seit 1867 Mitglied des Vorstandes, führte von 1867 bis 1880 die Kasse und anschließend 19 Jahre lang den Vereinsvorsitz. Unter seiner Leitung wurden die Barmer Anlagen wesentlich erweitert und ausgebaut. Zu seiner Erinnerung ist der Weg von der Lichtenplatzer Straße bis zur Kohlen- (Löns-)straße „Schüllerallee“ benannt worden.
1880er Jahre: Ringeltal und Toelleturm
Das Ringeltal entstand nach 1880, nachdem 1870 das Vormsteinsche Gut (Vormtal) erworben wurde. Der Kaufmann Ludwig Ringel erwarb weiteres Gelände und schenkte es dem Verein. Ludwig Ringel vermachte dem Barmer Verschönerungsverein 100.000 Mark, die von der Stadt Barmen verwaltet wurden. Die Zinserträge wurden dem Verein jährlich zur freien Verfügung übergeben.
Als Stiftung der Familie Toelle für ihr 1886 verstorbenes Familienoberhaupt Ludwig Ernst Toelle wurde 1887 der Toelleturm errichtet und am 29. April 1888 eröffnet.
Den Platz zwischen Toelleturm und Luftkurhaus schmückte eine Florastatue, bis der Brunnen aufgestellt wurde. (Antonia Dinnebier)
Die Einweihung des Rittershausdenkmals war 1900 ein großes Ereignis. (Mitteilungen des Stadtarchivs Wuppertal 1986)
1887 setzte der „Verein zur Pflege der Nachtigallen und anderer Singvögel“ fünfzehn Nachtigallenpaare aus; einige von ihnen nisteten sich zur Freude der Besucher ein.
Größere Walderwerbungen fanden 1889 statt, als der Verschönerungsverein von den Herren Dicke und Ibach die Brüninghausschen Waldungen in einer Größe von etwa 80 Morgen kaufte.
1889-1914 Glanzzeit und Ausbau
1890 erstand die Stadt Barmen am 1. Juli auf dem Heckinghauser Kopf („Deisemannskopf“), in unmittelbarem Anschluss an das Eigentum des Vereins, 27,5 Morgen Waldungen zum Preis von durchschnittlich 185 Mark pro Morgen. Die neuen Erwerbungen wurden dem Verein unterstellt. Zum Andenken an Kaiser Wilhelm I. erhielt dieses Gelände den Namen „Kaiser-Wilhelm-Höhe“.
Erworben wurden 1896 große Parzellen am Marper Bach, auf Mallack und Riescheid, die die Kasse des Vereins nicht stark in





























